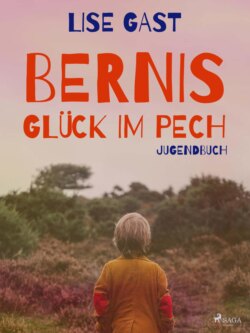Читать книгу Bernis Glück im Pech - Lise Gast - Страница 4
1. Kapitel
Оглавление„So, die nächste Station ist unsere“, sagte Angelika, als der Zug wieder anruckte. „Eine halbe Stunde fahren wir noch, aber gerade die letzte halbe Stunde wird einem am längsten. Wenn man denkt, daß sie jetzt zu Hause losgehen zum Bahnhof, um uns abzuholen! Und wir sitzen hier, und es wird nicht später!“
„Was wird nur deine Mutter sagen, wenn ich einfach so mitkomme“, sagte Friederun bedenklich. Angelika wischte das mit einer Handbewegung weg.
„Meine Mutter — ph! Meine Mutter sagt immer, bei so vielen kommt es auf eins mehr nicht an. Und wo doch meine größeren Geschwister zu diesen Ferien nicht nach Hause kommen!“
„Kommen sie nicht?“ fragte Friederun.
„Margot und Brigitte doch, aber nur ganz kurz, die letzten Tage. Ernst gar nicht, er macht mit ein paar andern Jungen eine Radtour.“
Friederun und Angelika waren Klassenkameradinnen in einer Internatsschule im Harz. In diesen Herbstferien nun konnte Friederun nicht nach Hause fahren, da ihre Mutter ganz plötzlich hatte verreisen müssen. Angelika, mitleidig und rasch bereit zu helfen, hatte die Freundin sofort zu sich eingeladen.
„Du mußt dich nur nicht daran stoßen, daß wir so viele sind“, sagte sie, „komm, ich zeig’ dir noch die Bilder. Mutter schickte gerade neue, die von den großen Ferien. Willst du mal sehen? Das hier ist Christoph, mein jüngster Bruder. Ist er nicht nett? Er tut alles, was ich will, wir verstehen uns herrlich.“
„Ach, ist er süß! Wie alt, fünf? Nein, Angelika, wenn ich doch auch solch goldigen kleinen Bruder hätte!“ Friederun, dreizehnjährig wie Angelika, war die jüngste von drei Schwestern.
Angelika lachte stolz. „Ja, der Toffer! Wir nennen ihn immer Toffer; weiß der Himmel, wer es ausgeheckt hat. Und das hier ist die Heidi, die ist elf. Marianndel neun — wir haben jetzt aber alle die Haare kurz, hier hat sie noch Zöpfe auf dem Bild.“
„Du sagtest doch aber, du hättest noch vier kleinere Geschwister“, sagte Friederun. Sie hatte ihr Köfferchen auf dem Schoß liegen und darauf die Bilder aufgereiht und betrachtete eins nach dem andern. „Oder hast du dich selber mitgezählt? Sonst sind es doch nur drei.“
„Mich zu den Kleinen dazugezählt? Du bist wohl wahnsinnig. Ich gehör’ doch zu den Großen“, sagte Angelika entrüstet. „Die Jüngste von den Großen — das hat seine Vorteile. Man darf schon, was die Großen dürfen, aber man muß nicht soviel, weil man eben doch die Jüngste davon ist.“
Friederun lachte. Die Vorteile, die man als Jüngste genoß, kannte sie aus eigener Erfahrung. Aber sie ließ nicht locker mit Fragen; sie war erst kurz in Angelikas Klasse und wollte alles genau wissen.
„Aber es sind doch nur drei Kleinere —“
„Nein, vier. Da ist doch noch Berni, das Unglückswurm.“
Angelika blätterte ihr Lesebuch durch. Das ging im Hui, wie überhaupt alles, was sie tat. Sie war ein Kind „mit Tempo“, wie die Mutter, manchmal mit Seufzen, sagte. „Siehst du, da steckt er. Ja, sieh mal her.“
Friederun nahm das Bild, das Angelika ihr hinreichte, und sah den kleinen Jungen an, den es zeigte. Er war lange nicht so hübsch wie der Jüngste, zwar auch blond, aber gleichsam fahl, wo der andere goldblond wirkte. Ein wenig stakige Beine standen aus den zu weiten Hosenröhren heraus.
„X-Beine, ja, leider“, sagte Angelika sachlich, „und zwei linke Hände und an jeder fünf Daumen. Berni ist der Dollpunkt der Familie, verstehst du — aber wir haben ihn alle trotzdem lieb.“
„Das würd’ ich aber auch“, sagte Friederun mit vor Empörung tiefer Stimme. „Er kann doch nichts dafür, daß er so ist.“
„Ich weiß nicht, du“, sagte Angelika nachdenklich.
„Man kann doch auch selbst was dazu tun. Sieh mal, Marianndel war auch mal so eine unmögliche Person. Sie knöpfte jedes Kleid, was hinten zugemacht wurde, grundsätzlich vorn zu, aß die Suppe mit der Gabel und zog den rechten Schuh an den linken Fuß. Meine Mutter schüttelte immer nur den Kopf. Da hab’ ich sie mir schließlich mal vorgenommen und zurechtgestaucht. Ich hab’ ihr gesagt: ‚Wenn du noch einmal die Schuhe verkehrt anziehst, dann setzt es aber was.‘ Amandern Tag dieselbe Geschichte. Ich hab’ sie verhauen, du, da war aber alles dran. Glaubst du, daß sie es nie wieder getan hat?“
„Aber mit Hauen ändert man doch den Menschen nicht“, sagte Friederun. Sie war von zu Hause andere Methoden gewöhnt, und ihr wurde ein wenig bange, wenn sie dachte, daß sie nun vierzehn Tage in solch einer gewalttätigen Familie leben sollte. „Meine Mutter haut in solchen Fällen nie; sie erklärt immer, warum, und macht schließlich selbst, was ich nicht kann.“
„Nicht kann! Natürlich kann man aufpassen, welches der rechte und welches der linke Schuh ist“, sagte Angelika ungerührt. „Übrigens, meine Mutter haut auch nicht wegen solcher Sachen. Sie hat gar nicht die Zeit dazu. Deshalb tu ich es ja, wenn’s nötig ist.“
„Auch den Berni? Verhaust du den auch?“
„Ich hab’ es probiert. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach wie bei Marianndel. Er heult und wird bloß immer verscheuchter. In den Ferien hab’ ich es dann aufgesteckt mit ihm, ich hatte keine Lust mehr.“
„Du, wird deine Mutter aber wirklich nicht ...“, setzte Friederun wieder an. Angelika stand auf und zog mit einem Schwung den Rucksack am Lederriemen aus dem Gepäcknetz.
„Sei unbesorgt, sie schimpft nicht. Nur — ja, das muß ich dir noch erzählen. Die Frau, bei der wir wohnen, die Hausbesitzerin, die Frau Simmer ... Es war sowieso schwer für uns, eine Wohnung zu bekommen, das kannst du dir denken“, fuhr sie fort, während sie zwei Äpfel aus dem Rucksack grub, Friederun einen davon gab und selbst in den andern biß, „wir brauchen ja keine für neun Personen, weil wir vier Großen schon auswärts sind, die längste Zeit im Jahr, aber immerhin, sie muß ja so sein, daß wir zu den Ferien alle da sein können. Und da haben wir ewig gesucht. Schließlich nahm uns Frau Simmer, aber nur weil sie mußte, gern nicht. Mutter hat geredet mit Menschen- und Engelszungen ...
Wir sind ja alle sehr vorsichtig, das muß man, sagte sie, ich hab’ zum Beispiel gemerkt, daß sie jedesmal, wenn eins von uns ins Häuschen geht, einen Strich an die Tür macht, einen Kreidestrich. Weil doch mehr Wasser verbraucht wird, wenn wir alle da sind. Und da hab’ ich immer, wenn sie es nicht merkte, einen oder zwei Striche am Tage ausgelöscht. Gar zu viele wegzumachen, würde auffallen, aber etwas weniger war es immer.“
„Du lieber Gott, und da komm’ ich noch mit!“
„Mutter macht das nichts aus“, versicherte Angelika wiederum. „Mutter ist ganz vernünftig. Wenn die Frau Simmer anfängt zu kreischen, geht Mutter in die Küche, dreht den Wasserhahn auf und läßt sich das Wasser über die Handgelenke laufen, hier, am Puls, weißt du. Da wird man ruhig oder, vielmehr, man ärgert sich von vornherein nicht.
Neulich hat Berni wieder so was angestellt. In aller Unschuld, weißt du. Er ist kein Lausbub, gar nicht, aber er glaubt andern immer alles. Da hat ihm ein Junge aus seiner Klasse, der die Frau Simmer kennt, weisgemacht, daß nichts schöner sei als verzierte Kürbisse. Die Frau Simmer hat nämlich hinterm Haus einen kleinen Garten, und dies Jahr gab es wirklich schöne Kürbisse darin. Was macht nun das Unglückswurm Berni? Er geht am Nachmittag, als niemand sich etwas Böses denkt, hinunter und schnitzelt mit viel Mühe und Liebe lauter Herzen in die Kürbisse, Herzen und Buchstaben. I. S. — die Frau Simmer heißt Irene, das steht an ihrer Tür. Und in den größten auch noch ‚Herzlichen Glückwunsch‘. Mutter schrieb, wir könnten uns nicht vorstellen, wie die Frau Simmer getobt hat, als sie es sah. Es ist ja auch verständlich, denn wenn man die Kürbisse nicht sofort verbraucht, fangen sie an zu faulen.“
„Natürlich!“ Friederun lachte. „Das war ja eine schöne Bescherung.“
„Na, nicht wahr? Nun muß sie alle Kürbisse auf einmal verbrauchen. Was fängt so eine einzelne Person mit diesen Mengen an?“
„Sie könnte euch ja welche davon schenken“, schlug Friederun vor. Ihre braunen Augen glänzten vergnügt. „Alle angeschnitzten könntet ihr haben, die langten bei euch ein paar Wochen.“
„Paar Wochen? Drei Tage höchstens. Was meinst du, was wir brauchen“, sagte Angelika etwas von oben herab. „Wenn Ernst da ist — der ist schon über einsachtzig —, dann reicht kein normaler Topf. Und Margot und Brigitte essen auch schon ganz schön.“
„Du, es muß prima sein mit so vielen Geschwistern“, sagte Friederun. Es klang so aus dem tiefsten Herzen kommend, daß Angelika lachen mußte.
„Bestimmt ist es prima. Mutter sagt auch immer, wenn wir ihr auch die Haare vom Kopf fressen, hergeben tät’ sie doch keins. Aber ihr seid ja auch drei. Ganz allein denk’ ich mir am schlimmsten, so wie Bärbel, ohne Bruder und Schwester.“
„Sicher. Aber meine Schwestern sind ja schon groß, beinah erwachsen. Zeig doch noch mal das Bild von deinem jüngsten Bruder, bitte. Ist er nicht niedlich! Und der kommt Ostern zur Schule?“
„Jetzt können wir anfangen einzupacken“, bestimmte Angelika nach einer kleinen Weile. Sie hatte keine Armbanduhr — natürlich nicht —, aber sie hatte auf Friederuns geschaut. „Geht die richtig? Dann sind es noch sieben Minuten.“
„Sie geht etwas vor.“ Friederun betrachtete verliebt ihr Handgelenk. „Findest du nicht auch, daß sie mir gut steht? Im Sommer, als ich so sehr braun war, hatte ich einen richtigen weißen Streifen um den Arm, dort, wo das Armband sitzt. Daran sah man erst, wie braun ich war.“
„Ja. Schade, daß es immer so schnell wieder weggeht. Ich werde übrigens nie richtig braun, ich bekomme nur Sommersprossen“, erklärte Angelika und knipste den Koffer auf, um noch etwas hineinzustampfen. Er war zum Überquellen voll; die beiden großen Schwestern, die der Billigkeit halber mit dem Rad kommen wollten, hatten ihr an Gepäck aufgeladen, was nur möglich war.
„Sommersprossen? Da mußt du Märzweiß nehmen, davon gehen sie weg“, sagte Friederun. Angelika sah sie ein wenig mitleidig an.
„Nein, weißt du, darauf reicht es wahrhaftig nicht. Mit Schönheitsmitteln dürfen wir erst anfangen, wenn wir selbst verdienen, sagt Mutter. Ernst darf auch dann erst rauchen — er raucht aber auch jetzt schon manchmal, ich weiß es.“
„Dann mußt du eine Schnecke darüberkriechen lassen“, sagte Friederun. „Da gehen sie auch weg, und es kostet nichts.“
„Eine Schnecke? Übers Gesicht? Puh, nein, da behalt’ ich lieber meine Sommersprossen“, sagte Angelika und schüttelte sich. „Los, zieh dich an, jetzt sind wir gleich da. Wer wird am Bahnhof sein? Alle?“
Sie standen an der Tür, als der Zug auf dem Bahnhof einlief, und spähten gespannt hinüber nach dem Zaun, der neben dem Bahnhofsgebäude die Straße abschloß. Als sie daran vorüberfuhren, erhob sich dort ein vielstimmiger, wilder Ruf. „Heeeeringe!“ gellte es herüber, so laut, daß man es auch durch das Rattern des Zuges hörte.
„Heringe!“ schrie auch Angelika aufgeregt und winkte zum Fenster hinaus, so daß Friederun sie hinten am Kleid festhielt.
„Warum schreit ihr denn ‚Heringe‘?“ fragte sie, als sie hinauskletterten. Angelika beförderte mit Wucht einen Koffer nach dem andern auf den Bahnsteig.
„Bei uns kommt jeden Montag ein Mann mit einem kleinen Eselswagen, der Heringe verkauft. Wenn er schreit, antworten wir immer alle — und da ist das der Familienschlachtruf geworden.“
Am Zaun standen drei winkende Kinder. „Winkend“ ist mild gesprochen, sie flügelten wild mit den Armen und sprangen immer wieder hoch. Angelika ließ zunächst den Umweg über die Sperre aus und rannte, zwei Koffer in den Händen, dem Zaun zu. Dort ließ sie das Gepäck fallen, griff erst einmal über die Latten und hob den kleinsten Bruder zu sich herüber. Er umarmte sie wie ein Affenjunges seine Mutter, während er sein Gesicht an das ihre drückte.
„Toffer! Ich hab’ dir auch was mitgebracht! Und du hast ja einen neuen Pullover an. Und schwer bist du geworden! Ißt du denn jetzt ordentlich? Und ...“
Friederun war ihr, ein wenig zögernd, gefolgt. Sie stand hinter ihr und wartete, was nun werden sollte. Heidi gab Angelika schließlich einen Schubs über den Zaun hinweg.
„Du, nun laß schon! Du hast ihn ja noch den ganzen Nachmittag. Gib deine Koffer ’rüber!“
„Erst den Toffer, dann den Koffer“, sagte Angelika und hob den Kleinen wieder hinüber. „So, Friederun, gib her! Das ist nämlich Friederun aus meiner Klasse, sie kann nicht nach Hause in diesen Ferien, deshalb hab’ ich sie mitgebracht.“
Heidi war, wie Friederun erleichtert feststellte, durchaus gefaßt bei dieser Nachricht. Sie nahm gleichmütig Koffer um Koffer, Rucksack, Pappschachteln, Wandertasche und Geigenkasten über den Zaun hin in Empfang. Dann liefen die beiden Reisenden der Sperre zu, durch die eben die letzten Fahrgäste gingen, die mit ihnen ausgestiegen waren. Gleich darauf waren sie alle dabei, das Gepäck in und auf einen kleinen zweirädrigen, gummibereiften Handwagen zu verstauen.
„Das ist Marianndel“, hatte Angelika kurz gesagt, als sie mit Friederun zu den Geschwistern trat. Marianne war schmal, nicht sehr groß, und schien gewohnt zu sein, daß man mit ihr nicht viel Wesens machte. Mit den andern übrigens auch nicht ... Angelika hatte Heidi nicht einmal die Hand gegeben. Alle Zärtlichkeit und Liebe schien man in dieser Familie auf den kleinen Toffer zu schütten, was der als naturgegeben hinnahm.
„Wo ist eigentlich Berni, das Unglückswurm?“ fragte Angelika, als sie neben Heidi die Deichsel des Wagens ergriff und sich in Marsch setzte. Die Bäume hier am Bahnhof, groß und alt, begannen gerade, sich zu färben. Es war ganz windstill, ein goldenes Herbstlicht lag über dem Städtchen.
„Ja, wo! Er wollte ganz bestimmt mit zur Bahn, er hat es mir heute früh gesagt. Halbtot hat er mich gemacht mit seinem Gefrage, immer wollte er ganz genau wissen, wann der Zug käme und von welcher Seite und auf welchem Bahnsteig. Schließlich hab’ ich es satt bekommen und hab’ ihn angeschrien, er solle selbst gehen und nachsehen. Und da ist er auch losgezogen und war prompt zu Mittag nicht da. Mutter hat sich mächtig geärgert. Wir hatten nur Pellkartoffeln und Quark, weil doch immer soviel zu tun ist, wenn ihr kommt. Mutter wollte noch Kuchen backen für euch. Und sie stellt so ungern das Essen warm.“
„Weder Dorf noch Stadt“, erklärte Angelika in ihrer kurzen, treffenden Art, als sie in den Ort einmarschierten. „Scheußlich, nicht? Wir würden viel lieber auf dem Lande wohnen, richtig, weißt du; wenn es hier wenigstens eine höhere Schule gäbe, aber dazu ist der Ort wieder zu klein. Zu klein für die Schule und zu groß, um richtig leben zu können!“
„Richtig leben“ hieß bei den Wittekinds „auf dem Lande leben“. Sie stammten vom Land, Mutter sowohl wie Vater. Jeder Mensch, den sie einigermaßen als Menschen ansprachen und rechneten, war vom Land. Zum Leben gehörte für sie alle — genau wie Atmen, Essen und Trinken —, daß man täglich mit Pferden und Kühen, Hunden, Hühnern und Gänsen zu tun hatte; daß man im Sommer früh um vier aufstand, weil man es einfach nicht erwarten konnte, in den Garten zu laufen, wo im betauten Gras die ersten mildsäuerlichen Frühäpfel lagen und die Schnecken im Salat sich unnütz machten, und daß man abends kaum ins Bett fand. Und daß man sich im Winter „einmottet“, wie Vater immer gesagt hatte, zeitig schlafen ging, morgens sich die Hände am Kartoffeldämpfer wärmte und den eigenen Atem wie eine Rauchfahne vor dem Munde stehen sah, wenn man zum Kuhstall hinüberging, um Milch zu holen.
In ihnen allen steckte die Liebe zum Land und die Sehnsucht nach dem Land; wer vom Land stammt, kann nie ganz heimisch werden in der Stadt. Die Wittekinds wußten das nicht, aber sie spürten es. Mutter sah es oft mit Betrübnis: Immer standen die Ihren etwas abseits, wo die Kleinstadtkinder spielten. Freilich, gar so schlimm war das nicht, sie hatten ja in der eigenen Familie Gespielen genug.
Als die vom Bahnhof Kommenden jetzt in die kleine, winklige Gasse einbogen, in der sie wohnten — sie bestand aus alten Fachwerkhäusern —, kam ihnen ein langbeiniges Etwas entgegengerannt. Berni! Nein, auf dem Bild sah er sogar noch vernünftiger aus; wahrscheinlich hatte man ihn damals erst gründlich in Ordnung gebracht, um ihn einigermaßen erträglich abzukonterfeien.
Er war groß für sein Alter, jeder schätzte ihn auf zehn und nicht auf acht Jahre, und er würde vielleicht auch einmal breit werden. Aber alles an seiner Figur saß irgendwie verkehrt. Die Schultern waren eckig und die Beine wie falsch eingeschraubt, das Haar hing ihm auf der falschen Seite in der Stirn, ach, und seine Nase!
„Komm mal her, wie siehst du wieder aus“, sagte Angelika ärgerlich, sehr ärgerlich sogar. Sie hatte Friederun ja vorbereitet, aber daß Berni so auftreten würde —
Das schlimmste an diesem Auftritt war nämlich, daß er heulte. Er heulte wahrhaftig, so groß wie er war, und mitten auf der Straße. Und da er immerfort mit den Händen die Tränen wegwischte, wurde es nicht besser, sondern schlimmer. Das ganze Gesicht war verschmiert, und unter der Nase saß eine feste, wertbeständige Kruste. Die war es, die Angelika vor allem haßte.
„Wie ein Dreckferkel. Wenn man auf die Straße geht, guckt man erst in den Spiegel“, sagte sie und zog ihn in einen geschützten Winkel, wo man ihn schnell ein wenig mit Taschentuch und Spucke bearbeiten konnte. „Du siehst aus ... eine Schande ist das. Warum warst du nicht zur Zeit an der Bahn?“
„Ich wollte ja“, schluchzte Berni, „ich hab’ doch den ganzen Tag über nur gewartet, daß ich endlich losgehen könnte. Heidi hat mir nichts gesagt! Erst bin ich zur Bahn gegangen und hab’ nachgesehen, und da stand sechs Uhr vierzehn, und da wollte ich schon eher losgehen und fragte Mutter, und da ...“
„Sechzehn Uhr vierzehn, du Kamel“, sagte Angelika und entließ ihn halb geheilt. Ganz bekam man die Schmiere ohne Seife und Lappen doch nicht weg. „Weißt du, was sechzehn Uhr ist? Um vier!“
Das war wieder einmal bezeichnend für ihn. Den ganzen Tag warten und lauern und sich vorfreuen — was Berni so „vorfreuen“ nannte — und dann falsch nachsehen und alles verpassen. „Der wird noch einmal das Glück seines Lebens vertrödeln“, sagte Mutter manchmal, und hier hatte Mutter wahrscheinlich wirklich recht.
„So, nun gib schon Ruhe, du hast uns ja wenigstens noch halb abgeholt“, sagte Angelika, der das unglückliche Gesicht des Bruders eben doch leid tat, zum Abschluß. „Komm, jetzt wollen wir Kaffee trinken.“