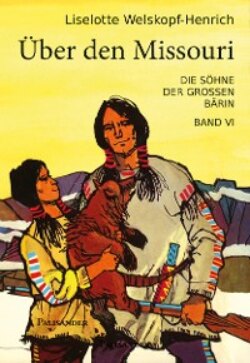Читать книгу Über den Missouri - Liselotte Welskopf-Henrich - Страница 8
Der Gefangene
ОглавлениеWeihnachten und die Sonnenwende waren längst vorüber. Die Tage wurden schon länger als die Nächte, aber die Kälte, die erst spät mit voller Strenge eingesetzt hatte, wollte nicht weichen, und die Bewohner der rauhen Prärien erwarteten noch schwere Schneefälle. Das kleine Fort am Niobrara lag einsam und verlassen. Auf dem Turm hielt Pitt in Pelzkleidung Wache. Ohne viel Aufmerksamkeit schaute er über die hügelige, steppenartige Landschaft, über Sand und kurzes Gras, über den seichten Fluss und die von Frühjahrs- und Herbstwassern abgefressenen Ufer, hinein in den Wirbel von Schneekristallen und Sandwehen. Dabei fiel ihm der Tag ein, an dem er zum ersten Mal zu dieser Vorpostenstation in der Prärie geritten war. Auch damals war es dem Kalender nach schon Frühling, auch damals hatte es aber noch gestürmt. Pitt sagte zu sich selbst, dass er in dem abgelaufenen Jahr sowohl auf Fort Randall am Missouri als auch auf diesem kleinen Fort am Niobrara wahrhaftig mehr Schlechtes als Gutes erlebt habe. Er wollte den Dienst so bald als möglich aufgeben und hinüberreiten zu der Agentur der neuen Dakotareservation. Vielleicht gab es dort ein besseres Auskommen für einen kleinen Mann. Red Fox, erfahrener Präriejäger und Gauner, hatte dem Stummelnasigen in dieser Richtung Hoffnungen gemacht.
Während Pitt den ereignislos und ungefährlich gewordenen Wachdienst versah, saß Capt’n Anthony Roach im Kommandantenzimmer und hing ebenfalls seinen Gedanken nach, die sich mit denen des kurznasigen Pitt in einigem trafen. Auch Roach wollte dem Niobrara so bald als möglich den Rücken kehren; er hoffte auf die Versetzung in eine angenehme Garnison im Hinterland, nachdem er seine Pflichten im Indianerkrieg vorzüglich erfüllt zu haben glaubte.
Anthony Roach trug, wie er das immer zu tun pflegte, eine tadellos sitzende, fleckenlose Uniform. Sein Gesicht war glatt, die Nägel waren gepflegt. Der Capt’n lehnte sich zurück und konnte dabei wieder feststellen, dass der Armstuhl, den er sich hatte anfertigen lassen, genau zu seiner Figur passte. In der Rechten hielt er ein aufgeschlagenes Notizbuch, mit der Linken nahm er die Zigarette vom Mund. Er beugte sich vor, um sie im Aschenbecher auszudrücken, und wandte seine Aufmerksamkeit ganz den Notizen zu. Ein Bleistift, nach dem er griff, erschien ihm zu stumpf, er legte ihn weg und suchte sich einen anderen, Marke Faber, aus.
Als er eben neue Anmerkungen zu machen gedachte, rüttelte der Sturm an Palisaden und Holzbauten. Das Schiebefenster vibrierte. Roach warf dem Fenster einen Blick strafender Überlegenheit zu und begann seine Gedanken mit Hilfe von Blei und Notizbuch systematisch zu ordnen.
Jahr des Herrn 1877. April – der 21.
Wir sind erfolgreich gewesen. Die feindlichen Dakota sind vollständig geschlagen, auf die Reservation getrieben.
Roach strich, von seinen eigenen Gedanken geleitet, eine Position in seinem Notizbuch aus, mit geradem, genau abgemessenem Strich, und setzte den Bleistift neu an.
Zweitens streichen wir Samuel Smith, den Major mit Ehre und Gewissen, der die roten Schweine noch gegen mich in Schutz nahm. Er ist gestorben, hat mir endgültig Platz gemacht. Das Verfahren gegen ihn erübrigt sich.
Anthony zog den zweiten Strich, langsam, grausam, mit Genuss. Er war sich der Narbe an seiner rechten Hand bewusst, die von einem Pistolenschuss des verstorbenen Majors herrührte. Nun konnte eben diese Hand den Namen Samuel Smith ausstreichen. Wieder wurde die Bleistiftspitze angesetzt.
Drittens streichen wir Cate Smith, die Tochter des Majors, ehemals meine Verlobte, ehemals Erbnichte der Mühlenbesitzerin und Witwe Betty Johnson, heute enterbt, entlobt, überhaupt völlig überflüssig. Wird mit dem nächsten Transport an den Missouri zurückgeschickt … Roach zog einen achtlosen, nicht ganz geraden Strich.
Viertens …
Anthony Roach wurde unterbrochen. Die Tür des Kommandantenzimmers, die in den Hof führte, war aufgerissen worden. Der Sturm heulte herein, wirbelte die Zigarettenasche aus dem Becher und fuhr in die mit Pomade gelegte Frisur des Captains. Ein großer Mensch, ganz in Leder gekleidet, betrat den Raum und zog die Tür, der Gewalt des Sturmes entgegen, wieder zu. Mit hörbaren Schritten kam er zu dem Schreibtisch heran. Ohne überhaupt zu grüßen, warf er die Kuriertasche auf die Tischplatte vor Roach hin. Dann ließ er sich auf die Wandbank fallen. Er streckte die Beine aus und holte seine Pfeife hervor.
Der Capt’n in Roach kochte. Anthony Roach wollte sich das jedoch nicht anmerken lassen, sondern Abstand, Ansehen und Ordnung auf leicht gedämpfte Weise wahren. Die verstreute Asche blies er vom Tisch, richtete die Augen wieder auf das Notizbuch und setzte sein bis dahin nur in Gedanken geführtes Selbstgespräch laut fort, in einer Haltung, als ob der andere überhaupt nicht vorhanden sei.
»Viertens streichen wir den gefangenen Indsman.« Er deutete mit der Bleistiftspitze auf einen Deckel, der in den Boden eingelassen war und zu dem Kellerraum unter dem Kommandantenzimmer führte. »Seit acht Tagen ist der Kerl da unten im Hungerstreik.«
Der Lederbekleidete auf der Wandbank hatte seine Pfeife zum Brennen gebracht, schaukelte sie im rechten Mundwinkel, fing eine Fliege, zerdrückte sie und wies Roach mit einer Bewegung seines starken Kinns darauf hin, dass er weniger reden und lieber die überbrachten Briefe öffnen sollte.
Anthony Roach ließ sich von dem andern unwillkürlich bestimmen. Er schloss die Kuriertasche auf, griff zum Brieföffner, schlitzte die Umschläge sehr korrekt auf und entnahm ihnen die Schreiben. Er las genau, krauste die Nase und strich einen der Bogen auf der eichenen Tischplatte glatt, während er die anderen wieder zusammenfaltete. Das Blut stieg ihm in seine mattfarbenen Wangen.
»Freilassungsbefehl!« Roach zischte das Wort.
Der Lederbekleidete deutete mit dem Daumen auf den Deckel der Kellerluke. »Freilassung? Doch nicht etwa für den da unten?!«
Anthony Roach lächelte so erbost wie boshaft. »Und dieses Schreiben bringt mir ausgerechnet Red Fox!«
Der Lederbekleidete sprang von der Wandbank auf, kam zu Roach heran und spuckte seine Pfeife auf die eichene, von einem Brand etwas angekohlte Tischplatte. »Hätt ich gewusst, was da drin steht! Verdammte Waschbärengehirne, Aasfresser! Den …«, er wiederholte die Bewegung des Daumens in Richtung des Kellerdeckels: »… den … freilassen?!«
Roach steckte sich eine neue Zigarette an. Er war sehr nervös, und der Tabak fing erst beim dritten Versuch Feuer. »Du bist Red Fox! Schrei nicht wie ein Baby!«
Der andere mäßigte seine Lautstärke nicht. »Grün wie Gras sind die Herren in der Stadt an ihrem Schreibtisch! Aber ich kenn die Prärie und den jungen Burschen da unten: Ein Scharfschütze und Messerheld ist das, Jägerblut, Häuptlingsehrgeiz und Rachsucht!« Red Fox stampfte auf.
Anthony Roach weidete sich an der Wut des anderen, die ihm die eigene erleichterte. Er sprach langsam und betonte jedes Wort: »Du hast seinen Alten umgebracht, nicht ich.«
»Aber du, Anthony Roach, hast ihn als Parlamentär gefangennehmen lassen! Wenn der Bursche noch einmal freigelassen wird, träumst du des Nachts von einem langen Messer, Anthony.«
Roach ließ sich hinreißen. »Lange genug hast du Zeit gehabt, ihm den Garaus zu machen!« Er strich Asche ab und beherrschte sich wieder. »Einen Befehl – führe ich aus. Das weitere … deine Sache.«
»Leider nicht nur meine, sondern auch seine Sache.« Red Fox versuchte wieder, eine Fliege zu fangen, die ihm aber entkam. »Wir werden ja sehen. Das eine ist sicher, Anthony Roach: Du lässt mir den Burschen nicht lebend aus dem Keller heraus. Verstanden?« Red Fox holte sich seine Pfeife wieder.
Roach spielte mit leicht zitternden Fingern an seinem Bleistift. »Benimm dich, wie es dir zukommt, du Präriewolf. Noch bin ich Capt’n und du bist nichts. Das Thema ist erledigt. Hole mir jetzt Tobias.«
Red Fox blies Luft durch die Lippen. »… aber zum letzten Mal dein Laufbursche! Der Indianerkrieg ist aus, ich quittiere den Dienst als Scout. Auf der Reservation braucht der Stellvertreter des stellvertretenden Agenten einen tüchtigen Dolmetscher, der mit Crazy Horse und seinen Leuten Dakota sprechen und notfalls noch mal schießen kann. Ich gehe, und den kurznasigen Pitt nehme ich mit mir. Gehab dich wohl, Anthony, in deiner palisadenumringten Hundehütte hier!«
Red Fox klopfte die Pfeifenasche auf die Tischplatte. Seine rötlichen Haare hatten sich im Nacken gestellt wie die eines gereizten Hundes. Er verließ den Raum und knallte die Tür hinter sich zu.
Roach war wieder allein. Er stand auf und ging auf und ab. Die Pfeifenasche auf der Tischplatte erregte als Zeichen der Unordnung seinen Unwillen. Aber es widersprach auch seiner Würde und seiner Ordnungsliebe, so viel Asche wegzublasen. Dieser frech gewordene Spießgeselle! Und derart ungehörige Schreiben! Wie konnten sie überhaupt zustande gekommen sein? Roach hatte auf das Wohlwollen seiner Vorgesetzten vertraut; er hatte gehofft, weiterhin eine schnelle Karriere zu machen.
Der Capt’n ging zum Tisch zurück, faltete die beiden Schreiben, die er wieder zusammengelegt hatte, mit spitzen Fingern auseinander und zog das eine, an einer Ecke anfassend, hin und her wie eine tote Maus am Schwanz.
Von Ernennung war in diesem Schreiben nicht die Rede und Versetzung nur zur Agentur … »größere Aufgaben« … Wieder in der Stinkprärie bei den verfluchten Indianern!
Roach steckte die beiden Schreiben in den Umschlag zurück. Er musste diesen sehr merkwürdigen Entscheidungen auf den Grund gehen. Das dritte Schreiben stammte nicht aus Washington und nicht von den Dienstvorgesetzten des Capt’ns, sondern von dem Kommandanten des Forts Randall am Missouri, der Roach auf Intrigen eines gewissen Herrn Morris aufmerksam machen wollte. Vielleicht ließe sich an den höchst überraschenden und unangenehmen Befehlen und Entscheidungen doch noch etwas ändern, wenn man die zuständigen Instanzen zutreffender informiere.
Warum Tobias noch nicht kam?
Anthony Roach klingelte mit der Glocke, die noch von der Zeit her, als Smith Kommandant gewesen war, auf dem angekohlten Eichentisch stand. Sie hatte Kampf und Brand überlebt, zierlich und dauerhaft wie der Capt’n selbst, und gab in jeder Hand den gewünschten Ton.
Tobias, der indianische Kundschafter, trat ein. Dieser Scout war in den Augen des Capt’ns ein Requisit aus vergangenen Tagen, aber auch im Frieden für dies und jenes brauchbar, immer dienstwillig, nicht schwatzhaft. Roach hatte sich an ihn gewöhnt und spendierte ihm des öfteren Dollars, um sich seiner Ergebenheit völlig zu versichern und selbst auf billige Weise den großen Mann zu spielen.
Der Capt’n setzte sich, steckte die dritte Zigarette an, blies Rauch in feinen Kringeln und lehnte sich wieder zurück. »Tobias! Welcher Idiot kann neuerdings über den verdammten Burschen in unserem Keller geplaudert haben?«
»Nur ein Idiot, Capt’n.«
»Wer ist das, ein Herr Morris?«
»Ein verrückter Maler, Capt’n, der immer Indianer gemalt hat.«
»Der Verrückte mischt sich in Angelegenheiten, die ihn nichts angehen. Hat er auch diesen Harry Tokei-ihto einmal abkonterfeit?«
»Kann sein, Capt’n, kann auch nicht sein. Weiß nicht.«
»Es ist ein Befehl gekommen, dass wir das rote Schwein aus dem Keller laufenlassen sollen. Hol mir den Feldscher!«
»Jawohl, Capt’n!«
»Eine halbe Stunde später Fräulein Cate Smith.«
»Jawohl, Capt’n.«
Tobias führte den Befehl aus und brachte den Feldscher. Captain Roach hatte diesen Sanitäter in schlechter Erinnerung, weil er im vergangenen Frühjahr die durchschossene Hand des damaligen Leutnants Roach nach Meinung des Patienten brutal behandelt hatte. Aber ein solcher Kurpfuscher mochte jetzt gerade nützlich sein.
»Brauche Ihre Meinung über den Gesundheitszustand unseres Gefangenen«, erklärte der junge Kommandant dem Eintretenden. »Tobias, hebe den Bodendeckel auf, lass die Leiter hinunter, und dann troll dich!«
»Wo ist der Schlüssel, Capt’n?«
»Der … Ach so!« Roach wies auf ein Wandschränkchen. »Dort! Mach auf – ja – links in dem kleinen Kasten. Hast du?«
Tobias hatte den kleinen Schlüssel gefunden. Seit dem missglückten Befreiungsversuch war der Gefangene im Keller unter dem Kommandantenzimmer sehr sicher verwahrt. Die Kellerluke zum Hof hatte Roach vergittern lassen. Der Bodendeckel hatte Scharnier und Vorhängeschloss erhalten. Tobias schloss jetzt das Vorhängeschloss auf und hob den schweren Deckel. Er ließ die Leiter hinunter und entfernte sich dann befehlsgemäß.
Roach erhob sich.
Der Feldscher, ein bärtiger Mann, begann als erster über die Leiter in den Keller hinabzusteigen. Roach folgte ihm, etwas besorgt um seine fleckenlose Uniform.
Als der Capt’n den Kellerboden erreicht und die Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatte, fasste er den gefangenen Indianer ins Auge.
Der Dakota stand aufrecht. Er hatte das Gesicht der Luke zugekehrt, durch die das weißliche Licht vom Hof her nur mit einem Streifen in schräger Bahn eindrang. Den beiden Männern, die in den Keller heruntergekommen waren, drehte er den Rücken zu.
Feldscher Watson trat an den Indianer heran. Der Dakota war um einen Kopf größer als seine beiden Besucher. Er trug noch immer die Kleidung, in der er gefangengenommen worden war, den reich gestickten Rock, Gürtel, Leggings und Mokassins. Sein Haar und seine Lederbekleidung waren über und über von Staub beschmutzt und von Blut besudelt, das verklebt und angetrocknet war. Die Hände waren dem Gefangenen mit Handschellen auf den Rücken, eine Kette war ihm einschnürend um die Hüfte geschlossen, die Füße waren so gefesselt, dass er nur kleine Schritte machen konnte. Der Feldscher wunderte sich, dass ein Mensch das Leben in einer solchen Fesselung so lange ausgehalten hatte. Der gesamte Kreislauf und Stoffwechsel musste stocken und der Gefangene Tag und Nacht von Schmerzen, Übelkeit und Schwindel gequält sein.
»He!«, rief Roach den Indianer an.
Der junge Häuptling beachtete den Anruf nicht. Er blieb stehen, mit der Regungslosigkeit eines gefangenen Adlers.
Watson winkte Roach, sich nicht weiter zu bemühen. Er schlug den Rock des Gefangenen über dessen Schultern, sah jetzt, wie das ausgemergelte Gesicht und die knochigen Hände, so auch den völlig abgemagerten Körper, der nur durch die harten Muskeln und Sehnen noch dem Druck der Fesseln widerstand. Der Feldscher horchte an Brust und Rücken und spürte dabei die Fieberhitze im Körper. Das Herz ging schnell und unregelmäßig, der Atem konnte nicht mehr frei durch die Lunge ziehen.
»Auf alle Fälle eine beginnende Rippenfell- und Lungenentzündung und das entsprechende Fieber«, unterrichtete der Feldscher den Capt’n. »Auch schwere Bronchitis. Wahrscheinlich bereits Schwindsucht, aber um das festzustellen, müsste ich weitere Untersuchungen vornehmen.«
»Danke! Was Sie sagen, genügt zunächst. Besteht Lebensgefahr?«
»Der Indsman muss unbedingt aus diesen Fesseln und aus dem Keller heraus, sonst tut er in wenigen Tagen seinen letzten Atemzug.«
»Ich habe Sie nicht um Ratschläge gebeten, sondern nach der Diagnose gefragt.«
Watson kehrte sich nicht an diese Zurechtweisung. »Der Indsman scheint ganz ausgedörrt. Warum bekommt er nicht zu trinken?«
»Ich werde befehlen, das künftig nicht wieder zu vergessen.«
»Saubermachen könnte hier auch mal einer. Der Schmutz allein wirkt schon wie eine Folter.«
»Indianer lieben den Dreck. Watson, denken Sie bitte daran, dass es sich hier nicht um einen ehrbaren Häuptling handelt, sondern um einen uns entlaufenen Kundschafter und einen gemeinen Meuchelmörder. Er hat nicht nur Mannschaften, sondern auch Offiziere niedergemacht und hat sich damit durchaus etwas mehr als einen schnellen Tod verdient.«
»Es war Krieg.«
»Rebellion, meinen Sie! Watson, halten Sie sich von den falschen Auffassungen des verstorbenen Majors a. D. Smith fern. Sie könnten sonst Nachteile haben!«
Roach war mit dem Verhalten des Feldschers sehr unzufrieden und brach ab. Er kletterte als erster wieder die Sprossen hinauf. Der Sanitäter folgte ihm, zog die Leiter hoch und schloss den Deckel. Roach legte den Schlüssel zurück in den kleinen Kasten im Wandschrank.
Während der Feldscher ohne weiteres Wort den Kommandantenraum wieder verließ, setzte sich der Capt’n in seinen Armstuhl und entdeckte dabei Cate Smith, die ihm gegenüber an die Wand gelehnt stand.
Er musste sich selbst erst wieder daran erinnern, was er befohlen hatte. »Ah, Fräulein Smith!«
Das Gesicht des Mädchens war blass, ihre Hände schienen blutleer. Sie trug einfache schwarze Kleidung als Zeichen der Trauer um ihren Vater. Ihr Ausdruck war merkwürdig abgewandt.
»Sie sind etwas zu früh gekommen, Fräulein Smith … Wir haben uns soeben den Gefangenen angesehen, um den Ihr Herr Vater sich damals so ungemein besorgt zeigte.«
Cate antwortete nicht. Sie wartete.
»Fräulein Smith, wir machen es kurz. Setzen Sie sich!« Roach flüchtete sich in einen schulmeisterlichen Ton.
Cate überhörte die Aufforderung und blieb stehen.
Roach spielte mit der Zigarette zwischen den gelben Fingern. Lauernd, etwas unsicher, fuhr er fort: »Sie verstehen …«
»Allerdings.« Cate sprach das Wort ohne irgendein Zeichen der Erregung über ihren ehemaligen Verlobten.
Roach betrachtete das Mädchen mit widerwilliger Achtung und einer ihm natürlichen Frechheit. »Sie verstehen …«
»Ich musste vor einem Jahr verstehen lernen, dass Sie ein Schuft sind, Roach. Ihre Intrigen haben meinen Vater das Leben gekostet.« Cates Stimmklang blieb schlicht, ohne Pathos. »Heute weiß ich auch, dass Sie ein kleiner – ein sehr mittelmäßiger Schuft sind. Ich werde gehen.«
Die Bezeichnung »mittelmäßig« war ein Hieb, der traf. Roach versuchte ihn zurückzugeben. »Ausgezeichnet! Ich habe den Transport schon arrangiert. Halten Sie sich in vierzehn Tagen bereit. Eine Erbschaft oder sonstige Versorgung haben Sie als Tochter Ihres Vaters nicht zu erwarten. Vielleicht können Sie als Wäscherin arbeiten oder in welchem Gewerbe es Ihnen sonst zusagt …«
»Ich brauche Ihre Arrangements nicht, Capt’n.« Das Mädchen wandte den Blick von Roach ab und schaute noch einmal ringsum in den Raum, in dem sich im vergangenen Frühjahr die Szene des Verrats an dem indianischen Unterhändler und der letzte heftige Zusammenstoß zwischen Cates Vater, dem Major Samuel Smith und Red Fox, Anthony Roach sowie dessen Gönner, dem Obersten Jackman, abgespielt hatte.
Damals hatte in diesem kahlen Raum noch kein Armstuhl gestanden. Roach hatte die Wandbank an der einen Seite des Eichentisches herausreißen lassen, um seinen Stuhl aufzustellen. Das ganze Fort schien von Roachs Tun und seinem Atem vergiftet. Sie verließ den Raum.
Der Sturm hatte etwas nachgelassen. Cate nahm das Schultertuch über den Kopf und ging über den Hof zu dem großen Tor im Palisadenring. Die Torwache ließ das Mädchen ohne weiteres hinaus. Die Wachen waren gewöhnt, dass Cate täglich das Grab ihres Vaters draußen vor den Palisaden aufsuchte.
Das tat sie auch heute. Es war ein schlichtes Grab, ohne Blumen, ohne Kranz. Das Mädchen blieb bei dem Holzkreuz stehen. Ihre Schultern, ihr Kopf waren schon von Schneeflocken besetzt. Sie schaute irgendwo hin. In Wahrheit sah sie ihre Umgebung nicht, sondern nur Bilder der Erinnerung an ihren Vater.
Als Tobias sie aufschreckte, waren ihre Hände kalt geworden, und sie spürte auf einmal, dass der Frost schon ihren ganzen Körper schauern ließ.
»Geht hinein, Miss Cate.« Der Kundschafter sprach wie ein älterer Bruder zu dem Mädchen. »Es gibt eine wichtige Nachricht. Heute Abend komme ich zu Euch. Ihr müsst uns helfen.«
»Gut, Tobias.«
Cate begab sich wieder in das Fort und in ihre Kammer. Es war die Kammer, in der ihr Vater gestorben war. Sie nahm eine Näharbeit zur Hand. Es gab noch dies und jenes zu richten, wenn sie das Fort bald ganz verlassen wollte.
Als sie des Nähens müde wurde, räumte sie die Arbeit beiseite. Sie betrachtete das Bild, das sie sich von dem Grab ihres Vaters gezeichnet hatte, und holte dann einen wohlverwahrten Brief hervor. Die Handschrift war ungelenk, aber deutlich. Es war der Brief des Rauhreiters Adams, der zu Samuel Smith gehalten und den verratenen Indianer hatte befreien wollen. Er hatte mit seinen guten Gesellen Thomas und Theo zusammen vor Roach fliehen müssen. In dem Brief stand, dass Cate auf weitere Nachricht warten sollte. Adams wollte ihr beistehen, sobald sie das Fort verlassen würde.
Der Brief war vor Monaten geschrieben. Tobias hatte ihn damals heimlich überbracht. Ob Adams auch jetzt noch an Cate dachte?
Das Mädchen holte sich neue Arbeit hervor. Der Tag schien ihr lang, weil sie wartete. Aber auch dieser Tag ging vorüber. Matt glitzernd fielen noch einige Flocken vom wolkenverhangenen Himmel zur dunkel gewordenen Erde. Cate hörte, wie die Mannschaften Essen fassen gingen, ein paar Worte und Rufe, schwere Schritte, dann wurde es ganz still. Das Mädchen hatte die Lampe nicht entzündet, sie wartete im unbeleuchteten Zimmer auf Tobias.
Endlich öffnete sich die Tür, und der Kundschafter trat lautlos ein. Er drückte sich, weitab vom Fenster, an die Wand. Cate zog den Vorhang zu.
»Was sagt Watson über den Dakota?«, fragte Tobias. »Ihr müsst es mit angehört haben. Der Bodendeckel war offen. Ihr seid schon im Kommandantenzimmer gewesen, während Watson und Roach bei dem Gefangenen im Keller waren.«
»Du brauchst mir das nicht nachzuweisen, Tobias. Ich sage dir, was ich gehört habe. Warum sollte ich es vor dir verschweigen? In wenigen Tagen stirbt Tokei-ihto, wenn er gefesselt im Keller bleibt. Sie wollen ihm jetzt wenigstens wieder zu trinken geben.«
»Der Freilassungsbefehl ist da. Morris, der Maler, hat dafür gekämpft. Er kannte Harry Tokei-ihto schon als Knaben im Zelt seines Vaters. Roach will mit einem Handschreiben rückfragen, um Zeit zu gewinnen und Lügen zu verbreiten. Ich bin der Bote, und ich kenne die weißen Männer. Ein Befehl ist ein Befehl, und einen schriftlichen Befehl heben sie niemals mehr auf. Sie werden den Freilassungsbefehl bestätigen und Roach zurechtweisen.
»Aber vorher stirbt Tokei-ihto.«
»Ein Indianer stirbt, wenn er sterben will. Cate, Ihr Vater hatte dem Häuptling vor den Verhandlungen verbürgt, dass er dieses Fort wieder frei verlassen kann. Ihr müsst Tokei-ihto sagen, dass der Befehl, ihn freizulassen, da ist. Dann wird der Häuptling leben wollen.«
»Ich soll es ihm sagen?«
»Ja. Ihr! Ihr seid die Einzige, die einen zweiten Schlüssel zum Kommandantenzimmer besitzt. Bei Eures Vaters Sachen müsst Ihr ihn gefunden haben.«
»Das ist wahr. Ich kann ihn dir geben.«
»Nein. Ich muss mit Roachs Brief nach Randall reiten; mein Mustang steht bereit. Ich habe schon viel Zeit verloren, um noch vorher mit Euch zu sprechen. Geht Ihr selbst des Nachts in das Kommandantenzimmer und steigt in den Keller hinunter. Der Schlüssel für die Bodenluke liegt im Wandschrank, das habt Ihr auch gesehen. Wenn Euch jemand trifft, so sagt, der Geist Eures Vaters habe Euch gerufen und verfolge Euch. Niemand wird Euch bestrafen, wenn etwas fehlgeht. Man wird Euch wegschicken, das ist alles und nicht mehr, als Euch sowieso bevorsteht. Aber des Gefangenen wegen müsst Ihr vorsichtig sein. Roach sucht nach einem Grund, den Dakota zu töten, ehe er ihn freilassen muss.«
»Tobias! Nicht nur Roach schläft in seiner Kammer über dem Keller. Im Kommandantenzimmer hält ein Mann Wache!«
»Aber nicht heute Nacht. Ich habe den Burschen wissen lassen, dass er sich heute Nacht fernzuhalten hat, weil Roach es so wünsche und Euch einmal des Nachts bei sich empfangen wolle, ehe Ihr abreist.«
»Tobias! Bist du wahnsinnig geworden!«
»Das Kommandantenzimmer ist heute Nacht leer. Ihr könnt dessen gewiss sein. Ihr habt den zweiten Schlüssel. Niemand wird Euch aufhalten.«
Der Kundschafter konnte nicht wissen, was in Cate vorging, und in der Dunkelheit ihr Mienenspiel nicht beobachten.
»Ich wage es«, sagte sie aber endlich. »Mein Vater würde wünschen, dass ich es tue.«
»Gut.«
Tobias entfernte sich noch nicht. Er zog einen Brief hervor und gab ihn Cate.
»Der junge Adams wartet darauf, dass Ihr das Fort verlasst«, sagte er dabei. »Er will Euch zur Frau nehmen, wenn Ihr mit ihm hinaufgehen werdet nach Kanada. Adams ist ehrlich. Vertraut ihm und lest den Brief genau. Ihr kennt ihn doch, den Adams. Er hat immer zu Eurem Vater gehalten.«
»Es ist wahr, was du sagst, Tobias.« Cate atmete auf. »Wirst du Adams noch einmal treffen?«
»Ich kann ihm Eure Antwort bringen.«
Als Roach und der Feldscher die Kellerluke wieder verschlossen hatten, hatte sich der Gefangene gerührt. Er hatte seinen Standplatz, der ihm den Blick zur Luke gewährte, verlassen und war zu der Wand zurückgetreten. Seine Kette klirrte. Er hasste es, sich auf den Kellerboden in den Schmutz zu legen, und lehnte sich an die Wand, um die Nacht im Stehen zu verbringen, wie er es in den Gefahren der Wildnis gelernt hatte. Aber es fiel ihm jetzt schwerer als früher. Seine Kräfte hatten nachgelassen.
Draußen seufzte und sang der Wind. Irgend etwas schwebte durch die Dunkelheit und glitzerte. Ein paar Flocken verirrten sich und schwebten zögernd durch die Luke herein. Die Augen des Gefangenen folgten ihnen, bis sie am Boden zergingen.
Obgleich der Gefesselte erschöpft war, schlief er nicht ein. Mit eingesunkenen Schultern lehnte er an der Wand und hing in halbwachem Zustand seinen Gedanken und Fieberphantasien nach. Er dachte an sein Zelt, an Mutter und Schwester. Er dachte an seinen Mustang und an die weite Prärie. Er dachte an seine Kampfgefährten, aber er hoffte nicht mehr, sie wiederzusehen. Der Gefangene hatte gehört, dass sein Volk geschlagen, dass es aus der Heimat vertrieben und ganz unterworfen sei; das hatte ihm der Wächter mit einer bösen Freude ausgemalt. Er hatte gehört, dass er selbst krank sei und nur noch wenige Tage zu leben habe. Als der Gefangene vor Tagen aufgehört hatte zu essen, weil seine Organe unter dem Druck der Kette kaum mehr arbeiten konnten, und als er mit keinem Wort um das verweigerte Wasser zum Trinken bat, da hatte er von sich selbst geglaubt, dass er mit dem Leben abgeschlossen habe und gegen seine feindliche Umgebung nicht nur Gleichmut spiele, sondern auch im Innern völlig gleichgültig geworden sei. Als Roach mit dem Feldscher gekommen war, hatte der Gefesselte aber die Erfahrung machen müssen, dass noch etwas in ihm lebte, wovon er selbst nichts mehr gewusst hatte. Er hatte gar nichts gegenüber dem bärtigen Feldscher selbst empfunden. Aber als dieser ihn im Auftrag des Capt’n Roach anfasste, hätte der Gefangene den Anthony Roach niederschlagen mögen. Noch immer war der Indianer nicht so vollständig gebrochen, dass er die Stimme des Capt’n Roach hören und seine Gegenwart hätte ertragen können, ohne von Hass gepackt zu werden.
Als die ersten Stunden der Nacht vergangen waren, begann der Gefangene darauf aufmerksam zu werden, dass etwas anders verlief als in den anderen Nächten. Roach hatte sich sehr früh zu Bett gelegt; der Dakota hatte die Schritte und das Quietschen der Zwischentür gehört; das waren Geräusche, die er genau kannte. Der Capt’n schnarchte, und der Gefangene unterdrückte mühsam sein Husten, weil er etwas Ungewöhnliches vernommen hatte und lauschen wollte. Der Wachposten, der sich wie jede Nacht im Kommandantenzimmer eingerichtet hatte, verließ das Haus eben wieder. Der Dakota hörte ihn hinausgehen und zuschließen. Zeit verging, aber der Posten kam nicht wieder.
In dem Gefangenen sprang ein Argwohn auf, der ihn im Grunde Tag und Nacht beseelte. Er glaubte, dass Roach ihn ermorden lassen wollte. Er wartete im Stillen jeden Tag und jede Nacht auf einen Mörder. Warum war jetzt die Wache weggegangen? Sollte etwas geschehen, wovon der Kommandant dienstlich nichts gewusst haben wollte?
Es musste um Mitternacht sein. Roach schnarchte immer noch.
Die Tür zum Kommandantenzimmer wurde wieder aufgeschlossen. Es trat jemand ein und schloss wieder zu. Schritte ließen sich hören: Das waren nicht die Schritte des Wächters. Es war ein leichter, tastender Schritt. Ein Brett knarrte. Darauf war es wieder still, als ob jemand fürchtete, sich zu verraten.
Der Dakota bewegte den Kopf. Seine wochen- und monatelangen Kopfschmerzen beeinträchtigten sein scharfes Wahrnehmungsvermögen, aber sein Wille zwang seine Gehörnerven und sein Gehirn, in diesem Augenblick zu funktionieren. Er horchte angespannt und nahm den nächsten vorsichtigen Schritt wahr.
Die Vermutungen und die Stimmung des Gefangenen schlugen um. Eine derartige Vorsicht zu üben, hätte ein Mörder im Auftrag des Capt’n nicht nötig gehabt. Alle Hoffnungen, die der Gefangene lange und gewaltsam hinuntergewürgt hatte und auch jetzt niederhalten wollte, erhoben sich und überwältigten ihn.
Wer war da oben? Was wollte er? Würde er den Deckel heben?
An dem Deckel, der die Bodenöffnung zum Keller verschloss, wurde gearbeitet. Der Deckel bewegte sich ein wenig, fiel wieder zurück, als sei er schwachen Händen zu schwer gewesen, und bewegte sich von neuem. Er wurde ganz aufgehoben. Der Gefangene befand sich in einiger Entfernung von der Öffnung und konnte nicht hinaufsehen. Er hörte aber, wie die Leiter bewegt, und sah dann, wie sie langsam heruntergelassen wurde. Es erschienen zwei kleine Füße in hohen Reitstiefeln, die von Sprosse zu Sprosse abwärts stiegen.
Die Dunkelheit war von einem schwachen Schimmer des Mondlichts aufgehellt. Der Dakota erblickte ein Mädchen. Sie hatte den Kellerboden erreicht, sah sich um und ging auf den Gefangenen zu.
»Du kennst mich, Tokei-ihto«, sagte sie einfach. »Ich bin Cate, die Tochter des Samuel Smith. Mein Vater ist gestorben. Ich gehe jetzt auch fort. Tobias hat mir den Auftrag gegeben, dir vorher etwas zu sagen.«
»Ja?« Das Wort war mehr ein Bewegen der Lippen als ein Ton.
»Der Krieg ist zu Ende. Der Befehl, dich zu entlassen, ist schon da. In spätestens vierzehn Tagen hat Roach auf seine Rückfrage die Bestätigung, dass er ihn unbedingt ausführen muss. Tobias ist der Bote. Du wirst frei.«
Das Wort »frei« traf den Gefangenen wie ein Kriegsruf, der den Mann aus dem Schlaf weckt; die Willenskraft des Häuptlings sprang sofort auf, und ohne Gefühlen Raum zu geben, konzentrierte er sein Denken. Er musste fragen, er konnte fragen; das war seine erste Waffe, nach der er zu greifen vermochte. »Wie hat der Krieg geendet?«
»Mit eurer Niederlage, Häuptling. Es ist wahr, dass ihr erst große Siege errungen habt. Eure Häuptlinge Sitting Bull und Crazy Horse haben die Truppe des Generals Custer vernichtet, und Custer selbst ist gefallen. Nur ein einziger Scout und ein Maultier entkamen. Auch die Generale Crook, Benteen und Reno habt ihr geschlagen, und sie mussten sich zurückziehen. Aber dann ist euren Männern die Munition ausgegangen. Sie mussten weichen.«
»Wo ist Red Fox?«
»Zur Agentur geritten. Er wird dort Dolmetscher.«
»Was macht Adams?«
»Er ist entflohen, als sie seine Eisenfeile bei dir fanden. Er geht nach Kanada. In den Staaten, wo sein Vater ermordet wurde, will er nicht bleiben.«
»Sein Vater ermordet? Wie geschah das?«
»Sie haben dem alten Mann die Farm weggenommen, weil er das Land, das er von den Dakota gekauft und das er urbar gemacht hatte, nicht noch einmal bezahlen konnte und auch nicht noch einmal bezahlen wollte. Er sagte, es sei Betrug. Als die Dakota vertrieben waren und die Langmesser kamen, hat er sich mit der Flinte zur Wehr gesetzt. Dann floh er: Sie haben ihn aufgegriffen und haben ihn nach ihrer Sitte mit heißem Teer beschmiert und mit Federn beklebt und gehetzt, bis er tot war. Auch die weißen Männer verstehen zu martern.«
»Das weiß ich. – Wie wird Adams in Kanada leben?«
»Er will sich Fallen leihen bei der Pelzkompanie und will mit Thomas und Theo zusammen als Biberjäger arbeiten. Wenn er wieder Land bekommt, will er Vieh züchten und ackern. Sein Schicksal ist wie das eines roten Mannes – vertrieben ist er und wenig geachtet.«
»Aber dennoch will er kein Indianer sein. So sagte er mir einmal.«
Cate dachte nach.
»Die Haut des Adams ist weiß, und seine Augen sind blau, aber heute wäre er euer Bruder, wenn er bei euch leben dürfte. Er darf es aber nicht. Die Grenzen der Reservation sind für Weiße verschlossen.«
»Hält er sich noch in der Nähe auf?«
»Ja. Er wartet mit Thomas und Theo auf mich.«
»Adams, der solche Worte gesprochen hat, wie du sie mir berichtest, wollte uns dennoch verachten, weil wir nicht den Pflug führen und Vieh züchten.«
»Aber das würdet ihr lernen«, erwiderte Cate. »Wie gern würde Adams euch das heute lehren, wenn es ihm erlaubt wäre.«
Im Hof ließen sich Schritte vernehmen. Das Mädchen zog sich zu der Leiter zurück. Die Schritte entfernten sich.
»Gehe jetzt!«, forderte der Gefangene Cate auf. »Du darfst nicht entdeckt werden. Dein Mut war groß genug.«
»Ich gehe. Du bist unser Bruder. Wenn du frei wirst, komme nach Kanada. Dort verfolgt dich niemand. Wir werden an der Grenze in der Nähe der Waldberge sein.«
»Sage dem Tobias: Ich will um mein Leben kämpfen. Hau. – Aber nun gehe.«
»Lebe wohl!« Cate stieg schnell die Leiter hinauf und zog sie hoch. Sie ließ den Deckel wieder herunter. Der Gefangene vernahm noch ihre leichten, vorsichtigen Schritte. Schließlich hörte er, wie sie die Außentür öffnete und schloss. Dann war alles still.
Der Dakota gedachte der Nachrichten, die ihm Cate Smith gebracht hatte. Er war erst vierundzwanzig Jahre alt, und er sah noch einmal eine Aufgabe vor sich.
Von Stund an begann er um vierzehn Tage Leben zu ringen, um die Tage und Nächte bis zu jenem Moment, in dem Roach ihn freilassen musste.
Der Gefangene straffte seine Muskeln gegen den Druck der Kette. Selbst wenn er sich erbrechen musste, aß er, um keinen Anlass zu geben, dass der Wächter ihm wieder den Becher mit Wasser verweigerte. Mit eiserner Anstrengung hielt er einen regelmäßigen Wechsel von Wachen und Schlafen ein.
Vierzehn Tage später, an einem trüben Nachmittag, kam der vierschrötige Wächter früher als sonst zu dem Gefangenen. Es war noch nicht die Stunde der Abendmahlzeit, und er hatte auch nichts bei sich. Als er vor dem Dakota stand, holte er umständlich Schlüssel aus der Tasche und zeigte sie dem Gefangenen. »Du sollst zum Kommandanten kommen«, sagte er, »zu Capt’n Roach. Benimm dich anständig. Davon hängt dein Leben ab.«
Er schloss die Handschellen und die Kette auf und nahm dem Gefangenen die Fußfesseln ab. Der Dakota ließ sich nicht anmerken, dass er die Erleichterung empfand.
»So«, befahl der Vierschrötige, der die Pistole gezogen hatte, »nun vorwärts, die Leiter hinauf. Und mache mir keine Schwierigkeiten. Droben stehen schon ein paar und nehmen dich in Empfang.«
Der Dakota folgte stumm der Anweisung. Er fürchtete, dass ihm seine Feinde einen Fluchtversuch unterschieben und ihn erschießen würden. Aber er konnte ihren Befehlen auch keinen Widerstand leisten, sonst würde er aus diesem Grunde erschossen.
Als er das Arbeitszimmer des Kommandanten betrat, erkannte er am Schreibtisch Roach. Vier Dragoner mit gezogenen Pistolen schützten den Capt’n vor einem befürchteten Hass- und Verzweiflungsausbruch des zu entlassenen Gefangenen. Der Capt’n hatte sich nach seiner Gewohnheit zurückgelehnt und hielt die Zigarette zwischen den gelben Fingern. In seiner Miene lag alles, was ein karrierelüsterner und bösartiger Mensch im Augenblick eines Triumphes empfindet. Er rümpfte die Nase, als der Indianer in den blut- und staubbedeckten Kleidern vor ihm stand, deren kostbare Stickerei kaum mehr zu erkennen war.
»Was bringst du mir den Kerl dreckig und stinkend hier herein!«, schnarrte er den vierschrötigen Rauhreiter an. »Du hättest ihm erst ein paar Kübel Wasser übergießen können. Lass jetzt«, fügte er hinzu, »wir werden die Angelegenheit möglichst kurz machen.« Er betrachtete den Dakota wie ein Tier, das auf dem Markt taxiert wird. »Du scheinst ziemlich krank zu sein, Schwindsucht oder etwas Ähnliches.« Roach gab sich keine Mühe, seine Befriedigung darüber zu verbergen. »Der Feldscher meinte jedenfalls Schwindsucht. – Es bestehen in Washington keine Bedenken mehr, dich zu entlassen, wenn du zur Vernunft gekommen bist und unterschreibst, dass du dich widerstandslos auf die Reservation begeben wirst.« Roach spielte mit einem Schriftstück. »Nun, wie steht’s? Hast du dir die Sache überlegt?«
»Dass ich mich selbst auf die Reservation begeben werde?«
»Ja, natürlich. Für deinen Stamm brauchst du nicht mehr zu unterschreiben. Der ist längst dort.«
»Ich begebe mich ohne Widerstand auf die Reservation.«
»Famos. Was doch so ein paar Monate Keller ausmachen können! Ein ganz anderer Mensch geworden!« Roach schob dem Dakota das Schriftstück hin. »Hier! Unterzeichne!«
Der Indianer hatte in der Zeit, in der er viel mit Weißen umgegangen war, lesen gelernt. Er studierte sorgfältig die Sätze, die er unterschreiben sollte. Sie enthielten tatsächlich nichts anderes, als was Roach gesagt hatte. Der Dakota unterschrieb im Stehen.
»Deine Waffen bekommst du nicht mehr. Du wirst jetzt aus einem Wilden zu einem zivilisierten Menschen werden. Morgen früh geht die Reise los. Tobias hat einen Brief nach Fort Robinson zu bringen, er kann dich mitnehmen. Dein Gaul ist dir wiedergeschenkt, die Bestie ist doch nicht zu gebrauchen. Und sieh zu, dass du uns auch das andere Raubtier fortschaffst, den schwarzen Wolf, der die Gegend unsicher macht. Das soll dein Hund sein?!«
Der Dakota zuckte die Achseln.
Roach sah sich um. »Wo ist denn Tobias?«, fragte er die Anwesenden. »Es war ihm befohlen, zu kommen.«
Die Tür tat sich auf, und der Gesuchte trat ein.
»Aha, Tobias! Hier ist dein Schützling. Er geht auf die Reservation. Du nimmst ihn morgen mit. Heute Nacht kann er mit dir im Mannschaftshaus schlafen.«
»Hau.«
Ohne ein weiteres Wort verließen die beiden Indianer den Raum. Draußen im Hof war es dämmrig, der Abend brach schon herein. Ein paar umstehende Soldaten und Rauhreiter schauten mit unverhohlener Neugier nach dem entlassenen Gefangenen, und dieser hörte ihre Reden.
»Kein Kunststück, den jetzt freizulassen. Dem sieht jeder an, dass er’s nicht mehr lange macht.«
»Verdient hat er nicht, dass er überhaupt frei wird. Ich hab noch nicht vergessen, wie er den Leutnant Warner im Finstern niedergestochen hat.«
Der Dakota unterdrückte seinen Husten.
Tobias führte ihn in das Mannschaftshaus. Zwei Petroleumlampen erleuchteten matt den düsteren Raum. Der Delaware kramte an seinem Schlafplatz in der Ecke. Er gab dem Dakota von seinem Pemmikan, und ein flüchtiges Lächeln glitt über Tokei-ihtos Züge, als er seine alte Pfeife zurückerhielt.
Die Mannschaften fanden sich am Abend schwatzend, rauchend und spielend in dem Blockhaus zusammen. Die meisten beachteten die beiden Indianer gar nicht, aber aus einer Gruppe alter Mannschaften, die die erbitterten Kämpfe um die Station noch mitgemacht hatten, flogen böse Blicke und feindselige Bemerkungen herüber. »Was soll das stinkende Schwein hier bei uns?« – »Vielleicht erzählt er uns mal, wie er George und Mike und die anderen ermordet hat!« – »Nehmt ihm doch das Feuerzeug weg, sonst fliegen wir heute Nacht noch einmal in die Luft!«
Der Dakota ließ sich nicht anmerken, ob er verstanden habe. Der Delaware wollte einen Zusammenstoß, bei dem der entlassene Gefangene gelyncht werden konnte, vermeiden. »Gehen wir zu den Pferden!«, schlug er vor.
Der Dakota erhob sich rasch, und die beiden Indianer verließen das Haus. Die Wache am Tor ließ Tobias mit seinem Begleiter durch. Vor dem Tor war eine Koppel, in der einige Tiere das braune Wintergras weideten. Nur ein falber Hengst stand mit gesenktem Kopf, ohne zu fressen. Der Dakota lockte leise. Der magere Falbe, dessen Fell die Spuren vieler Misshandlungen zeigte, hob den Kopf, spitzte die Ohren und war dann mit wenigen Galoppsprüngen an der Umzäunung. Er legte die weichen Nüstern an die Wange des einzigen Reiters, den er je auf seinem Rücken geduldet hatte, und der Dakota streichelte ihm den Hals.
Die Indianer verständigten sich mit einem Blick. Tobias nahm die Stangen am Koppelausgang heraus, und die beiden holten sich ihre Tiere.
Sie ritten in die Prärie hinaus. Weit über das Land zu blicken, das war ein erster Wunsch des Befreiten.
Als die Reiter die Station so weit hinter sich gelassen hatten, dass sie von dort nicht mehr gehört und gesehen werden konnten, machten sie halt. Der Dakota musste den Falben scharf zügeln, denn das Tier wollte stürmisch weiter in die Freiheit und zu den ihm bekannten Prärien im Südwesten ausbrechen. Feine Schneekristalle huschten mit ihrem schnell aufblitzenden und wieder versinkenden Schimmer durch die Lüfte. Zwischen den Wolken flimmerten Sterne, fern wie seit Tausenden und Abertausenden von Jahren. Der Vollmond, Herr der Nacht, zog kreisrund am Himmelsgewölbe empor. Feierlich wanderte er durch die Finsternis und erhellte sie mit einem drohenden roten Schein. Rings lag das leere Land. Seine Söhne, die Dakota, waren vertrieben, und noch hatte keiner der neuen Herren Lust gezeigt, sich in der unfruchtbaren Wildnis niederzulassen. Endlich schweifte der Blick über kahle Sandhügel, über von kurzem Gras bewachsene Höhenkämme und Täler. Am Flussufer neigten sich spärliche Weiden im Atem der Nacht.
Der Häuptling sah zum letzten Mal seine große Heimat. Am nächsten Morgen sollte der Ritt zur Reservation beginnen.
Er öffnete die Lippen, und leise und dumpf begann sein Klagelied über die weite Steppe zu tönen. Der Klang mischte sich mit dem rauhen Singen des Windes.
Lange und einsam sang der Häuptling, immer wieder von Husten unterbrochen, und der heimatlose Delaware hörte in dem Lied des Dakota die eigene Klage.
Da war es, als habe das Lied des Indianers den schlafenden Boden geweckt. Von einem der mondbeschienenen Hügel hob sich ein fremder Schatten. Es war ein Wolf, anders als andere Wölfe, größer und dunkel. Das magere Tier mit seinem geöffneten Rachen und den gleißenden Augen erschien wie ein Spuk, der sich erheben und durch die Lüfte davonfahren kann. Aber er blieb am Boden haften, und langsam, Schritt für Schritt, kam er heran, immer näher zu dem dumpfen Klageton, der dem Wind und den Wölfen von den Taten der Dakota und ihrem Schicksal erzählte.
Der Häuptling hatte den Wolf erkannt. Aber er rührte sich nicht. Leise sang er weiter, und seine Stimme zog das Tier heran wie ein mächtiger Zauber. Knurrend noch, mit gefletschten Zähnen schlich der Schwarze herbei. Endlich traten seine Pfoten am Platz das Gras. Sein Knurren ging in Winseln über, und er legte sich.
Als der Häuptling schwieg, stieß das Tier einen bellenden Laut aus. Unaufhörlich zog seine feine Nase die Witterung ein.
»Ohitika!«
Der Hund sprang den Dakota an, so dass dieser sich einstemmen musste, um nicht umgeworfen zu werden. Laut jaulte das Tier auf. Der Falbe hatte den schwarzen Wolfshund auch erkannt. Er schnaubte und begann, an dem dürren Gras zu rupfen.
»Nun frisst er wieder«, sagte der Delaware.
Spät ritten die Indianer zu der Station zurück. Sie blieben außerhalb der Palisaden in der Koppel bei den Pferden. Die Wache kümmerte sich nicht um sie.
Der Delaware gab dem Dakota den zweischneidig geschliffenen Dolch mit dem geschnitzten Griff zurück. »Hier«, sagte er, »das ist die einzige erlaubte Waffe für dich. Ich habe sie aus Oberst Jackmans Gepäck herausgenommen, als er die Station verließ. Er wird es erst in der Garnison bemerkt haben und konnte nicht mehr nachforschen.«
Der Dakota steckte die vertraute Waffe in die Scheide.
Noch ehe die Angehörigen der Garnison am nächsten Morgen erwachten, standen die beiden Indianer am Flussufer und legten die Kleider ab, um sich zu baden. Einer der Posten bei den Pferden kam zu ihnen her. Es war ein älterer Mann mit einem dichten Vollbart.
»Lass das sein«, sagte er zu dem entlassenen Gefangenen. »Der Fluss ist eisig, und du bist krank. Willst du gleich krepieren, nachdem sie dich freigelassen haben? Komm rüber in das Blockhaus! Ich gebe dir warmes Wasser. Das geht keinen anderen dort was an!«
Der Häuptling beantwortete und beachtete die Warnung nicht, sondern sprang in den Fluss und schwamm.
»Hat man schon eine solche Unvernunft gesehen!« Der Vollbärtige schüttelte bedauernd den Kopf. »Die Wilden haben doch keinen Funken Verstand.«
»Die Dakota kennen das nicht anders«, erklärte Tobias dem Mann. »Sie nehmen zwar Dampfbäder; aber das Ende ist immer das Schwimmen im Fluss.«
»Das Ende, ja, richtig gesagt!« Der gutmütige Mann ging zu den Pferden zurück.
Tobias sprang dem Dakota nach in die seichten Fluten. Dann rieben sich beide am Ufer mit Sand ab. Der Körper des Dakota schauerte im Fieber, und sein Herz kämpfte, aber als er allen Schmutz, wo es nicht anders ging, samt der Haut abgeschürft hatte, fühlte er sich wie ein Mensch, der aus der Folter entlassen ist. Der Delaware gab dem Dakota neue indianische Leggings und Mokassins und ein Gürteltuch. Der junge Häuptling nahm das alles. Aber seinen Wampumgürtel und den blutbesudelten Festrock gab er nicht her, sondern legte beides wieder an.
Da die beiden Indianer unter sich waren, fragte der Dakota in seiner Muttersprache: »Wie konnte mein Name bis Washington dringen?«
»Der Maler Morris, den ihr Dakota Weitfliegender Vogel Geheimnisstab nennt, hat für dich gesprochen. Er war immer ein Freund der Dakota und wollte wenigstens dich retten, wenn er auch sonst nichts für euch zu tun vermag.«
»Was macht Cate Smith?«
»Sie hat vor zehn Tagen eine Gelegenheit gefunden, mit einer Händlerfamilie wegzureiten. Roach gab die Erlaubnis dazu; er war froh, das Mädchen nicht mehr zu sehen. Unterwegs wird Adams, der Rauhreiter, sie treffen und ihr weiterhelfen. Ich, denke, er nimmt sie zu seiner Frau.«
Als der Morgen hell und die Station lebendig wurde, hatten die Indianer ihren Ritt zur Reservation schon begonnen. Der schwarze Wolfshund lief mit ihnen. Tobias hatte die Richtung angegeben, aber der Dakota führte, um dem Falben den gewohnten ersten Platz in der Reihe zu gönnen. Wie gut kannten Reiter und Pferd das Gelände! Das waren die Wiesen und Sandstrecken, die Hügel und Bodenwellen, durch die der Kriegshäuptling der Bärenbande seine Männer mehr als zwei Jahre hindurch zu ihren erfolgreichen Angriffen auf die Truppe am Niobrara geführt hatte.
Der Delaware, dessen Schecke von selbst in der Spur des Vorreiters lief, schaute während des Rittes auf diesen Reiter und seinen falben Mustang. Er konnte nur den schwarzen Schopf des Dakota sehen, der im Wind trocknete, den blut- und schmutzgefärbten Rock, die magere muskulöse Hand, die hin und wieder den Falben zügelte, damit der Schecke nicht zurückbleiben musste. Was sollte aus diesem Mann werden? Was dachte er? Wie lange würde er es ertragen, auf der Reservation im Zelt zu sitzen und auf Rationen zu warten?
»Das allmächtige Geheimnis hat mich zu einem Indianer geschaffen, aber nicht zu einem Agentur-Indianer«, hatte Tatanka-yotanka in den Verhandlungen mit den Langmessern ihren Generalen geantwortet. Das war ein Wort, das auch für Tokei-ihto galt.
Als die Reiter ihre Pferde mittags kurz rasten ließen und der Dakota sich neben Tobias auf die Felldecke warf, sagte der Kundschafter, und er glaubte, dass er dies sagen müsse: »Wenn du fliehen willst, Tokei-ihto, ehe wir auf die Reservation gelangen, ich hindere dich nicht.«
»Glaubst du, dass ich aus der Reservation nicht mehr entfliehen könnte?«
Der Delaware versuchte, in den Augen des Dakota zu lesen. Es war irgendeine Kraft und eine Bestimmtheit darin, die er nicht deuten konnte. Daher sagte er nur: »Fliehen könnten viele. Aber sie wissen nicht wohin.«
»Wo stehen die Zelte meiner Brüder? Weißt du es?«
»Oben im Nordwesten der Reservation in den Bad Lands.«
»Also nahe der Reservationsgrenze nach den Black Hills zu?«
»Ja.«
Der Dakota schloss einen Moment die Augen. Nach dem, was er eben gehört hatte, wollte er nicht weiter fragen und auch nichts mehr gefragt werden.