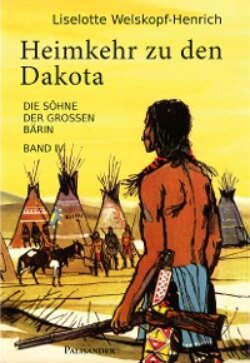Читать книгу Heimkehr zu den Dakota - Liselotte Welskopf-Henrich - Страница 6
Das Abschiedsfest
ОглавлениеEs war Morgen, und Joe Brown saß in seiner Barackenkammer. Diese Baracke war ein gutes Stück weiter westwärts aufgeschlagen als drei Jahre zuvor, und es führte schon ein Eisenbahngleis bis zu dem Baulager, zu dem die Baracke gehörte. Ein Materialzug wurde erwartet; er sollte in der bevorstehenden Nacht ankommen und am Tag darauf wieder zurückfahren.
Brown war allein in der Kammer, saß auf seinem Feldbett und rauchte schon die dritte Zigarre. Seine Arbeit hatte er abgeschlossen und alle Pläne und Berechnungen dem Nachfolger übergeben. Er hatte an diesem letzten Tag seines Aufenthaltes an der Präriestrecke der im Bau befindlichen Union Pacific nichts mehr zu tun. Am kommenden Tag wollte er mit dem Materialzug die bereits fertige Strecke nach Osten zurückfahren. Er hatte eine Berufung in die Zentrale der Bauleitung erhalten, um an maßgebender Stelle an dem Endspurt um die Fertigstellung der Bahn mitzuwirken. Es standen bis dahin sowohl technisch als auch organisatorisch noch sehr schwierige Aufgaben bevor. Die Bahnstrecke wurde gleichzeitig von Osten und von Westen her gebaut; in den Rocky Mountains sollten sich die Strecken treffen, und da sie an zwei verschiedene Baugesellschaften im Wettbewerb vergeben worden waren, nahmen das Tempo und die Rücksichtslosigkeit, mit denen gebaut wurde, zuweilen groteske Formen an. Joe Brown traute man die nötige Energie und auch die notwendige Erfahrung zu; man hatte sich seiner erinnert.
Joe studierte das Schreiben, mit dem er berufen wurde, noch einmal und steckte es weg. Er war nicht gewohnt, nichts zu tun zu haben; der eine einzige Tag der Untätigkeit wurde ihm bereits am Morgen zu viel. Seinen Nachfolger hatte er eingeführt, und wenn er auch gern gewusst hätte, ob dieser seine Obliegenheiten in Browns Sinne wahrnahm, so kam er sich bei dem Wunsch zu kontrollieren doch lächerlich vor. Er wusste nicht, was er mit den Stunden anfangen sollte, die für ihn nicht frei, sondern nur leer waren. Henry war nicht verfügbar. Er bereitete die Abschiedsfeier vor, die am Abend für Joe Brown stattfinden sollte. Der Leiter des Lagers, Taylor, war beschäftigt. Die Ingenieure hatten alle zu tun. Die Kundschafter waren auf der Strecke unterwegs, um den erwarteten Materialzug gegen etwaige Angriffe der Indianer zu sichern. Alle machten sich nützlich, nur Joe Brown saß in seiner Kammer und rauchte. Er kam sich vor wie ein Gefangener, der nicht arbeiten durfte. Durch die unablässige Anspannung der letzten Jahre waren seine Nerven überreizt. Er wäre imstande gewesen, sich schon am frühen Morgen zu betrinken, wenn ihm nur jemand Branntwein gebracht hätte. Aber Daisy, die Kellnerin, schien ihn auch schon vergessen zu haben. Er reiste morgen ab, und sie musste sich künftig die Trinkgelder anderer zahlungskräftiger Kunden sichern.
Joe Brown spuckte aus. Er spuckte ohne Bedenken auf den Boden, denn er brauchte ja nur noch eine Nacht in dieser Kammer zu schlafen! Falsch; er brauchte überhaupt nicht mehr in dieser Kammer zu schlafen, die kommende Nacht wurde durchgefeiert. Und dann stieg er mit Henry in den Zug, der ostwärts fuhr ... zu der Stadt, und in der Stadt war ein Büro mit Vorgesetzten, die noch nie den Wilden Westen gesehen hatten ... und in der Stadt wohnte die Familie, die Joe kaum mehr kannte ...
Brown spuckte noch einmal, machte dann das Fenster auf und schaute hinaus. Es war windig und staubig draußen, und er wusste, dass er in der Stadt diesen Wind und diesen Staub der Prärie vermissen würde.
Nun hatte Daisy ihn doch erspäht und seinen Wunsch erraten. Ihr Gesicht war am Fenster der Küche erschienen, und gleich darauf kam sie mit einer Flasche Whisky zu dem Fenster von Browns Kammer. Sie war sehr jung, hatte eine fettige Haut, und ihr Haar war lange nicht gewaschen, aber ihre Augen waren lustig und ihre Nase kurz und keck.
»Jetzt schon trinken?«, fragte sie, als sie dem Ingenieur die Flasche gab und das Geldstück dafür einkassierte, nicht ohne einen Blick darauf geworfen und festgestellt zu haben, dass Joe heute freigebig war.
»Abschiedsschmerz, Daisy.«
»Ich heiße nicht Daisy. Für dich schon gar nicht. Vicky heiße ich.«
»Vicky passt nicht zu dir. Daisy ... der Whisky tötet den Abschiedsschmerz. Hol dir auch einen Becher!«
»Das Trinken gewöhne ich mir noch nicht an, das ist was für die alten Herren. Ich kenne noch keinen Abschiedsschmerz und brauche keinen Brandy, um ihn wegzuspülen.«
»Als ich so jung war wie du, war ich auch so frech. Die Jahre gehen hin.«
»Wenn du heute Abend auch solche Trauerlieder singst, wird’s aber langweilig!«
Joe trank aus der Flasche. »Heut’ Abend kommt’s doch nicht auf mich an. Das ist nur eine Gelegenheit, damit sie alle saufen können!«
»Wenn’s dabei bleibt, ist es ja gut.«
»Wieso soll es nicht ... was willst du damit überhaupt sagen?«
»Ich habe die letzte Messerstecherei noch nicht vergessen. Blut, das mag ich nicht sehen. Es wird mir schlecht dabei. Wenn ich nur daran denke, wie der Mackie gebrüllt hat, als ihm die Klinge überm Ohr saß wie dem Schreiber der Bleistift ..., ich könnte gleich noch mal speien.«
»So zarte Saiten auf deiner Geige? Willst du morgen mitkommen in die Stadt?«
»Aber nie und nimmer. Der Mackie ...«
»Ach so. – Aber ich glaube auch nicht, dass es heute wieder so heiß hergehen wird. Wir fangen erst um Mitternacht zu trinken an, nachdem der Zug angekommen ist. Bis dahin müssen wir alle nüchtern bleiben. Von Mitternacht dann bis zum Morgen – hat sich ein richtiger Grenzer noch nicht mal warm gesoffen! Und die Sache mit der langen Lilly ist entschieden, Hahnenkampf-Bill hat allein ein Anrecht auf sie.«
»Hoffen wir’s, dass es dabei bleibt. Also bis Mitternacht!« Daisy-Vicky kicherte schnippisch und lief zur Küche zurück.
Joe Brown nahm noch ein paar Schlucke Whisky und erging sich dann im Freien. Er konnte nicht den ganzen Tag in der Bude sitzen.
Als er lange beim Gleis stand und über die Strecke, die schon gebaut war, ostwärts zurückschaute, hörte er Hufschläge, und bald darauf tauchten Reiter auf, allen voran Jim, hinter ihm noch drei Mann, unter denen Joe den Hahnenkampf-Bill und einen kleinen, auch von weitem schon in seiner Kleidung schmierig wirkenden Mann erkannte. Die Reiter hatten ihre Pferde abgetrieben. Sie kreuzten das Gleis und ritten zum Stationslager, wobei sie unmittelbar an Joe vorbeikommen mussten. Sie ließen die Tiere in Schritt fallen, und da Jim bei Joe Brown haltmachte, hielten alle an.
»Morgen«, grüßte Red Jim. »Schon aufgestanden, der künftige Herr Chefingenieur der Union Pacific?«
»Aufgestanden«, antwortete Joe. Er ging dabei auf Jims Ton ein. »Aber ganz überflüssigerweise! Die Schwellen unter dem Gleis, die Grashalme auf der Prärie oder die Bretter in der Bude zählen – kommt letzten Endes auf eins hinaus.«
»Möcht ich auch mal sagen können, dass ich nicht zu arbeiten brauche. Aber du wirst sehen, es gibt wieder eine große Schweinerei. Ein Haufen versteckter Fährten ...«
»Wollen die Dakota an meiner Abschiedsfeier teilnehmen?!«
Jim lachte kurz auf, gekünstelt, ohne Übergang; es war mehr wie ein Hohnschrei. »Könnte sein! Die Dakota denken vielleicht, sie gehören wirklich dazu, und es fehlt dir etwas, wenn sie nicht kommen. Hast du nicht wieder mal Lust auf ein Fischgericht im Dakotaland?«
»Bleib mir drei Schritt vom Leibe mit solchen Witzen.«
»Auf Wiedersehen um Mitternacht! Hoffentlich nicht früher. Ich habe Lust, gründlich und lange zu schlafen. Wenn der Zug nur erst da wäre! Dann wird mir leichter zumute sein.« Jim trieb sein Pferd wieder an, die anderen folgten ihm, und Joe blieb allein beim Gleis zurück.
Jeder Indianerüberfall bedeutete nicht nur Gefahr, sondern auch Verzögerung. Es durfte aber nicht eine Stunde verloren werden, sonst hatte die Konkurrenz ihre Strecke eines Tages früher fertig, und der ausgesetzte Preis ging der Gesellschaft, für die Joe arbeitete, verloren. Joe strengte Augen und Ohren unwillkürlich schärfer an, obgleich das zur gegenwärtigen Tageszeit völlig unnütz war.
Als Red Jim auf dem Hauptplatz des Zelt- und Barackendorfes angelangt war, sprang er ab und verabschiedete zwei Mann. Diesen beiden gab er sein Pferd sowie das des Hahnenkampf-Bill mit. Bill bedeutete er mit einem Blick, er möge ihn begleiten.
Red Jim bewohnte eine Kammer für sich allein. Niemand wusste, wie er zustande gebracht hatte, was nicht einmal die Ingenieure oder der Leiter des Stationslagers erreichen konnten, aber es gab auch niemanden, der sein Vorrecht antastete. Die Kammer war winzig klein, doch hatte Jim sich sogar Doppelwände eingebaut. Wozu diese dienen sollten, wusste auch niemand. Wenn ihn je einer danach fragte, behauptete Red Jim, des Nachts so heftig zu träumen, dass er eine einfache Wand leicht einmal einschlagen könne.
Die Tür zu Jims Kammer war verschließbar. Jim schloss auf. Das Fenster war mit einem Nesseltuch verhängt, das undurchsichtig war, aber für den Inhaber der Kammer Licht genug hereinließ. Der bartlose rothaarige Scout ließ Bloody Bill zuerst eintreten, während er selbst die Tür noch in der Hand behielt. »Setz dich schon hin«, sagte er, »ich bringe noch einen.«
Bill ließ sich auf das Bett nieder.
»Wen bringst du?«, wollte er wissen. »Einen Drink?«
»Nein, du Whiskyfass. Den Charlemagne.«
»Was? Wen?«
»Du hast schon recht gehört. Er ist gestern eingetroffen.«
»Und ich ...«
»Und du, sein bester Freund, musst das erst durch mich erfahren! So ist das Leben. Also, einen Moment!« Jim verschwand.
Bill knurrte und steckte sich eine Pfeife an. Er war eine Nacht und einen Tag auf Kundschafterdienst gewesen und müde wie ein Hund. Wenn er schon nicht schlafen sollte, wollte er wenigstens trinken. Hoffentlich hegte Charlemagne den gleichen Wunsch! Das Wiedersehen nach so langer Zeit musste begossen werden.
Jim kam bald mit dem Erwarteten zurück und hieß ihn, sich zu Bill zu setzen. Dann holte er Fleisch und Branntwein unter seinem Bett hervor und teilte aus.
Als die drei geschmaust und getrunken hatten, fragte Bill seinen ehemaligen Kundschafterkollegen Charlemagne: »Wo kommst du denn auf einmal wieder her? Verschwindest plötzlich und tauchst wieder auf, kein Mensch weiß, wieso und warum! Sonderbare Figur bist du.«
»Im Norden wurde mir’s doch zu langweilig. Ich hatte auch Sehnsucht nach dir.«
»Du denkst wohl, ich glaube dir alle Lügen. Meinst du, ich habe nicht gesehen, wie dich der zahnlose Ben, dieser Gauner, damals ausstaffiert hat? Das hat er doch nicht umsonst getan! Pferd, Büchse, Revolver, Kleider – und du konntest ihm nicht einen Cent dafür bezahlen!«
Red Jim grinste, überlegen, aber auch misstrauisch. »Charlie«, mischte er sich ein. »Was muss ich da hören? Ben hat dir mehr gegeben, als ich für dich bestellt hatte! Du hast versucht, Privatgeschäfte zu machen, mein Lieber. Dabei hast du die größte Dummheit deines Lebens begangen.«
Charlemagne war es ungemütlich zwischen seinen beiden Partnern. Als sie anfingen, alte Geschichten aufzuwärmen, wünschte er sie alle beide in das Land, wo der Pfeffer wächst. Aber nachdem er sich wieder in den Süden gewagt hatte, musste er auch die alten Freunde wieder in Kauf nehmen; es half nichts. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, sagte er zu Jim.
»Dann will ich dir das erklären. Du bist’s, der uns den Harry auf den Hals gehetzt hat. Wie konntest du denn nur auf den Gedanken kommen, den verdammten rothäutigen Bengel wieder von den Blackfeet wegzuekeln?! Ich hatte Vater und Sohn fein säuberlich getrennt – Top hier, Harry dort –, du flickst sie wieder zusammen. Etwas noch Dümmeres konntest du wirklich nicht machen! Du hast dir wohl eingebildet, du könntest dir den Harry angeln, so wie ich mir den Top?«
»Was? Ich hab doch nie ...«
»Jetzt hör aber auf! Ich kenne die ganze Geschichte. Ich bin Tops Freund, vergiss das nicht! Und wenn du deines Lebens hier froh werden willst, Charlie mit dem Knebelbart, so versuche kein einziges Mal mehr, mir was vorzuflunkern. Mir nicht! Den Harry haben wir jedenfalls jetzt hier; wie ’ne Klette hängt er an seinem Alten und macht uns das Leben sauer. Irgend etwas muss geschehen, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Fünf Jahre ...«
»Was, fünf Jahre?«
»Seit fünf Jahren wird an dieser Bahn hier herumgemessen und herumgebaut«, wich Jim aus. »Nächstes Jahr ist sie fertig. Dann kommt der große Strom ... Vorher müssen wir unser Schäfchen im Trockenen haben. Sonst können wir packen und gehen.«
»Was für’n Schäfchen denn?«
»Wenn ihr beide nicht so verdammt unzuverlässig wäret, könnte ich deutlicher werden. Ich sage euch nur so viel: Mit Top allein ließe sich jetzt was machen. Aber der Junge muss weg!«
Charlemagne und Bill, die rechts und links von Jim saßen, schauten den Mann in ihrer Mitte aus den linken beziehungsweise rechten Augenwinkeln an.
»Aha!«, sagte Bill.
»Aha!«, sagte Charles. »Also weiß der Top doch was. Aber warum hast du dir das Gold noch nicht allein geholt? Hattest doch fünf Jahre Zeit, und Top ist dein Freund!«
»Du redest, wie du’s verstehst. Ich hab mir das selber angesehen. Top muss die Spinnfäden seiner dummen indianischen Ehrbegriffe zerreißen und mitmachen, sonst wird es nichts, und der Junge muss vorher aus dem Weg, denn er hasst mich und wird nie eine Silbe verraten. So viel steht fest.«
»Dann mach den Jungen kalt! Sollte dir doch nicht schwerfallen.« Das war Bills Meinung.
»Hab dem Top versprechen müssen, dass ich seinen Jungen nicht anrühre.«
»Du hast in deinem Leben auch noch immer Wort gehalten, was? Red Jim, der Gentleman!«
»Strenge doch den Rest deines Gehirns an, der noch nicht von Brandy überschwemmt ist! Wenn ich den Jungen umbringe, hab ich bei dem Alten verspielt. So geht es nicht, wie du dir das in deinem Hahnenkämpfergemüt vorstellst. Wir brauchen den Top! Ihn allein! Und ihn als Freund.«
»Du musst es wissen. Was gibst du aus, wenn wir den Jungen ohne Aufsehen beiseite räumen?«
»Ihr zwei allein bringt das nicht zustande.«
»Oho! Den bezopften Bengel – siebzehn Jahre, das ganze Bürschchen ..., den wird’ ich mit der linken Hand erledigen!«
»Unterschätze diesen jungen Indsman nicht, Hahnenkämpfer. Aber davon ganz abgesehen, er ist nicht allein, und deshalb schaffst auch du es nicht allein.«
»Er ist ja nicht immer mit dem Vater zusammen.«
»Aber er ist ein ganz raffinierter Bandenchef geworden, der Harry. Sonst wäre die Sache schon längst erledigt, das kannst du mir glauben.«
»Der? Bandenchef? Davon müsst ich ja mindestens auch was gemerkt haben.«
»Was du da sagst, beweist nur, dass der Harry klüger ist als du. Er arbeitet wie ein echter Indsman. Wie man einen Bund aufzieht, ohne dass einer was davon merkt, das verstehen sie. So an ein Dutzend Männer, die dem Harry auf einen Pfiff beistehen, hab ich schon herausgefunden. Es müssen aber noch mehr sein. Und unter uns gibt es irgendein Klatschweib – denn was ich mir auch vornehme, ein paar Stunden später weiß es Harry unter Garantie. Also haltet ihr beide wenigstens den Mund! Denn mit dem Messer ist er verdammt schnell, und seine Augen hat er überall.«
»Hm!«, knurrte Bill.
»Hm!«, brummte Charles.
»Was soll also werden?«, fragte Bill. »Wozu erzählst du uns den ganzen Roman?«
»Heute Nacht, die Abschiedsfeier von Joe, das wäre so eine Gelegenheit. Ich kann noch nicht genau sagen wie, aber ...«
»Nein.« Bill war nicht einverstanden. »Doch nicht öffentlich!«
»Nur öffentlich. Bei einer Rauferei muss es passieren.«
»Er kommt aber nicht zum Trinken. Wie willst du ihn herschaffen?«
»Das ist Joes Sache. Zur Abschiedsfeier! So unhöflich kann selbst ein Harry nicht sein, ganz davon wegzubleiben.«
»Darf Joe etwas wissen?«
»Nein! Nie und nimmer!«
»Schon faul. Aber nehmen wir an, Harry kommt. Der Vater ist auch da!«
»Es muss um eine Sache gehen, bei der der Vater begreift, dass wir uns mit Harry auseinanderzusetzen haben.«
»Die finde mal!«
»Ganz einfach.«
»So?!«
»Ja. Du wirst nie lernen, Bill, einen Indsman zu beobachten. Top ist vernarrt in seinen Jungen, aber gerade darum gibt es einen Punkt ..., einen Punkt, wenn daran gerührt wird, fängt der Alte an zu rasen.«
»Und der ist?«
»Er misstraut Harry. ’ne alte dumme Geschichte ist das, Top hat mir davon erzählt. Als es gegen die Bärenbande ging, die das Wasser und damit eine ganze Expeditionsgruppe von uns vergiftet hatte, wurde der Junge unzuverlässig und wollte seine Schwester oder seine Mutter warnen. Top und Harry stammen doch aus den Zelten der ›Bärensöhne‹– Top kann niemals mehr zurück; er ist verbannt, weil er mein Freund wurde. Er hat aber Angst, dass Harry ihn verlässt und wieder heimfindet ...«
»Und uns verkauft und verrät? Genau das habe ich mir schon lange gedacht!«
»Sobald der Verdacht ausgesprochen wird, leuchtet er jedermann ein.«
»Aber wer spricht ihn aus?«, fragte Charlemagne.
»Keiner von uns!«, rief Bill.
»Nein, keiner von uns«, stimmte Jim zu. »Irgendein harmloses Gemüt.«
»Der Mackie?«, schlug Bill vor.
»Wenn er nicht ängstlich geworden ist«, bedachte Jim. »Dein Messer hinterm Ohr, Hahnenkämpfer, stand ihm nicht gut.«
»Aber darum hält er mich für stark. Dumm ist er auch.«
»Ja, dumm ist er. Man braucht ihn nicht viel wissen zu lassen. Nur eben so viel, dass er im Suff behauptet, der Harry habe heimliche Verbindung mit der Bärenbande ...«
»Hm! Nicht schlecht. Schätze, dass das sogar die Wahrheit ist. Eine Frage nebenbei: Warum hast du denn Joe solche Greuel von versteckten Spuren erzählt? Wir haben doch nichts gefunden, gar nichts! Nicht das geringste!«
»Die Spuren sind eben versteckt.«
»Quatsch nicht. Was hast du für einen Zweck verfolgt?«
»Begreifst du das noch nicht?«
»Ach so. Es dämmert.«
»Selbst bei dir!«
»Wie wird Harry reagieren, wenn Mackie ihm Verrat vorwirft?«
»Das trifft die Stelle, an der Harry empfindlich ist. Also reagiert er sofort mit der Kugel – oder mit dem Messer – je nach der Situation. Wir treten dann für den ermordeten Mackie ein.«
»Das heißt, wir müssen zu mehreren sein und Harry schon vorher isolieren.«
»Das ist das wichtigste. Sobald wir ihn erledigt haben, werden sich seine Freunde nicht weiter rühren. Denn sie halten nur zu ihm, weil sie ihre Vorteile dabei haben, denke ich. Ein Toter aber hat nichts mehr zu vergeben.«
»Du kennst nicht alle seine Freunde.«
»Nein, aber wir kennen uns untereinander. Acht oder zehn Mann unmittelbar zur Hand, das genügt.«
»Und wenn er doch lebend davonkommt?«
»Lassen wir ihn als Totschläger festnehmen und schicken ihn morgen mit dem Zug zurück, vor die Gerichte. Mit Indsmen wird da nicht viel Federlesens gemacht, und im Gefängnis wird ein Indianer keine zwei Jahre älter.«
Bill schüttete noch einen Brandy hinunter.
»Das ist aber der letzte«, sagte Jim. »Sonst erzählst du zu viel.«
»Der letzte vor Mitternacht, so wahr ich sechsundzwanzig Hahnenkämpfe bestanden habe! Vielleicht kommt heute noch der siebenundzwanzigste dazu!«
»Es wird Zeit! Du hast schon weidlich lange Pause gemacht. Aber jetzt ist genug geredet. Ihr wisst Bescheid.«
Jim warf seine beiden Gäste hinaus, zog die Stiefel aus, weil er die Füße auslüften wollte, und legte sich auf das Bett.
Während Red Jim einschlief, führte Bloody Bill seinen Komplizen Charlemagne in das riesige Proviantzelt, in dem Fässer und Kisten gestapelt waren. In einer freien Ecke hatte Bill hier mit zwei Mann sein Quartier aufgeschlagen. Die Ecke war mit Fässern und Kisten gegen Zudringliche abgegrenzt. Decken, Brandyflaschen, Bierkrüge, Fleischtöpfe, alles war hier zusammengetragen.
»Euer Hamsterloch!« Charles grinste.
»Unsere Fuchshöhle. Ich schlaf jetzt ein paar Stunden. Und du?«
»Bin noch nicht eingeteilt. Was kann man hierzulande mit ein paar Stunden anfangen?«
»Leiste doch dem Joe Gesellschaft. Hast du ihn schon begrüßt?«
»Nein. Er ist mir heute noch nicht über den Weg gelaufen.«
»Dann mach das. Er hat immer Zigarren.«
»Wär’n Gedanke. Guten Schlaf!«
Charlemagne besichtigte das Proviantzelt noch etwas genauer und bummelte quer durch das geschäftige Treiben des Lagers. Von weitem schon sah er Joe, der immer noch beim Gleis stand. Der Wind hatte um die Mittagszeit nachgelassen, der Staub hatte sich gelegt. Der Himmel war aber nicht klar. Diesige Luft hatte sich verbreitet, und die Kette des Felsengebirges am Horizont glich eher einem Nebelstreifen als festgefügtem Fels.
Der Lange mit dem Knebelbart stand schon fast eine Minute neben dem Ingenieur, als dieser ihn endlich bemerkte. Joe Brown hatte sich ganz in seine Gedanken verloren gehabt.
»Ach ... du bist das!«, sagte er nur und maß Charles, nicht eben freundlich, auch nicht ablehnend. Charlemagne war dem Ingenieur als Mensch völlig gleichgültig, aber er war eine der Figuren in einem gefährlichen Spiel gewesen, dessen Erfolg jetzt greifbar nahe bevorstand, und in dieser Erinnerung begrüßte Joe den Kundschafter, wie ein Stück Möbel etwa, das man einmal benutzt hat und das sich aus einer Rumpelkammer plötzlich wieder anfindet.
»Muss doch auch sehen, wie das hier zu Ende kommt, was wir zusammen angefangen haben.« Charlemagne tat vertraulich.
Joe Brown war das zuwider, aber er spendierte die erwartete Zigarre. »Ja, ja«, sagte er dabei zerstreut. »Hoffentlich sind wir im letzten Jahr noch schnell genug.«
»Ihr geht morgen schon wieder fort?«
»Mit dem Zug.«
»Heute Nacht wird doch Abschied gefeiert?«, erkundigte sich Charles, obgleich er Bescheid wusste.
»Du bist natürlich auch eingeladen, Charlemagne.«
»Wir vier müssten eigentlich beieinandersitzen: Ihr und Henry und Bill und ich – nicht gerade nackend wie damals, aber doch als die vier ... nun eben die vier ...«
»Die das Giftwasser nicht getrunken hatten, ja. Komm nur mit an unseren Tisch! Top, der uns vier dann gefunden hat, sollte auch dabei sein.«
»Habe sagen hören, Tops Junge ist wieder zu ihm gekommen?«
»Schon lange wieder bei ihm. Den holen wir uns auch. Noch einmal die alten Zeiten feiern!«
»Wenn sie auch nicht gut waren.«
Joe lächelte gezwungen.
Über die Prärie kamen wieder Reiter im Galopp herbei, eine zweite Kundschaftergruppe, die von einem jungen Indianer geführt wurde. Charlemagne musterte den Burschen. Er erkannte ihn erst kaum wieder. Harry war nicht nur größer geworden. Die letzten vier Jahre hatten ihn überhaupt verändert.
Joe rief den Indianer an, der daraufhin auf seinem Grauschimmel zu dem Ingenieur heranritt, während seine Begleiter sich von ihm trennten und gleich den Zelten und Bretterbuden zustrebten.
Wenn Charlemagne erwartet hatte, von Harry begrüßt zu werden, so sah er sich getäuscht. Der junge Indianer schaute nur Joe an, in Erwartung irgendeiner Bemerkung oder Frage des Chefs, und auch dem Ingenieur gegenüber verriet sich in seinen Zügen keine besondere Spannung oder Aufmerksamkeit.
»Ich gehe morgen, das weißt du, Harry«, sagte Joe. »Sobald heute Nacht der Zug da ist, feiern wir Abschied. Dein Vater und du, ihr seid auch meine Gäste.«
»Die Nacht über bin ich wieder auf Kundschaft.«
»Habt ihr die verdächtigen Spuren enträtselt?«
Der Indianer beantwortete die Frage nicht gleich, und durch dieses kurze Schweigen drückte er seine Überraschung aus. »Ich habe keine verdächtigen Spuren gesehen«, sagte er schließlich.
Es war nun an Joe, überrascht zu sein. Auch er wartete einen Augenblick, bis er antwortete: »Umso besser. Dann mache dich doch heute Nacht wenigstens für ein paar Stunden frei. Ich erwarte dich.«
»Ich komme, wenn es möglich ist.« Der junge indianische Scout ritt weiter.
Joe und Charlemagne schauten ihm nach. »Ihr müsst mit seinem Alten reden«, riet Charles. »Der bringt ihn mit.«
Joe Brown machte eine abwehrende Handbewegung gegen den aufdringlich erscheinenden Vorschlag. Er war selbst im Stationslager oberste Instanz für den Kundschafterdienst, da er Prärieerfahrung besaß, und er wollte die Kräfte so einteilen, dass er die alten Präriehasen für zwei oder drei Stunden um sich versammeln konnte.
»Komisch«, murmelte er nur noch. »Der eine phantasiert von ganz großer Schweinerei, die zu befürchten steht, und der andere will überhaupt nichts gesehen haben.«
»Sonderbar ist es wirklich«, bekräftigte Charles.
Joe wollte Charlemagne loswerden. Er verließ daher seinen Standplatz am Gleis und ging zunächst wieder zurück auf seine Kammer. Dort fand er Henry vor.
Der junge Ingenieur war voller Lebendigkeit und Erwartung. »Heute Nacht wird es großartig, Joe! Habe den Geiger abgesetzt, der sein Instrument immer wie mit einer Kratzbürste behandelte. Bei den Ballen und Säcken hab ich einen Zigeuner gefunden – Joe, das ist klasse! Der wird spielen! Gekocht wird jetzt schon. Der Leitende rechnet einen Teil der Unkosten auf Spesen. Und morgen geht es endlich weg aus dieser traurigen Grassteppe hier. Wie ich mich freue!«
Joe lächelte so freundlich, wie er es mit seinem ledernen Gesicht noch vermochte. »Hauptsache, es freut sich einer, und wir schaffen es dann mit unserer Strecke. Der Preis nächstes Jahr muss uns gehören!«
»Muss er, Joe. Und nun entschuldige mich! Ich hab eine Menge zu tun. Nur eins noch rasch: Wen willst du an unserem Tisch haben?«
»Von den Respektspersonen, was sich nicht vermeiden lässt. Auf alle Fälle auch die alten Prärieläufer, die noch wissen, wie es uns mal erging.«
»Das heißt ... Hm! Weißt du ..., der Hahnenkampf-Bill ist nicht gerade die Figur, die ich mir am Tisch wünsche. Tom ist nicht mehr da ...«
»Auch wahr. Rück zwei Tische nebeneinander. Wir und die Respektspersonen sitzen zusammen, am nächsten Tisch die alten Rowdies.«
»Top auch?«
»Top und Harry.«
»Harry wird wieder nein sagen. Er kann die Weißen nicht leiden.«
»Dieser Querkopf, der mir einmal das Leben gerettet hat ...«
»Der – dir ...?«
»Alte dumme Geschichte.« Joe wusste nicht, dass er die gleichen Worte gebrauchte wie kurz zuvor Red Jim. Er zögerte etwas und entschloss sich dann weiterzusprechen. »Damals bei der Strafexpedition gegen die Bärenbande ist’s geschehen. Harrys jüngerer Bruder, der noch in den Zelten lebte, ein halbes Kind, ging mit dem Messer auf mich los. Ich war darauf nicht gefasst, aber Harry stieß ihn im letzten Augenblick nieder. Vielleicht haben ihn die Augen des Vaters dazu gezwungen. – Lassen wir das!« Joe, der das Unverständnis und das Misstrauen im Gesichtsausdruck des jungen Henry bemerkt haben mochte, brach ab. »Harry soll heute Abend kommen«, bestimmte er nur noch. »Sag ihm einen schönen Gruß von mir, und die Feier gehört zum Dienst.«
»Gut, dann weiß ich Bescheid.« Henry zog mit verwirrten Empfindungen ab, und zur Beruhigung versah er sich dabei noch mit einer Zigarre aus Joes Vorrat.
Schnellen Schrittes ging Henry zunächst noch einmal in die Küchenbaracke. Ein selbstbewusster Koch regierte hier die Kessel und die Küchenfrauen, unter denen sich auch drei Negerinnen und eine alte Indianerin befanden. Henry begegnete Charlemagne, der eines der weißen Küchenmädchen angesprochen hatte und trotz der hinausweisenden Blicke des Kochs zähe die Unterhaltung fortzusetzen trachtete.
»Also gut!«, rief das Mädchen schließlich, »aber jetzt mache, dass du hinauskommst!«
Charlemagne zwirbelte befriedigt seinen Knebelbart, nickte Henry wie einem alten Bekannten zu und stolzierte ab.
Henry ließ sich vom Koch noch einmal bestätigen, dass dieser von der Lagerverwaltung alles Gewünschte erhielt, und verließ wieder die Küchenbaracke, um am Rande des Stationslagers das Indianerzelt aufzusuchen, das Top und Harry als Behausung diente.
Henry schlüpfte durch den Zelteingang hinein. Er traf Harka an, der sich offenbar auf seiner Büffelhautdecke ausgestreckt gehabt hatte, jetzt aber den Hereinkommenden schon wieder stehend begrüßte. Henry, fünfundzwanzig Jahre alt, war um einen Kopf kleiner als der lang gewachsene siebzehnjährige Indianer. Der junge Ingenieur hatte sich sonst nicht mehr viel um den Kundschafter gekümmert. Er hatte ihm hin und wieder ein Buch verschafft, wenn Harry sich im Lesen üben wollte, und er hatte ihm Landkarten besorgt im Austausch gegen Felle. Aber das waren äußerliche, versachlichte Beziehungen geblieben. Jetzt, am letzten Tag, den Henry in der Prärie verbrachte, schaute er den Indianer etwas aufmerksamer an. Das Gesicht dieses Burschen war nicht das eines jungen Menschen. Die gut ausgebildete Stirn, die gebogene Nase und die gesamte Knochenbildung traten überdeutlich hervor, da das Gesicht mager war. Die Augenlider blieben immer gesenkt bis auf einen schmalen Spalt, der dem Sehvermögen, aber keinem Ausdruck Raum gab. Henry fühlte sich diesem jungen Mann gegenüber fremd. Die ungeklärten Vorstellungen und Gerüchte, »bester Kundschafter« oder »Verräter«, »Lebensretter« und »Brudermörder«, konnte der Jungingenieur in seine mehr oberflächliche als tiefe Denkweise und in seine plätschernden Gefühle nicht einordnen; er fand keinen Kontakt zu Harry.
»Joe Brown lädt dich und deinen Vater zu der Abschiedsfeier heute Nacht ein. Diese Feier gilt als Dienst«, sagte er in etwas schnoddrigem Ton.
Der Indianer ging auf diesen Ton nicht ein. Er sprach kurz und gemessen: »Im Dienst trinke ich nicht. Ich trinke überhaupt nicht. Es wird also Ärger geben, wenn ich komme, aber wenn Joe Brown es so haben will, werde ich da sein – falls auch mein Vater es wünscht.«
»Wann kommt denn Top zurück?«
»Abends.«
»Gut! Wir erwarten euch, sobald der Zug glücklich eingelaufen ist.«
Henry ging lieber wieder hinaus, als er hereingekommen war. Er hatte nicht nur wenig Sympathie für Harry. Er hatte auch im Hintergrund des Zeltes ein Wesen sitzen sehen, vor dem ihm graute. Es schien eine Indianerin zu sein. Vielleicht war sie alt, vielleicht war sie noch jung. Ihr Gesicht wirkte weder menschlich noch unmenschlich; es wirkte außermenschlich. Ohren und Nase waren ihr abgeschnitten, die alten Wunden waren ungepflegt vernarbt. Ihre Wangen waren eingefallen, ihre Hände waren mager. Sie saß im Hintergrund wie eine Holzfigur, mit schwarzem Baumwolltuch verhängt. Der Ingenieur schüttelte sich unwillkürlich, als er das Zelt verlassen hatte.
Harry hatte ihn auch nicht ungern verschwinden sehen. Der junge Indianer legte sich nicht wieder hin, sondern hockte sich auf seine Büffelhautdecke und überlegte.
Als er mit sich ins Reine gekommen war, verließ er das Zelt und ging zum »Basar«. Der »Basar« war ein einfacher Verkaufsstand, der in einer Baracke mit einem Schiebefenster eingerichtet war. Die Waren wurden in Kommission und sehr teuer verkauft. Da es keinen anderen Laden gab, drängten sich trotzdem die Kunden. Harry wartete mit gleichgültiger Geduld, bis alle, auch solche, die nach ihm kamen, bedient waren, verlangte dann das Quantum Pfeifentabak, das er stets zu kaufen pflegte, und zahlte mit kleiner Münze, die er einem indianisch gestickten Lederbeutel entnahm. Der Geldbeutel war auf der Innenseite zur Hälfte grün, zur Hälfte rot gefärbt.
Der Indianer hielt den geöffneten Beutel so, dass die Verkäuferin die grüne Seite sehen musste. Das war eine stumme Frage, und die Verkäuferin, ein Indianermischling, jung, schwarzhaarig, braunhäutig, zeigte die Kette ihrer weißen Zähne, lachte und sagte im Dakotadialekt: »Die Großmutter hält die Ohren offen. Abends geht sie mit ihrem Enkel Wasser holen.«
»Eh, klappt das Stelldichein?«
Harry hörte diese Frage hinter sich und erkannte auch sofort die Stimme. Das war Mackie.
»Warum? Wolltest du das Mädchen haben?«, fragte er zurück.
»Nein, nein, habe mit Mestizen nichts im Sinn. Freut mich nur; dass du endlich irgendwo anbeißt.«
Der junge Indianer lächelte ironisch, aber so, dass der andere es nicht sah, und ging.
Er brachte den Tabak ins Zelt, gab ihn der verstümmelten Indianerin zum Aufbewahren, rauchte eine Pfeife und legte sich dann wieder schlafen. Bis zum Abend war noch lange Zeit.
Als er wieder erwachte und es schon dunkelte, kümmerte er sich um sein Pferd, das vor dem Zelt angepflockt war. Er machte es los und ritt weit vor das Lager bis zu einem Bach, der noch etwas Wasser führte. Er kam nicht ganz hinaus aus dem Bereich der Gerüche und Geräusche des Lagers, aber das Gewirr von Stimmen, das Klappern aus Küche und Vorratszelten, der Geruch aus großen Kesseln mit Einheitsessen, der Gestank von ungewaschenen Kleidern und Menschenkörpern kamen doch nur noch schwach, mit ihren Ausläufern, zu den Wiesen und dem Ufer des Baches, an dem Harry jetzt sein Pferd saufen ließ. Der Abendwind wehte; im Westen lag noch ein heller Streifen über den ins Violette dunkelnden Bergen. Die ersten Sterne flimmerten an dem Himmel auf, den die Sonne verlassen hatte.
Die Großmutter, von der das Mestizenmädchen gesprochen hatte, war gekommen.
Harry beobachtete unauffällig diese Indianerfrau, eine dick gewordene alte Frau, die tagsüber in der Küche arbeitete und auf diese Weise sich und ihr Enkelkind versorgte. Sie hatte das Kind mitgebracht, ein Mädchen von vier Jahren. Während das Kind sich im seichten Wasser puddelte, sprach die Alte in der Zeichensprache, aber nicht mit dem Kind, wie jeder nicht eingeweihte Beobachter geglaubt haben würde, sondern zu Harry, den sie mit seinem indianischen Namen Harka ansprach. Sie ließ ihn wissen, dass Charlemagne ein junges Küchenmädchen mit weißer Haut zur Abschiedsfeier eingeladen und dass er angedeutet hatte, es werde bei der Feier viel zu essen und zu trinken geben und auch sonst hoch hergehen, und aus einigen Wendungen hatte die Alte geschlossen, dass die Männer etwas Böses gegen irgend jemand planten. Der junge Indianer spähte umher, und als er sich überzeugt hatte, dass er nicht beobachtet wurde, antwortete er, auch in der Zeichensprache: »Der blonde Bart soll mit allen unseren Brüdern kommen.«
Die Alte verstand. Während Harka mit seinem Pferd noch am Bach blieb, rief sie das Kind, hieß es, sich wieder anzuziehen, und ging zum Lager zurück. Sie bewohnte mit den Negerinnen zusammen einen Gemeinschaftsraum neben der Küche. Dorthin brachte sie die Enkelin. Dann holte sie aus der alten Kiste, die sie sich als Aufbewahrungsort für ihre Habseligkeiten verschafft hatte, einen leinenen Mannskittel hervor, den sie geflickt hatte, und ging damit hinüber in die Schreibstube, in der die Lohnlisten geführt wurden. Ein blondbärtiger Mensch, der durch seinen Bart älter aussah, als er war, fegte die Schreibstube eben aus. Die Alte nahm ihm den Besen aus der Hand und stellte ihn an die Wand, sie legte den geflickten Kittel auf den Schreibtisch und sagte zu dem Blondbärtigen: »Bringe zur Abschiedsfeier alle Freunde mit. Harry kommt.«
Der junge Mann nahm seinen Kittel, dankte und verließ den Raum. Draußen zog er den Kittel über, schaute nach den Sternen, stellte fest, dass es noch sehr früh am Abend war und er genügend Zeit hatte, zwar nicht, um eine Stunde zu vergeuden, aber doch, um in Ruhe vorzugehen. Er schlenderte wie absichtslos zum Gleis, an den Abschnitt, an dem der erwartete Zug halten musste, und traf dort einen Trapper, der, die Büchse im Arm, eine Art Aufsicht führte.
»Wir setzen uns mit Harry zusammen, heute Nacht bei der Feier«, sagte er nebenhin und erkundigte sich dann, was der Zug voraussichtlich für Ladung führen würde. Als die beiden in größerer Entfernung Red Jim auftauchen sahen, ging der Blondbärtige weg. Jim hatte ihn bis jetzt noch nicht wiedererkannt, aber er wollte ihm auch keine Gelegenheit geben, ihn aufmerksam ins Auge zu fassen. MacLean war vor drei Jahren bei einem Streik der Eisenbahnbauarbeiter um ein Haar Red Jims Revolver zum Opfer gefallen. Er war entlassen worden, hatte sich aber unter falschem Namen und verändert durch den inzwischen gewachsenen Bart wieder anwerben lassen. Der Mann in der Schreibstube betrachtete ihn als seinen Burschen und Diener und nutzte ihn weidlich als Aushilfe beim Listenschreiben aus. So wusste MacLean mit vielem Bescheid, was ihn nach Meinung der Lagerleitung sicherlich nicht das geringste anging. Von ihm hatte Harka auch erfahren, was Jim als Manager einer Kundschaftergruppe von sechs Mann als Löhnung für diese erhielt, und Jim musste seitdem etwas mehr herausrücken. Die Auseinandersetzung war kurz und bündig verlaufen, und Jim hasste Harry dafür noch mehr.
Während der Blonde weiter im Lager umherstrich, war der junge Indianer zu seinem Zelt zurückgeritten.
Er pflockte den Mustang wieder an. Auch der Schecke des Vaters stand schon da und graste. Mattotaupa war also von seinem Kundschafterdienst zurück. Als Harka in das Zelt eintrat, fand er den Vater schlafend. Er setzte sich und wartete, bis Mattotaupa nach drei Stunden von selbst wieder wach wurde.
Die verstümmelte Indianerin kam aus dem Hintergrund, fachte das Feuer an und röstete für Mattotaupa ein Antilopenfilet.
Die Zweige knackten leise im Feuer, und das Fleisch am Spieß duftete gut. Mattotaupa saß Harka gegenüber an der Feuerstelle.
»Hast du etwas gefunden?« Mattotaupa sprach im Dakotadialekt. Er konnte annehmen, dass die Frau im Zelt ihn nicht verstand, denn sie stammte von den Seminolen.
»Nein, ich habe nichts gefunden«, gab Harka Auskunft.
»Ich auch nicht. Es scheint, dass sie von den Angriffen jetzt ablassen.«
Das Filet war gar; Mattotaupa fing an zu essen.
»Henry war hier«, berichtete Harka. »Wir sollen beide zu der Abschiedsfeier von Joe kommen, sobald der Zug glücklich eingelaufen ist.«
»Wir gehen hin.«
»Ich trinke nicht. Sie werden mich dafür verspotten wollen, und es wird Streit geben. Ist es nicht besser, wenn ich im Zelt bleibe?«
Mattotaupa aß weiter, aber das Antilopenfleisch schmeckte ihm nicht mehr so gut wie anfangs. Der Ton, in dem Harka die Worte »ich trinke nicht« ausgesprochen hatte, war ruhig, und dennoch war er für den Vater aufreizend gewesen. Denn Mattotaupa hörte darin die Frage mit: »Trinkst du?«, und ob sie nun gestellt war oder nicht, er stellte sie sich selbst und wurde nicht damit fertig.
»Die Sitten der Gastgeber zu verachten ist nicht Art eines Dakotakriegers«, sagte er schließlich. »Es ist auch nicht gut, dass du dich gar nicht geübt hast. Die ersten Becher würden genügen, und du liegst unter dem Tisch.«
Harka antwortete darauf nicht.
»Es waren vor drei Tagen Fremde hier, du weißt es«, fing Mattotaupa ein anderes Thema an. »Ich habe etwas eingetauscht, und ich werde heute bei der Feier unsere Freunde auch einmal einladen.«
Harka schwieg, aber sein Blick fragte: »Kannst du dich nicht anders auszeichnen?«
Mattotaupa erwiderte auf die nicht ausgesprochene Frage: »Unsere Väter waren Oglala, Leute, die ihre Habe freigebig austeilten. Ich bin kein Bettler, der immer nur nimmt, und ich denke, auch mein Sohn würde daran keinen Gefallen finden.«
Harka sagte auch dazu nichts.
Nachdem Mattotaupa gegessen hatte, legte er sich noch einmal schlafen. Sein Dienst als Kundschafter begann erst am nächsten Morgen wieder. Bei Harka stand es anders. Für ihn war es Zeit, sich mit der Gruppe, die er führte, schon bereitzumachen. Mit dem einlaufenden Zug wollte er um Mitternacht wiederum zum Lager zurückkommen, und dann mochte Joe weiter bestimmen. Vielleicht fiel es dem Ingenieur bis dahin selber ein, dass es doch besser sein würde, wenn Harka auch die zweite Hälfte der Nacht draußen blieb, um die Strecke sichern zu helfen.
Harka hatte sich mit den drei Männern, die zu seiner Gruppe gehörten, verabredet, dass sie nachts zu Fuß umherspähen wollten. Er ließ daher seinen Grauschimmel beim Zelt zurück. Am Halteplatz des Zuges traf er einen jungen Prärieläufer und die beiden Panikundschafter. Es gab nicht viel zu verabreden. Die vier waren aufeinander eingespielt. Sie kannten ihre Verständigungszeichen zu jeder Tages- und Nachtzeit, und sie wussten auch schon, welchen Abschnitt sie in dieser Nacht bewachen sollten. Dass Harka führte, obgleich er der Jüngste war, hatte sich von selbst ergeben. Die anderen drei verließen sich am liebsten auf ihn, und der junge Prärieläufer, dem die Verantwortung offiziell zukam, hatte sie inoffiziell dem Indianer zugeschoben.
Als die vier sich auf den Weg machen wollten, zeigten sich Charlemagne und Mackie und hielten sie noch auf.
»Da ist er ja«, sagte Mackie zu Charlemagne.
Charles wandte sich an Harry. »Junge, erkennst du mich gar nicht wieder?«
»Doch.«
»Wie geht es dir denn?«
»Gut.«
»Immer noch ein bisschen aufregende Gegend hier. Was macht denn die Bärenbande?«
»Keine Fährten.«
»Keine Fährten? Ach, sieh an. Ob sie sich jetzt wirklich zurückziehen oder ob das nur eine List ist?«
»Guten Abend!«, sagte Harry, ließ Charlemagne stehen und lief mit seinen drei Kundschaftergefährten nordostwärts in die Prärie hinaus.
Charlemagne und Mackie schauten den vier Spähern nach, bis diese im welligen Terrain verschwanden. Auch dann blieb Charlemagne noch stehen, und Mackie, der hatte kehrtmachen wollen, fragte: »Gibt’s noch was?«
»Hast du nichts bemerkt?«
»Was denn?«
»Wie der Rote plötzlich abbrach.«
»Komisch sind die Indsmen immer.«
»Er hätte doch antworten können. Aber nach der Bärenbande ist er nicht gern gefragt. Hast du das nicht bemerkt?«
»Kann ja sein. Was kümmert mich das!«
»Vielleicht wird es uns alle noch einmal kümmern, mehr als uns lieb ist.«
»Verstehe dich nicht.«
»Er stammt doch aus der Bärenbande. Weiß der Teufel, was er heute noch für Verbindungen dorthin hat.«
»So, meinst du?«
»Ich will nichts gesagt haben. Aber wenn ich dran denke, wie die uns alle vergiften wollten ..., dann wäre mir ein anderer als Kundschafter schon lieber als ausgerechnet einer von diesem Stamm!«
Mackie spuckte aus. »Mir gefallen die Indsmen überhaupt nicht! Hab gehört, die sollen heute Nacht bei der Feier auch dabei sein. Wozu das? Vielleicht lädt der Joe Brown auch noch einen Nigger ein!«
»So weit kommt’s. Wir müssen besser zusammenrücken.«
Die beiden gingen wieder in das Lager.
Die Zeit verlief. Gegen Mitternacht waren ungewöhnlich viele Männer, auch Frauen und Mädchen, auf den Beinen, um die Ankunft des Zuges zu erleben. Noch gingen auch die Materialzüge nicht regelmäßig. Manchmal hob der Sturm einen Zug aus dem Gleis, oder eine Büffelherde legte sich vor die Lokomotive, so dass kein Weiterkommen war. Die Indianer rissen, wenn es ihnen unbeobachtet gelang, die Gleise auf, denn sie hatten längst begriffen, dass die Lokomotive, dieses geheimnisvolle Tier, nur auf dem Gleispfad laufen konnte und auf Grasboden, ja selbst auf einem staubigen Büffelpfad völlig hilflos war.
Der Zug sollte nicht nur Material, sondern auch Löhnung und Proviant bringen. Alles spähte nach dem Zug aus.
Als in der Stille der nächtlichen Wildnis das Rollen der Räder, das Stampfen der Kolben zu hören war, schossen die freudigen Rufe in der Station auf, und als die Lokomotive, dampfend und pfeifend, die letzte Biegung nahm, schlugen sich die Männer gegenseitig auf die Schultern und sich selbst auf die Schenkel, denn nun stand nicht nur fest, dass der Zug wohlbehalten ankam, sondern auch, dass Joes Abschied gebührend gefeiert werden konnte.
Der Lokomotivführer bremste, der Zug hielt. Die Ausladekolonnen standen schon bereit und griffen sofort zu.
Joe Brown hatte sich mit Henry und mit dem Leiter des Stationslagers, Taylor, zusammengefunden.
»Also am letzten Tag doch noch einmal etwas genau nach der Richtschnur gegangen«, sagte der Ingenieur. »Dann können wir anfangen zu feiern! Kommt!«
In der Nähe der drei hatten noch zwei weitere Ingenieure gestanden, darunter Browns Nachfolger. Sie schlossen sich an, und die Gruppe ging langsam zu dem Hauptplatz und dem riesigen Zelt, das als Speiseraum und Wirtsstube diente. Einfache Tische und Bänke waren aufgestellt, in der Mitte des großen Raumes war ein Podium aufgebaut, und die Kapelle mit dem neuen Zigeunergeiger hatte sich bereits eingefunden. Als die Gruppe der angesehenen Personen eintrat, intonierten die Musiker einen Empfangstusch, und von verschiedenen Tischen dröhnten bereits Willkommensrufe. Das Zelt füllte sich rasch. Ein allgemeiner Lärm breitete sich aus, in dem jedes einzelne Geräusch nicht mehr nach seiner eigenen Natur, sondern nur noch als Lautverstärkung wirkte.
Die Tische und Bänke waren so gestellt, dass rings an den Zeltwänden entlang ein äußerer Kreis führte. Davon durch einen Zwischenraum, einen Gang, in dem sich drei bis vier Personen nebeneinander bewegen konnten, getrennt, waren die Tische dann in einem großen inneren Rechteck angeordnet. Durch dieses führten für die Bediener nur schmale Gänge, netzförmig, längs und quer. Der Tisch für die Ingenieure und den Stationsleiter befand sich in der äußersten Reihe dieses Rechtecks, unmittelbar an dem breiten Gang, an der oberen Schmalseite des Zeltes. An der unteren waren die Schanktische aufgestellt.
Für den Tisch, an dem Joe Brown sitzen sollte, hatte jemand eine Tischdecke und Blumen herbeigeschafft. Das wirkte im gewohnten Milieu erstaunlich, vielleicht auch töricht, und Henry hatte davon nichts gewusst, tat aber jetzt so, als ob dies unbedingt sein müsse. Joe Brown in der Mitte, sein Nachfolger links von ihm, der Stationsleiter rechts, präsidierten. Sie hatten den breiten Gang im Rücken und konnten ungehindert bedient werden. Die anderen Ingenieure, der Buchhalter, der Kassierer, der für den Bahnbetrieb Verantwortliche, fanden ihre Namenskarten an diesem Tisch, an den sich keiner setzen sollte, den Henry nicht dafür vorgesehen hatte. Daisy-Vicky kam und fragte nach den Wünschen der Herren. Joe bestellte für den ganzen Tisch.
Als sich der Ingenieur nach den Gefährten seiner Pionierzeit und nach der übrigen Prominenz der Kundschafter und Prärieläufer umsah, stellte er fest, dass für diese an den nächsten beiden Tischen, der Saalmitte zu, gedeckt war. Bloody Bill hatte sich schon eingefunden und seine lange Lilly mitgebracht. Auch Charlemagne tauchte auf, und Red Jim ließ sich sehen, groß, breitschultrig, neu in Leder eingekleidet, mit allen Waffen, ausgenommen die Büchse. Auch die beiden anderen Männer hatten Messer und Revolver bei sich. Dann kam Mattotaupa. Er hatte das Haar glatt gelegt und neu geflochten, und die Schlangenhaut, die um die Stirn lief, hielt am Hinterkopf zwei Adlerfedern, die der ehemalige Häuptling nur sehr selten anlegte. Er hatte einen schön gestickten Rock angezogen, der lose über den Gürtel hing. Die Stickerei zeigte nicht die bei den Dakota gebräuchlichen Muster und Farbzusammenstellungen. Der Rock war in einem Panidorf für Mattotaupa angefertigt worden. Das wussten die wenigsten, von den Weißen wusste es keiner. Mattotaupa war sehr groß und eine würdige und stolze Erscheinung, nicht nur durch seine Kleidung, sondern auch durch eine gestraffte Haltung, die er an diesem Abend annahm. Red Jim beobachtete den Indianer aus einiger Entfernung und fragte sich: Was ist plötzlich wieder in ihn gefahren? Er schaut um sich wie ein Häuptling, der Gäste empfängt; nicht wie ein Indsman, der als alter Kampfgefährte trotz einiger Bedenken wohl oder übel noch eingeladen wird. Auch Harka zeigte sich, ein paar Schritte hinter dem Vater zurück. Er war kaum mehr kleiner, aber noch jugendlich-schlanker als der Vater. Er hatte kein Gewand an, da er eine Sommerjacke überhaupt nicht besaß, sondern nur die im Winter unentbehrliche Pelzkleidung. Mattotaupa hatte wohl empfunden, dass aus Harkas Weigerung, sich einen Festrock für den Sommer arbeiten zu lassen, seine Verachtung für die weißen Männer sprach. Harka hatte in diesem Punkt eigensinnig auf seinem Standpunkt beharrt. Sein nackter Oberkörper war sehr gut eingefettet, nicht nur für den Kundschaftsgang, den er hinter sich hatte, sondern nochmals für die bevorstehende Feier. Er war glatt wie eine Schlange; keine Hand konnte ihn so leicht festhalten. Die Büffelhautdecke, die mit den Taten seines Vaters als Kriegshäuptling der Bärenbande bemalt war, hatte er über die Schulter um Brust und Rücken geschlagen. Niemand konnte ohne weiteres sehen, was für Waffen sich unter der Lederdecke verbargen. Seinen Platz wählte der junge Indianer so, dass er den Tisch mit Joe Brown und den Ingenieuren im Rücken hatte und die Grenzer alle vor sich. Er setzte sich noch nicht, da die meisten anderen sich auch noch nicht gesetzt hatten. Aber er stellte sich so an den Tisch, dass ihm der gewünschte Platz gesichert blieb.
Die Musik spielte; der Zigeunerprimas ging zu den Gästen in der Nähe des Podiums und sang zu seiner Geige. Die ersten fingen an zu lachen und zu trinken und mit ihren Bechern zu Joe hinüber zu grüßen. Dieser erhob sich und dankte. Eine Rede gedachte er nicht zu halten.
Mattotaupa ging zu Joe Brown und sagte ein paar leise Worte zu dem Ingenieur. Brown hob rasch den Kopf, erstaunt, erfreut, und winkte die Kellnerin her, deren fettige Haut schon Schweißtropfen absonderte, ehe der Betrieb richtig begonnen hatte. »Daisy«, sagte er, »für dich und deine Kollegen: An den beiden Tischen vor uns wird auf Tops Kosten getrunken. Verstanden?«
Das Mädchen schaute zweifelnd an dem Häuptling hinauf. »Wenn die das erst merken, an den zwei Tischen, Top, dann hast du morgen früh eine Rechnung, für die du dir eine Farm kaufen könntest! Kannst du so viel zahlen?«
Der Indianer lächelte wohlwollend, überlegen, öffnete den Lederbeutel ein wenig und ließ das Mädchen einen Blick hinein tun.
»Donnerwetter ... Top ... du ... wer hätte das geahnt!« Daisy-Vicky wurde über und über rot, und ihre Augen strahlten, als ob sie ein Wunder gesehen habe.
Mattotaupa gab ihr eine Münze im Voraus. »Das ist für deine Arbeit«, sagte er.
Das Mädchen war daraufhin sofort bei den beiden Tischen. Sie stellte sich neben Mackie, der Charlemagnes Nachbar geworden war. »Bestellen bitte«, sagte sie. »Top zahlt für alle!«
Die Mitteilung wurde mit Freudengeschrei und Hallo aufgenommen, und es hagelte Bestellungen, so dass Vicky zusammenrechnen und wiederholen musste, um nichts zu vergessen.
Charlemagne und Bill warfen Red Jim wieder vielsagende Blicke aus den Augenwinkeln zu, die Jim aber nicht bemerkte, da er selbst Top anstarrte. Harka jedoch fing die Blicke auf, während er Daisy-Vicky eben anwies, ihm eine Fleischmahlzeit zu bringen. »Sonst nichts«, fügte er auf ihre Rückfrage hinzu.
Bier, Brandy und Becher kamen schnell auf den Tisch. Das Mädchen hatte sich noch zwei Kollegen zur Unterstützung herbeigerufen.
Die Köpfe erhitzten sich bald. Es wurde viel Unsinn und viel Belangloses geredet, und die Männer tranken immer wieder Mattotaupa zu; er war auf einmal in viel stärkerem Maße der Mittelpunkt als Joe. Harka verzehrte sein Stück Braten. An der Unterhaltung, die ihn langweilte, beteiligte er sich überhaupt nicht. Mattotaupa hatte trotz allen Zutrinkens den ersten Becher Branntwein noch nicht geleert. Um sich einen zweiten eingießen zu lassen, kippte er den Rest aus dem ersten auf den Boden. Harka bemerkte das wohl; den meisten anderen entging es, da es schnell und geschickt geschah.
Nach einer Stunde waren die meisten im Saal angetrunken. An einigen Tischen sangen die Gäste im Chor. Der Stationsleiter Taylor begann aus seinem Leben zu erzählen. Browns Nachfolger erläuterte kühne Perspektiven von drei Bahnen quer durch die Union. Henry schwärmte von dem Leben in der Stadt. Joe Brown soff still vor sich hin, er fühlte sich auf einmal überflüssig. Da an dem Tisch von Top und Jim ein Platz frei wurde, setzte er sich zu diesen hinüber, und es dauerte nicht lange, da kam Taylor nach.
»Lassen wir die Greenhorns da hinten unter sich«, sagte er, »ich muss Prärie um mich haben und Männer! So bin ich’s gewohnt.«
Die Männer ließen ihn erzählen, und wenn er an diesem Tisch auch keine aufmerksamen Zuhörer für seine Geschichte fand, so doch sachverständige. Mattotaupa war höflich genug, hin und wieder eine Zwischenfrage zu stellen, die bewies, dass er gefolgt war.
Red Jim war noch vollkommen nüchtern, obwohl er mehr als jeder andere trank. Bloody Bill stritt sich mit der langen Lilly. Er war immer eifersüchtig. Mackie begann zu prahlen, und Charlemagne bestärkte ihn darin.
Mattotaupa hatte noch nicht mehr als einen halben Becher wirklich getrunken. Harka wusste nicht, dass seine Gegenwart es war, die den Vater hinderte, sich selbst und den anderen nachzugeben. Es war das erste Mal, dass Harka mit an einem Tisch saß, an dem gezecht wurde, und Mattotaupa war entschlossen, dem Sohn eben dieses erste Mal zu beweisen, dass ein ehemaliger Häuptling freigebig sein könne, ohne sich unwürdig zu benehmen. Die Rolle, die Mattotaupa spielte, gefiel ihm selbst mehr und mehr. Er hatte schon lange nicht mehr im Mittelpunkt gestanden, früher aber täglich, und das Wohlgefühl, bewundert zu werden, brach bei ihm durch. Die Tischgenossen sparten nicht an Schmeicheleien.
Es war in der dritten Stunde nach Mitternacht. Harka teilte Joe Brown kurz mit, dass er gehen und in den letzten Nachtstunden, die für unvorhergesehene Indianerangriffe die gefährlichsten waren, den Kundschafterdienst in seinem Abschnitt wieder selbst versehen wollte. Der Ingenieur sagte nicht nein, denn Harka trug zur Unterhaltung sowieso nichts bei. Nachdem Joe einverstanden war, konnte Mattotaupa nicht widersprechen, und Harka wollte stillschweigend den Tisch verlassen.
Da kam Mackie mit einem Becher auf ihn zu: »Einen Drink!«
»Trink selber aus«, antwortete der junge Indianer und war in dem breiten Rundgang schon drei Tische vorbei, als Mackie ihm, den Becher hochhebend, nachbrüllte: »Einen Drink, du verdammter Bursche! Willst du abschlagen?«
Harka dachte den Schreier auch weiterhin nicht zu beachten, aber da standen dem jungen Indianer bereits vier andere Kerle im Weg. Harka warf seinen Freunden an den Tischen einen raschen Blick zu. Sie hielten sich alle bereit, ihm beizuspringen. Der Indianer sah, dass die vier, die ihm in den Weg getreten waren, ihn nicht hindern konnten, aus dem Zelt hinaus zu gelangen, wenn er das wollte. Er brauchte nur seitlich über die Tische zu springen; keiner der Gäste, die an diesen Tischen saßen, würde schnell genug sein, um Harka zu halten. Eben weil er sich auf diese Möglichkeit verließ, zögerte er noch einen Augenblick.
»Ich schlage dir nichts ab. Ich trinke nichts. Trink du auf dein eigenes Wohl!« Als er dies zu Mackie zurückrief, stand er in ganz entspannter Haltung, als ob er für den nächsten Augenblick keineswegs etwas Besonderes vorhabe.
»Dann geh doch, du Esel! Wenn du nicht weißt, was gut schmeckt!«
Harka lächelte ein wenig. Diese Aufforderung war ein harmloser Abschluss, den er sich zunutze machen konnte. Es schien, dass Mackie, halb betrunken, noch nicht so funktioniert hatte, wie seine Hintermänner es erwarteten. Aber nun flüsterte dem Angetrunkenen jemand etwas zu.
»Ja, geh doch zu deinen Dakota, wo du hingehörst!«, brüllte Mackie plötzlich, ganz unvermittelt. »Es ist jetzt Zeit, dass sie die Brandpfeile abzuschießen beginnen!«
An den nächsten Tischen, an denen der Zuruf verstanden worden war, verstummten die Gespräche. Die Worte Dakota und Brandpfeile hatten im Bewusstsein aller, die sie vernahmen, wie ein Blitz eingeschlagen. Man befand sich in einem Zelt, und das Zelt stand in einer noch immer umkämpften Prärie. Gab es Verräter in den eigenen Reihen?
Harka sprang zurück, schneller fast als ein Gedanke. Er schlug Mackie schallend ins Gesicht, so dass dieser zur Seite taumelte, und stellte sich dann neben den Vater. Er hatte unter der büffelledernen Decke längst die Hand an der Waffe gehabt. Jetzt riss er den Revolver heraus, richtete ihn aber nicht auf Mackie, sondern auf Jim. »Pfeif sie zurück!«, sagte er leise. »Oder ich schieße.«
Red Jim wusste, dass er nichts mehr unternehmen konnte, was Harka entging, und er begriff, dass er erkannt war.
Er hob die Hände flach ein wenig hoch, zum Zeichen, dass er nicht zur Waffe greifen werde, und sagte laut: »Billy, bring doch den Mackie zur Vernunft! Jedes Mal fängt dieses Ross an, Krakeel zu machen! Damals um deine Lilly, jetzt mit Harry. Schaff das besoffene Schwein hinaus!«
Bill verstand, wenn er die Wendung, die eingetreten war, auch sehr bedauerte. Er packte mit Charlemagne zusammen Mackie an, dessen Nase blutete, und die beiden schleiften das unglückliche Opfer ihrer Pläne aus dem Zelt. Daisy-Vicky lief jammernd hinterher.
»Stecke den Revolver weg!«, befahl Mattotaupa seinem Sohn.
Harka gehorchte; seine rechte Hand verbarg sich wieder unter der büffelledernen Decke. »Ich gehe also«, sagte er gelassen.
Er ging ungehindert.
Seine Freunde lächelten ihm unauffällig zu.
Mattotaupa, Jim und Joe setzten sich wieder.
»Was war denn das?«, fragte Taylor, der Leiter des Stationslagers.
»Wildwest«, erläuterte Joe. »Eine Geschichte mehr für ihr Repertoire.«
»Begriffen habe ich die Sache nicht ganz.«
»Mackie war eben besoffen«, meinte der Ingenieur. »Er hat selbst nichts mehr begriffen. Wie sollen wir es begreifen?«
»Aber es besteht doch keine Gefahr?«
»I wo!«
»War das nicht dein Sohn?«, fragte Taylor Mattotaupa.
»Hau, mein Sohn.«
»Der Bursche hat mir gefallen. Er trinkt nicht, weiß sich zu helfen und nimmt seinen Dienst ernst. Solche Leute brauchen wir.«
»Also einen Drink ohne Harry, aber auf das Wohl von Harry!«, rief Jim und ließ die Augen blitzen.
Mattotaupa konnte nicht umhin, in diesem Falle mitzutun. »Du denkst sehr groß«, sagte er zu Jim in der Dakotasprache, so dass die anderen die Worte nicht verstanden. »Größer als mein Sohn.«
»Was heißt sehr groß?«, meinte Jim mit gut gespielter Generosität. »Der Junge ist nervös. Das kommt im Alter von siebzehn Jahren vor. Man muss dann nur die Ruhe bewahren.«
Joe und Taylor zogen sich wieder an den Tisch zurück, an dem die anderen Ingenieure saßen.
»Nur eine einzige blutige Nase«, meinte Henry. »Das ist ja diesmal glimpflich abgegangen.«
Es wurde weitergetrunken. Bill tanzte mit Lilly. Vicky bediente wieder mit Beflissenheit. Sie hatte sich überzeugt, dass Mackie bald wieder auf den Beinen sein würde.
Der Einzige, der auch nachträglich noch beeindruckt schien, ja nachträglich sogar noch stärker beeindruckt schien als im Augenblick des schnellen Ablaufs der Ereignisse, war Mattotaupa. Er mäßigte sich nicht mehr so beherrscht im Trinken, sondern goss einen Becher schnell hinunter und ließ ihn gleich wieder nachfüllen.
»Was hast du denn?«, fragte Jim.
»Nichts. Ich gehe auch noch einmal kundschaften.«
»Seid ihr alle verrückt?!«, protestierte Bill. »Abschied von Joe feiern wir nur einmal! Auf Kundschaft könnt ihr alle Tage gehen!« Aber Mattotaupa erhob sich. Er grüßte Joe höflich, zahlte bei Vicky die angelaufene Rechnung, sicherte ihr zu, dass er am Morgen die noch anfallende Zeche bezahlen werde, und ging langsam hinaus. Jim sah ihm nach, bis er aus dem Zelt verschwunden war. Dann sprang er auf und stürzte dem Indianer nach. Er traf ihn auf dem Weg zum Indianerzelt, wo Mattotaupa wohl seinen Festrock ablegen, vielleicht das Pferd holen wollte.
»Top, willst du mir nicht sagen, was du vorhast?«, fragte der Weiße, mit jenem tiefen Stimmklang, der um Vertrauen warb.
»Ich habe nichts vor, als auf Kundschaft zu gehen«, antwortete der Indianer abwehrend.
»Glaubst du, es besteht Gefahr?«
»Joe sagte mir, du habest versteckte Fährten gefunden. Sie sind mir entgangen. Sie sind auch Harka entgangen. Aber Mackie sprach von Brandpfeilen. Wir dürfen nichts versäumen. Wo hast du die Spuren gesehen?«
»Es war nur so eine Andeutung. Am Nordwestende meines Kundschafterreviers. Sie müssten eigentlich in Harrys Region hinübergelaufen sein. Du kannst nichts davon gesehen haben. Kommst du noch einmal zurück?«
»Sicher morgen Mittag, wenn Joe mit dem Zug abfährt.«
»Gut. Also beim Zug!«
Jim eilte in das große Zelt zurück.
Mattotaupa begab sich zu seinem Tipi. Er sah schon von weitem, dass beide Mustangs noch davor angepflockt waren. Als er eintrat, war nur die schweigsame Indianerin anwesend.
Die Glut in der Feuerstelle war gedeckt. Harrys Büffelhautdecke lag zusammengefaltet auf ihrem Platz. Er war da gewesen und war wieder gegangen. Die alte Flinte stand an ihrem Platz, aber den Bogen hatte Harka mitgenommen.
Mattotaupa legte den Festrock ab. Er zog die Adlerfedern aus der Schlangenhaut und verwahrte sie, die Büchse aber nahm er an sich. Er verließ das Zelt und ging zum Gleis. Dort fand er kaum einen Menschen mehr vor. Alle die vielen Männer und auch die Frauen, die bei der Ankunft des Zuges zusammengekommen waren, auch die Entladekolonnen, die ihre Arbeit inzwischen getan hatten, waren zur Feier oder zu ihrer Nachtarbeit gegangen, und vielleicht hatten sich auch einige zum Schlafen zurückgezogen. Das Gelände war leer und still, und nur aus dem großen Zelt, dem Mattotaupa den Rücken kehrte, drang der Lärm der Musik und das Singen und Johlen der Feiernden.
Der Indianer ging das Gleis entlang ostwärts, ein kleines Stück nur, dann schlug er einen Bogen nach dem Lager hin, als ob er zurückkehre. Sobald er Stapel von Fässern und Brettern erreicht hatte, die ein gutes Versteck boten, verschwand er für mögliche Beobachter dahinter und begann seinen Kundschaftsgang wie eine Schlange im Gras.
Auf diese Weise konnte er nur verhältnismäßig langsam vorankommen, aber er hatte auch nicht vor, eine große Strecke zurückzulegen. Er wollte in Harkas Revier, zu dem die andeutungsweisen Feindspuren geführt haben sollten, eine Anhöhe gewinnen, die er sehr genau kannte, da die Geländeabschnitte der Kundschaftergruppen wechselten. Von dieser Anhöhe wollte er Ausschau halten und Harkas Späharbeit unterstützen.
So sagte er im Stillen zu sich selbst.
Er sagte es sich immer wieder, aber er glaubte sich selbst nicht. Das Misstrauen wühlte in ihm. Harka hatte berichtet, er habe keine Spuren gesehen, aber Jim hatte von Fährten gesprochen, die in Harkas Abschnitt hinüberliefen. War Harka je eine Spur entgangen, die er finden wollte? Mattotaupa marterte sich selbst mit dem Gedanken, dass er mit seinem Verdacht nicht allein stehe. Mackie war betrunken gewesen, daran gab es keinen Zweifel. Aber Betrunkene sprachen aus, was sie nüchtern verschwiegen. Wie war Mackie zu seiner Beschuldigung gekommen? Was hatte er für Anhaltspunkte gehabt? Jim sagte darüber nichts. Er wollte den Vater schonen. Doch Mattotaupa wollte nicht geschont sein. Er wollte Gewissheit haben, volle, unzweifelhafte Gewissheit.
Er wollte wissen, was sein Sohn Harka in dieser Nacht tat.
Mattotaupa hielt Ausschau.
Nach einer Stunde des Wartens etwa konnte er wahrnehmen, wie Harka im Dunkeln zu der nächsten Bodenwelle schlich, hinaufkroch und oben, von Grasbüscheln gedeckt, liegen blieb, um nach derselben Richtung zu spähen wie der Vater.
Mattotaupas Herzschlag ging immer schneller. Hatte Harka irgendeine Verabredung, wollte er sich mit einem Feind treffen? War seine Eile, die Feier zu verlassen, nicht wirklich verdächtig gewesen? War es nicht sonderbar, dass die Krieger der Bärenbande schon so lange nichts mehr unternommen hatten? Planten sie einen großen Streich vor Einbruch des Winters? Hatten sie die Ankunft des Zuges abgewartet, um gefüllte Vorratsräume und wohlversehene Materiallager in Brand zu stecken und zu verwüsten?
Dem Vater wurde es heiß bis unter die Haut. Seine Augen glühten. Der Branntwein und das Misstrauen arbeiteten gleichzeitig in ihm. Er beobachtete, dass Harka sich bewegte. Der junge Kundschafter glitt den Hang der Anhöhe, auf deren Kamm er lag, an der für Mattotaupa nicht sichtbaren Seite hinab und blieb für lange Zeit verschwunden. Mattotaupa überlegte, ob er zu der Anhöhe, auf der Harka gelegen hatte, hinüberschleichen sollte. Aber der Platz, den Mattotaupa jetzt einnahm, bot im Ganzen den weitesten Ausblick. So wartete er, ob er entdecken könnte, wo Harka sich wieder zeigte. Aber er konnte ihn bis zum Morgen nirgends mehr beobachten.
Es war Herbst, und die Nächte waren lang.
Als es dämmerte, lief Mattotaupa gebückt zu der Bodenwelle hinüber, die er im Auge gehabt hatte. Er sah noch die Spuren, wo Harka im Gras gelegen hatte. Er sah auch die Fährten, die den Hang hinabführten. Dann aber fehlte jede weitere Spur. Harka war ein guter Schüler seines erfahrenen Vaters, ohne Zweifel, und er hatte als Kundschafter Tag für Tag nichts anderes zu tun, als andere zu entdecken und sich selbst zu verbergen. In dieser Kunst war er ein fast nicht mehr zu übertreffender Meister geworden, obgleich oder vielleicht gerade weil er noch so jung war.
Da in der Nacht kein Überfall stattgefunden hatte, begann Mattotaupa etwas ruhiger zu denken und zu empfinden. Mackies schwere Beschuldigung gegen Harka hatte sich nicht unmittelbar bestätigt.
Mattotaupa machte sich auf den Heimweg. Der Wind wehte stark, der Morgenhimmel war von Staubwolken verdüstert. Die Zeltwände blähten sich. Aus dem großen Speisezelt klangen noch immer die Geigen. Im Gras zwischen Zelten und Baracken lagen ein paar Betrunkene und schliefen ihren Rausch aus.
Als Mattotaupa sich seinem Zelt näherte, sah er, dass die Pferde nicht davor angepflockt waren. Harka war wohl schon zurück und brachte die Tiere eben zum Bach, um sie saufen zu lassen.
Mattotaupa ging in das Zelt. Die schweigsame Seminolin saß im Hintergrund. Über dem Feuer kochte Fleischbrühe im Kessel.
Mattotaupa stellte seine Büchse an ihren Platz. Dann wurde er steif wie ein Gelähmter.
Neben der Feuerstelle, auf der hellen Lederdecke, lag sein eigener Revolver.
Mattotaupa fasste nach dem Gürtel. Die Revolvertasche war leer.
Nun wusste der Vater, was Harka getan hatte, als er verschwand und seine Spuren so sorgsam verbarg. Er hatte dem Vater den Revolver aus der Tasche geholt. Es war ein Meisterstreich.
Mattotaupa hob den Revolver nicht auf.
Er ließ ihn vorläufig liegen. Wenn Vater und Sohn noch in jenem unverbrüchlichen, jede Offenheit und Heiterkeit erlaubenden Vertrauensverhältnis gestanden hätten wie einst, so würde Mattotaupa jetzt gelacht, sich gefreut und jedermann erzählt haben, was er für einen vorzüglichen Kundschafter und künftigen Krieger herangezogen habe, der mit siebzehn Jahren schon den eigenen Vater überlistete.
Vielleicht konnte er der Sache diese gute Seite abgewinnen. Wenn Harka glaubte, dass der Vater ihn hatte unterstützen und prüfen wollen – nur seine Kundschafterfähigkeiten hatte prüfen wollen –, dann konnte Mattotaupa dem Sohn jetzt das Lob frei ins Gesicht sagen. Wenn Harka aber nach dieser Nacht annahm, dass der Vater ihn verdächtigte, so wie der betrunkene weiße Mann Harka verdächtigt hatte, dann ... Mattotaupa scheute sich davor, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Es blieb ihm auch keine Zeit dazu.
Er hörte den Sohn mit den Pferden kommen. Er hörte, wie Harka mit ein paar Beilschlägen die Pflöcke an anderer Stelle in die Erde trieb, damit die Mustangs einen neuen Weidekreis fanden. Dann schlüpfte der junge Indianer ins Zelt.
Mattotaupa hatte den Revolver noch immer nicht aufgehoben. Jetzt erst, vor Harkas Augen, bückte er sich, griff nach der Waffe und steckte sie zu sich, mit dem Versuch eines Lächelns, mit einer verborgenen Frage, ob der Sohn ihm erlaube, die Sache von dieser Seite aufzufassen.
Harka holte sich seine alte Büffelhautdecke und legte sich wortlos schlafen. Der Vater hatte nur einen Augenblick in das Gesicht des Sohnes geschaut, aber er wusste jetzt, was alles verloren war.
Der alt gewordene Indianer zögerte, dann ging er aus dem Zelt hinaus in den Staubsturm. Er irrte im Lager umher und log sich vor, dass er kein Ziel habe. Doch lenkten seine Schritte immer näher zu dem großen Zelt, aus dem noch immer die Geige des Primas sang. Er gelangte zum Eingang, er ging hinein. Der Geruch von verschüttetem Bier, von kaltem Tabak, von erbrochenem Essen und Trinken schlug ihm entgegen. Die meisten Tische waren schon leer. Nur an einigen saßen noch die Unentwegten zusammen mit aufgedunsenen Gesichtern. Sie grölten heiser und unzusammenhängend und verlangten weiterzutrinken. Drei Kellner bedienten. Die Mädchen waren schon gegangen.
Mattotaupa schaute nach den Tischen, an denen die Ingenieure und die alten Prärieläufer gesessen hatten. Bloody Bill und seine lange Lilly hockten noch dort, außer ihm vier Mann. Red Jim, Joe, Henry, Taylor, Charlemagne, Mackie waren nicht mehr zu sehen. Als der Indianer langsam zwischen den Tischen hindurchging, begann der Zigeunerprimas einen wilden Tanz zu spielen. Mattotaupa kam nah an dem Podium der Kapelle vorüber, betrachtete den Geiger abwesend, wie über eine weite Entfernung hinweg, und warf ihm dann eine Goldmünze hin. Aus den Augen des Zigeuners schoss Feuer; die ganze Kapelle spielte Sturm, und die reißende Melodie wirkte gespenstisch in dem riesigen leeren stinkenden Raum.
Mattotaupa ließ sich auf die nächste Bank fallen. Es war ihm gleichgültig, dass der Tisch davor von verschüttetem Bier triefte.
»Brandy!«, rief er.
Die Kellner waren flink für diesen Gast. Während die Kapelle nur für ihn spielte, schüttete Top den Branntwein hinunter.
Es schwindelte ihm, und er trank weiter. Er wusste nicht mehr, dass er von der Bank auf den Boden sank. Er war schwer, und seine Augen schlossen sich.
Die drei Kellner warfen sich im Umherlaufen verstohlene Blicke zu. Allmählich zogen sie ihre Kreise enger um den vom Alkohol Eingeschläferten, endlich standen sie um ihn herum.
»Zahlen muss er noch«, sagte schließlich der eine.
Da merkten sie, dass sie nicht mehr drei waren, sondern schon fünf. Der Geiger und Bloody Bill hatten sich mit eingefunden.
Bill nahm den Lederbeutel, den Top am Gürtel trug, leerte ihn und legte die Münzen auf den Tisch. »Teilen wir ehrlich?«
»Erst die Zeche!«, sagten die Kellner und nahmen den größeren Teil an sich.
»Dann die Musik!«, sagte der Geiger und griff nach dem Rest.
»Ihr Raub- und Diebesgesindel!«, schrie Bill und wollte dem Zigeuner das Geld entreißen, aber da blitzte schon ein Stilett, und Bill zog die durchstoßene Hand fluchend zurück. Die lange Lilly kreischte im Hintergrund.
»Schaffen wir den Indsman heim«, meinte einer der Kellner. »Das ist mitbezahlt!«
Während der Zigeuner und Bill zu einem Hahnenkampf ansetzten, bei dem alle Mittel erlaubt waren, schleppten zwei der Kellner den Indianer auf ihren Schultern weg und trugen ihn hinaus bis zu seinem eigenen Zelt. Dort warfen sie ihn neben den beiden Pferden ins Gras.
Als sie weggegangen waren und das Indianerzelt schon nicht mehr sehen konnten, schlüpfte Harka aus dem Tipi. Er holte den Vater, der noch immer nicht zu sich gekommen war, in das Zelt herein und legte ihn auf eine Decke.
Dann setzte er sich an das Feuer und rauchte.
Die Seminolin saß im Hintergrund. Sie hatte sich so gesetzt, dass Harka ihr verstümmeltes Gesicht sah, wenn er vom Feuer aufblickte. Die Frau galt als stumm; vielleicht war auch ihre Zunge verstümmelt. Nie hörte jemand sie ein Wort sprechen. Auch Harka wusste nichts von ihr, als dass sie eine Seminolin war, die nach der Niederlage ihres Stammes in Florida in Sklaverei geraten und nach Beendigung des Bürgerkrieges frei geworden war. Sie hatte als Kesselschlepperin bei der Küche gearbeitet. Von dort hatte Harka sie mit Joes Erlaubnis und der Unterstützung des Blondbärtigen weggeholt, um für den Vater und sich jemanden zu haben, der das Zelt in der gewohnten Weise versorgte.
An diesem Morgen, an dem sich das Licht durch Staubwolken und Lederplanen nur trübe ins Zelt kämpfte, schienen aus dem verstümmelten Gesicht zum ersten Mal lebende Augen zu schauen. Allmählich fingen sie Harkas Blick und hielten ihn fest.
»Sprechen.« Mühsam, rauh kam die lange nicht gebrauchte Stimme aus der Kehle und zwang sich in die fremde, die englische Sprache. Harka war in ganz anderen Gedanken gefangen gewesen, und vielleicht hatte er nie so wenig an die Verstümmelte gedacht wie in diesem Augenblick. Aber als sie ihn lange genug fest angesehen hatte und nun zu sprechen begann, war es so, als ob ein Wunder geschehe und ein Baum Sprache bekommen habe, und er musste zuhören und antworten.
»Wer hat dich verstümmelt?«, fragte er.
»Weißer Mann. Seminolen haben gekämpft.«
»Ich weiß.« Auch Harka formte an seinen Worten. »Sieben Sommer und Winter habt ihr gekämpft. Für jeden eurer Krieger, der den Tod fand, starben hundert weiße Männer.«
»Nicht besiegt. Unser Häuptling verraten und gefangen.«
»Euer Häuptling Osceola. Er starb als Gefangener der weißen Männer.«
»Ja. Er ist tot, der Vater meines Vaters. Aber die tapfersten meiner Väter leben und kämpfen seit vierunddreißig Sommern und heute noch immer in den Sümpfen von Florida.« Die Frau, die vielleicht ein Mädchen war, stand auf. Eckig standen ihre Schultern unter der schwarzen Kattunbluse. Sie war groß und sehr mager, wie ein halb verhungertes herangewachsenes Kind oder eine verhärmte Mutter, wer wusste es? Ihr verstümmeltes Gesicht verzog sich in einem verzweifelten Hass. »Aber du, Harka Steinhart Wolfstöter, du kämpfst für die weißen Männer – für die Betrüger – die Mörder ... die blutgierigen Kojoten!«
Harka stand auf. »Geh und hole Wasser!«, sagte er.
Als die Seminolin in das Zelt zurückkam, fand sie Harka nicht mehr dort vor. Ihre Augen erloschen wieder, und ihre Lippen pressten sich von neuem fest zusammen. Sie wartete still und stumm. Stundenlang wartete sie. Dann stand sie plötzlich auf, zog die Decke unter dem Körper von Mattotaupa weg und goss ihm zwei Kübel kalten Brunnenwassers über den Kopf, in die Augen, in Mund und Nase.
Top schüttelte sich. Er hob die Augenlider, betrachtete die Seminolin erstaunt, sah sich einen Augenblick um, als ob er nicht wisse, wo er sich befinde, sprang aber auch schon auf und rannte an den Bach, um sich zu baden.
Während er den ganzen Körper in das kalte Wasser legte, versuchte er sich zu erinnern, was in der Nacht geschehen war. Sein Gedächtnis wiederholte ihm die Ereignisse, und als er endlich vor sich selbst nicht mehr glauben konnte, dass er geträumt habe, ging er zum Zelt zurück.
Er legte seinen Festrock an und begab sich zu dem Platz, an dem der Zug hielt. Es ging schon gegen Mittag. Lärm und Leben herrschten wieder im ganzen Lager. Alle, die sich über Mittag freimachen konnten, strömten zu dem Gleis, um die Abfahrt des Zuges und den Abschied Joe Browns und Henrys zu erleben.
Mattotaupa schaute nicht nach diesem oder jenem aus. Er wollte sich aber allen zeigen, einem jeden, wer es auch war. Er war sich bewusst, dass er zwei schwere Niederlagen erlitten hatte, eine gegenüber seinen eigenen Entschlüssen und Vorsätzen, sich nicht wieder zu betrinken, und die andere gegenüber dem Sohn. Er wollte aber den Kampf nicht aufgeben. Er wollte Achtung für sich verlangen und erzwingen, mit allen Mitteln, auf Biegen oder Brechen.
Seine hohe Gestalt blieb nicht unbemerkt. Joe, umgeben von einem Kreis Abschiednehmender, erspähte ihn und winkte ihn herbei. Mit gemessenen Schritten ging der Indianer auf den Ingenieur zu, der Kreis gab eine Gasse frei, und Top begrüßte Joe in der eigentümlich zurückhaltend-würdevollen Art, die ihm noch immer anhaftete, wenn er nüchtern war.
»Hab gehört, du bist auf elende Weise bestohlen worden, Top?« Joe musterte das graue Gesicht des Indianers mit der Teilnahme eines Mannes, der solche Erlebnisse kannte.
»Nein. Ich habe einige Münzen verschenkt«, log der Indianer in stolzer Haltung. »Den weißen Männern erschien es vielleicht etwas viel. Aber das hat nichts zu sagen.«
»Bill und der Zigeuner haben sich gegenseitig beinahe umgebracht. Bill liegt auf seinen Decken und stöhnt, gepflegt von der langen Lilly. Der Zigeuner arbeitet wieder bei den Ballen und Kisten. Er darf nicht mehr aufspielen. Alles in allem aber doch noch ein glimpfliches Ende!«
Der Lokomotivführer ließ seine Maschine ungeduldig pfeifen. Er erhielt das Abfahrtszeichen. Joe kletterte in den Güterwagen, in dem Henry sich schon eingerichtet hatte.
Die Räder begannen ostwärts zu rollen. In der staubigen Luft war der Zug bald nicht mehr zu sehen.
Abseits der Menge, die sich zu der Abfahrt eingefunden hatte, standen Red Jim und Charlemagne.
»Alles in allem«, zog Charles die Bilanz, »haben wir uns gründlich blamiert, und der Vogel, den wir fangen wollten, ist uns entronnen.«
»Er ist schnell, aber ich habe den längeren Atem.« Jim tat einen Lungenzug und fügte hinzu: »Siehst du nicht den alten Top dort allein? Sein Geld ist er los. Ich will wetten, dass er es sich für Nuggets eingetauscht hatte. Nun muss er sich wieder Gold holen, wenn er weiter den großen Herrn spielen will. Der Versuchung widersteht er nicht. Ich kann mich an seine Spur hängen.«
»Denke aber nicht, dass du mich dabei wieder abhängen kannst! Und was wird Harry machen? Die beiden haben wir nun doch nicht auseinandergebracht. Darauf kam es aber an!«
»Warte ab. Ich sagte dir ja, mein Atem ist länger. Top ist von neuem misstrauisch geworden. Er hat versucht, dem Harry nachzuschleichen.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe ja meine Augen! Was Mackie sagte, hat sicherer gewirkt als unsere Waffen.«
»Du bist ein junger Kerl, Jim. Nicht mehr ganz so jung wie damals, als wir uns kennenlernten. Doch auf ein paar Sommer kommt’s bei dir noch nicht an. Ich aber bin zehn Jahre älter, ich will nicht mehr zu lange warten.«
»Wer Beute machen will, muss geduldig lauern; das ist die erste Jagdregel. Wenn du das nicht vermagst, steh gleich von allem ab.«
»Du wirst mich nicht mehr los!«
»Scheint so. Aber ich warne dich. Harry hat beobachtet, dass du es warst, der dem Mackie zuletzt was eingeflüstert hat.«
»Du meinst ...?«
»Ja, ich meine, dass es anderwärts sicherer für dich wäre als gerade hier. Für Mackies Leben gebe ich auch keinen Cent mehr.«
»Und für deins?«
»Mich schützt Top, wenn ich nicht allzu große Dummheiten mache.«
»Schuft bist du.«
»Das kannst du nennen, wie du willst! Ich habe dich jedenfalls gewarnt. Schade, dass du den Zug verpasst hast.«
»Ich habe ein Pferd.«
Während dieses Gespräch stattfand, war Harka noch einmal in sein Zelt zurückgekehrt, aber nur, um sich seine Büffelhautdecke zu holen. Er schnallte sie dem Grauschimmel um, ritt in die Prärie hinaus und suchte an diesem Tag mit seinem Mustang zusammen einen Schlafplatz im Freien. Er konnte das verstümmelte Gesicht der Seminolenfrau, ihren wieder stumm gewordenen Hass und die Lippen mit den wieder verstummten Fragen nicht sehen, und er wollte seinem Vater an diesem Tag nicht mehr begegnen.
So schlief er mit seinem Mustang draußen in Staub und Gras, holte sich abends im Zelt ein Stück Fleisch zu essen und begab sich dann wieder zu dem Spähdienst, zu dem er sich verpflichtet hatte.