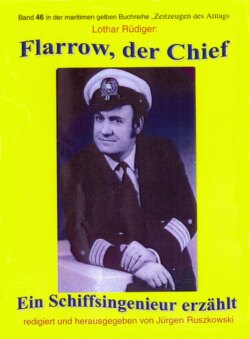Читать книгу Flarrow, der Chief – Teil 3 - Lothar Rüdiger - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chief auf KMS „HILDEGARD“
ОглавлениеChief auf KMS „HILDEGARD“
Als Chief wird der Chef der Maschinenanlage bezeichnet, sei er nun Erster Maschinist, Erster Ingenieur oder Leitender Ingenieur. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet Häuptling oder Oberster. Oberingenieur oder Chefingenieur lautet die deutsche Übersetzung für Chief-Engineer. Der Heuertarif kennt nur den Ersten Ingenieur, der in aller Regel Wache geht (Chiefwache: 08–12 / 20-24 Uhr) und drei Streifen trägt, wie der Erste Offizier auch. Der Vergleich mit dem Ersten Offizier hinkt, weil der auch fachlich dem Kapitän unterstellt ist. Das ist bei dem Ersten Ingenieur nicht der Fall. Er hat keinen Fachvorgesetzten und ist für seinen Bereich allein verantwortlich; dies natürlich auch als Disziplinarvorgesetzter der Maschinencrew. In der britischen und amerikanischen Handelsmarine tragen die Chiefs vier Streifen wie der Kapitän, dem sie nur disziplinarisch unterstellt sind. Bei der Hamburg-Süd tragen die Chiefs, wenn sie Leitende Ingenieure sind, drei und einen halben Streifen. Im Spannungsfeld Deck / Maschine spielt das natürlich eine Rolle. Da der Kapitän nämlich nicht Mitglied der Besatzung ist, ist klar, dass der Erste Ingenieur als höchster Dienstgrad die Besatzungsliste anführt. Das sehen die Ersten Offiziere als Stellvertreter des Kapitäns gerne anders als die Chiefs.
Wenn das Verhältnis zwischen Deck und Maschine stimmt, ist das alles nicht so wichtig. Wenn nicht, sind bekanntlich klare Regeln immer die beste Lösung.
* * *
„Mit Wirkung vom 10. Januar 1967 befördern wir Sie zum Leitenden Ingenieur. Wir bitten Sie, diese Beförderung als Anerkennung für Ihre bisher geleisteten Dienste zu betrachten und hoffen auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.“
Flarrow las die Zeilen noch einmal und begriff, dass er nun sein Berufsziel erreicht hatte. Er würde diese Anerkennung unter Beweis stellen müssen, aber davor war ihm nicht bang. Bei der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, auch kurz Hamburg-Süd genannt, als Chief, das war doch etwas, und das machte ihn stolz!
Kurz vor Weihnachten, auf dem Heimweg von Flensburg nach Kassel, hatte er sich in der Nautisch-Technischen Abteilung der Reederei gemeldet, wo man ihn bereits erwartet hatte.
Sie hatten ihm sofort angedeutet, dass man ihn als Leitenden Ingenieur einsetzen würde. Ja, er könnte unter drei Schiffen wählen. Das waren die Motorschiffe „CAP DELGADO“, „CAP COLORADO“ und „HILDEGARD“.
Die beiden CAP-Schiffe fuhren derzeit im Liniendienst der Columbus-Line Ostküste Nordamerika / Ostküste Südamerika und Südost-Asien / Papua Neuguinea, eine vor allem bei Junggesellen sehr begehrte Route im Südseeraum. Die „HILDEGARD“ lief als Tiefkühlschiff in weltweiter Tramp- und Charterfahrt. Sie war das kleinste und am wenigsten reizvolle Schiff des Angebotes. Gegenüber den beiden CAP–Schiffen, mit knapp 5.000 BRT, war „HILDEGARD“ mit gerade einmal 1.352,1 BRT und 72 m Länge eher ein fett gemachtes Küstenmotorschiff.
Für keines der ihm angebotenen Schiffe war ein C6-Patent erforderlich, das Flarrow ja auch noch nicht besaß, weil deren Maschinenleistungen unter 6.000 PS lagen. Allerdings waren die 1.350 PS der „HILDEGARD“ für ein ausgefahrenes C5-Patent auch schon beinahe etwas peinlich, wenn man von der geltenden gesetzlichen Regelung der Schiffsbesetzungsordnung ausging. Man gab ihm Bedenkzeit. Er sollte sich in Ruhe entscheiden, aber Flarrow kapierte sofort. Die Angebote passten nicht zueinander, also hatte das mit KMS „HILDEGARD“ einen besonderen Grund, und deshalb entschied er sich für dieses Schiff, das derzeit in einem jugoslawischen Hafen Schweineschmalz für London lud.
KMS „Hildegard“ gehörte der Nord-Ost-Reederei Konsul Westphal, war auf der Elsflether Werft gebaut und 1958 in Dienst gestellt worden. Von 1962 an lief sie in Bareboat-Charter der Reederei H. C. Horn, dem „Kleinen Horn“, wie sie an der Küste sagten. H. C. Horn wiederum gehörte der Hamburg-Süd und betrieb eine Reihe kleiner, hoch moderner Kühlschiffe, die meisten in der weltweiten Trampfahrt.
In Charter der spanischen Firma PESCANOVA S. A. / Vigo sollte "HILDEGARD“ Fisch von spanischen Trawlern, die in der Antarktis fischten, übernehmen und nach Spanien transportieren.
Langfristig wäre daran gedacht, auch von deutschen Trawlern in der Antarktis, Fisch nach Deutschland zu bringen. Dazu müsste allerdings die Kühlanlage besser laufen als jetzt, sagte man ihm in der Nautisch-Technischen Abteilung (NTA).
Losgehen sollte es Mitte Januar 1967. Weihnachten und Silvester würde er also dieses Jahr zu Hause verbringen können.
Anfang Februar war es soweit, Flarrow fuhr nach Hamburg, bekam ein paar Informationen über den technischen Zustand des Schiffes, die nicht überraschten und flog nach London.
KMS „HILDEGARD“ lag am Themse-Kai, gleich hinter der Tower Bridge, und als Flarrow aus dem Taxi stieg, reckte sie ihm ihren eher plumpen Bug entgegen, den ein Zwölf-Knoten-Schiff hatte, wenn es bei einer Länge von 72 Metern einen Laderauminhalt von 62.000 Kubikfuß besaß. Da keine Ladung mehr an Bord war, lag sie hoch heraus, was von der Flut, die gerade lief, noch unterstützt wurde.
Ein fett gemachter Kümo, dachte Flarrow, nahm seinen Koffer auf und ging über die Gangway an Bord. Dort begegnete ihm ein Steward, den er an einer ehemals weißen Jacke erkannte. „Wo wohnt der Chief?“ fragte er, und der Steward antwortete, indem er schweigend mit der Hand nach oben zeigte. Ein Deck höher klopfte er an die Tür mit dem Schild „Ltd. Ingenieur“ und öffnete sie, als er ein geknurrtes „Herein“ hörte. Im abgedunkelten Wohnraum saß ein schon etwas älterer Mann in der Sofaecke, der sich sofort erhob und auf ihn zukam, als er eintrat. „Sie sind meine Ablösung, nicht wahr? und Sie sind von der Süd, nicht wahr?“ Flarrow nickte. „Bestimmt Ihr erstes Schiff als Chief, nicht wahr?“ Flarrow nickte abermals.
„Also hier ist soweit alles o. k. Wir haben den Laden in Schuss, wollen ja euch jungen Leuten nicht die Karriere versauen, nicht wahr?“ Als Flarrow nun etwas sagen wollte, unterbrach ihn der Chief. „Haben Sie gerade C5- oder den C6-Lehrgang gemacht?“ - „Den C6-Lehrgang habe ich gemacht.“ – „Na dann wird ja die Personallage langsam besser, nicht wahr?“ Flarrow erklärte ihm, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland zugenommen hätte und die Leute sich um Arbeit mehr bemühen müssten, als bisher.
Dann hörte man Lärm auf dem Niedergang zum Hauptdeck, und der Chief fragte, ob das eventuell der neue Kapitän wäre. Es würde sowieso Zeit, dass der alte abgelöst würde. Der wäre ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, man könnte sich gar nicht mehr richtig mit dem unterhalten. Er hätte ja auch bloß immer seine Briefmarkensammlung im Kopf. „Gehen wir doch gleich mal rüber zum Alten, damit ich Sie vorstellen kann, nicht wahr?“ Flarrow nickte abermals.
Zwischen den Wohnräumen von Chief und Kapitän lag der Salon. Im Hafen wurden hier die Behörden und Agenten empfangen, außerdem war der Salon auch der Speiseraum für die leitenden Offiziere.
Im Salon war viel Betrieb, die Ablösung für den Kapitän und einen Steuermann war zusammen mit einigen Matrosen eingetroffen. Die Matrosen schickte der Erste Offizier schon bald nach Entgegennahme ihrer Seefahrtsbücher nach unten. Flarrow erregte Aufsehen, als bekannt wurde, dass er von der Hamburg-Süd kam. „So, so, von der Süd kommt der und nicht von H. C. Horn, da haben die wohl zu viel Leute?“, wurde gesagt.
Später erfuhr er, dass das Personal der verschiedenen Reedereien innerhalb der Hamburg-Süd-Gruppe unterschiedlich behandelt wurde. So mussten die Leute von H. C. Horn beispielsweise ihre Uniform selbst kaufen und bezahlen, während die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft die Uniformen stellte. Deshalb waren Offiziere von der Hamburg-Süd für die Leute von den Horn-Schiffen so etwas wie „feine Pinkel“.
Nach dem Abendessen saß man noch im Salon zusammen. Die Besatzung von ursprünglich neunzehn Mann war in den letzten Monaten auf vierzehn reduziert worden, darunter waren auch der Funker und der Dritte Offizier. Darüber wurde nun lange und lauthals gemeckert.
Der Zweite Offizier kam ebenfalls aus Kassel, und der neue Kapitän sagte nicht viel, hörte sich das Geschwafel seines Vorgängers an, das sich schon bald um seine Briefmarkensammlung drehte. Der Chief betonte immer wieder, wie sehr sie gearbeitet hätten, um den Laden in Schuss zu bringen. Vor der Jugoslawienreise war das Schiff bereits in Charter für Pescanova S. A. gewesen. Sie hätten vier Wochen vor Walvis Bay auf Reede gelegen und auf die Trawler gewartet. Da wäre gut Zeit gewesen, alles auf Vordermann zu bringen.
„Sie werden gut zurechtkommen und können bei der Reederei einen guten Eindruck machen, nicht wahr?“
Flarrow, dem das „Nicht wahr“ bereits auf die Nerven ging, nickte nur noch. Am nächsten Morgen verschwanden die Urlauber. Zwei überholte Generatoren wurden angeliefert, mit eigenem Geschirr an Bord genommen und vom Dritten und dem Elektriker montiert.
Flarrow betrat den Maschinenraum und glaubte zunächst nicht, was er da sah. Im Kopf hatte er immer den Maschinenraum des Hornschiffes, das sie damals in Leixöes getroffen hatten, als er noch Zweiter auf der „LORENZO“ war. Der war klar aufgebaut, klein aber gediegen und vor allem blitzsauber. Hier dagegen gab es das nicht. Dieser Maschinenraum war völlig verbaut, als ob man ihn nachgerüstet hätte, wozu man den vorhandenen Raum völlig wahllos genutzt hatte. Es herrschte eine Enge, so dass viele Maschinen kaum zugänglich waren. Ungepflegt war der gesamte Maschinenraum auch. Schmierige Geländer, Öl und Dreck auf den Flurplatten, sogar vor dem Fahrstand!
Als Flarrow den Zweiten kennen lernte, der exakt das vorstellte, was man als „Schmierpäckchen“ bezeichnete, war ihm alles klar. Der Elektriker, ein bulliger Typ, sah Flarrow schief an, weil der in Uniform auftrat. Er ließ ihn deshalb sogleich wissen, dass sie hier genug zu tun hätten und keinen Hamburg-Süd-Chief bräuchten. Flarrow lächelte nur und verlangte vom Zweiten Meldung, wenn die Generatormontage beendet wäre, da er bei der Inbetriebsetzung dabei sein wollte. Der wachhabende Assistent, rein äußerlich zu den beiden vorgenannten passend, stand am Fahrstand und hatte Mühe, die Hände aus den Taschen zu bekommen, als sich Flarrow vorstellte. Die Ablehnung die ihm hier entgegen gebracht wurde, konnte man förmlich greifen. Als er an Deck kam, torkelte einer über die Gangway an Bord. Der Betrunkene, den niemand sonst wahrnahm, verschwand im Deckshaus. An Deck wurde aufgeklart und seeklar gemacht. Der Zweite Offizier spielte den Bootsmann. Flarrow war kaum in seiner Kabine, als der Alte kam und ihn fragte, wie es denn so aussehen würde mit der Maschine. Er grinste nur und fragte zurück, wann es denn losgehen sollte. „Sobald Sie mit der Maschinenreparatur fertig sind. Schaffen Sie das bis heute Nachmittag? Ab vierzehn Uhr ablaufendes Wasser, das wäre der richtige Zeitpunkt.“ Flarrow nickte dazu und prüfte auf die Schnelle noch die wichtigsten Papiere auf Vollzähligkeit.
Gegen Mittag kam der Zweite und meldete die beiden Generatoren klar. Sie wären in Ordnung, und der Elektriker hätte jetzt beide Aggregate am Bordnetz. Flarrow sagte dazu nichts. Der Zweite hatte nämlich die gegebene Weisung, vor der Inbetriebnahme der Generatoren Bescheid zu sagen, einfach nicht beachtet. „Können wir um vierzehn Uhr auslaufen?“, fragte er den Zweiten, der das bestätigte. „Also, dann um vierzehn Uhr Maschine klar.“
In der Kabine des Kapitäns saß auch der Erste Offizier, ein sympathischer junger Mann, der Flarrow darauf aufmerksam machte, dass Uniformen auf diesem Schiff abgelehnt würden. „Von wegen feine Pinkel, die Streifenträger oder so?“, antwortete Flarrow. „Genauso, ich sage das nur, um zu informieren. Mir persönlich ist das egal.“ – „Na, da bin ich aber beruhigt“, sagte der Kapitän. Und zu Flarrow gewandt: „Chief, die mögen uns hier also nicht, was halten Sie davon?“ – „Warten wir es ab“, meinte Flarrow. Nach den Erlebnissen des Vormittags konnte es ja eh nur besser werden.
Flarrow war nicht in der Maschine, als es losging. Er überließ alles dem Zweiten, der das gewöhnt war. Sollten sie glauben, was sie sahen. Einen uniformgeilen Hamburg-Süd-Chief, der natürlich keine Ahnung hatte und schon gar nicht mit anpacken würde.
Deshalb hatte Flarrow Zeit, den Tower zu betrachten, als „HILDEGARD“ die extra für sie geöffnete Tower Bridge passierte.
Bei der ersten Hartruderlage, die das Schiff überholen ließ, war aus der Maschine ein Alarm zu hören, und die Hauptmaschine stotterte etwas. Flarrow gab sich alle Mühe gelassen zu wirken, wohl wissend, dass der Alte ihn aus den Augenwinkeln beobachtete. Als sie dann die nächste Flussbiegung erreichten, wiederholte sich der Vorgang, und die Hauptmaschine stoppte. Da gab es kein Halten mehr, der Lotse wurde nervös, und Flarrow stürzte in den Maschinenraum, wo der Zweite inzwischen die Hauptmaschine wieder gestartet hatte und lächelnd erklärte: „Wir fahren so wenig Schmieröl wie möglich, denn das spart ja bekanntlich. Wir setzen jetzt aber Schmieröl zu.“
Flarrow ließ Öl peilen und sah, dass der Ölstand unter dem Minimum lag. Außerdem war das Öl ziemlich trüb und dunkel, also stark verunreinigt. „Füllen Sie sofort Schmieröl auf, bis zum mittleren Ölstand. Was ist mit dem Schmierölseparator, ist der in Ordnung?“ – „Ja.“ – „Das Öl ist sehr dreckig, sehen Sie das nicht. Wir müssen, glaube ich, über Verschiedenes reden, sobald wir auf See sind.“
Gegen achtzehn Uhr ging der Lotse von Bord, und die Seereise begann. Flarrow erregte großes Staunen, als er im Kesselpäckchen zur Übernahme seiner Abendwache erschien. Das waren sie also nicht gewöhnt, dachte er. Der Zweite hatte gerade auf Schweröl umgestellt, und weil die Temperatur des Brennstoffs viel zu niedrig war, lief die Maschine hart. Nach ein paar Minuten bekamen zwei Zylinder nicht mehr genug Treibstoff, und die Drehzahl fiel. Der Zweite war nicht überrascht und sagte der Brücke Bescheid, dass sie stoppen müssten. Das geschah dann auch, und nach dem Wechsel von zwei kleinen Rückschlagventilen im Brennstoffpumpenblock lief endlich alles rund. Die Vier-Acht-Wache ging nach oben, während Flarrow in seinem Wachgänger den betrunkenen Mann vom Vormittag erkannte. „Ich bin Jan van Thaden und Schmierer hier an Bord.“ Jan hatte ein niederländisches Seemaschinistenpatent, das auf deutschen Schiffen nicht galt. Deshalb fuhr er hier nur als Schmierer. Man konnte natürlich den Verdacht haben, dass Jan nur auf deutschen Schiffen fuhr, weil er, aus welchen Gründen auch immer, in den Niederlanden keine Heuer mehr bekam. Jan war hier immer die Chiefwache allein gegangen, was nicht unüblich war, und er hatte den Laden im Griff. Flarrow begann sich in die Anlage einzuarbeiten und fragte dieses und jenes. Dabei entdeckte er zunächst, dass es in der Werkstatt kein Werkzeug gab. Das würde der Zweite unter seiner Koje fahren, weil das angeblich immer geklaut würde, sagte Jan. Es gab also noch eine Menge Merkwürdigkeiten hier an Bord. Kaum zu glauben, aber trotzdem wahr, leider.
Der Schmierölseparator, der normalerweise ein Reinigungsintervall von vierundzwanzig Stunden hatte, war bereits nach zwei Stunden reif für die Reinigung. Das interessierte aber augenscheinlich niemanden. Eine Peilung der Ölreserven ergab Überbestände von rund zwanzig Prozent, aber warum so wenig Schmieröl im Hauptmotor gefahren wurde, wusste auch Jan nicht. Das hatte der Chief so gewollt, war die lakonische Antwort.
Gegen zweiundzwanzig Uhr rief der Alte an und fragte, ob Flarrow wohl ein paar Minuten Zeit hätte, die Nachrichten der Deutschen Welle zu hören. Das tat Flarrow auch. Nach den Nachrichten fragte der Kapitän, wie es denn so ginge im Maschinenraum. Flarrow sagte ihm seine Meinung und beschönigte nichts. So etwas haben sie mir in Hamburg auch angedeutet, meinte der Alte. An Deck sähe es nicht viel besser aus, nur die Steuerleute wären o. k. Dafür gäbe es aber nur zwei, so dass er als Kapitän gegebenenfalls auch Wache gehen müsste.
Er erzählte nun Flarrow, was er von seinem Vorgänger gehört hatte. Der hatte den Chief wegen irgendeiner Geschichte zu Hause verpetzt. Der Chief wiederum hatte sich diesbezüglich revanchiert, und so hatten die beiden vor den Augen der ganzen Besatzung einen offenen Kleinkrieg geführt. Flarrow kapierte, das hier nicht nur in der Maschinenanlage einiges zu richten war. Der Kapitän erwähnte auch die Kühlmaschine, daran wären sie in Hamburg besonders interessiert. Wegen einer zukünftigen Charter müsste die Anlage viel besser laufen. Dazu konnte Flarrow allerdings noch nichts sagen. Dessen Hauptsorge waren zunächst die Dieselmotoren. Neben dem Hauptmotor gab es auch die vier Hilfsdiesel. Das waren Lkw-Motoren der Firma Büssing, für die kaum Ersatzteile vorhanden waren. Die gemeinsam gehörten Nachrichten der Deutschen Welle wurden schon bald zur guten Gewohnheit.
Um Mitternacht übergab Flarrow seine Wache einem Dritten, der darüber staunte, dass der Chief um diese Zeit in der Maschine war. Von ihm erfuhr Flarrow auch, wie die Geschichte mit dem Schmieröl lief. Öl aus der Hauptmaschine wurde in den Hilfsdieseln weiter verwendet! Flarrow sträubten sich die Haare. „Machen Sie sofort bei allen Hilfsdieseln Ölwechsel. Fangen sie das Altöl auf, ich möchte sehen, ob wir Wasser im Öl haben und wie viel.“ Der Dritte strahlte. Endlich konnte er seinen Dieseln etwas Gutes tun.
Als Flarrow am nächsten Morgen wieder im Kesselpäckchen zur Wachablösung erschien, fehlte der Elektriker, der noch in der Koje lag. Es hatte nämlich in der vergangenen Nacht ein Besäufnis gegeben, und da schlief man eben seinen Rausch aus. Er wurde unsanft geweckt und erhielt sofort eine Menge Aufträge, so dass er gar nicht dazu kam, nach einer Entschuldigung zu suchen. Der Assistent von der Null-Vier-Wache wurde zum Zutörnen geweckt und zwar vom Chief persönlich. Flarrow musste wissen, wie es um die Hilfsdiesel stand. Der Zweite hatte den Vormittag über dafür zu sorgen, dass das Werkzeug, welches er in seiner Backskiste gestaut hatte, wieder in die Werkstatt kam. Dagegen protestierte er zwar, aber das rührte Flarrow nicht. Der neue Style erzeugte aber auch Respekt, denn auf einem so kleinen Schiff gibt es kaum Geheimnisse.
Als Flarrow beim Koch auftauchte, wurde er sehr zuvorkommend behandelt. „Eine Tasse Kaffee vielleicht?“ Flarrow sagte nicht nein und fragte so nebenbei, ob der Koch irgendwelche Probleme hätte. „Herd o. k? Wie sieht es in den Proviantkühlräumen aus? Temperaturen zufriedenstellend?“
Sie sollten Dakar anlaufen, um zu bunkern und dann weiter nach Kapstadt gehen. Bis Dakar waren es zehn Reisetage, bis dahin wollte Flarrow einen Zustandsbericht über die gesamte Maschinenanlage fertig haben. Deshalb gab es jede Menge Überstunden für die Maschinencrew.
Sie waren sieben Mann in der Maschine; drei Ingenieure, zwei Assistenten, ein Schmierer und ein Elektriker. Damit war nur der Elektriker auf Tageswache, alle andern gingen Seewache und mussten deshalb auch in ihrer Freiwache zwei bis drei Stunden arbeiten. Flarrow hatte auf einem Fischdampfer und auf der „BERLIN“ gelernt, was er seinen Leuten zumuten durfte und ging mit gutem Beispiel voran. Das wirkte bei allen, bis auf den Elektriker. Als Flarrow jedoch bei einer Inspektion der Schalttafel eine mit einem Nagel überbrückte 160 Ampere-Schmelzsicherung entdeckte, gab auch der seinen Widerstand auf. Es wurde ihm nämlich klar gemacht, dass das ein schwerer Verstoß gegen die Schiffsicherheit war, die ihn nicht nur seinen Job, sondern auch seinen Facharbeiterbrief kosten könnte. „Wenn Sie hier nicht mitspielen“, sagte Flarrow, „fliegen Sie. Von mir aus auch von Kapstadt. Vergessen Sie das niemals, so lange Sie bei mir fahren.“
Jan van Thaden zeigte, was er konnte, nahm die Gelegenheit wahr, mit Überstunden einiges dazu zu verdienen und wurde eine große Hilfe für Flarrow, weil er sehr zuverlässig war. Der Kapitän fragte an, ob Flarrow für eine Inspektion der beiden Ladeluken Zeit hätte. Flarrow freute das, weil das nach guter Zusammenarbeit aussah. Die Laderäume waren inzwischen gereinigt und klar zum Laden von Lebensmitteln. Der Kapitän, der schon länger bei H. C. Horn fuhr und deshalb Tiefkühlschiffe kannte, meinte, dass hier wohl vieles nachgerüstet worden wäre. So war das auch. Bestellt war das Schiff ursprünglich als Trockenfrachter für kleine und mittlere Fahrt. Allerdings hatte man sich kurz vor der Indienststellung entschlossen, ein Kühlschiff daraus zu machen. Die gesamte Kühlmaschinenanlage und ein Hilfsdiesel waren deshalb in den Laderaum II hineingebaut worden. Weil Laderaum dem Reeder lieb und teuer ist, war es im Kühlmaschinenraum entsprechend eng. In den Laderäumen gab es ein paar kleine Reparaturen, die der Zweite Ingenieur zusammen mit einem Matrosen während seiner Freiwache erledigte. Das war ein damals durchaus nicht übliches Teamwork von Deck und Maschine.
Inzwischen hatten sie die Kanarischen Inseln passiert, der Nordostpassat wurde spürbar und hilfreich. Und der Kanarenstrom sorgte ebenfalls für gute Etmale. Am zehnten Reisetag kam Kap Verde in Sicht. Flarrow saß hinter seiner Schreibmaschine und tippte seinen Zustandsbericht, dem er eine ausführliche Ersatzteilbestellung beifügte.
Am nächsten Morgen gingen sie in Dakar an die Bunkerpier. Der französische Agent mahnte zur Vorsicht, es gab Spannungen mit der schwarzen Bevölkerung. Die würden den Leuten von der Besatzung Waffen anbieten, und wenn die dann gekauft hätten, würde die Polizei das Schiff auf den Kopf stellen, bis die Waffen gefunden wären. Daraus würde dann eine saftige Strafe für das Schiff werden, das so lange aufgehalten würde, bis die Reederei gezahlt hätte.
Dementsprechend wurden alle Leute vergattert und Landgang untersagt, was nicht zur allgemeinen Fröhlichkeit beitrug.
Aufgrund der Erfahrung des Zweiten wurden alle Auslassventile der Hauptmaschine gewechselt. Flarrow stimmte zu, obwohl diese Ventile gerade einmal zweihundertfünfzig Betriebsstunden gelaufen hatten. Der Schwerölbetrieb wäre daran schuld, die Auslassventile wären dafür völlig ungeeignet. So sah es zumindest der Zweite Ingenieur. Das Bunkern verzögerte sich, weil es den schwarzen Bunkerleuten am Tag dafür zu heiß war. Flarrow nutzte die Gelegenheit, einen Kolben zu ziehen, bei dem sich vermutete Risse bestätigten. Die Post nach Hamburg wurde noch einmal geöffnet und zusätzlich zwei neue Kolben für die Hauptmaschine bestellt. Am späten Abend begann das Bunkern endlich, und es sollte die Nacht über dauern. Gegen zwanzig Uhr kamen zwei blonde Damen weißer Hautfarbe an Bord. Sie erregten natürlich Aufsehen und fragten ziemlich ungeniert nach Hering in Dosen und Schwarzbrot. Sie wären Mitglieder eines deutschen Sinfonieorchesters, welches im Zuge eines Entwicklungshilfeprogramms den Eingeborenen in Stadt und Land klassische Musik zu Gehör bringen sollte. Das löste natürlich großes Staunen, aber auch Entrüstung bei der Schiffsleitung aus. Man konnte das einfach nicht glauben. Die Ladies zogen dann auch bald mit einer großen Dose Rollmops und Graubrot, das an Bord gebacken worden war, ab. Am Morgen mussten sie noch auf das Schmieröl, das in Fässern geliefert wurde, warten. Die durften nämlich während des Bunkerns nicht geliefert werden. Eine reine Schikane, um die Liegegebühr zu erhöhen. Aber der französische Agent zuckte nur mit den Achseln. Der Schwarze Mann hatte hier in der Republik Senegal das Sagen, und die abziehende französische Kolonialmacht hatte nur in einem sehr beschränkten Umfang für eine gute Verwaltung gesorgt. Es wurde Mittag, bis sie endlich loswerfen konnten und nach dem obligatorischen Stopp beim Umstellen auf Schweröl ging Flarrow endlich in die Koje, die ihn zwei Nächte lang nicht gesehen hatte. Am nächsten Tag wurde die Ladekühlanlage in Betrieb genommen. Im Kühlmaschinenraum standen vier Kompressoren so eng beieinander, dass man zwischen ihnen kaum stehen konnte. Der Antriebsmotor des Kompressors I war nicht ganz in Ordnung. Das lag an zwei Kühlwasserpumpen, die genau über dem Motor direkt an der Bordwand auf einem Podest montiert waren. Bei Leckagen an den Pumpen oder den Rohrleitungsanschlüssen lief dann das Kühlwasser auf den nur gegen Spritzwasser geschützten Elektromotor, was dem natürlich nicht bekam. Offensichtlich waren die Pumpen bei der hastigen Planung völlig vergessen und im letzten Moment dann eben wegen Platzmangels so unglücklich platziert worden. Der Elektromotor, der nicht durch den Zugang zum Kühlmaschinenraum passte, war auf der Reise von London nach Dakar zerlegt und im Herd der Kombüse getrocknet worden. Die Kühlwasserpumpen hatten Leckbleche bekommen, und ihre Stopfbüchsen waren so gut es ging neu verpackt worden. Das war deshalb schwierig, weil die Pumpenwellen starke Riefen aufwiesen und Ersatz nicht vorhanden war.
Außerdem gab es im Kühlmaschinenraum noch ein Dieselaggregat, das auf einem Podest montiert war. Der Dieselmotor stand direkt am Schott zum Maschinenraum, seine Abgasleitung wurde aber noch über zwei Meter im Kühlmaschinenraum geführt und das nicht schwingungsfreie Podest sorgte dafür, dass die Abgasleitung stark vibrierte. Das Ganze war konstruktiv eine Zumutung, ganz zu schweigen von der Brandgefahr, die von der vibrierenden Abgasleitung ausging. Ändern konnte man das jedoch nicht mehr.
Unter den misstrauischen Augen des Zweiten wurden nun die einzelnen Kompressoren gestartet. Das ging auch bei Kompressor I ganz gut. Nachdem alle Kompressoren gelaufen hatten, blieb ein Kompressor in Betrieb, um die Laderäume vorzukühlen. Die Lufttemperaturen im Laderaum begannen sofort zu sinken, was ein gutes Zeichen war. Am Abend erreichten sie null Grad Celsius, und Flarrow widmete sich beruhigt seinem Bürokram. Zum Wachwechsel um Mitternacht zeigten die Fernthermometer minus fünf Grad. Alle anderen Temperatur- und Druckanzeigen lagen im normalen Bereich. Nach einem kurzen Schwätzchen mit dem zweiten Offizier, der die Null-Vier-Wache auf der Brücke ging, machte Flarrow seine Kojenlampe aus. Gegen sechs Uhr tauchte er unerwartet im Maschinenraum auf. Der Zweite stand in der Werkstatt an der Drehmaschine. Flarrow warf zunächst einen Blick auf die Laderaumtemperaturen. Die Fernthermometer zeigten nur minus fünf Grad!
Nun ging er zum Zweiten in die Werkstatt und sah, dass der die Sitze von neuen Auslassventikegeln abdrehte. Der Zweite erklärte ihm, dass er die neuen Kegel überdrehen würde, damit die Sitze dann auch passen würden, viel einzuschleifen wäre da dann nicht mehr. Das hätte Flarrows Vorgänger herausgefunden. Flarrow fragte zurück, ob er denn die Lieferscheine nicht lesen würde, denn dann wüsste er, dass die Sitze mit Stellit beschichtet wären, wie das für Schweröl erforderlich sei. Die dürfte man natürlich nicht überdrehen, höchstens schleifen. Der Zweite schwieg dazu. Flarrow wurde nun einiges klar. Durch das Abdrehen der Stellitsitze war die Oberfläche beschädigt worden, und das führte schon nach kurzer Standzeit zu diesen merkwürdigen Auskohlungen, die er in Dakar gesehen hatte. Der Zweite hatte mit seiner Abdreherei genau das Gegenteil von dem erreicht, was durch die Beschichtung vermieden werden sollte!
Die Geschichte mit den stellitisierten Ventilkegeln konnte man ja noch verzeihen. Es war nicht üblich, dass von der Reederei solches Wissen mitgeteilt wurde; ein ganz schlechtes Zeugnis lieferte der Zweite aber damit, dass er das Abdrehen auf einer völlig „ausgeleierten“ Drehmaschine vornahm, mit der die erforderliche Präzision gar nicht mehr erreicht werden konnte. Es ging also offenbar darum, das mühevolle Einschleifen von Kegel und Sitz zu umgehen, und das roch, wie vieles seiner Aktivitäten auch, nach Faulheit. „Was ist mit den Laderäumen?“, fragte Flarrow. „Die habe ich schon weiter aufgedreht, damit die Temperaturen sinken.“ – „Sie haben was?“ Der Zweite antwortete nicht, und Flarrow überprüfte die Expansionsventile, die alle völlig falsch eingestellt waren. Was er herausfand war, dass der Zweite den Kälteprozess überhaupt nicht verstanden hatte. Da platzte ihm der Kragen, aber ehe er anfing, den Zweiten anzuschreien, stürzte er an Deck, fraß das Erlebte in sich hinein und lief zwei Tage mit Magenschmerzen herum.
Flarrow hatte die Expansionsventile eingestellt und drohte jedem mit fristloser Entlassung, der sich an diesen Ventilen noch einmal vergreifen sollte. Auf der Nachmittagswache sprach er mit dem Dritten, der ihm erzählte, wie das mit dem Kühlbetrieb bisher gelaufen war. Vorkühlung maximal minus zehn Grad, schon um Treibstoff zu sparen. Die Spanier hätten das nie überprüft. Der Fisch kam mit minus dreißig Grad Celsius in die Räume, und auf der Reise bis zum Äquator hatte er dann die Laderäume auf minus vierzehn oder fünfzehn Grad herunter gekühlt. In Vigo wurde die Ladung mit sechzehn bis achtzehn Minusgraden gelöscht. Da aber die Lukenabdeckung entweder nicht dicht oder schlecht isoliert war, hatten die Kartons der obersten Lage selten mehr als minus fünfzehn Grad. Das war natürlich nicht kalt genug, Fisch musste kälter als minus achtzehn Grad gefahren werden, damit die Qualität erhalten blieb. Ein Logbuch für die Kälteanlage wurde hier auch nicht geführt. Das stünde ja alles im Maschinentagebuch, und die Spanier nahmen das so hin. Das waren weiß Gott unhaltbare Zustände, und die Inspektion in Hamburg „wusste (angeblich) nicht genau“ was hier an Bord los war?
Nach insgesamt dreißig Stunden Vorkühlbetrieb waren die Laderäume der „HILDEGARD“ auf minus zwanzig Grad, weshalb der Betrieb gestoppt wurde.
Flarrow änderte die Zuständigkeiten und gab dem Zweiten die Hauptmaschine, der Dritte behielt den Hilfsbetrieb, und er selbst kümmerte sich allein um die Kälteanlage. Für die verbleibende Zeit bis Kapstadt, sah er sich die Kompressoren genau an, beseitigte eine Reihe von Mängeln. Kurbellager, Ventile und Kolbenringe waren in einem sehr schlechten Zustand, obwohl es an Ersatzteilen nicht mangelte. Die Arbeit wurde sehr schnell mühevoll, weil das Wetter nun nicht mehr mitspielte.
Der Südost-Passat trat sehr früh, also noch in Äquatornähe, auf. Der Alte war so lange als möglich unter Land geblieben, um den mitlaufenden Guinea-Strom zu nutzen. Aber spätestens ab der Höhe von Freetown, wo das Land immer mehr zurück wich, hatten sie den Äquatorialstrom gegenan, und das würde bis Kapstadt so weiter gehen.
Der kräftige Passat hatte Zeit und Raum genug, eine See aufzubauen, die „HILDEGARD“ nur schwer meistern konnte. Obwohl alle Ballasttanks geflutet waren, ragte das Vorschiff wegen der achtern liegenden Maschinenanlage und den Aufbauten hoch heraus. Durch den geringen Tiefgang tauchte auch der Propeller nicht tief genug ein und war deshalb nicht so wirksam, wie es erforderlich war. „HILDEGARD“ quälte sich in Berg- und Talfahrt nach Südosten, und in der Maschine fluchte Flarrow, der mit dem Kopf im Kurbelraum eines Kältekompressors hing, während sein Werkzeug durch die Schaukelei, rasselnd über die Flurplatten rutschend, in der Bilge verschwand. Dem Dritten, der einen Hilfsdiesel überholte, ging es nicht viel anders.
Um das Schiff zu entlasten, steuerte der Alte Zick-Zack-Kurse, wie ein Segelschiff, das aufkreuzte. Trotzdem konnte die Dienstgeschwindigkeit von zwölf Knoten nicht annähernd gehalten werden.
An einem grauen Sonntagmorgen, an dem nicht gearbeitet wurde, ging Flarrow auf die Brücke, wo der wachhabende Kapitän angewidert in die graue See blickte.
Eigentlich war es ein eher majestätisches Bild, das Flarrow immer wieder begeisterte. Mit Blick auf den Alten behielt er aber seine Gefühlsausbrüche lieber für sich.
Zwischen beiden hatte sich ein recht freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Einmal hatte der Kapitän ihn auf der Abendwache im Maschinenraum besucht. Da er die „Hörnchen“ kannte, kam er sich hier in dieser „Zeche Elend“ ziemlich verloren vor, und als Flarrow ölverschmiert und dreckig aus der Bilge auftauchte, schüttelte er nur noch den Kopf und verschwand nach oben. Das wäre ja kein Maschinenraum mehr sondern ein Dreckstall und alles wäre so furchtbar durcheinander. Flarrow gab ihm Recht. Für groß angelegte Reinigungsarbeiten war eben noch keine Zeit gewesen, abgesehen davon, dass auf „HILDEGARD“ kein Reiniger gefahren wurde. Damit musste man leben, wenigsten im Moment noch. Der Kapitän fragte, warum der seegrüne Anstrich der Hauptmaschine entfernt worden war. Flarrow fragte den Zweiten danach und erfuhr, dass sie während der Liegezeit vor Walvis Bay die Farbe „mechanisch“ entfernt hätten. Der Chief hätte gemeint, dass das den Wirkungsgrad der Maschine verbessern würde. Während dieser Liegezeit hatte aber der Zweite auch die beiden Brennstoffpumpenblöcke aufgenommen und „generalüberholt“. Er hatte damit dafür gesorgt, dass Farbsplitter in die Brennstoffpumpenblöcke gekommen waren, die schon mehrmals zu Störungen geführt hatten. In der Regel bedeutete das dann, dass sie auf See stoppen mussten. Auf die Frage, wie die Farbsplitter in die Brennstoffpumpen gekommen sein könnten, hatte der Zweite aber nie geantwortet.
Flarrow hatte schon lange begonnen an seinem Zweiten Ingenieur, der immerhin ein ausgefahrenes C5–Patent besaß, zu zweifeln. Hier hatte der Wahnsinn wirklich Methode, und das musste doch sogar die Inspektion in Hamburg gemerkt haben!
„Ich habe heute Nacht geträumt“, sagte der Alte zu Flarrow. „Dieser Kahn war mal wieder dabei eine See zu nehmen. Die war aber viel zu groß und wuchs und wuchs, und unsere ‚HILDE‘ fuhr bergauf und immer bergauf, wurde langsamer und langsamer, bis sie anfing, rückwärts ins Wellental zu rutschen. Na, was sagen Sie dazu?“ – „Wenn ich das geträumt hätte, wäre natürlich auch noch die Maschine stehen geblieben.“ Da lachte der Alte und wurde aber sehr schnell wieder ernst. „Wir haben keine Chance, den vorgegebenen Termin für die Ankunft in Kapstadt zu halten. Wenn das so weitergeht, werden wir mit erheblicher Verspätung ankommen. Die Fischer sind dann bestimmt stinksauer auf uns, aber ändern können wir das nicht.“
Achtundzwanzig Tage nach London liefen sie in Kapstadt ein und gingen mitten im Becken des alten Viktoriahafens an die Bojen. Sie hatten fast sechs Tage länger gebraucht als veranschlagt. Der Reiseschnitt für die 6.258 Seemeilen von London bis Kapstadt lag damit deutlich unter zehn Knoten. „You are minimum five days late Captain, Sir!“ Mit diesen Worten kam der Agent an Bord, während ein spanischer Trawler, der an der Pier gelegen hatte ablegte und auf „HILDEGARD“ zu lief. Der Alte murmelte etwas von „Damned fucking shit weather“, aber der Agent meinte, dass das Sommerwetter in den vergangenen Wochen doch recht gut gewesen wäre. Ja, es war Sommer auf der südlichen Hemisphäre des Planeten und Kapstadt auf 33° 54’ Süd, umgeben vom gewaltigen Südmeer hatte natürlich ein sehr gemäßigtes Seeklima. Von den Verhältnissen auf See hatte der Agent natürlich keine Ahnung.
Es gab jede Menge Post von der Reederei und einige Pakete mit Ersatzteilen, die per Luftpost eingetroffen waren. Die Privatpost wurde sofort verteilt, und der Agent legte im Salon Listen aus, auf denen jedes Mitglied der Besatzung vor dem Landgang bestätigen musste, dass es hinsichtlich der geltenden gesetzlichen Regelungen der Apartheid unterwiesen war. Alle an Bord mussten wissen, dass Geschlechtsverkehr mit Farbigen – Coloured People – verboten war und strafrechtlich verfolgt werden würde.
Der Zweite kam mit den Papieren für die Pakete. Die Reederei hatte prompt reagiert, und der Zweite staunte Bauklötze, was da alles möglich war. „Das hätte sich Ihr Vorgänger nicht getraut. Aber der war ja auch nicht von der Süd“, meinte er. Dass er sich nicht traute, das war das Übel, dachte Flarrow.
Der spanische Trawler machte an Backbord fest, und dann tauchte noch ein weiterer Trawler auf, der sich an die Steuerbordseite legte.
KMS „HILDEGARD“ in Kapstadt
„Wie bei einem flotten Dreier“, ließ sich ein fröhlicher Dritter Ingenieur hören.
Flarrow fragte nach dem Schiffshändler, der Rohrleitungen und Armaturen, die für den Umbau der Schwerölvorwärmung benötigt wurden, sowie eine Menge anderer Dinge, die zum täglichen Bedarf des Betriebs zählten, liefern sollte.
Die Behörden, vertreten durch einen Hafenpolizisten, arbeiteten unauffällig und schnell mit dem Kapitän zusammen. „No wireless Operator?“, fragte der Südafrikaner, und der Alte zeigte ihm sein Großes Funksprechzeugnis. Damit war der Punkt abgehakt.
Sie würden mindestens fünf Tage zum Laden benötigen, und damit stand für Flarrow fest, dass sie einige Kolben der Hauptmaschine ziehen würden. Dann kehrte Ruhe ein, Agent und Polizist gingen an Land, die wachfreie Besatzung auch, und der Obersteward deckte im Salon den Tisch. Nach dem Abendessen las Flarrow die Reedereipost. Sie lobten seinen Bericht, weil er so schnell und tatkräftig gehandelt hatte, versicherten ihm ihre volle Unterstützung und wünschten weiterhin gute Reise. Es machte ihn stolz, weil sie von ihm beeindruckt waren, aber auch, weil er das richtige Schiff gewählt hatte. Ein Neubauprogramm von sechs Kühlschiffen war aufgelegt worden. Da wollte er dabei sein, und der Erfolg auf der „HILDEGARD“ würde bestimmt dazu beitragen. Die bittere Pille stand in einem Absatz über die Versicherung des Schiffes. KMS „HILDEGARD“ war maschinentechnisch nur gegen Fehlbedienung versichert. „Bei Ihren Entscheidungen sollten Sie deshalb vorher die Ursachen ergründen und, natürlich nur gegebenenfalls, Fehlbedienung feststellen. Für diesen Fall benötigen wir dann einen Bericht und entsprechende Unterlagen, die wir der Versicherung einreichen können.“ Zwischen den Zeilen hieß das, die Schadensursachen möglichst oft auf Fehlbedienung zu schieben. Was verlangten sie da von ihm? Und wie würde sich das auswirken, wenn die Versicherung ihn als Chief wegen zahlreicher Fehlbedienungen ablehnte?
Dann fiel sein Blick auf einen privaten Brief, der nur von zu Hause sein konnte. Ach ja, zu Hause das gab es ja auch noch! Er riss den Brief auf und las, was die Eltern von Kassel und den Ereignissen aus ihrer Welt zu berichten hatten.
Am nächsten Morgen fehlte der Schmierer Jan van Thaden und trat deshalb seine Hafenwache von acht bis sechzehn Uhr nicht an. Der Elektriker tauchte ziemlich betrunken gegen neun Uhr auf und bekam sofort einen freien Tag. Unter diesen Bedingungen hatte es keinen Zweck, mit dem Kolbenziehen zu beginnen. Es waren einfach zu wenige Leute da.
Die Zulus von der Stauerei erschienen in dicker Winterkleidung. Sie mussten eine halbe Stunde stauen und hatten dann eine halbe Stunde Aufwärmzeit an Deck, und alles war sehr neu für diese Leute. Die Räume waren auf minus zwanzig Grad vorgekühlt. Das war bestimmt schwer für die Zulus, in solcher ungewohnten Kälte zu arbeiten. Deshalb ging es auch so langsam. Umgeschlagen wurde mit den Ladewinden der „HILDEGARD“, die von qualifizierten Farbigen bedient wurden. Sie kannten sich mit der Arbeit aus und waren eingearbeitet.
Als abends die Kühlung angesetzt wurde, lief der Kompressor I nicht. Es war der Elektromotor, der wieder irgendwoher Wasser geschluckt hatte. Also wurde Kompressor II angesetzt. Der Fisch war mit minus zwanzig Grad gut gekühlt, da brauchte es nicht viel Kälteleistung vom Schiff.
Der Elektriker saß am Achterdeck und trank mit ein paar Matrosen. Er hatte gehört, dass der Kompressor nicht in Ordnung war und verkündete nun jedem, der es hören wollte, dass er leider einen freien Tag hätte und da müsste eben der schlaue Chief sehen, wie er klar käme. Der Zweite hatte Bordwache, und der Dritte war an Land gegangen. Von Jan noch immer keine Spur. Der Schiffshändler hatte die bestellten Materialien bereits geliefert, so dass am nächsten Morgen mit dem Umbau der Schwerölvorwärmung begonnen werden konnte.
Der Alte kam noch auf einen Schluck Whisky und begann irgendwann von früher zu erzählen. Er war mit vierzehn zur See gegangen, zuerst auf einem Kümo und später auf Großer Fahrt. Als der Krieg ausbrach, war er Zweiter Steuermann auf einem großen Frachter, der von der Kriegsmarine gechartert worden war. Ab Mai 1940 war er überwiegend mit der Versorgung der deutschen Truppen in Norwegen beschäftigt. Anfang 1941 wurde sein Schiff torpediert und sank. Er bekam ein neues Schiff und wurde zum Ersten Offizier befördert. Die zweite Versenkung fand im Sommer 1943 statt, und er überlebte wiederum. Im Anschluss an einen Erholungsurlaub sollte er sein erstes Kommando bekommen. Das Schiff, auf dem er den Kapitän ablösen sollte, wurde aber vorher versenkt. Er bekam nun einen Erzfrachter als Erster Offizier, mit der Aussicht, später dort als Kapitän zu fahren. Der Erzfrachter lief aber auf dem Weg zum Ladehafen Lulea auf eine deutsche Mine und sank. Alle Besatzungsmitglieder überlebten. Nun wurde er auf einen Trockenfrachter versetzt, der in der Ostsee als Versorger der Ostfront fuhr. Das Kriegsende erlebte er auf diesem Schiff als Erster Offizier. Seine Reederei hatte kein Schiff mehr. Mit einer Landstellung tat er sich schwer. Er wartete, bis Deutschland wieder eine Handelsmarine haben durfte und begann nach dem Krieg als Dritter Offizier. Mittlerweile war er dreißig Jahre alt geworden und noch immer Dritter Steuermann. Dann bekam er bei H. C. Horn eine Chance als Erster Offizier, nach einem Jahr wurde er Kapitän. Als H. C. Horn von der Hamburg-Süd-Gruppe übernommen wurde, versuchte er, auf ein Südschiff zu kommen. Er bekam das Kommando auf einem Frachter, der im Columbus Line Service fuhr; ein Service, der gerade im Aufbau war. Da wurde jede Ladung angenommen. In New York luden sie unter Anderem gefährliche Ladung, Chemikalien in Stahlfässern, die wegen der Brandgefahr nur an Deck gefahren werden durften. Andererseits bestand bei der Berührung mit Wasser Explosionsgefahr. Es war September und Hurrikanzeit in der Karibik. Dort traf der Alte mit einem zusammen. Als der Wirbelsturm anfing, die Aufbauten und die Decksladung zu beschädigen, ließ er die Fässer über Bord werfen. Obwohl er weisungsgemäß handelte, wurde er nach dieser Reise abgelöst. Ohne Angabe von Gründen schickten sie ihn zurück zu den Hörnchen. Die Kaufleute der Hamburg-Süd wollten ihn nicht mehr. „Nun werde ich wohl hier alt werden, mit siebenundvierzig sind doch fast alle Züge abgefahren“, sagte der Alte.
Gerade, als Flarrow noch einmal einschenken wollte, gab es Getöse. Der Dritte war von Land gekommen, den völlig betrunkenen Jan unter dem Arm, der sich heftig wehrte. Auch der Dritte war betrunken. Trotzdem schaffte der es, Jan in die Koje zu packen. Dem wachhabenden Matrosen gab er Anweisung, ihn auf keinen Fall wieder an Land zu lassen. So ging der zweite Tag im Victoria Basin in Kapstadt zu Ende.
Am nächsten Morgen meldete sich Jan zum Wachdienst und bat um Entschuldigung für das Wachvergehen. Flarrow drohte ihm bei Wiederholung den Sack an und machte ihm klar, dass dies völlig ernst gemeint wäre. Der Elektriker, immer noch nicht ganz nüchtern, meldete sich zum Tagesdienst und teilte mit, dass er für andere Arbeiten als die seines Fachgebietes nicht mehr zur Verfügung stünde. Flarrow ließ sich nicht provozieren und schickte ihn zum Motor von Kompressor I. Der Elektriker war zum Problem geworden. Weil ihm der Chief nicht passte, stellte er sich stur und versuchte möglichst viele Schwierigkeiten zu machen.
Mit dem Umbau der Schwerölvorwärmung kamen sie vor allem deshalb so gut voran, weil der Dritte ein ausgezeichneter Schweißer war. Am Abend begann der Probelauf, und alles funktionierte tadellos. Der Zweite staunte, er hatte bezweifelt, dass das etwas werden würde. Auf Flarrows Frage, warum sie diesen Umbau nicht schon längst erledigt hätten, gab er aber keine Antwort. Das genau war es, was Flarrow niemals begreifen konnte. Kaum einer der Schiffsingenieure, die alle auch gute Handwerker waren, war bereit, an der Anlage etwas zu ändern. Das wäre doch in der Verantwortung der Reederei, sagten sie immer, und dabei blieb es dann. Am Abend des dritten Tages wurde nach Löschende noch eine Schicht von den Besatzungen der Trawler und der Matrosen der „HILDEGARD“ gefahren. Die schafften fast das Dreifache der Tagesschicht. Die Fischer waren nervös geworden, weil sie bereits fünf Tage verloren hatten, als sie auf „HILDEGARD“ warten mussten. Nach Schichtende luden sie zu sich an Bord zum Nachtmahl ein. Als Flarrow mit einer Kiste Becks Bier die Messe des Trawlers betrat, fühlte er sich sofort heimisch. Erinnerungen an ROS 107 wurden wach! Es war gegen zwei Uhr morgens, als sie zur „HILDEGARD“ zurückkehrten. Am nächsten Vormittag wurde der Trawler leer, ging an den Bunkerpier und lief danach aus, um zu den südlichen ergiebigen Fanggründen an der Eisgrenze zurückzukehren.
An der Hauptmaschine waren mittlerweile alle Auslassventile gewechselt worden. Die neuen Ventile hatten sie nach Flarrows Anweisung von Hand eingeschliffen, worüber besonders die Assistenten fluchten, die diese Arbeit während ihrer Hafenwachen erledigen mussten. Nun durften alle gespannt sein, welche Standzeiten diese Ventile erreichen würden. Der Zweite hatte die Brennstoffpumpen mit neuen Rückschlagventilen versehen, und das Schweröl im Tagestank war exakt auf Vorwärmtemperatur. Aber der Motor von Kältekompressor I machte Sorgen. Es war natürlich nicht die Schuld des Elektrikers, dass der Isolationswert des Motors nicht auf ein ausreichendes Niveau gebracht werden konnte. Aber der Elektriker fasste die ihm zugeteilte Arbeit an dem Motor als Schikane auf. Früher war es doch auch ohne diesen verdammten Kompressor gegangen, warum sollte er gerade jetzt gebraucht werden? Und je mehr er sich diese Gedanken zu eigen machte, umso mehr trank er, auch während der Arbeitszeit. Flarrow setzte sich hin und schrieb nach Hamburg, dass er den Elektriker von Vigo aus nach Hause schicken würde. Der Ersatz sollte aber wegen der noch zu erledigenden Arbeiten an der Bordelektrik Vollelektriker sein.
Der letzte Abend in Kapstadt! Die Agentur hatte zu einem Essen an Land eingeladen. Mit von der Partie war ein Texaner von der Personalabteilung von SAFMARINE, der staatlichen Reederei der Republik Südafrika. Ihm ging es darum, Patentträger anzuwerben. Es gab Verständigungsprobleme, weil der Texaner ungehemmt in seinem Slang parlierte und Flarrow rügte, der diesen Dialekt nicht so ganz verstand. Er machte ihm ein sehr gutes Angebot, aber ein Wechsel zu einer ausländischen Flagge kam für Flarrow nicht in Frage. Das tat man einfach nicht. In Erinnerung an diesen Abend würde das gewaltige T-Bone-Steak und der hervorragende Rotwein der Kapregion bleiben, sonst nichts.
Am nächsten Mittag wurden auf „HILDEGARD“ die Luken geschlossen, der zweite Trawler legte ab, bunkerte und ging in See. „HILDEGARD“ übernahm noch Frischwasser und Frischproviant, um dann gegen Abend die Reise nach Vigo anzutreten.
Während die Lichter von Kapstadt langsam hinter die Kimm rutschten, begann der kräftige Westwind mehr und mehr auf Süd zu drehen, und am nächsten Morgen liefen sie, vom Südost-Passat getrieben, im Benguelastrom. Wind und Strom „mit“, wann gab es das schon?!
Die Ladung hatte sich während des Ladens auf minus zwanzig Grad gehalten. Mehr war mit drei Kompressoren nicht drin.
In Dakar, das nur zum Bunkern angelaufen wurde, warteten zwei neue Kolben für die Hauptmaschine und weitere Ersatzteile für die Hilfsdiesel. Der Bunkerclerk, mit einem schweren Colt an der Seite, kam an Bord und verlangte von Flarrow, dass er die Bunkerbestellung ausfüllte. Flarrow meinte aber, dass er der Kunde sei und der Clerk das Ausfüllen erledigen sollte. Der Clerk klopfte nach Wild-West-Manier auf seinen Colt und murmelte etwas auf Französisch, das Flarrow nicht verstand. Um die Situation zu entspannen, legte er drei Stangen Zigaretten auf den Tisch, worauf der Clerk noch Seife verlangte. Als er die bekommen hatte, teilte er leicht grinsend mit, dass er gar nicht schreiben könne, und ein zorniger Flarrow füllte das wichtige Formular aus. Danach zauberte der Clerk ein weiteres Papier auf den Tisch.
Das war eine Erklärung, dass das Schiff 50.000 $ zahlen müsste, für den Fall, dass Bunkeröl „auch in geringen Mengen“ in das Hafenbecken gelangen würde. Flarrow unterschrieb zähneknirschend auch das, weil er einsah, dass hier jeder Protest zwecklos war. Die anderen saßen eben am längeren Hebel. Endlich erschien der französische Agent der Ölgesellschaft und teilte mit, dass in der Stadt Dakar, Hauptstadt der Republik Senegal, von Umsturz und Revolution geredet würde. Es gäbe Spannungen, und die Schwarzen wären nervös. Flarrow hielt ihm die Zahlungsverpflichtung unter die Nase und zeigte auf das ölige Wasser im Hafenbecken. Der Agent warnte ihn, denn die Bunkerleute hätten da eine Geldquelle entdeckt. Sie würden alles versuchen, einen Overflow herbei zu führen; und sie versuchten es natürlich. Aber der Zweite rettete die Situation, indem er den Bediener im richtigen Moment vom Absperrventil wegstieß und es zudrehte. Flarrow begann, die Leute von Land zu hassen. Er empfand diese Behandlung als Demütigung und dachte darüber nach, wie man zukünftig das Bunkern in Dakar umgehen könnte. „Scheiß Nigger“, sagte er zum Alten, der zustimmend nickte. Nach sechs Stunden Liegezeit verließen sie Dakar mit vollen Bunkern, froh, dass sie so gut davon gekommen waren.
Im Fischereihafen von Vigo löschten sie den Fisch mit durchschnittlich minus zwanzig Grad. In den oberen Lagen und unter den Luken waren es allerdings nur minus siebzehn und weniger, was aber hier niemanden interessierte.
Das Löschen dauerte vier Tage, in denen die Hauptmaschine zwei neue Kolben bekam. Die Auslassventile hatten durchgehalten, und eine Prüfung zeigte, dass sie wohl noch weiter durchhalten würden. Der Zweite war darüber so sauer, dass er Urlaub einreichte. Der Elektriker packte seine Sachen und verschwand nicht von Bord, ohne noch einmal eine richtige Saufparty mit seinen Freunden veranstaltet zu haben. Er konnte aber damit keinen bleibenden Eindruck bei Flarrow hinterlassen, der dieses Verhalten in seiner Beurteilung für die Reederei berücksichtigt hatte.
Nachdem die Ladung gelöscht worden war, begannen die Leute von Pescanova Ausrüstung und Stückgut in Luke I zu laden, und der neue Elektriker traf ein, ein sehr junger Mann, gerade ausgelernt und nun dabei, die große weite Welt kennen zu lernen. Sie hatten ihm einen unbefahrenen Elektriker-Assistenten geschickt! Noch schlimmer war aber, dass er von einem kleinen Handwerksbetrieb kam, der vornehmlich im Wohnungsbau tätig war. Solche Leute nannten sie an Bord „Schwachstrom-Elektriker“. Als Flarrow dem Jungen den Motor von Kältekompressor I zeigte, wurde der blass und sagte ihm frei heraus, dass er davon praktisch keine Ahnung hätte. Daraufhin bekam er ein Buch über Gleichstrommotoren in die Hand gedrückt. Und Flarrow empfahl ihm dringend, sich schlau zu machen. „Denken Sie daran, dass wir diesen Motor an Land geben werden und zwar zerlegt, weil wir ihn nicht durch das Kühlmaschinenraumschott bekommen. Er wird auch in Einzelteilen von Land zurückkommen, und Sie werden dann den Motor zusammenbauen und in Betrieb nehmen!“
Da das Laden sehr langsam ging, beschlossen Kapitän und Chief, einen Nachmittag an Land zu verbringen. Zunächst besuchten sie die von der Hamburg-Süd autorisierte Agentur LINEAS MARITIMAS, MEINO VON EITZEN Y CIE in der Valperra 5. Dort wurden sie sehr willkommen geheißen, denn solche Besuche bei den Agenturen waren eher selten geworden, weil die Leute von Bord kaum noch Zeit dafür hatten. Der hoch betagte Meino von Eitzen empfahl den Besuch von Baiona, einem Badeort mit viel Gastronomie. Sie bekamen auch gleich eine Empfehlung für ein bestimmtes Fischlokal mit. Nach einem sehr herzlichen Abschied, nahmen sie die Ferrocarril, eine schon fast historische Straßenbahn, die sich schlingernd, quietschend, knarrend und blitzend auf den Weg machte. Der Tourismus von 1967 war mit heute nicht zu vergleichen, und das Dorf lag Anfang April noch ein bisschen im Winterschlaf. Die empfohlene Gaststätte lag etwas höher in den Hügeln, wo man einen sehr hübschen Ausblick auf das Meer und das Dorf hatte. Der Wirt beendete seine Siesta und machte dem Personal lauthals Beine. Meeresfrüchte waren angesagt, und sie waren wirklich frisch. Es wurde eine richtige Schlemmermahlzeit mit Austern, Muscheln und allerlei nie gesehenem Schalengetier. Natürlich mussten sie bei so viel Eiweiß vorsichtig sein, weshalb als Zwischengang jeweils ein Carlos Primero fällig war und natürlich der vorzügliche Vino Rocha. Der überaus freundliche Wirt schenkte reichlich ein. Die deutschen Gäste waren hier noch eine Seltenheit, weshalb er sich sehr geehrt fühlte. Als Hauptgang hatte er zwei ausnehmend große Krabben, wie sie Flarrow noch nie gesehen hatte, angepriesen, die dann auch auf den Tisch kamen. Es schmeckte einfach herrlich, und sie waren seit langer Zeit wieder einmal frei von allen Verpflichtungen. Nach der zweiten Flasche Roten brachen sie auf, hinunter ins Dorf, so lange sie noch Tageslicht hatten. Im Dorf wanderten sie weiter, von einer Bar zur nächsten, was recht interessant war, bis sie schließlich die letzte Bahn nach Vigo erwischten. Dort angekommen, fanden sie ein nettes Restaurant, wo sie auf Bier umstiegen und köstliche Tapas vorgesetzt bekamen. Dort zeigte ihnen der Wirt auch ein Eisernes Kreuz erster Klasse, das er im Krieg an der Ostfront als Soldat in der spanischen Blauen Division bekommen hatte. Diese Division war Francos Beitrag zum Krieg Hitlers. Mehr hatte der Caudillo nicht für den deutschen Faschismus übrig gehabt.
Lange nach Mitternacht stiegen sie aus einem Taxi, das sie zu ihrem Schiff gebracht hatte. Ein ausnehmend schöner Nachmittag war zu Ende.
Am nächsten Morgen verholten sie zum Eispier. Dort sollten sie hundertfünfzig Tonnen Eis für das Fabrikschiff „GALICIA“, das vor Las Palmas lag, laden. Die Ausrüstung in Luke I war für die spanische Fangflotte bestimmt, die weiter südlich im Atlantik fischte. Die „GALICIA“ war ihr Mutterschiff.
Jan van Thaden war an diesem Morgen nicht an Bord zurückgekehrt und hatte wiederum seine Wache nicht angetreten. Er wurde spät abends von der Polizei an Bord gebracht. Wegen einer Schlägerei hatte man ihn in Gewahrsam genommen. Nun saß Flarrow in der Tinte, denn er hatte Jan versprochen, ihn bei der nächsten Übertretung fristlos zu entlassen, und weil der Schmierer außerdem völlig betrunken war, konnte er ihn gar nicht ansprechen. Das Eis rauschte in Luke II, und am Abend liefen sie aus. In drei Tagen würden sie auf der Reede von Las Palmas / Gran Canaria ankern. Das Problem „Schmierer Jan van Thaden“ musste wohl oder übel auf die lange Bank geschoben werden. Die beiden Assistenten teilten sich die Abendwache des Schmierers und meckerten über ihn. Der Elektriker-Assistent gab sich viel Mühe mit der Demontage des Antriebsmotors von Kältekompressor I. Eigentlich lief alles gut, die Arbeit wurde leichter und weniger. Der Dritte war ein fleißiger Mann und hatte so ganz nebenbei seine Hilfsdiesel überholt, die nun mit neuen Laufbuchsen und Kolbenringen merklich besser liefen. Man konnte ruhiger schlafen auf „HILDEGARD“. Störungen und Ausfälle hatten stark abgenommen. Seit Kapstadt hatte es nur einen kurzen Stopper auf See gegeben!
Da begann ein Ing.-Assistent zu spinnen. Er trat in die Fußstapfen des abgelösten Elektrikers und fand in der Mannschaftsmesse sofort Trinkkumpane. Zunächst nahm der Zweite, der ihn drei- und viermal wecken lassen musste, das nicht ernst. Dem Chief wurde das nicht bekannt, weil der Zweite nicht darüber redete.
Auf der Reede von Las Palmas lag TS „GALICIA“, ein zum Fischereifabrikschiff umgebauter Passagierdampfer, der lange vor dem zweiten Weltkrieg im Nordatlantik und später auf der Südamerikaroute gefahren hatte. Dort ging „HILDEGARD“ längsseits, um ihre Ladung zu löschen.
Der zerlegte Elektromotor wurde von der Werft abgeholt und sollte nach zwei Tagen wieder zurück sein. Flarrow ging mit an Land, um die notwendigen Absprachen mit der Werkstatt zu treffen. Die war sehr gut ausgerüstet, was ihm schon in Vigo gesagt worden war. Flarrow musste den Spaniern klar machen, dass der Motor einen kompletten Probelauf unter Last absolvieren sollte, dann aber wieder auseinander gebaut werden musste und an Bord zu liefern war. Es dauerte, bis die Spanier das verstanden hatten.
In Luke II schaufelten Leute von der „GALICIA“ das Eis in die Körbe, die dann per Ladebaum auf das Fabrikschiff wanderten. Irgendwann standen sie alle im Wasser, weil offensichtlich das Schmelzwasser nicht mehr abgepumpt wurde. Das lag an den Sieben der Saugkörbe im Laderaum, die schon lange nicht mehr gereinigt worden waren. Der wachhabende Assistent behauptete, dass seine Pumpe saugte, und die Wachingenieure waren anderweitig beschäftigt. Deshalb kam es zur Überschwemmung im Laderaum. Als Flarrow wieder an Bord kam, war das große Palaver schon im Gang. Die Leute vom Fabrikschiff hatten keine Stiefel und das Wasser war eisig. An die Siebe war nicht mehr heranzukommen, dazu stand das Wasser zu hoch, eiskaltes Schmelzwasser, wie gesagt.
Flarrow musste bei dem spanischen Chief um eine mobile Pumpe bitten und die schaffte das Schmelzwasser schnell außenbords. Nach dem Löschen, wurde die Luke geschlossen und der Raum mit Warmluft beheizt. Sie sollten siebenhundert Tonnen Fisch für Vigo übernehmen, und da musste die Luke trocken sein, obwohl die Spanier drängten, denn das Eis sollte an die Frischfischfänger geliefert werden, die weiter im Süden fischten. Gab es eigentlich auf den Kanarischen Inseln keine Eisfabrik für die Fischerei? Während der Trocknungszeit nahm sich Jan freiwillig der Saugkörbe an. War da vielleicht ein bisschen Reue im Spiel? Da der Schmierer völlig pleite war, kein Geld mehr bekam und ihm niemand etwas borgte, gab es keine Probleme. Ohne Geld zog es ihn nicht an Land. Nach drei Tagen ging Flarrow mit dem E-Assistenten zum Probelauf des E-Motors an Land. Alles klappte, die Werkstatt hatte sehr gute Arbeit geleistet, auch, wenn das Ganze einen Tag länger als geplant gedauert hatte. An Bord wurde der Motor sofort montiert. Als alles fertig war, durfte der E-Assistent den Motor starten. Der tat andachtsvoll und zögerte, bis Flarrow ein „Na los, mach schon hin!“ sagte.
Damit hatte die Kühlanlage wieder ihre volle Kälteleistung, und es war nun kein Problem mehr, die Ladung auf minus zwanzig Grad zu halten, mit der sie in Vigo gelöscht wurde.
Die Ausreise führte über Dakar, wo es den Bunkerleuten wiederum nicht gelang, einen Overflow zu produzieren, nach Walvis Bay und Kapstadt.
In Walvis Bay wartete ein Trawler, der sein Fanggeschirr beim Fischen verloren hatte und nun ein neues bekam. Außerdem gab er seinen bisherigen Fang ab, was nicht viel war. Da blieb keine Zeit für einen Spaziergang durch die Stadt.
Kapstadt erreichten sie vormittags und machten an den Bojen im Victoria Basin an der Victoria & Albert Waterfront fest. Der erste Trawler wurde für den nächsten Morgen erwartet.
Mit Jan van Thaden hatte Flarrow eine Vereinbarung getroffen. Wenn Jan wollte, bekam er nach dem Einlaufen ein oder zwei freie Tage. Wenn er seinen Landgang beendet hatte, musste er allerdings bereit sein, zwölf Stunden Hafenwache zu gehen. Alternativ drohte der Sack bei der nächsten Verfehlung. Das würde in Kapstadt beispielsweise ganz schön teuer werden, denn er durfte in diesem Fall neben den eigenen auch die Flugkosten für seinen Ersatzmann bezahlen.
Jan war ein guter Mann auf See, zuverlässig und qualifiziert. Ein Typ, den man gut gebrauchen konnte, den man deshalb nicht gern verlieren wollte. Leider vergaß er an Land seine Pflichten vollkommen, begann immer zu trinken, geriet auch in Schlägereien und überzog regelmäßig seinen Landurlaub. Er ging immer allein an Land, ein einsamer Wolf, der nervös wurde, wenn er Vorschuss aufnehmen konnte und Land in der Nähe war. Vielleicht hatte er keine Familie, denn Post bekam er auch nie. Am Nachmittag meldete er sich für zwei Tage ab. Sein Guthaben war ihm auf seinen Wunsch hin ausbezahlt worden. Flarrow machte keinen Versuch ihn zu bremsen, weil er wusste, dass solchen Leuten damit nicht beizukommen war. Für den E-Assistenten bedeutete das für zwei Tage Hafenwache zu gehen.
Flarrow wollte weiteres Bunkern in Dakar vermeiden und fragte den Agenten nach den Möglichkeiten in Kapstadt oder Las Palmas, was in jedem Fall vom Charterer, der den gebunkerten Treibstoff bezahlen musste, zu genehmigen war. Der Agent würde also Rücksprache mit Vigo via TELEX nehmen und am nächsten Abend Bescheid geben. Außerdem sollte er einen Vertreter von BBC-Südafrika an Bord schicken, weil Flarrow die Proviantkühlanlage einer gründlichen Überholung unterziehen wollte. Der BBC-Mann erschien noch am Abend an Bord. Die entscheidende Frage war, ob es in Kapstadt alle erforderlichen Ersatzteile gab, und das war der Fall, denn dieser Anlagentyp wurde hier auch an Land, vor allem in Hotels eingesetzt. Morgen würde er zwei Mann schicken, die nicht mehr als zwei Tage für diese Arbeit benötigen würden. Das hörte sich gut an, denn nun hatte Flarrow Zeit, sich um die Hauptmaschine zu kümmern. Auf dem Arbeitsplan stand nämlich für diese Liegezeit die Inspektion aller Auslassventile, die nun schon über tausend Betriebsstunden ohne ein Versagen hinter sich hatten, der Wechsel eines weiteren schadhaften Kolbens und das Nachpassen von Kurbel- und Grundlagern. Da konnten sie eine lange Liegezeit, die der Agent schon angedeutet hatte, gut gebrauchen.
Die Reederei teilte mit, dass die Charter für „HILDEGARD“ wahrscheinlich in Vigo auslaufen würde. Die Möglichkeit, von deutschen Trawlern in der Antarktis Fisch nach Deutschland zu bringen, wäre gegeben. Man erwartete aber einen Bericht über den Zustand der Ladekühlanlage und Kopien des Kühlmaschinentagebuches, das es inzwischen auf „HILDEGARD“ gab, sobald als möglich, um der Frachtabteilung gegebenenfalls eine verbindliche Zusage machen zu können. Schließlich und endlich war das Urlaubsgesuch für den Zweiten Ingenieur genehmigt worden, man würde ihn in Vigo ablösen.
Der Alte kam herüber und fragte nach Flarrows Meinung hinsichtlich der Ladekühlanlage. Er wusste, wenn das Schiff die Zusagen der NTA – und die versprechen dem Charterer ja bekanntlich immer Gott und die Welt – nicht würde halten können, wäre sofort das Schiff im Obligo. Er dachte dabei natürlich an seine Erfahrung mit der explosiven Decksladung von New York. Flarrow lächelte, er würde den Bericht sofort fertig machen.
Hier zeigte sich die Problematik, in der Schiffsführungen in jener Zeit steckten. Da es genug Kapitäne gab, aber zu wenig gute Chiefs, würde man sich natürlich an den Kapitän halten. Die an Land waren ja bekanntlich immer unschuldig, und ein Kapitän konnte sich am schlechtesten wehren. Damit hatte der Alte ja seine Erfahrungen und war natürlich beunruhigt.
Der abschließende Satz in Flarrows Bericht über die Ladekühlanlage lautete: „Da die bisherigen Betriebswerte des Elektromotors von Ladekühlkompressor I im normalen Bereich liegen, der Leck- und Spritzwasserschutz wirksam ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Verfügbarkeit von vier Kompressoren, entsprechend 100% installierte Kühlleistung, gegeben ist. (hz. s. Anlage: Kopien des Kühlmaschinentagebuches KMS ‚HILDEGARD‘; Reise mit Fisch von Las Palmas nach Vigo)“
Das wird auch den Alten beruhigen, dachte sich Flarrow und zündete sich eine Zigarette an.
Da klopfte es, und der E-Assistent trat ein. Er wäre nicht abgelöst worden. Von den Assistenten wäre keiner an Bord. Wie es denn nun weiter gehen sollte. „Haben Sie dem Wachhabenden Bescheid gegeben?“ – „Das sind Sie doch.“ Das stimmte natürlich. Flarrow sah auf die Uhr, es war schon fast ein Uhr morgens! „Und wann ist das letzte Boot von Land gekommen?“ „Das war kurz vor Mitternacht, da war aber meine Ablösung nicht dabei.“ Es gab natürlich die Möglichkeit, ein Boot zu mieten, wenn man das vom Schiff zur Verfügung gestellte und nach Fahrplan verkehrende Boot verpasst hatte. Ein solches Boot kam um ein Uhr. Die beiden Assistenten kamen aber auch mit diesem Boot nicht. Der Dritte kam zurück. Er hatte mit ein paar spanischen Fischerleuten den Abend im Hafenviertel, das bei Seeleuten besonders beliebt war, verbracht. Beide Assistenten waren allein weitergezogen. Flarrow fluchte, weil er in dieser Nacht Wachhabender war. Er konnte den E-Assistenten auch nicht länger in der Maschine behalten, denn der hatte ja auch schon mehr als zwölf Stunden Arbeit hinter sich. Der Dritte kam nicht infrage, weil er ja wachfrei war, der Zweite erst recht nicht. Wenn er also gerecht sein wollte, und das wollte er auch demonstrieren, blieb es an ihm hängen. „Gut“, sagte er zu dem E-Assistenten, „Sie gehen in die Koje oder wollen Sie noch an Land? Ich löse sie in zehn Minuten ab.“ Gegen drei Uhr kam ein Boot von Land. Der Wachhabende auf der Brücke rief deshalb Flarrow in der Maschine an und teilte ihm mit, dass keine Assistenten mitgekommen seien. Die erschienen am Morgen mit dem ersten regulären Boot so rechtzeitig, dass der für die Acht-Sechzehn-Wache eingeteilte Assistent pünktlich ablösen konnte. Der andere, der zur Ablösung um Mitternacht nicht erschienen war, meldete sich erst gar nicht, sondern schloss sich in seine Kammer ein und ging schlafen.
Jan van Thaden traf überraschend gegen Mittag ein, und das Bild, das er bot, erinnerte Flarrow an seine Fahrzeit bei der Hochseefischerei. Jan war offensichtlich wieder in eine Auseinandersetzung geraten und sah entsprechend „abgerissen“ aus. „Viel zu früh, Jan“ sagte Flarrow; „Geld geklaut!“ kam es von Jan zurück. „Heute Abend Null-Acht-Wache?“ – „Ja, das mache ich.“ – „Na, dann hau dich aufs Ohr.“ Jan schlich davon.
Flarrow fragte den Dritten, was denn an Land los wäre. Es wären die Mädchen, die die Seeleute gleich mit auf ihr Flat nehmen würden. Prostitution wäre das nur begrenzt. Natürlich würden die Seeleute die Feierei bezahlen. „Das ist schon ein toller Hafen hier. Hübsche Miezen, scharf wie Rettich; das Hafenviertel nicht weit weg und gute Liegezeiten. Was ja auch den Mädchen gefallen würde. Die Spanier sind knauserig, gehen kaum an Land, weil sie ja alle Familie haben, dafür sind wir Deutschen aber sehr beliebt.“ – „Wie das?“ – „Wir sind die besten im Bett.“ – „Na dann wird es ja wohl noch interessant werden in Kapstadt.“ – „Für mich nicht, ich muss sparen, für die Schule.“ – „Na gut, dann gehen Sie mal fleißig Hafenwache.“
Flarrow freute sich über die Auslassventile, die keinerlei Beschädigung aufwiesen. Der Dritte reinigte sie, und nach einem kurzen Einschleifen wurden sie alle wieder eingebaut. Der Zweite, der das sah, schwieg dazu, wie er sich überhaupt immer mehr zurückzog und immer weniger aktiv war. „Was ich auch mache, es ist Ihnen ja doch nicht recht“, pflegte er zu sagen. Er ist eben urlaubsreif, dachte Flarrow. Ihm war das egal, denn er hatte den Zweiten längst als unfähig abgehakt.
Der BBC-Monteur war pünktlich mit zwei Farbigen erschienen. Ein Engländer, und als Flarrow meinte, er hätte nur zwei Mann erwartet, sagte der: „Well, it’s me and these two guys; they count fifty percent each, Sir.” Flarrow warf ein Auge auf die Leute von BBC und sah, dass der Monteur die Arbeit machte. Die beiden Farbigen waren wirklich nur Hilfskräfte.
Gegen sechzehn Uhr erschien der wachhabende Assistent bei Flarrow, weil sein Kollege, der inzwischen ausgeschlafen hatte, die Wache nicht übernehmen wollte. Der sagte, er hätte ja Null-Acht-Wache und wollte jetzt an Land. Das Boot ginge ja gleich. Flarrow machte ihm klar, dass die Wachen wegen ihm geändert werden mussten. Das Ergebnis sei, dass er jetzt die Abendwache hätte, die er umgehend anzutreten habe. Und dann kam die Frage, warum er gestern Abend zum Wachwechsel nicht an Bord war. Außerdem hätte er sich auch heute Morgen nicht zurück gemeldet. Kaltschnäuzig behauptete er, das Boot verpasst zu haben, und ein privates Boot sei ihm zu teuer, er hätte auch gar kein Geld mehr gehabt und im Übrigen müsse er jetzt los, denn sonst würde er ja das Boot verpassen. Flarrow machte ihm klar, dass dies Arbeitsverweigerung sei, welche zur fristlosen Kündigung führen könnte und was ein Flug nach Deutschland kosten würde. „Sie haben eine dienstliche Anweisung, sofort Ihre Hafenwache anzutreten.“ Dies sagte Flarrow natürlich in Gegenwart des Zweiten, der dem Assistenten gut zuredete, doch der drehte sich nur um und verschwand. Kurz darauf kam Jan an, mit dem sich der Assistent inzwischen abgesprochen hatte und erklärte sich bereit, die Abendwache zu übernehmen. Da er einen Ersatzmann vorweisen konnte, war ihm der Landgang nicht zu verweigern, und die schriftliche Verwarnung, die er am nächsten Tag wegen Überziehen des Landurlaubs bekam, regte ihn nicht weiter auf. Flarrow hatte verloren, und das sollte noch schlimme Folgen haben. Aber was sollte er tun? Dem Assistenten konnte man nicht viel anhaben, Gefahr war ja nicht im Verzug. Er hatte mit Jan einen Deal gemacht, der hier an Bord üblich war und den der Assistent nun ausnutzte. Außerdem hatte sich herumgesprochen, dass der Chief für Jan die Wache gegangen war. Das wurde von der Mannschaft als Schwäche ausgelegt und allgemein belächelt. In den nächsten Tagen lief das Bordleben wieder normal, Jan hielt sich an seine Abmachung, er war scharf auf Überstunden, um Geld zu verdienen und ließ die Finger vom Alkohol.
Die Arbeiten an der Hauptmaschine liefen problemlos, so dass Flarrow Zeit fand, sich ein bisschen umzusehen. Es war später Nachmittag, als Flarrow an Deck kam. Er blickte hinauf zu dem gewaltigen Massiv des Tafelbergs, der, eingegrenzt von Devils Peak östlich und Lions Head westlich, wie ein Schutzwall vor der Stadt lag. Nebel zog sich auf dem über tausend Meter hohem Plateau zusammen und verdichtete sich sehr schnell. Und dann, nach einigen Minuten wälzte sich die Wolkenwand über die Plateaukante hinab auf die Stadt zu, deren Abwärme den Nebel genauso schnell wieder auflöste, wie er entstanden war. Es war das, was die Kapstädter das „Tischtuch“ nennen, das meist Regen ankündigt. „Ein tolles Schauspiel“, meinte der Alte, und da hatte er Recht.
Abends ging Flarrow mit dem Ersten Offizier an Land. Sie fuhren hinaus zur Camps Bay, wo ihnen ein Restaurant empfohlen worden war. Es gab hervorragende Steaks mit reichlich Knoblauch und den berühmten roten Wein der Cap Region. Es wurde ein interessanter Abend auf der Terrasse des Restaurants. Der Erste fragte Flarrow nach seiner Zeit bei der Fischerei und wollte seine Meinung zur Überfischung der Meere hören. Zu meiner Zeit, meinte Flarrow, sprachen nur wenige von Überfischung. Niemand dachte damals daran, so weit im Süden zu fischen, wie heute. Die Bestände im Nordmeer reichten noch. Von Überfischung sprach man also nicht, obwohl sie bereits stattfand. Die Fischer wichen mit immer besseren Fangschiffen und neuer Ortungstechnik nach Norden in neue Fanggründe aus. Da für Frischfisch die Reisezeit zu lang wurde, begann man damit, einen Teil des Fangs zu frosten. Extrem leistungsfähige Kälteanlagen kühlten den frisch gefangenen Fisch innerhalb von sechs Stunden auf minus dreißig Grad Celsius herunter. Damit wurde er für lange Zeit lagerfähig und behielt dabei seine Qualität. Mit der Frosterei begann aber auch die Fischverarbeitung an Bord, denn man frostete ja nur Filets und nicht den kompletten Fisch. So entstanden Fabrikschiffe, die ihren gesamten Fang auf See verarbeiteten und gefrostetes Filet, Tran und Fischmehl anlandeten. Sie konnten leicht hundertfünfzig Tage auf See bleiben und in ferne Fanggründe entsandt werden, wie beispielsweise den Südatlantik. Die Überfischung würde auch hier kommen, die Frage war nur, wie lange die modernen Fangschiffe dafür brauchen würden. Über diesem Vortrag war es Abend geworden. Die Sonne versank im Meer, und mit der kurzen Dämmerung kamen die Sterne hervor, die schon bald vom nachtschwarzen Himmel herab funkelten.
Ein Taxi brachte sie zur Waterfront, wo das Nachtleben pulsierte. Sie suchten sich eine Bierkneipe, weil der Rotwein so durstig gemacht hatte, bewunderten attraktive Mädchen in extrem kurzen Minis und kehrten mit dem letzten Boot an Bord zurück.
Am nächsten Morgen stand der Kapitän vor Flarrows Koje und schimpfte über den Knoblauchgestank. Das sei ja kaum auszuhalten. Das „Garlic-Steak“ von Camps Bay ließ grüßen, aber Flarrow und den Ersten störte das wenig.
Am kommenden Sonntag wollte der Alte auf den Tafelberg. Das Wetter war gut und so zogen sie zusammen mit dem Zweiten Offizier los. Mit der Seilbahn, der Cable Way, ging es nicht nur am bequemsten, sondern auch am schnellsten. Nach zehn Minuten Fahrzeit erreichten sie das über tausend Meter hohe Plateau. Tier- und Pflanzenwelt überraschten, vor allem eine Art Meerschweinchen (Dassies), die einem schon fast über die Füße liefen, aber auch scheue Bergziegen, Steinböcke und dreiste Paviane.
Kapitän der „HILDEGARD“ auf dem Tafelberg
Sie brauchten einige Zeit, um die atemberaubende Aussicht auf Kapstadt und seine am Fuß der Berge liegenden Siedlungen zu erfassen. Das Hafengebiet mit den großen Duncan und Ben Schoeman Docks und der geschützten Reede, wo große Tanker ankerten, die Frischproviant aufnahmen oder Besatzungswechsel durchführten. Dagegen fiel das kleine, schon fast historisch zu nennende Victoria Basin kaum auf. Wenn man aber genau hinschaute, konnte man sogar die „HILDEGARD“ mit den Trawlern an den Bojen erahnen. Im Süden breitete sich die False Bay aus, die falsche Bucht. So genannt von enttäuschten, ersten Seefahrern, die nach ihrem Landfall erkennen mussten, dass dies nicht die Table Bay war und dass sie Kapstadt verfehlt hatten. Die Kap-Halbinsel, als westliche Eingrenzung der False Bay, erstreckt sich weit nach Süden, wo sich ungefähr fünfzig Kilometer entfernt das Cape of Good Hope befindet.
Bartolomäus Diaz, der 1487/88 auch an der Table Bay vorbei bis zum Südkap gekommen war, entdeckte dieses Kap erst auf der Rückreise und nannte es „Kap der Stürme“. Der portugiesische König dagegen, der an Geld, Gold und Gewürze dachte, änderte später den Namen in Kap der Guten Hoffnung.
Vasco da Gama umsegelte zehn Jahre später auch das Südkap und konnte nun Kurs auf Indien oder die Gewürzinseln absetzen. Wenn auch mit Hilfe arabischer Lotsen, erreichte er schließlich Calicut, und die Gute Hoffnung seines Königs konnte sich nun erfüllen.
Der Alte wies auf eine steinerne Tafel, auf der die Erstbesteigung des Tafelbergs durch einen Europäer verewigt worden war. Der portugiesische Seefahrer Antonio de Saldanha hatte das 1503 vollbracht.
Weil es bis zum Kap zu weit für eine Tagestour war, kehrten sie in die Stadt zurück und nutzten den Nachmittag für einen Bummel durch das Zentrum von Kapstadt, wo sie vom Bahnhof aus über die Strand Street zum Castle of Good Hope gelangten. Dieses sternförmige Kastell mit fünf Bastionen, mit Kanonen bestückt, war 1666 erbaut worden. Dreitausend Matrosen hätten dafür nur ein Jahr benötigt. Allerdings blieb diesem Relikt aus der Zeit der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die als Residenz der Gouverneure am Kap diente, ein Angriff bis heute erspart.
Beeindruckend auch der Botanische Park mit seltenen Bäumen und Rosensträuchern, Companys Garden genannt. Denkmäler erinnerten an den Diamantenkönig und Landeroberer Cecil John Rhodes und Sir George Grey, der einst Gouverneur am Kap war. Jan van Riebeek, dessen Denkmal sie schon am Hauptbahnhof gesehen hatten, gründete Kapstadt in dem er eine Versorgungsstation für die Schiffe der VOC eröffnete. Seine Gemüsebeete waren dann auch der Ursprung des Companys Garden.
Das Kaufhaus GARLIC fiel von seiner Größe her auf, der Name allerdings, erinnerte eher an die grandiosen Steaks in Camps Bay.
Müde vom ungewohnten Wandern, landeten sie am Abend wieder an Bord.
Der letzte spanische Trawler legte ab und ging in See. „HILDEGARD“ verholte zum Bunkerpier, wo bis in die Entlüftungen hinein gebunkert wurde. Dakar sollte ja nicht mehr angelaufen werden. Nachdem auch die Frischwassertanks voll aufgefüllt waren und Frischproviant an Bord gestaut war, verließ auch „HILDEGARD“ Kapstadt.
Alles lief recht gut, es gab nur wenige Störungen, was immer gut für die Stimmung an Bord ist. Die Ladekühlanlage lief einwandfrei, und bei Temperaturen um minus zweiundzwanzig Grad näherte man sich dem Äquator, gut gerüstet also für wärmeres Seewasser. Mit steigenden Lufttemperaturen versammelten sich die Leute abends wieder mehr an Deck. Es war eine Gruppe um den Koch, die anscheinend den Elektriker nicht vergessen konnte und in der der Assistent der Vier-Acht-Wache nun über die Schiffsleitung und insbesondere den Chief herzog, dem er es in Kapstadt mal so richtig gezeigt hatte. Dabei kam er immer unpünktlicher und oft nicht nüchtern auf Wache. Weil der Zweite das deckte und ihm sogar gestattete, auf Wache zu schlafen, bekam Flarrow das sehr spät mit. Dann aber bekam der Assistent mehrere Verwarnungen, und als er eines Morgens den Wachdienst verweigerte, die fristlose Kündigung. Da er nun als Passagier weiter fuhr, bekam er die Eigner-Kabine, und der Zutritt zum Wohnbereich der Besatzung wurde ihm untersagt. Das konnte nicht wirklich verhindert werden, zeigte aber, dass man sich nicht auf der Nase herumtanzen ließ. Seine Mahlzeiten hatte er im Salon einzunehmen, wovon er aber nur selten Gebrauch machte, und Alkohol durfte ihm nicht verkauft werden.
Der Kapitän legte ihm schon einmal die Rechnung für die Passage bis Vigo vor und verlangte seine Unterschrift. Da er sich weigerte, machte ihm der Alte klar, dass er dann mit einer Klage der Reederei zu rechnen hätte. Seine Freunde wurden nachdenklich, als ihnen das bekannt wurde. Neben den Reisekosten für den Ersatzmann kämen dann eventuell auch noch die Gerichtskosten auf ihn zu. Das könnte ganz schön teuer werden.
Der Kapitän nutzte die bestehende Situation, den Kantinenverkauf von Alkohol stark einzuschränken, womit eine mehr realistische Betrachtung der Situation, auch bei den fröhlichen Zechern, die Oberhand gewann. Der Versuch des Passagiers, die Sache ungeschehen zu machen, scheiterte aber an Flarrow, der das rundweg ablehnte.
Sie hatten Kap Verde passiert, und mit dem einsetzenden Nord-Ost-Passat wurden die Nächte frischer, was die Ausgucks veranlasste, die Dufflecoats hervor zu holen.
Flarrow stand am Fahrstand, als das Telefon klingelte. „Wir haben Feuer im Schiff.“ Und weil die Stimme des Ersten so entspannt klang, antwortete Flarrow: „Natürlich, im Kombüsenherd, weil der Koch morgen früh Brot backen wird.“ – „Nein, nein, es brennt wirklich, eine Matrosenkammer im Wohndeck Steuerbord. Wir müssen wahrscheinlich mit der Fahrt runter gehen und wegen der Windrichtung auch den Kurs ändern.“ – „O. k, wir treffen uns im Hauptdeck am Niedergang zum Wohndeck.“ So begann Flarrows erster Einsatz in Sachen „Feuerlösch“. Am Niedergang wurde einem Matrosen gerade der Rauchhelm KÖNIG aufgesetzt. Das war ein Monstrum aus einem anderen Jahrhundert, aber noch immer als Atemschutzgerät auf deutschen Schiffen zugelassen. Das war der eigentliche Skandal. Die Luftversorgung des Trägers erfolgte nämlich über eine Handpumpe, die durch einen Gummischlauch mit dem Rauchhelm verbunden war, aber die Bewegungsfreiheit stark einschränkte. Die gläserne Sichtscheibe des Helms beschlug meistens und machte seinen Träger blind. Der Rauchhelmträger musste beim Abstieg in das Wohndeck zwei Wendungen von je neunzig Grad vollziehen und geriet sofort außer Sicht. Es dauerte jedoch nicht lange, da tauchte er aus dem dunklen Wohndeck wieder auf, weil er in Atemnot gekommen war. „So eine Scheiße!“, brüllte der Erste, „das war der zweite Versuch!“
Flarrow, der inzwischen über den Brandherd informiert worden war, machte sich seine eigenen Gedanken. Das Feuer brannte in einer Kammer, die direkt am Maschinenraumschott lag. Dahinter gab es einen fast leeren Brennstofftank, mit leichtem Dieselöl, das gegebenenfalls gasen würde! Er schnappte sich einen Feuerlöscher, ein nasses Taschentuch und empfahl dem Ersten einen C–Schlauch anzuschlagen, damit man notfalls mit Seewasser löschen konnte. „Die Feuerlöschpumpe läuft, ihr braucht nur das Ventil aufzudrehen.“ Damit stieg er in das Wohndeck hinunter. Beleuchtung gab es nicht mehr, da jemand den Gang aus Sicherheitsgründen stromlos gemacht hatte und Notstrombeleuchtung war auf „HILDEGARD“ ein Fremdwort. Er erreichte die Kammer, riss die Tür auf, sah den brennenden Kleiderschrank und entleerte den Feuerlöscher fachgerecht am Brandherd. Die Füllung war ausreichend. In der starken Rauchentwicklung tastete er sich, wegen tränender Augen fast blind, zurück. Atemluft wurde knapp, und dann bog er zu früh nach links ab und landete unter dem Niedergang anstatt daneben. Er fühlte noch das Ölzeug der Decksleute und begriff seine Situation, bevor er ohnmächtig wurde. Weil der Erste mit zwei Mann auf das Wohndeck hinab gestiegen war und auf den rückkehrenden Flarrow wartete, konnten sie ihn bergen. An der frischen Luft kam er schon bald wieder zu Bewusstsein, und bis auf die Rauchvergiftung, die ihn noch eine Woche lang quälte, war er unverletzt. Über die Brandursache wurde natürlich spekuliert.
Die Ausgucks durften nachts auf der Brücke nicht rauchen, weil das ihre Sehkraft minderte. Deshalb erlaubte der Wachhabende dem Ausguck, wenn nichts Besonderes anlag, nach zwei Stunden die Brückennock für eine Zigarettenpause zu verlassen. In diesem Fall hatte der Ausguck die Pause dazu benutzt, seinen Dufflecoat aus dem Kleiderschrank in seiner Kammer zu holen. Da das Schiff rollte, schwangen auch die Kleider im Schrank hin und her. Wenn man nun beide Hände benötigte, den Mantel aus dem Schrank zu nehmen, hatte man die brennende Zigarette natürlich im Mund. Eine Berührung der Glut mit den Kleidern genügte dann durchaus. Das konnte sich auch der Alte zusammenreimen und stellte die entscheidende Frage nicht. Im Protokoll stand deshalb: „Aus nicht geklärter Ursache“
Ein paar Tage später, im kalten Atlantikwasser, zeigten die in der Ladung ausgelegten Fernthermometer Temperaturen um minus fünfundzwanzig Grad an. Der Alte staunte und fragte Flarrow, wie kalt es denn noch werden solle. „Das will ich ja gerade wissen“, antwortet Flarrow, „aber ich denke, dass es noch ein oder zwei Grad mehr werden. Unsere Lukendeckel sind nicht sehr dicht, außerdem schlecht isoliert.“ – „Da sind wir ja für Deutschland fein raus, oder? Chief, ich hätte, ehrlich gesagt, nicht geglaubt, dass Sie das schaffen würden.“
In der nächsten Nacht, als das Schiff im Seegang zunehmend schlingerte, gab es einen Knall, der auch Kapitän und Chief weckte. In der Maschine hatte die Wache nichts gehört, aber der Wachhabende auf der Brücke vermutete, dass das Geräusch aus Luke 2 gekommen war.
Da sich nichts weiter tat, keine Beschädigung oder Wassereinbruch festgestellt werden konnte, verschob man die Begehung des Laderaumes II auf den folgenden Morgen, wo die Ursache des Knalls gefunden wurde. Das Zwischendeck auf der Steuerbordseite war um eine Decksstütze herum bis zur Bordwand hin abgebrochen und hatte sich teilweise auf die Ladung im Unterraum gelegt! Daran konnte man erst etwas ändern, nachdem die Ladung gelöscht war. „Das ist auf jeden Fall Werftarbeit“, sagte Flarrow, „und in Vigo soll es ja eine Werft geben“.
Als sie in Vigo nach einer ausgesprochenen Schönwetterreise einliefen, stand der Agent Meino von Eitzen am Pier, um die Heimschaffung des „Passagiers“ schnellstens zu organisieren. Der wirkte hilflos, als er in den Wagen des Agenten stieg und nicht übersehen konnte, dass das niemand mehr interessierte. Flarrow aber machte drei Kreuze und war sehr erleichtert, dass diese elende Arie von Disziplinlosigkeit, die auch viel Schreibkram verlangte, endlich zu Ende war. Auch der Zweite Ingenieur und ein paar Leute von Deck wurden abgelöst, was sicher gut war für die Verbesserung des Bordklimas.
Der neue Zweite Ingenieur machte nicht viel Worte, besah sich seine Kabine, schüttelte den Kopf, schnappte sich den zuständigen Steward und verlangte eine saubere Kabine. Bis dahin zog er in eine freie Kammer.
Pescanova teilte mit, dass die Charter mit Löschende beendet sei, eine Verlängerung würde es nicht geben.
Die Werft, die Fischereifahrzeuge wie am Fließband baute, begann mit dem Abstützen des Zwischendecks in Luke 2, nachdem die Ladung in diesem Bereich gelöscht war.
Flarrow sah sich den Sprödbruch genau an, konnte aber natürlich nicht feststellen ob Ermüdung oder Kaltsprödigkeit zum Bruch geführt hatte. „HILDEGARD“ war ja als Trockenfrachter in Auftrag gegeben worden, und das konnte die Materialauswahl beeinflusst haben. Aber der Leitende Ingenieur der Werft, ein Deutscher, schüttelte zu Flarrows Gedanken nur den Kopf. Die modernen Schiffbaustähle wären in dem Temperaturbereich schon „kältefest“.
Von Hamburg wurde auch die komplette Erneuerung der Dichtungen der Lukendeckel genehmigt, und darüber freute sich natürlich der hiesige Vertreter der Firma Mc Gregor, die einst die Lukendeckel geliefert hatte.
Die Spanier gaben sich alle Mühe, eine saubere Arbeit abzuliefern, und an der Qualität der Arbeit war tatsächlich nichts auszusetzen. Das galt auch für die ausgebrannte Matrosenkammer. Natürlich wurden bei der Gelegenheit auch Reparaturen in anderen Kammern erledigt, denn es gab ja gute Chancen, dass diese Arbeiten in der großen Werftrechnung untergingen, und so geschah es dann auch.
Am letzten Abend lud die Werft die Schiffsleitung der „HILDEGARD“ ein. Es wurde Deutsch gesprochen, das auch die anwesenden Spanier gut beherrschten. Schon bald kam das Thema auf die Werft und die dort gebauten Fischereifahrzeuge im Zusammenhang mit der Überfischung der Fanggründe. Der Werftingenieur hielt dagegen. Zunächst wäre es wichtig, die große Arbeitslosigkeit, die in und um Vigo herrschte, abzubauen. Spanien müsse außerdem den Lebensstandard seiner Bevölkerung verbessern. Das ginge vor allem durch Industrieansiedlungen, wie beispielsweise der Werft. Überfischung? – Wohl kaum, bei der Unermesslichkeit der Meere. Man wollte natürlich auch mehr Tourismus in die Galicia holen, ob die Deutschen wohl auch hierher kommen würden, wo das Wetter nicht so sonnig wäre wie im Süden? „Und was halten Sie von unserer Werft? Wie beurteilen Sie die Reparatur? Diese Frage ging an Flarrow, der sich nur lobend äußern konnte, denn Schlendrian und Pfusch hatte er nicht beobachtet. Das machte vor allem die Spanier sehr stolz.
Am nächsten Tag kam die Reiseorder. Auslaufen nach Walvis Bay; Laden von deutschen Vollfrostern für Cuxhaven oder Bremerhaven auf eigene Rechnung; Bunkern in Dakar. Das war Beschäftigung für das Schiff für die nächsten zwei Monate. Der Arbeitsplan Flarrows sah nun weitere Instandsetzungen der Maschinenanlage vor, die sich an der Ankunftszeit in Deutschland orientierten. Weil dort die Klasse erneuert werden musste, hatten die Klassearbeiten erledigt zu sein.
An einem Freitag Ende Juni gingen sie mit dem leeren Schiff in See. Bis Dakar hielt sich das Sommerwetter, die See war angenehm, und deshalb kamen auch die Instandsetzungsarbeiten, die hauptsächlich von den Ingenieuren während ihrer Wachen ausgeführt wurden, gut voran. Flarrow werkelte in der Kühlmaschine, der Zweite hatte den Haupt- und Hilfsbetrieb, und der Dritte kümmerte sich um seine Dieselaggregate. Der E-Assistent arbeitete inzwischen selbständig. Kurz, das Betriebsklima hatte sich erheblich verbessert. Und das galt nicht nur für die Maschinencrew, sondern für die gesamte Besatzung.
In Dakar hatten sich die Verhältnisse nicht geändert, da sie aber möglichst viel bunkern wollten, um die Seeeigenschaften des leeren Schiffes zu verbessern, wurde es am Ende ziemlich kitzlig. Trotzdem ging alles gut, und danach begann wieder einmal der Kampf gegen Südostpassat und Benguela Strom. Nach Süden, vom Sommer also in den Frühling.
Nach einer störungsfreien Überfahrt ging „HILDEGARD“ an einem Vormittag an dem wartenden Hecktrawler „TÜBINGEN“ der NORDSEE DEUTSCHE HOCHSEEFISCHEREI GmbH längsseits. Der brandneue Vollfroster war sehr gut in Farbe, als ob er gerade seine erste Fangreise gemacht hätte, und auf seiner Brücke stand ein Mann, der eine blaue Uniform mit vier Streifen trug. „Ein Fischdampferkapitän in Uniform“, murmelte der staunende Flarrow, der beim Anlegen neuerdings auf der Brücke aushalf. Auch der Alte konnte das kaum fassen. Aber das, was sie da vor sich hatten, war eben kein Fischdampfer aus den fünfziger Jahren, sondern eher ein moderner Produktionsbetrieb. Und weil die Reederei Wert auf einen guten Eindruck ihrer Flotte im Ausland legte, trugen die Offiziere die gestellten Uniformen. Der Hamburg-Süd-Agent war von Kapstadt herüber gekommen und bestätigte als Zielhafen Bremerhaven. Flarrow brauchte einen Surveyor vom Germanischen Lloyd für die Hauptmaschine. Frischproviant und Frischwasser wurden geordert.
Dann kam die Einladung des Kapitäns von der „TÜBINGEN“. Die NORDSEE war eine „feine“ Reederei, der Lloyd unter den Reedereien der Hochseefischerei gewissermaßen, das war bekannt. Trotzdem staunte Flarrow über die komfortable moderne Ausstattung des Wohnbereichs. Dieses Schiff würde ja bis zu hundertfünfzig Tagen auf See bleiben, weil es eben seinen Fang vollständig verarbeiten konnte, und das hatte man offensichtlich beim Bau berücksichtigt. Außerdem war alles sehr geräumig, weil das Schiff immerhin fast siebzig Meter lang war, gab es ausreichend Raum.
„Sie haben ja wieder erwachsene Matrosen, offensichtlich werden die Zeiten wieder besser“, wurde der Alte auf der „TÜBINGEN“ begrüßt. Der zeigte aber auf Flarrow und sagte: „Wir lassen uns manchmal von der Maschine aushelfen, einfach zu wenig Leute.“ Darüber lachten zwar alle, aber der Alte hatte Recht. Beim Anlegen hatte er keinen Rudergänger auf der Brücke, weil die komplette Decksbesatzung beim Festmachen benötigt wurde.
Der Kollege von der „TÜBINGEN“ fragte Flarrow, ob der sich mal seinen Laden ansehen wollte, und so verschwanden sie in der Maschine, die einen voll gekapselten Fahrstand hatte und jede Menge Elektronik dazu. Interessant auch die Filetiermaschinen und die Schnellfrostanlage, die mühelos minus dreißig Grad schaffte. Im Fischraum lägen die Temperaturen dann so um minus siebenundzwanzig Grad.
Als sie zurück in die Offiziersmesse kamen, war auch der Surveyor eingetroffen und Flarrow konnte mit ihm die fälligen Inspektionen, die er in Walvis Bay erledigen wollte, absprechen. Der Erste vereinbarte mit dem Ersten Steuermann der „TÜBINGEN“ die Übernahme der Ladung. Es würde wenig Hilfe von Land geben, und die Winden müssten auf jeden Fall von den Besatzungen bedient werden. Rund sechshundert Tonnen Filet hatte die Tübingen abzugeben.
Irgendwann schweifte das Gespräch ab und man kam auf die Situation des Landes hinsichtlich der farbigen Bevölkerung zu sprechen. Der anwesende Metzger, der den Frischproviant liefern würde, meinte, dass in Europa niemand die Apartheid verstünde. „Sie werden sie veronanieren“, sagte er, aber hier hätte jeder seine Winchester im Schrank, da hätte man keine Bange vor den Schwarzen. Schließlich lud der Metzger zu einer Landpartie ins benachbarte ehemalige Deutsch-Südwest ein. Da der neue Zweite seinen Job verstand, sah Flarrow keinen Grund nicht mit zu fahren.
Walvis Bay gehörte nämlich 1967 zur Südafrikanischen Union. Der einzige Tiefwasserhafen an der Westküste, von Diaz 1478 entdeckt, und von der VOC genutzt, wurde aus strategischen Gründen bald von den Briten annektiert und 1910 Mitglied der Südafrikanischen Union.
Nach der Kapitulation der deutschen Schutztruppen übernahm Südafrika die Mandatschaft über Südwestafrika, der Walvis Bay angegliedert wurde. Erst 1994 wurde die Enklave an Namibia zurückgegeben.
Mit der Eisenbahn direkt am Strand entlang von Walvish Bay nach Swakopmund
Am nächsten Morgen versammelte sich die Herrenpartie. Mit der Eisenbahn, die zwischen Walvis Bay und Windhoek verkehrte, fuhr man ins vierzig Kilometer entfernte Swakopmund.
Die Stadt konnte die Herkunft ihrer Erbauer aus dem kaiserlichen Deutschland nicht leugnen. Nicht nur wegen der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Bismarck- und der Woermannstraße. Alles hier war sprichwörtlich sauber wie zu Hause; es gab ein Gasthaus, den Krug zum Grünen Kranz und ein Marineehrenmal zum Gedenken an die Gefallenen des Marine-Expeditionskorps während der Herero- und Namaaufstände von 1904 bis 1907. Die Stadt schlummerte dahin. Die Reste eines eisernen Landungssteges, der dreihundert Meter ins Meer hinaus ragte, erinnerten an die Zeit als deutsche Kolonie. Er sollte einmal über sechshundert Meter lang werden, damit große Schiffe dort anlegen konnten; die Woermann-Linie versorgte ja bekanntlich die Kolonie mit allem was gebraucht wurde. Die Mündung des Swakop war eine seichte ungeschützte Bucht. 1862 vom kaiserlichen Kanonenboot „WOLF“ in Besitz genommen, wartete das Land bis 1892, ehe die ersten vierzig deutschen Siedler in Begleitung von einhundertzwanzig Soldaten der Schutztruppe an Land gingen.
Da Walvis Bay von den Briten besetzt war, wurde das für die Versorgung der Kolonie sehr ungünstig gelegene Swakopmund als Versorgungshafen dringend gebraucht. Nach der Kapitulation der deutschen Schutztruppen 1915, bauten die Südafrikaner Walvis Bay aus und schlossen Swakopmund, das in einen Dornröschenschlaf fiel.
Der Metzger führte die Gruppe durch die anheimelnde Stadt und erklärte dies und das. Beeindruckend die Gebäude: Altes Amtsgericht, Woermannhaus und das Kaiserliche Bezirksgericht. Im Gasthaus gab es am frühen Nachmittag deftige deutsche Küche, und als man dann Kaffee und Schwarzwälder Kirschtorte endlich hinter sich hatte, wurde es Zeit, sich die Beine zu vertreten und auf der Promenade zur Landungsbrücke zu spazieren, wo die Angler saßen und die heimischen Bewohner sich Bewegung verschafften. Flarrows Blick wanderte hinaus zur endlosen Kimm über das Meer, das eine schon tief stehende Sonne golden flimmern ließ.
Dann wurde es Zeit, den Bahnhof anzusteuern, der 1901 gebaut, damals auch Sitz der Kaiserlichen Eisenbahnverwaltung war. Der Zug brachte sie alle wieder zurück zu den Schiffen und beendete einen eindrucksvollen Tag.
Am nächsten Morgen inspizierte der Surveyor die Hauptmaschine. Über den guten Zustand der Anlage zeigte er Erstaunen und sagte das auch. Flarrow war stolz und froh, dass nun alle wichtigen Klassearbeiten am Hauptmotor erledigt waren. Laut GL war alles im Lot. „As fare as could be seen“, sagte der Zweite und zitierte damit einen berühmten Satz der Surveyor von Lloyds Register, London.
Nach drei Tagen waren fast sechshundert Tonnen Fisch umgeschlagen, und die „TÜBINGEN“ lief zu einer neuen Fangreise aus. Ihr Kapitän hatte gesagt, es käme darauf an, wie lange die Besatzung das mitmachen würde. Also, noch eine oder zwei Fangreisen, ehe es zurück nach Bremerhaven ging, das war für die „TÜBINGEN“ die Frage.
Nun galt es, auf das nächste Schiff zu warten, das erst am nächsten Abend einlaufen sollte. „HILDEGARD“ war inzwischen an die Pier gegangen, hatte Frischwasser und Proviant übernommen, der wirklich lobenswert war. Besonders die Frischwurst des Metzgers aus Swakopmund schmeckte wie zu Hause!
Am nächsten Abend lief ein Seitenfänger der HANSEATISCHEN HOCHSEEFISCHEREI GmbH ein. Diese Reederei hatte wohl die Entwicklung zum Heckfänger verschlafen. Deshalb musste auf diesem Schiff das Netz immer noch Hand über Hand eingeholt werden. Es war auch nicht so groß, wie die „TÜBINGEN“, weshalb das Leben auf engem Raum bestimmt sehr stressig war. Ein rostiger Rumpf zeugte von langer Einsatzzeit und schweren Tagen auf den Fangplätzen. Der größte Unterschied zur „TÜBINGEN“ war jedoch die Besatzung. Während die Leute von der „TÜBINGEN“ sich sofort mit der Besatzung der „HILDEGARD“ verstand und sich gegenseitig besuchte, waren die Leute des Seitenfängers stumm und schweigsam. Auch die Schiffsleitungen wechselten nur die notwendigsten Worte. Es gab keine Einladungen, und die von der „HILDEGARD“ ausgesprochenen wurden nicht angenommen. Das war eben das Verhalten einer gestressten Besatzung, die reif war zur Ablösung. Die Arbeit auf einem Seitenfänger war eben um vieles härter als auf den viel effizienteren Heckfängern. Da deshalb auch die Fangergebnisse schlechter waren, wurde auch weniger verdient. Gute Leute waren natürlich rar und deshalb für solche Schiffe nicht zu bekommen.
Walvis Bay war auch lange ein Stützpunkt der Walfänger gewesen, als der Walfang noch mit Segelschiffen betrieben wurde. Wenn man den geschäftigen Hafen, den auch viele japanische Thunfischer anliefen, hinter sich ließ, erreichte man eine Siedlung mit eher dörflichem Ambiente. Die ehemaligen Häuschen der Walfänger, die hier überwinterten oder sesshaft geworden waren, konnte man noch an den riesigen Kieferknochen von Blauwalen erkennen, die als Torbögen verwendet wurden. Viel war nicht los in diesem Städtchen. Ein kleines Museum, ein paar Pubs und die Wüste Namib. In Erinnerung blieb eine Holztafel, die im Museum hing und verkündete, dass alle weiblichen Personen, die nach acht Uhr p. m. auf der Straße angetroffen wurden, vergewaltigt werden durften. Das waren wirklich wilde Zeiten, damals, als segelnde Walfänger noch drei Jahre benötigten, um ihre Tranfässer zu füllen.
Als „HILDEGARD“ an einem Nachmittag in See ging, war sie voll abgeladen. Man hatte bis in das Lukensüll hinein gestaut. In diesem Zustand benahm sich „Beulen-HILDE“ wie ein großer Frachter, der sich träge im Seegang wälzte. Während Walvis Bay hinter der Kimm versank, drehte der Westwind immer mehr nach Süden und fiel schließlich von achtern ein. Und „HILDEGARD“ lief locker ihre zwölf bis dreizehn Knoten über Grund. Trotzdem würde es noch fünfundzwanzig Tage dauern, bis sie den Leuchtturm Roter Sand in der Wesermündung sehen würden.
Es lief gut, sogar in Dakar, wo Flarrow Schneepflüge aus dem Ural am Rand des Hafenbeckens entdeckte. War das vielleicht Wirtschaftshilfe á la UdSSR?
Die Reise ging weiter, und alle freuten sich auf Deutschland, das sie nun über sechs Monate lang nicht gesehen hatten, der Alte besonders. Wenn es auch zu einem Besuch in Itzehoe nicht reichen würde, seine Frau und die Tochter würden sich an Bord sehen lassen.
Die See spielte weiter mit, das Wetter war sommerlich. In der Biscaya nahm der Verkehr zu. Große Tanker, Erzfrachter, schnelle Bananenjäger beachteten den Kümo „HILDEGARD“ kaum, rauschten vorbei. Ein Autotransporter, der von der US-Ostküste kam, lief langsamer. Er hatte entweder Zeit oder Probleme mit seiner Maschine. Er konnte viertausend PKW laden, ein Riesenschiff, welches von allen an Bord entsprechend bestaunt wurde. Im Kanal begann ein gründliches Rein-Schiff, man musste doch mit einem sauberen Dampfer einlaufen.
Texel Radio meldete sich, und Hamburg informierte über eine geplante Werftzeit, die für das Schiff völlig überraschend kam und in Bremerhaven durchgeführt werden sollte. Nun musste schnell noch eine Werftliste produziert werden, die bis zum Einlaufen fertig zu sein hatte.
An einem Mittwochabend nahmen sie den Weserlotsen an, und es wurde Nacht, bis sie durch die Doppelschleuse gingen und im Fischereihafen I festmachten.
Am Pier standen nicht nur die Familien, Verwandten, Freundinnen und Freunde, sondern auch die halbe Nautisch-Technische Abteilung aus Hamburg, die nach der Einklarierung sofort den Salon belegte und nur eine Frage hatte: „Wie kalt ist der Fisch?“ Flarrow konnte alle beruhigen, und gerade, als der Inspektor nach der Liste der Werftarbeiten fragte, wurde die Tür aufgerissen und der zuständige Veterinär, der die Einfuhrgenehmigung für die Ladung zu erteilen hatte, erschien im weißen Kittel und dröhnte los: „Was ist denn hier los? Ich kenne dieses Schiff doch. Immer gab es Schwierigkeiten mit den Temperaturen, und jetzt messen wir minus sechsundzwanzig Grad in den oberen Lagen und das im Sommer!“ – „Weiter unten werden es siebenundzwanzig bis achtundzwanzig Grad werden. Stört Sie das etwa?“, fragte Flarrow zurück und bemerkte die Erleichterung beim Chef der NTA und den Inspektoren.
Während der Veterinär immer noch kopfschüttelnd die erforderlichen Papiere ausfüllte und abzeichnete, nahm der Technische Direktor Flarrow beiseite und sagte: „Gut gemacht haben Sie das, sehr gut gemacht. Bereiten Sie hier Ihre Übergabe vor, wir haben Sie für die „POLARSTERN“ vorgesehen, die Sie in gut einer Woche übernehmen sollen. Wir sehen uns dann noch auf dem Büro. Die „POLARSTERN“ liegt bei MAN Hamburg in der Werft.“
Damit ließ er Flarrow stehen, denn nun hatten es alle eilig, zu ihrem Bus zu kommen, der sie nach Hamburg zurückbringen sollte.
Als Ruhe eingekehrt war, ging Flarrow auf die Brücke. In der Nock begann er zu begreifen, was wirklich geschehen war. Heute Abend war es um die „HILDEGARD“ gegangen, konnte man sie weiter beschäftigen? Die Frachtabteilung hatte Druck gemacht, und deshalb hatte der gesamte Stab und nicht nur ein Inspektor, auf das Ergebnis der Reise gewartet!
Die Stille lenkte ab und brachte ihn auf andere Gedanken. Vor ihm lag das Hafenbecken, wo sich nichts regte. Auf der anderen Seite des Beckens lagen ein paar Fischkutter und ein stillgelegter Fischdampfer, noch mit Dampfantrieb. Weiter hinten in Richtung Doppelschleuse zwei große Seitentrawler, die wohl morgen auslaufen würden. Hinter den Schuppen erhob sich die Helling der SEEBECK-WERFT, auf der keine Nachtschicht gefahren wurde. Lautlosigkeit um ihn herum und über ihm kein Stern.
Aber er war zu Hause, in einem heimatlichen Hafen. Eine Reise war zu Ende gegangen. Sie war ein Erfolg, denn das Schiff würde weiter beschäftigt werden, und an diesem Erfolg hatte er den Löwenanteil. „Nicht schlecht“, sagte sich Flarrow und war sehr stolz auf sich, vor allem weil er nun die „POLARSTERN“ bekommen sollte, das Modernste und Schnellste, was die Reederei zu bieten hatte. Sein Einsatz hatte sich ausgezahlt, und er empfand das als eine überaus gerechtfertigte Anerkennung.
Es wurde Zeit für die Koje. Da mit der Frühschicht Löschbeginn war, würde es nur eine kurze Bauernnacht werden.
Am nächsten Tag war viel Betrieb. Jan war auf seiner Sauftour, die er noch in der Nacht angetreten hatte, der Dritte Ingenieur nahm Urlaub, und der E-Assistent fuhr am Abend über das Wochenende nach Hause. Er würde am Montag wieder zurück sein.
Der Werftingenieur erschien zum Kaffee mit einer langen Liste aus Hamburg und sprach mit Flarrow die Arbeiten durch. Schwerpunkt waren die Wärmetauscher, wie Ölkühler, Frischwasserrückkühler etc. und natürlich Ruder, Schraube, Seekästen und der Schiffskörper – Klassearbeiten eben.
Man wollte das Schiff bereits am Freitag docken, über das Wochenende würde aber nicht gearbeitet werden. Die Löschgang arbeitete deshalb in zwei Schichten, um das Schiff bis Freitagmittag leer zu machen.
Der Erste ging abends an Land, Flarrow saß in der Sofaecke und las, als der Alte erschien und ihn einlud. „Ich möchte Sie meinen Weibern vorstellen, haben Sie Lust auf einen guten Scotch?“ Da konnte Flarrow schlecht nein sagen, und es wurde ein netter Abend. Am Freitag nach dem Verholen würde die Familie nach Hause fahren, worauf sich der Alte ganz besonders freute. Auch der Kapitän würde am Ende der Werftzeit abgelöst werden, allerdings hatte er noch kein neues Schiff. Später hörte Flarrow, dass er einen Frachter bei der Levante-Linie, die ebenfalls zur Hamburg-Süd Gruppe gehörte, bekommen hatte und damit endlich im Liniendienst in der Mittelmeerfahrt gelandet war. Das bedeutete nämlich alle drei Monate zu Hause in Hamburg.
Freitagmorgen; der Erste fehlte. Kurz vor dem Verholen traf er ein, und der Alte zog die Brauen hoch. Der Erste hatte aber die Liebe seines Lebens gefunden und gleich bei ihr übernachtet.
Freitagmittag; Löschende und Verholen ins Dock der Seebeck-Werft.
Zur Kaffeezeit ging die Maschinenanlage außer Betrieb, Flarrow schaltete die Stromversorgung auf Landstrom, und „HILDEGARD“ lag im Dock. Das war immer ein besonderer Moment, die Stille im Maschinenraum war so ungewöhnlich, aber nicht unangenehm.
Als er aus der Maschine kam, sah er den Lloydschlepper „MARS“, der zusammen mit „HILDEGARD“ gedockt worden war. Flarrow stieg ins Dock hinunter und begann seine Besichtigungstour. Als er unter dem Achterschiff auf die andere Schiffsseite wechselte, entdeckte er einen einsamen Mann, der sich scheinbar intensiv mit dem Voith-Schneider-Antrieb des Schleppers beschäftigte. Richtig, dieser Mann musste der Erste Ingenieur der „BERLIN“ sein, der ja jetzt Inspektor für die Lloydschlepper war. „Was machen Sie denn hier?“ fragte der Erste. „Auf so einem kleinen Schiff haben Sie doch nichts verloren.“ – „Ich fahre auf diesem Vollkühlschiff seit sieben Monaten als Chief. Es war so etwas wie ein Sonderauftrag.“ – „Und wo kommen Sie jetzt her?“ – „Mit Fisch von Walvis Bay, wir hatten Ladung von deutschen Trawlern, die dort unten fischen.“ – „Dann sind Sie also regulär als Leitender bei der Hamburg-Süd angestellt?“ Und weil Flarrow nickte: „Na dann herzlichen Glückwunsch und wie geht’s weiter?“ – „Nächste Woche soll ich unsere „POLARSTERN“ übernehmen.“ – „Die liegt doch in Hamburg und hat einen Haufen Probleme, oder?“ Flarrow nickte abermals, und der Erste sah auf die Uhr. „Na, dann wünsche ich Ihnen viel Glück und alles Gute!“ Ein Händedruck, und der Erste ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Flarrow hatte ein ungutes Gefühl, so hatte sich der Erste doch noch nie gezeigt, ein ausgesprochen kühler Abschied – er wurde eben aus dem Lloyd und seinen Leuten nicht schlau.
Freitagabend; kein Wachbetrieb mehr und ein leeres totes Schiff. Der Zweite Ingenieur stellte seine Frau vor, und kurz danach kam der Zweite Offizier ebenfalls mit seiner Frau, die ein Päckchen aus Kassel mitgebracht hatte. Muttern hatte sich wohl Sorgen gemacht und ein paar luftgetrocknete Würste mitgeschickt.
Dann tauchte der Erste auf, um Flarrow zum Landgang abzuholen. Mittlerweile war es zwanzig Uhr geworden, und so zogen sie los zur Femina-Bar, dort wurde der Erste nämlich erwartet.
Als Flarrow der großen Liebe vorgestellt wurde, tat ihm der Erste leid. Die würde ihm die letzte Mark abnehmen, bis er wieder los fuhr. Er verabschiedete sich denn auch sehr bald. Dem Ersten war eh nicht mehr zu helfen, Flarrow wusste aus Erfahrung, dass der nun ein Verlorener war.
Allein spazierte er die „Bürger“ hinunter. Es war Sommer und ein Wochenende, aber viel Betrieb gab es nicht. Einsam überlegte er, was mit diesem Abend anzufangen wäre. Für das Kino war es zu spät. Die Fischbratküche vielleicht, für ein zweites Abendessen? Die Rialto Bar! – ob es die noch gab? Natürlich gab es die Bar nicht mehr, und dort, wo sie gestanden hatte, gähnte eine Baulücke in der Häuserzeile. Was nun? dachte Flarrow und schlenderte langsam den bunten Lichtern auf der Rickmerstraße entgegen, die für die Verlorenen immer blinkten.
Der Montagmorgen machte den stillen Tagen ein Ende. Die Werft kam an Bord, und es wurde laut, sowohl im Dock als auch im Maschinenraum. Die Besatzung, soweit nicht beurlaubt, hatte die Arbeiten zu erledigen, mit denen man die Werft nicht beauftragt hatte.
Nachdem die Werft eingewiesen worden war, begann Flarrow seine Übergabe vorzubereiten. Er saß vor seiner Schreibmaschine, um den Reisebericht zu erstellen, als Kapitän Wichmann, der Nautische Inspektor, herein schaute und ihm einen verschlossenen Umschlag übergab. „Wir sehen uns ja dann noch“, sagte er und verschwand. Flarrow öffnete neugierig den Brief. Die Nautisch-Technische Abteilung sprach ihm für vorbildliche Einsatzbereitschaft bei der Brandbekämpfung Dank und Anerkennung aus. Der Brand lag soweit zurück, da kam dieses Schreiben völlig überraschend. Doch dann las er weiter: „Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, Ihnen eine Prämie in Höhe von DM 100,-- auszuzahlen, die wir inzwischen Ihrem Gehaltskonto gut geschrieben haben.“ Das sollte der Ansporn sein für weitere wirkungsvolle Mitarbeit? Da blieb Flarrow die Luft weg. Das, was er getan hatte, war nichts weiter als seine Pflicht. Als Vorgesetzter hatte er auch die Pflicht, die ihm unterstellten Personen gesund nach Hause zu bringen. Über eine schriftliche Anerkennung hätte er sich gefreut, aber eine Prämie, in einer Höhe, die gerade einmal vier Prozent seiner Monatsheuer entsprach, das fand er einfach unanständig, abwertend. „Das schicke ich denen zurück!“ sagte Flarrow zum Alten und zeigte ihm den Schrieb. „Die verwechseln mich doch glatt mit dem Salonsteward. Ich bin doch kein Trinkgeldempfänger! Was bilden die sich eigentlich ein?!“ Der Alte beschwichtigte und verwies auf die allgemeine Lage der Reederei. Flarrow sollte sich das überlegen, es sei doch gut gemeint. Aber Flarrow knurrte nur etwas von „beschämendes Verhalten“.
Am nächsten Tag erschien der Inspektor. Er gab Flarrow natürlich recht: „Sicher, ich verstehe Sie sehr gut, aber es war wirklich sehr schwer, den Vorstand überhaupt zu einer Äußerung zu bewegen. Die Prokuristen sind angewiesen, äußerste Sparsamkeit walten zu lassen.“ Schließlich gab sich Flarrow zufrieden. Aber hinsichtlich der Wertschätzung von Leistungen des Bordpersonals seitens der Reederei, konnte er von nun an eine gewisse Voreingenommenheit nicht mehr unterdrücken.
Man war offenbar froh, dass man tüchtige Leute hatte, deshalb musste man sie noch lange nicht wirklich als wertvoll akzeptieren. Der Psychologe des Verbandes Deutscher Reeder, den er in Sankelmark kennen gelernt hatte, ließ grüßen. So war es.
Bei der Übergabe an seinen Nachfolger, der frisch befördert worden war, sprachen sie über die einzelnen Mitglieder der Maschinenbesatzung, insbesondere über Jan van Thaden. Flarrow erklärte seine Taktik und die Erfahrung, die er damit gemacht hatte.
„HILDEGARD“ hatte inzwischen ausgedockt und Jan, völlig pleite, ging nun wieder brav Hafenwache, als Flarrow ihn noch ein letztes Mal ermahnte. Jan nahm das Ganze sehr ernst. Doch drei Wochen später trafen sie sich in der S-Bahn in Hamburg wieder. Der neue Chief hatte Jan wegen seines unveränderten Verhaltens beim Landgang gefeuert. Er hatte den Sack noch in Deutschland bekommen.
„HILDEGARD“ lag nun schon im Handelshafen und wartete auf die Reiseorder. Sie war gut in Farbe, in strahlendem Weiß und rotem Unterwasseranstrich, der weit aus dem Wasser war, weil das Schiff noch keine Ladung und nahezu leere Brennstofftanks hatte. Flarrow stand mit dem Alten an der Pier. Die Tochter des Kapitäns erschien mit dem Auto, um den Vater abzuholen. Der Alte reichte Flarrow zum Abschied die Hand: „Also, dann viel Glück, mein Lieber!“ – „Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Kapitän.“ Und als das Auto des Kapitäns verschwunden war, murmelte er mit Blick auf den völlig hoch aufragenden Bug: „Nichts, als ein fett gemachter Kümo; wie man so etwas nur mögen kann.“
Der Taxifahrer verlud Flarrows Gepäck und brauste mit ihm in Richtung Hauptbahnhof Bremerhaven davon.
* * *