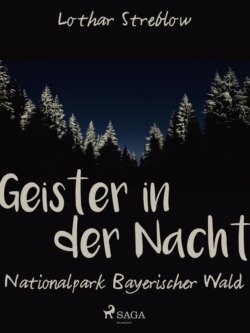Читать книгу Geister in der Nacht. Nationalpark Bayerischer Wald - Lothar Streblow - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Urwald
ОглавлениеEigentlich gehöre ich nicht zu den Menschen, die vom Frühaufstehen sonderlich begeistert sind. An diesem Morgen aber trieb es mich gegen fünf Uhr aus den Federn, trotz der zahlreichen nächtlichen Polterspäße. Als ich die Augen öffnete, schimmerten die drei riesigen dunklen Fichten vor dem Fenster in einem fast unwirklich strahlenden Morgenlicht. Was kein Mensch zu hoffen gewagt hatte, war eingetreten: Die Sonne schien. Sie schien, trotz der Morgenkühle, unwahrscheinlich warm und lockte einen geradezu fantastisch-intensiven Duft aus den Wäldern. Mit einem Schlag war ich hellwach und beschloß, diese möglicherweise einmalige Gelegenheit zu nutzen und zumindest die nähere Umgebung in Richtung Rachelsee bei Morgenstimmung zu erkunden.
Aber natürlich blieb auf den knarrenden Dielen unserer hölzernen Behausung meine morgendliche Aktivität nicht unbemerkt.
»Spielst du vielleicht jetzt zur Abwechslung mal Großer Geist?« fragte Nole verschlafen. »Wie spät ist es denn überhaupt?«
»Guten Morgen!« verkündete ich fröhlich. »Es ist kurz vor fünf.«
»Verrückt so was!« knurrte Nico unter seiner Decke hervor. »Noch nicht mal in den Schulferien kann man ausschlafen!«
»Recht hat er!« sekundierte Nole.
»Ihr könnt!« antwortete ich beruhigend. »Aber ich werde eine Morgenexkursion unternehmen. Gleich bin ich verschwunden. Also schlaft schön weiter.«
Mit diesen Worten verschwand ich durch die Tür, um mich unten einer Kaltwasserkur zu unterziehen. Doch als ich zurückkam, hatte sich Nico ebenfalls aus dem Bett bequemt und erklärte:
»Ich gehe mit!«
»Ich auch«, sagte Nole. »Schlafen kann man schließlich auch bei Regenwetter. Außerdem muß ich ja Frühstück machen.«
Mir war das nur angenehm. Und nach kurzem Imbiß stiefelten wir los, bewaffnet mit Fotoapparat und Fernglas, über den Dammweg der alten Triftklause, wo uns eine offenbar verspätete Erdkröte begegnete, die gemächlich dem Uferdikkicht zustrebte.
»Guten Morgen, du Krötling«, grüßte Nico freundlich und betrachtete aufmerksam das für uns selten zu beobachtende Tier.
Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die Kröten eklig finden, mochten wir Kröten ausgesprochen gern: Sie haben so etwas Gemütlich-Behäbiges. Und natürlich wußten wir auch, daß sie als ausgesprochen nützlich gelten. Aber das interessierte mich weniger. Ich hielt überhaupt nichts von der schematischen Einteilung nach Nützlingen und Schädlingen: Schließlich haben alle Lebewesen im Gesamthaushalt der Natur ihre Funktion, vorausgesetzt, daß das natürliche Gleichgewicht nicht durch menschliche Eingriffe gestört worden ist. Und konsequenterweise müßte dann der Mensch als schlimmster Schädling der Natur eingestuft werden, was er ja seit Generationen schlagend bewiesen hat und täglich aufs Neue beweist. Aber so was hören unsere Zeitgenossen bekanntlich nicht sehr gern.
Der Kröte allerdings waren solche Überlegungen fremd. Und mit unfreundlichen Menschenfüßen hatte sie wohl noch keine Bekanntschaft gemacht. Sie zog unbekümmert des Weges ihrem Schlupfwinkel zu.
»Sag mal, Paps?« fragte Nico, als wir ebenfalls weitergingen. »Hat der freundliche Ordnungsdienstmann, der uns gestern hier hochbrachte, nicht davon gesprochen, daß die alte Triftklause neben der Racheldiensthütte trocken gelegt werden soll?«
»Hat er«, bestätigte Nole. »Es wäre schade drum.«
Auf Nicos Stirn bildete sich eine Zornesfalte.
»Das verstehe ich nicht, Paps. Was soll denn dann aus all den Tieren werden, die am und im Wasser leben? Damit würde doch ein wichtiges Biotop zerstört!«
»Eben«, brummte ich. »Schließlich ist ein Biotop ein durch bestimmte Pflanzen- und Tiergesellschaften gekennzeichneter Lebensraum. Und wenn hier das Wasser verschwindet, verschwindet auch die spezifische Pflanzen- und Tierwelt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß hier jemand so etwas ernsthaft in Erwägung zieht. Wir sind immerhin in einem Nationalpark.«
Nico warf mir einen schrägen Blick zu.
Er wußte natürlich genausogut wie ich, daß Nationalparks Landschaftsräume sind, die wegen ihres ausgeglichenen Naturhaushalts, ihrer Bodengestaltung, ihrer Vielfalt oder ihrer Schönheit überragende Bedeutung besitzen und die vornehmlich der Erhaltung und wissenschaftlichen Beobachtung natürlicher und naturnaher Lebensgemeinschaften, sowie eines möglichst artenreichen heimischen Tier- und Pflanzenbestandes dienen. Und daß sie der Bevölkerung zu Bildungs- und Erholungszwecken zu erschließen sind, soweit es der Schutzzweck erlaubt. So war es in leicht grauslichem Amtsdeutsch im Bayerischen Naturschutzgesetz von 1973 verankert. Doch das Nationalparkgebiet war keine reine Urlandschaft mehr. Auch hier hatte der Mensch bereits spürbar eingegriffen. Und dazu gehörten auch die Triftklausen, die im neunzehnten Jahrhundert künstlich errichtet worden waren, und deren Stauwasser die Abtrift des geschlagenen Holzes über die zu Tal fließenden Bergbäche wesentlich erleichterte. So gesehen bildeten die Triftklausen also im Grunde vom Menschen geschaffene Fremdkörper im Naturwald. Andererseits existierten sie nun schon mehr als hundert Jahre und spielten für den Wasserhaushalt des Waldes eine wichtige Rolle. Außerdem wußten wir, daß die Dämme einiger Triftklausen sogar erneuert worden waren, um sie auch weiterhin zu erhalten. Es war also nicht einzusehen, warum ausgerechnet die Triftklause an der Racheldiensthütte verschwinden sollte. Sie paßte dort in die Landschaft, fanden wir.
Inzwischen waren wir weitergegangen und an der Abzweigung des Weges zum Rachelsee eingebogen. Und hier machten wir eine interessante Entdeckung. Dieser Wald sah ganz anders aus als die Wälder, die wir sonst kannten. Es war ein Bergmischwald aus Fichten, Buchen und vereinzelten Weißtannen unterschiedlichen Alters. Das war im Gegensatz zu den uns vertrauten Wirtschaftswäldern aus meist altersgleichen eintönigen Fichtenbeständen für uns schon ein seltener Anblick. Das Eigenartigste daran aber waren die vielen toten aufrechtstehenden oder umgestürzten Bäume, die dem Wald sein besonderes Gepräge gaben.
»Ist das vielleicht schon der Urwald?« erkundigte Nico sich interessiert.
Ich unterdrückte ein Grinsen. Nico hatte sich wie immer darauf verlassen, daß ich mich vor unserer Exkursion etwas präpariert hatte: Das ersparte ihm die Mühe. Und das hatte ich selbstverständlich getan, jedenfalls soweit es mir möglich gewesen war: schließlich bin ich kein studierter Forstmann. Doch mit etwas Interesse und einer gehörigen Portion Aufmerksamkeit für unsere Umwelt läßt sich vieles entdecken, woran die meisten achtlos vorüberlaufen. Nico besaß dieses Interesse. Und Nole natürlich auch; deshalb sagte sie jetzt:
»Der Urwald beginnt doch erst am Rachelsee!«
»Hmmm«, machte Nico. »Ich finde aber, daß es hier schon ziemlich urig aussieht. Überall auf den umgestürzten Bäumen wachsen schon wieder kleine Bäume heraus. Und dort drüben aus dem modernden Baumstumpf auch. Richtig wild und unordentlich ist das hier. Einfach toll, finde ich.«
Das fand ich auch. Und dann versuchte ich den beiden zu erklären, was ich darüber wußte. Im Vergleich mit anderen Waldlandschaften ist der Bayerische Wald und besonders das Nationalparkgebiet noch verhältnismäßig naturnah, das heißt: nur sehr wenig durch den Menschen verändert. Und hier ist der Artenreichtum der ursprünglichen Pflanzen- und Tierwelt noch fast vollständig erhalten. Dabei spielt gerade das tote Holz abgestorbener Bäume eine wesentliche Rolle: nicht nur für bestimmte Insekten, Pilze, Moose und Flechten und die auf moderndem Holz besonders gut gedeihenden Keimlinge, sondern auch für eine Vielzahl von Tieren, vor allem aber für den Specht, von dem es im Nationalparkgebiet allein fünf Arten gibt. Und besonders der sehr seltene schwarz-weiße Dreizehenspecht ist auf stehende tote Bäume angewiesen, um überhaupt leben zu können. Wo jedoch Spechte ihre Höhlen nicht in totes Holz bauen können, haben auch die anderen Höhlenbrüter wie Stare, Meisen, Hohltauben, Rauhfuß– und Sperlingskäuze keine Unterschlupfmöglichkeiten, was zwangsläufig zu einer Verarmung der Tierwelt führt, wie sie in den typischen Wirtschaftswäldern, in denen jedes tote Holz restlos beseitigt wird, überall der Fall ist. Und auch die Bilche, die gern in verlassenen Spechthöhlen hausen, wären dann obdachlos, sofern sie nicht gerade einen ihnen sympathischen Dachboden finden.
»Aha«, grinste Nico sachverständig. »Wie unser nächtlich polternder Großer Geist. Offenbar gibt es für Bilche trotz der vielen toten Bäume hier immer noch Wohnungsmangel.«
»Oder es gefällt ihm bei uns einfach besser«, meinte Nole.
»Möglich«, brummte Nico und blickte mich fragend an. »Und jetzt möchte ich gern wissen, wieso das hier kein Urwald ist.«
Ich nickte.
»Dieser Wald ist noch zu jung und offensichtlich früher zumindest teilweise genutzt worden. Jetzt bemüht sich die Nationalparkverwaltung, diese Waldgebiete in einen möglichst naturnahen Zustand zurückzuführen. Und dazu gehört vor allem, das tote Holz im Wald zu lassen. Der Sinn ist: den natürlichen Umweltkräften eine möglichst ungestörte Entfaltung zuzugestehen. Werden und Vergehen sollen sich nach den Gesetzen der Natur vollziehen, wie es sehr treffend in einem der Prospekte heißt. Hier siehst du den Anfang dieser Bemühungen. Und ich nehme an, wenn wir oben im Urwald am Rachelsee sind, wirst du den Unterschied selbst erkennen.«
»Hmmm«, machte Nico. »Ich bin gespannt.«
Das waren wir auch. Doch bis dahin sollten wir noch ganz schön unter Dampf geraten. Der Weg stieg ständig an. Ich hatte mir inzwischen den Pullover ausgezogen und um die Hüften geschlungen. Auch Nico wischte sich gelegentlich über die Stirn. Aber das störte uns nicht. Diese Morgenstimmung im Wald war einfach fantastisch. Die Sonne brach ungehemmt durch die Baumwipfel und malte helle Kringel auf den Waldboden. Kein Mensch begegnete uns. Und in den Zweigen über uns ertönte ein vielstimmiges Vogelkonzert, wie wir es seit langem nicht gehört hatten. In diesem Wald war die Welt offenbar noch in Ordnung.
Erfreulicherweise wurde der Weg jetzt etwas ebener und fiel dann sogar leicht ab. Aus der Ferne klang ein Rauschen. Und wenig später kamen wir zu einem Wildbach, der glucksend über bemoostes Geröll strömte. Auch die mit Farn dicht bewachsenen Ufer waren von glattgeschliffenen Felsbrocken übersät. Wir standen vor einer eiszeitlichen Moräne und am Anfang des Eiszeitlehrpfades, wo mittels kunstvoll geschnitzter Holztafeln der Wanderer über die glazialmorphologische Geschichte des Rachelgebietes informiert wurde. Das war höchst aufschlußreich. Und nachdem wir die Tafeln aufmerksam studiert hatten, fühlten wir uns um einiges schlauer. Danach hatte sich während der Eiszeit am Rachel ein Gletscher gebildet, der unter sich Geröll und Geschiebe zu Tal beförderte, das nach seinem Abschmelzen als Moränen zurückblieb. Wir befanden uns also jetzt dort, wo vor mehr als zehntausend Jahren die Ausläufer des Gletschers standen.
»Ein merkwürdiges Gefühl«, meinte Nico beeindruckt. »Dabei kann einem richtig kalt werden. Es sieht aus, als hätten hier Zyklopen mit Steinen gespielt.«
Aber uns wurde ziemlich schnell wieder warm, als wir nach Überqueren eines weiteren Geröllfeldes beim sogenannten Roßstall, einem ehemaligen Pferdestall aus vergangener Holzfällerzeit, über die Mittelmoräne des alten Gletschers aufwärts kletterten, immer begleitet vom Rauschen des Seebachs, der sich weiter talwärts mit anderen Seitenbächen zur Großen Ohe vereinigt. Weit konnte es nun nicht mehr sein. Und das war es auch nicht.
Nico, der uns mit seinen langen Beinen um einiges voraus war, blieb plötzlich stehen, um sich mit einer riesigen Informationstafel zu beschäftigen.
»Urwald!« bemerkte er trocken.
Das hatten wir inzwischen auch schon gesehen. Der Wald besaß hier einen völlig anderen Charakter. Dann entdeckte Nole den See, dessen in der Morgensonne glitzernde Wasserfläche silbrig durch die Stämme schimmerte. Nun waren es nur noch ein paar Meter, bis wir uns auf einer der Bänke am Ufer niederlassen konnten, leicht verschwitzt, aber doch restlos zufrieden.
Das also war der berühmte Rachelsee, einer der drei einzigen im Bayerischen Wald auf natürliche Weise während der Eiszeit entstandenen Seen, als sich die Wasser des abschmelzenden Rachelgletschers am Fuß der Steilwand in einer Karmulde hinter einem Moränenwall stauten. Damals mochte es hier wesentlich anders ausgesehen haben als heute. Doch diese überwältigende Landschaft hier war in Jahrhunderten und Jahrtausenden ihren eigenen Gesetzen folgend natürlich gewachsen. Nichts erinnerte hier an einen Eingriff durch den Menschen.
»Ein Natursee im Urwald«, sagte Nole leise. »Kaum zu fassen, daß es dies in unseren Breiten noch gibt.«
Sie schwieg. Und auch uns war nicht nach Sprechen zumute. Diese tiefe Ruhe inmitten der unberührten Natur war eines der ganz wenigen unschätzbaren Erlebnisse, die man nur schweigend in sich aufnehmen konnte. Dabei glitten unsere Blicke hinüber zum seitlichen Seeufer, wo riesige, mehrere hundert Jahre alte Weißtannen die Buchen und Fichten überragten, und dann weiter hinauf nach Norden zu, an der durch die dunkelgrünen Baumwipfel kaum erkennbaren Rachelkapelle vorbei bis zu der mit urwüchsigem Bergfichtenwald bedeckten Gipfelregion des Rachel. Ich wußte, daß See und Urwald schon lange unter strengem Naturschutz standen. Immerhin galt dies hier als das wertvollste Urwald-Naturschutzgebiet des Bayerischen Waldes. Doch so im wahrsten Sinne des Wortes urwüchsig hatte ich es mir nicht vorgestellt. Überall zwischen dem wuchernden Grün standen und lagen die mächtigen Ruinen abgestorbener Baumriesen, auf denen sich schon wieder junge Bäume ihren Weg zum Licht erkämpften. Es war ein ständiges Werden und Vergehen in unendlichem Kreislauf. Und ich spürte, wie winzig, wie unbedeutend im Grunde der Mensch ist inmitten des Waltens ungestörter Natur.
Plötzlich schreckte uns Nicos Stimme aus unserer Beschaulichkeit.
»Hol mal das Fernglas raus, Paps! Drüben über der Seewand schwebt ein größerer Vogel. Das könnte ein Bussard sein!«
Doch bevor ich das Glas aus dem Futteral hatte, war der Vogel bereits dem hinteren Teil des Sees zugeglitten. Und vor der dunkelgrün aufstrebenden Seewand war die Zeichnung seines Gefieders nicht zu erkennen. Immerhin: der Größe nach war es wohl ein Mäusebussard. Aber: gab es die hier oben überhaupt? Eigentlich lag ihr Hauptverbreitungsgebiet in der Nähe von Feldfluren, ähnlich wie im Remstal. In Bergwäldern jedoch kam er nur spärlich vor. Und wir waren hier im Bergwald. Vermutlich war es ein Habicht, der als Charaktervogel alter, reich strukturierter Wälder gilt. Und neben dem Mäusebussard brütete auch der Habicht im Nationalpark.
»Nun, was ist, Paps?« fragte Nico ungeduldig.
Ich schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid. Ich habe ihn nicht genau erkennen können. Es wird wohl eher ein Habicht gewesen sein, der zwar schlanker ist, aber die gleiche Größe hat.«
»Hmmm«, machte Nico.
Inzwischen war der Vogel waldwärts abgestrichen und nicht mehr zu sehen. Nico suchte noch eine Weile mit dem Glas die Gegend ab, gab es schließlich aber auf.
Und dann entdeckten wir etwas, das wir hier oben später nie wieder zu sehen bekommen sollten. Dicht vor uns am Uferrand zog eine kleine Schar winziger Krickentenküken ihre Bahn durchs Wasser: wie hingetupfte gelbliche Federbällchen. Nur eins war merkwürdig: die Entlein waren allein. Und so sehr wir auch den See mit dem Fernglas absuchten, nirgends konnten wir die Entenmutter erblicken.
»Verstehst du das?« fragte Nole.
Nein, ich verstand es auch nicht. Normalerweise wurden solche Winzlinge immer noch von der Mutter geführt. Aber wo war sie? Hatte der Habicht sie vielleicht geholt? Möglich war es. Allerdings wirkten diese niedlichen Federbällchen schon ziemlich selbständig. Und Krickenten waren ohnehin verhältnismäßig klein. Zielstrebig zogen sie an uns vorüber dem am seitlichen Seeufer liegenden Schilfgürtel zu, wo sie eines nach dem anderen verschwanden.
Nico grinste.
»Du kannst ja mal ein bißchen Entenmutter spielen, Paps, wie der gute alte Konrad Lorenz.«
Das schien mir allerdings ein reichlich verwegener Gedanke, zumal hier oben am Rachelsee in mehr als tausend Meter Seehöhe.
Nole nahm mir die Antwort ab.
»Das dürfte wohl überflüssig sein, mein Sohn. Diese Kleinen sahen nicht so aus, als ob sie ausgerechnet deinen Vater als Mutter nötig hätten.«
Ich zog es vor zu schweigen. Und auch die beiden verfolgten das Thema nicht weiter, als wir aufbrachen, um nach dem Studium der am Urwaldlehrpfad aufgestellten Informationstafeln den Abstieg anzutreten. Es war inzwischen immerhin bald acht Uhr, und wir spürten alle drei ein durchaus menschliches Rühren in der Magengegend. Außerdem wollten wir zurück sein, bevor der alltägliche Touristenstrom begann. Eines jedenfalls stand für uns fest: Diese fantastisch urwüchsige Landschaft würde uns bald wiedersehen.