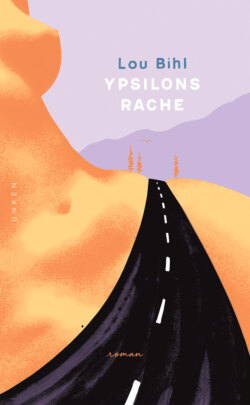Читать книгу Ypsilons Rache - Lou Bihl - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBerlin
Diesmal sah sie mir nicht in die Augen.
»Professor Wolff ist gleich bei Ihnen«, begrüßte mich die Chefsekretärin der urologischen Klinik. Minuten später federte Wolff in das Sprechzimmer, ließ seine massige Gestalt in den ledergenoppten Drehsessel fallen und goss stilles Wasser aus einer Kristallkaraffe in zwei Gläser. Eines reichte er mir über den Tisch.
»Leider ist es keine Prostatitis, sondern doch ein Karzinom.« Ich griff nach dem Glas und setzte es ab.
»Passt ja zum Wetter«, hörte ich mich sagen und starrte auf die fetten grauen Tropfen, die an der Fensterscheibe zerplatzten.
»Wetter geht vorbei«, murmelte Wolff und klickte im Rechner auf Drucken.
»Danke, sehr tröstlich, Leben geht auch vorbei.«
Ich starrte weiter auf das Fenster und die trommelnden Tropfen. Der Laserdrucker begann zu schnurren.
»Sorry, war nicht so gemeint«, brummte Wolff und reichte mir den Pathologiebericht.
Dort stand: Prostatastanzbiopsie Prof. Dr. Kristian Starck, Adenokarzinom der Prostata cT2c, Graduierung 3 (ISUP), den Rest konnte ich ohne Brille nicht lesen, war auch egal. Allerdings amüsierte mich die handschriftliche Notiz: Achtung, Pat. ist Pathologe!!
»Die Konkurrenz schreibt immer so unprofessionelle Befunde«, kommentierte ich.
Wolff knurrte: »Nächstes Mal lasse ich die Biopsiepräparate direkt an dich schicken!«
»Wie kommst du darauf, dass nächstes Mal nicht schon vorbei ist?«
»Deine Ironie ist destruktiv. Lass uns das Gespräch in eine zielführende Richtung lenken.«
»Sehr wohl, Boss, führe mich, oh Herr, und lenke!«
Erstaunlich, wie gut es sich anfühlte, meinen alten Studienfreund rüde zu behandeln. Wolff straffte die Schultern, zog seinen beschichteten Sixpack-Bauch ein und schaltete die Stimme in den Trostmodus. »Du siehst, dein Tumor ist auf die Prostata beschränkt, das heißt, wir haben zwei Therapieoptionen und eine realistische Chance.«
Wolffs persönliche Empfehlung war eine radikale Operation, bei der Prostata und Lymphknoten entfernt würden; nicht ohne Stolz fügte er hinzu, der neue Da-Vinci-Roboter ermögliche eine besonders schonende Operationstechnik.
Ich konnte kaum folgen und sah mich schon wehrlos und winzig auf den OP-Tisch geschnallt, während das Robotermonster sein Messer an einem vielgliedrigen Stahlarm in computergesteuertem Winkel in meinen Unterleib rammte.
Als Kind entdeckte ich den Dichotomschalter und nutzte ihn, wenn Ängste mich überwältigten, zum Beispiel vor Vaters Strafe. Ich lege den Schalter um und trete heraus aus dem furchtsamen Selbst, betrachte wie durch ein Teleskop, was dem Menschen Starck geschieht. So rückt das Gegenwärtige in weite Distanz, der Schmerz wird betäubt, die Angst vaporisiert. Ich sehe den anderen Starck in perfekter Pseudo-Coolness, wie Sean Penn in Death Sentence – gegenüber dem massigen Uro-Boss, eigentlich ein abgebrühter Macho, heute aber mit Schweißfilm auf der Oberlippe, obwohl für ihn die Verkündung potenzieller Todesurteile zum Alltag gehört, wie für den Pathologen. Nichts Bedrohliches. Selbst der Da-Vinci-Roboter kommt plötzlich daher wie E. T., mit großen, freundlichen Kinderaugen.
Wolffs Erläuterungen rauschten weiter an mir vorbei. Seltener Harninkontinenz, entscheidender Vorteil sei, dass man die OP sofort terminieren könne, wohingegen vor Beginn einer Bestrahlung drei Monate antiandrogene Therapie fällig wären. Mit Nebenwirkungen, beispielsweise Feminisierung der Gestalt und Brustschwellung.
»Super, kann ich so eine Hormontherapie auch vor der Operation machen?«
Wolff sah mich entgeistert an. »Neoadjuvant? Wozu? Das wäre doppelt gemoppelt, und Studien besagen, dass das nichts bringt. Warum solltest du dir also so was antun?«
»Weil ich Zeit brauche – für mein Sabbatical und mein Buch, einige Dinge, die ich schon viel zu lange vor mir her schiebe …«
Bei den letzten Worten geriet ich ins Nuscheln, meine Hände sanken auf die Lehne.
»Du musst dich nicht heute entscheiden«, beruhigte mich Wolff, »denk in Ruhe über alles nach! Hast du noch Fragen zur OP?«
Eine fette Fliege krabbelte über die nackte Brust der androgynen Südseeinsulanerin von Gauguins verlorenem Paradies.
»Kann man nach einer Prostatektomie eigentlich noch eine geschlechtsangleichende Operation durchführen?«, hörte ich mich fragen, biss mir auf die Zunge und schob hinterher: »War nur Scherz.«
Irritiert von meinem Blick, der an ihm vorbeiging, drehte Wolff den Kopf zum Bild, um jetzt selbst das Insekt zu beobachten, wie es die Brustwarze der jungen Frau umrundete, die ihrerseits völlig ungerührt am Insulaner vorbeistarrte. Als die Fliege abhob, schüttelte Wolff den Kopf. »Komische Frage. Ich weiß nicht, ob nach Prostatektomie eine Geschlechtsumwandlung machbar ist, soweit ich weiß, braucht man die Prostata für die Lubrikation.«
»Geschlechtsangleichung«, korrigierte ich reflexhaft.
Wolff trommelte mit Zeige- und Mittelfingern auf der Tischplatte. »Wie auch immer. Sag mal, bist du ein bisschen neben der Spur – oder ist das mal wieder dein bizarrer Humor? Wie kommst du auf den Quatsch?«
»Nur so, ich habe neulich einen Artikel über Prostatakarzinome bei Transgenderfrauen gelesen.«
Wolff verdrehte die Augen, schüttelte den Kopf, sah auf die Uhr und stand auf. »Nicht mein Metier, aber um deine Prostata kümmere ich mich gern. Du weißt, ich bin immer für dich da, ruf mich an, wenn du dich entschieden hast. Kannst ja vorher noch mit dem Strahlentherapeuten sprechen.«
Zum Abschied schüttelten wir uns die Hand, was die Gefühlsschwere des Augenblicks nicht ausreichend löste. Also umarmten wir uns wie schwitzende Boxer, mit gefühlt einem halben Meter Abstand, und klopften uns dabei kräftig auf die Schultern.
Mit beschlagener Brille lief ich durch den peitschenden Regen, setzte mich klatschnass ins Coupé und fuhr im Schritttempo durch den hauptstädtischen Berufsverkehr in Richtung Spreebogen.
Beim Aufschließen der Wohnungstür wappnete ich mich für die Erkenntnis, dass nun nichts mehr so sein würde wie zuvor. Die dazu passende Empfindung stellte sich nicht ein. Im Spiegel war die graue Mähne regensträhnig, ansonsten sah ich mir nichts an. Im Kühlschrank herrschte Ebbe, für Rotwein war es zu früh, für härtere Sachen der Magen zu leer. Ich schälte mich aus den nassen Klamotten und verließ die Wohnung in Lieblingsjeans, Hoodie und Anorak mit dem unbestimmten Wunsch, irgendetwas anderes zu tun als sonst.
Der Regen löcherte die Spree wie ein Schrotgewehr. Die Straße der Erinnerung war fast menschenleer, nur ein einsamer Jogger trabte vorbei an Edith Steins zersplittertem Gesicht, am schwermütigen Blick von Käthe Kollwitz und dem trotzigen Georg Elser. Bei jeder Statue klopfte er, ohne seinen Lauf zu unterbrechen, zweimal mit den Knöcheln auf den Sockel, Ludwig Erhard ließ er aus.
Mich würde niemand auf einen Sockel stellen, nicht mal in der Erinnerung. Aber einen Grabstein wollte ich auch nicht.
Als der Anorak durchnässt war, brach ich den ziellosen Marsch ab und flüchtete in die nächstbeste Kneipe. Ein Schwall aus Alkohol, altem Bratfett und ungewaschenen Körpern schlug mir entgegen. Die wenigen Gäste, ausschließlich Männer, starrten mit grauen Gesichtern und leerem Blick in halbvolle Biergläser. Das Neon über dem Tresen flackerte grünlich, Helene Fischer dröhnte atemlos durch die Nacht. Ich bestellte ein Pils und zwei Buletten, die auf der Theke unter einer Plastikabdeckung schwitzten, dazu eine Portion Kartoffelsalat, bei dem die Mayonnaise schon Krusten bildete. Trotz der frühen Stunde orderte ich einen Korn dazu, ohne mich an den Fingerabdrücken auf dem Schnapsglas zu stören, mein Befund machte die Sorge um hygienische Belange belanglos.
Nach dem dritten Pils ging ich auf das Unisexklo. Es tröpfelte so zögerlich, als hätte Wolffs Diagnose mir eine Stahlklammer um die Harnröhre geschraubt. Auf dem Rückweg in den Gastraum kam mir die Idee, eine Schachtel Marlboro zu ziehen. Selige Zeiten, als man sechzehnjährig für zwei Mark zwanzig Zigaretten bekam, dachte ich, als der Automat den Nachweis meiner Volljährigkeit verlangte.
Zu Hause fand ich bei den Teelichtern ein Päckchen Streichhölzer und inhalierte den ersten Zug seit zwanzig Jahren mit lustvoller Hingabe. Den Hustenreiz ignorierte ich, auch der Schwindel war nicht unangenehm, wohl aber das Aufstoßen: Bier, Bulette und Marlboro. Die Notration Underberg fiel mir ein, ich fand zwei Viererpackungen von 2-cl-Flaschen in der hintersten Ecke des Hängeschranks. Die bittere Schärfe ätzte sich durch die Speiseröhre und räumte den Magen auf.
Ich konnte ich es nicht lassen, klappte den Laptop auf und wurde bei PubMed fündig. Was die Überlebensraten betraf, gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Operation und Strahlentherapie, sehr wohl aber deutliche Differenzen bei Inkontinenz und Impotenz. Zu Ungunsten der Operation. Dann gab ich Gender Affirming Surgery und Prostate Cancer ein, fand aber nur in einem Artikel die lapidare Aussage, Patienten mit vorangegangenen Operationen oder einer Strahlentherapie im Beckenbereich müssten über erhöhte Risiken und Schwierigkeiten bei der operativen Konstruktion einer Neovagina aufgeklärt werden. Und dann noch die Aussage, bei Rauchern sei die Komplikationsrate höher. Ich warf die Zigaretten in den Müll.
Der blinkende Posteingang lenkte mich ab.
Wie war’s bei Wolff, ich warte seit Stunden!! Gruß A.
Alex, die ich vergessen hatte. Ich klickte auf Antworten und tippte:
Liebste Alex, wer, wenn nicht du, sollte die Erste sein für den Hiob? Ich könnte mich in den Hintern beißen, dass ich den Routinecheck gleich am Anfang des Sabbaticals absolviert habe, statt erst mal die freie Zeit zu genießen und das Buch zu schreiben. Will der heilige Sankt Ypsilon mir das jetzt vermasseln, indem er mich dafür bestraft, dass ich ihm die Dankbarkeit fürs Geschlechtschromosom verweigere? Prostatakrebs! Noch nie habe ich mich so verkehrt in meinem Körper, so völlig im falschen Film gefühlt. Auf dem Pathobefund stand Kristian Starck, der musste ja wohl ich sein, aber der war mir fremder als je zuvor. Leider war auch Kristina wie von einer Nebelschwade eingehüllt und ließ sich nicht greifen oder spüren.
Meine Hilflosigkeit habe ich an Wolff ausgelassen, mal wieder mit sarkastischen Sprüchen, und diesmal konnte er nicht einmal zurückschlagen. War wenig übrig von seiner sonst zelebrierten Souveränität. Sein Vorschlag: radikale Prostatektomie. Ob der Künstler entscheidende Nervenstränge schonen kann, stellt sich erst hinterher raus – und das »entscheidend« bezieht sich dabei auf den Erhalt der Potenz. Oder eben deren Verlust … Weiteres Risiko: Inkontinenz. Also Pampers.
Damit ist die OP eigentlich indiskutabel. Dann habe ich Idiot mich noch verquatscht, indem ich ausgerechnet ihn fragte, ob nach einer Prostatektomie noch eine geschlechtsangleichende OP möglich wäre. Bin dann aber sofort eingeknickt und habe vorgegeben, das sei bloß ein Scherz gewesen, was er mir in seiner beschränkten Spießerphantasie auch prompt abgekauft hat. Kristina hat mich einen Feigling geschimpft, aber ich habe es einfach nicht geschafft, sie Wolff vorzustellen, gerade jetzt und zumal er außer dir der Erste wäre … Übrigens: Eine mögliche Nebenwirkung der die Bestrahlung begleitenden antihormonellen Therapie ist eine Schwellung der Brustdrüsen! Titten auf Rezept!
Sorry, Liebste, muss aufhören, hab – wie zu Urzeiten – Bier, Underberg und mehrere Marlboros intus und mir ist ein bisschen schlecht – aber mental schon viel besser, nachdem ich alles bei dir abgeladen habe. Also, alles unter Kontrolle, spar dir bitte jegliches Psycho-Blabla für deine Patienten und verschone mich mit Mitleid, das hole ich mir von der Exgattin. Quasi als Selbstbestrafung dafür, dass ich Depp damals nicht DICH geheiratet habe. Luv, dein Kris
Die Antwort von Alex kam umgehend:
Merde alors!!! Dass sich die Verdachtsdiagnose bestätigt hat, finde ich furchtbar im Wortsinne. Hier geht es nicht um mich, aber da ich dich liebe, musst du mir schon erlauben, mit dir zu leiden, wenn ich mir den Krebs in dir vorstelle. Den Ausdruck Psycho-Blabla lasse ich dir (nur!) heute wegen mildernder Umstände durchgehen, Underberg macht dich seit Studentenzeiten unverschämt. Es hat sicher nichts mit Psycho zu tun, wenn ich wissen will, wie es DIR geht und NICHT, wie brillant du den blöden Wolff und die ganze Situation unter Kontrolle hast – abgesehen von dem kleinen Ausrutscher, ausgerechnet jetzt und ausgerechnet diesen Macho nach einer geschlechtsangleichenden OP zu fragen!?
Dass du dich als halbmilitanter Ex-Raucher mit Zigaretten vergiftest und Schnaps trinkst, ist für den Moment nicht zu beanstanden, ich hoffe, das geht schnell vorbei. Aber wenn du deinen Kater kuriert hast, wirf bitte den Sarkasmuspanzer ab und REDE gefälligst mit mir. Betrachte das als ausdrücklichen Anspruch einer besten Freundin, die du gottseidank nicht geheiratet hast! Ich drück dich. LuvU, deine Alex.
Ich drückte meine Zigarette aus. Spürte die Rinnsale auf den Wangen. Fing an zu summen. Smoke Gets In Your Eyes.
Das Morgenlicht blendete und mein Kopf dröhnte. Gut, dass der Schnaps Hirnmetastasen unwahrscheinlich machte. Der Magen rotierte, und die Zunge fühlte sich an wie mit Nikotinkaugummi an den Gaumen geklebt. Sogar das Zwitschern der Vögel war aufdringlich und die Spatzen tschilpten, als ginge das Leben einfach so weiter. Es half auch nichts, die Augen geschlossen zu halten, um den Augenblick im wattigen Halbschlaf zu verlängern und die Erinnerung hinauszuschieben.
Kein Traum. Wolffs Hiob. Krebs.
Die Blase duldete keinen Aufschub, also quälte ich mich aus dem Bett; das Zähneputzen verstärkte den Brechreiz. Ich stolperte in die Küche, schaltete die Espressomaschine ein und wieder aus, heute nur Kamillentee. Wenigstens Samstag, keine Termine, und eine Krankmeldung nicht nötig. Sabbatical, das lang ersehnte freie Jahr, endlich Zeit für mein Buch, eine Reise ins Blaue und sonstige Träume. Nun war das Reiseziel vom Veranstalter unangekündigt geändert worden. In Krebsbehandlung. Was aus den anderen Träumen würde, stand in den Sternen. Oder auf Messers Schneide. Wie die stereotypen Assoziationen frisch Diagnostizierter: zerschossen von Strahlenkanonen; kastriert von Hormonbomben. Jetzt war auch ich ein frisch Diagnostizierter.
Heute keine Entscheidungen, funkte mein dröhnendes Hirn, das geht vorbei.
»Jeden anderen hätte ich draußen stehen lassen«, brummte ich, als Alex hereinstürmte, eine Brötchentüte und einen Blumenstrauß auf den Tisch warf und mich heftig umarmte. Ihr Parfum war tröstlich, auch wenn ihre geblähten Nasenflügel mich ahnen ließen, dass ich selbst keinen Wohlgeruch verströmte. Sie wuschelte mir durch die strähnigen Haare. »Petit déjeuner!«
Ihr Ton ließ keinen Widerspruch zu. Also setzte ich mich still an den Küchentisch, ohne Hilfe anzubieten, und beobachtete schweigend, wie ihre sehnige Gestalt mit den eckigen Schultern geschmeidig und ortskundig durch die Küche wirbelte.
Meine Alex. Die Einzige, die mich mit allen Untiefen kennt und mag – den ängstlichen Kris ebenso wie die verstörte Kristina, die nun dagegen aufbegehrt, dass die Ypsilon-Krankheit ihr die Bedeutung streitig macht. Den Menschen, der sich hinter einer Glaswand aus Sarkasmus verschanzt, sobald es emotional ans Eingemachte geht, der aber weiß, dass Alex seinen Seelenzustand durch diese gläserne Barriere, wie durch eine Lupe, noch deutlicher erkennt. Die ihn festhält, wenn er wehrlos und verletzlich ist, und ihn mit herber Herzlichkeit schützt.
Im Morgenlicht konnte man ihrem Gesicht ansehen, dass sie die Spuren der Jahre nie bekämpft hatte. Ihre Wimperntusche war nicht wasserfest, die offensichtlich lange nicht gezupften Augenbrauen verliehen ihr einen zusätzlichen Hauch androgyner Herbheit, und die furchig vertiefte Zornesfalte über den Augen zeugte davon, dass ihre letzte Botoxinjektion gegen Migräne auch schon einige Zeit zurücklag.
Sie schnitt ein Brötchen auf und reichte mir die obere Hälfte. »Also?«
»Ist das jetzt die psychoprofessionelle Gesprächseröffnung?«
Alex köpfte ihr Ei. »Okay. Dann eben anders. Falls dich meine Meinung interessiert: Du musst dich operieren lassen.«
»Wie kommst du auf diese Expertenempfehlung?«
»Was weg ist, ist weg. Für solche Logik braucht man kein Expertentum.«
Damit hatte sie sich auf mein ureigenes Terrain gewagt. Auch ich köpfte ausnahmsweise mein Ei und hielt ihr das abgeschnittene Oberteil vor die Nase. »Hausfrauen- und Chirurgenlogik! Weg ist nur, was der Wegschneider mit bloßem Auge sieht, also das Makroskopische. Wenn ein Chirurg verkündet, ein Tumor wäre nach der Operation weg, dann ist das bestenfalls nicht gelogen. Die Wahrheit des Wegseins erkennt frühestens der Pathologe, wenn er das, was angeblich weg ist, unter dem Mikroskop sieht. Wenn irgendwo noch Tumorzellen sind, bedeutet das: nix Heilung, sondern Metastasen!«
Eigentlich wäre jetzt einer ihrer sarkastischen Kommentare fällig gewesen, von wegen Pathologensprech. Aber sie senkte nur den Kopf und winkte ab. »Stop, Kris, sprich über das Medizinische mit Leuten, die du ernst nimmst! Aber rede mit mir über das, was dich bewegt …«
Jetzt hatte sie mich da, wo ich nicht zu Hause war. Ich konnte nichts erwidern.
Alex kam um den Tisch und nahm mich in die Arme. Ich hörte ihr Herz hämmern. Jeder Schlag zerbröselte ein Stück meiner Fassade und als der Damm gebrochen war, klammerte ich mich an ihr fest, geschüttelt von Schluchzen, das nicht zu mir zu gehören schien. Sie hielt mich für eine gefühlte Ewigkeit, streichelte meinen Kopf und murmelte Unverständliches. Ihre Bluse wurde nass.
Als ich mich beruhigt hatte, ging sie zurück zu ihrem Stuhl und reichte mir zwei Stück Küchenkrepp.
»Es ist ja nicht nur, dass der Krebs mich möglicherweise impotent oder inkontinent macht, falls er mich nicht gleich ganz umbringt. Viel mehr würfelt mich, dass mein Leben vielleicht vorbeigeht, ohne dass ich es so gelebt habe, wie es vielleicht meins wäre.«
Ich sprang auf, fischte die halb durchweichte Marlboroschachtel aus dem Mülleimer, zündete mir eine an und inhalierte, ohne zu husten. Alex ließ das unkommentiert. Nach einem Moment des Schweigens schaute sie mir in die Augen und sagte leise:
»Alors, mon cher, dann fang doch jetzt damit an. Aber bitte erst mal ohne OP!«
»Schon klar«, murmelte ich. Meine einzige Transvertraute hatte mich immer ermuntert, zu meinem Wunschgender zu stehen, mir von einer totalen, operativen Geschlechtsangleichung aber eher abgeraten. Sie hielt den Penis als Sinnbild des Männlichen für überbewertet, schließlich sei die Essenz einer Person unabhängig davon, ob das Teil dran oder ab wäre – und mein armer Schwanz habe das Skalpell nicht verdient.
»Du kannst leicht reden als Frau«, maulte ich, doch ihr Lächeln steckte mich an und löste den Tränenkloß in meiner Kehle.
Ich wollte nicht abheben, ertrug aber die Schrille nicht. Auf dem Display stand Irmgard.
Ich solle zum Abendessen kommen, es gebe Königsberger Klopse. Die Phase meiner Klopspräferenz war seit zwanzig Jahren vorüber, aber damit wollte ich meine Exfrau nicht kränken. Also Kopfschmerzen. Die Klopse hielten auch bis morgen, meinte sie. Die Dringlichkeit in ihrem Tonfall ließ Alarmglocken schrillen und mich fragen, ob sie am Vortag bei ihrer Freitagsrunde im Fitnessstudio gewesen sei.
»Ja, wieso?«
»War Kimi auch da?«
Nach kurzer Pause kam ein zaghaftes »Ja, schon. Warum?« Wie vertraut war mir dieses Zögern aus all den Situationen unserer Ehe, in denen ich sie ertappt hatte oder sie sich so fühlte. Zum Beispiel auf der Party, als sie im Vollrausch Sex mit Wolff gehabt hatte. In seinem Hobbykeller. Seinerzeit hatten mich alle Kerle um meine Frau mit ihrer 90-60-90-Figur beneidet, und zu diesen Kerlen gehörte auch Wolff, damals noch wampenlos. An uns allen hatte zwischenzeitlich der Zahn der Zeit genagt, den Irmgard aber eisern und nicht ohne Erfolg beim Freitagstraining bekämpfte. Mit Kimi, die eigentlich Kriemhild hieß und Wolffs Frau war.
»So viel zur ärztlichen Schweigepflicht.«
Diesmal war die Pause länger, durch den Lautsprecher drang Schluchzen. Entnervt stellte ich die Freisprechtaste aus.
»Okay, Kimi hat es mir erzählt und ich musste versprechen dir nichts zu sagen. Ich dachte, wenn du zum Essen kommst, sagst du es mir und ich kann dich trösten.«
Meine Abwehr schmolz. Ich sagte ihr für den nächsten Abend zu. Und nahm mir vor, Blumen mitzubringen.
Die vertraute Strecke über die Moabiter Brücke erschien fremd, das Tageslicht grell. Selbst die alten Bäume im Englischen Garten, sonst Oase grüner Geborgenheit, wirkten heute nur knorrig. In meinem Kopf lieferten sich Roboter, Linearbeschleuniger und Hormonbehandlung eine unausgewogene Schlacht. Das Joggen, sonst ein zuverlässiges Instrument zur Auflösung von Hirnchaos, versagte als Sortierfunktion. Nach dem ersten Kilometer wurden die Muskeln sauer, das Atmen mühsam und mein Herz pumpte altmännermüde, als nähme es vorweg, wie die Krankheit oder deren Behandlung ihm einmal die Schlagkraft rauben würden. Das geht vorbei. Ich gelobte mir, Marlboro aufzugeben.
Bei der Altonaer Straße warf ich das Handtuch und opferte den Tiergarten der Couch und meiner Lieblingsserie, den Sons of Anarchy, die heute komplett an meiner Aufmerksamkeit vorbei auf ihren fetten Harleys durch die kalifornische Wüste ratterten. Nicht einmal Gemma, die Old Lady, konnte mich inspirieren, obwohl die androgyne Sexbombe in Leder und genagelten Stiefeln, wenig jünger als ich selbst, mich sonst verlässlich beflügelte.
Als ich den Bikern bei ihrem Ritt in die untergehende Sonne nachsah, kam mit dem Fernweh die Idee: die Hormontherapie vorzuziehen, mich erst dann für Bestrahlung oder Operation zu entscheiden und damit drei Monate Aufschub zu gewinnen. Drei Monate Zeitgewinn für eine Reise, ohne dabei etwas zu versäumen.
Ridin’ through this world vor mich hin summend, warf ich den Trainingsanzug in die Wäsche, suchte den blassblauen Kaschmirpullover heraus, den Irmgard mir zum Geburtstag geschenkt hatte, und bändigte die Haare mit einem Spritzer Styling-Gel. Die Spuren der schlafarmen Nacht, die sich in schwarzen Runzelringen um meine Augen eingegraben hatten, ließ ich unter einem Hauch Concealer verschwinden. Kurz war ich versucht, Alex’ Blumenstrauß für meine Exfrau zu zweckentfremden, entschied mich dann aber für den Umweg zum Floristen im Hauptbahnhof.
Irmgards Hosenanzug spannte über Bauch und Hüften, sie roch nach Chanel No. 5 und Pastis. Ihre Umarmung war ungewohnt umschlingend und ihre Augen schimmerten verdächtig, als sie mir die Blumen abnahm. »Alles wird gut, ich bin für dich da.«
War das die Chance? Wann, wenn nicht jetzt, wo nichts mehr ist wie immer? Vielleicht der Moment der Wahrheit? Noch bevor ich zu Ende denken konnte, wirbelte Micky mir entgegen. Wie ein Gummiball sprang sie an mir hoch, schlang mir die braunen Arme um den Hals und die verschrammten Beinchen um die Taille.
»Lass das, du sollst Opa nicht so anstrengen«, schallte die Stimme ihrer Mutter aus dem Hintergrund.
»Opa sieht total gesund aus und gar nicht wie bald tot«, brüllte Micky zurück und strahlte mich aus ihren malzbonbonfarbenen Augen an. Behutsam setzte ich meine Enkelin ab.
Umkehren wäre noch möglich, dachte ich, als ich in die betretenen Gesichter meiner Exfrau und der beiden Töchter blickte. Für ein Klopsdinner als Familienzusammenkunft war ich nicht gewappnet, auch nicht, meinen ewig streitenden Töchtern Rede und Antwort zu stehen. Aber gegen Mickys Strahlen war ich machtlos.
Bevor Maren diplomatisch ausführen konnte, dass Micky da etwas falsch verstanden habe, fiel Carla ihr ins Wort. »Grandios einfühlsam, vor einer Sechsjährigen über Papas Krebs und den Tod zu sprechen!«
Sehnsüchtig sah ich zur Tür.
»Jetzt trinken wir erst mal alle einen schönen Pastis«, ordnete Irmgard an.
Ich ergab mich, nahm den Pastis entgegen, den ich seit Jahren so wenig mochte wie Klopse und umarmte meine Töchter.
Maren hatte neben den ebenmäßigen Gesichtszügen die Figur ihrer Mutter geerbt, allerdings glich sich auch bei ihr die Taille allmählich dem zunehmenden Hüftumfang an, was jedoch nichts an ihrer Vorliebe für hautenge Kleidung änderte, die nicht zum typischen Erscheinungsbild einer Lehrerin passte. Ihre Hose spannte über den Oberschenkeln.
In der anderen Sofaecke hatte Carla die Füße auf den Couchtisch gelegt, eine Angewohnheit, die ihre Mutter verabscheute. Der asymmetrische Kurzhaarschnitt ließ ihre grünen Augen noch größer erscheinen. Sie trug eine hautenge schwarze Lederleggins, die ihre Beine eher mager als schlank aussehen ließ, und darüber ein schlabbriges quietschbuntes Desigual-Shirt, das ihre Zierlichkeit verbarg. Bei ihr passte die äußere Erscheinung gut zum Nicht-Beruf einer dreizehnsemestrigen MediendesignStudentin.
Ich setzte mich zwischen meine Töchter, die mir und damit auch einander etwas näher rückten. Einmal mehr staunte ich über das Spektrum der Genetik bei gleichem Erbgut. Dazu passte das gerahmte Foto an der Wand, auf dem der Außenstehende kaum die Mutter dieser beiden jungen Frauen erkannt hätte. Auf dem Gruppenbild der Pankower Freiheit lächelte Irmi als Lead-Sängerin der Pop-Band in einem hautengen Paillettenkleid mit korallenrot gelackten Lippen in die Kamera, cool wie Madonna.
Wir schwiegen, bis die Klopse uns erlösten.
Irmgards Regel, kritische Themen am Esstisch strikt zu meiden, galt für alle außer Micky. Der große Bruder einer Klassenkameradin habe zu ihr gesagt, sie sehe aus wie Blutwurst und ihre Zähne wie die weißen Fettstücke. Auf die Frage, was sie geantwortet habe, grinste sie breit. »Und du siehst aus wie vergammelter Magerquark.«
»Da kennt sich Micky ja aus«, stichelte Carla in Richtung ihrer älteren Schwester, deren Kampf um die verlorene Schlankheit sie zu gelegentlichem Kauf größerer Mengen Magerquark verleitete, der dann regelmäßig im Kühlschrank verschimmelte.
Mit einem strengen Blick unterband Irmgard die Ausweitung des Schwesternzwists, schickte Micky zum Schaukeln in den Garten und forderte mich auf, alles über diese schreckliche Sache zu erzählen.
Ergeben berichtete ich, was ich von Wolff erfahren hatte. Erwartungsgemäß riet mir auch Irmgard zur Operation. Ich wollte nicht erklären, warum die Prostatektomie nicht wirklich in Frage kam und schob die Angst vor Inkontinenz vor, die als potenzielle Folge einer Operation drohte. Ein Argument, das meine Hausärztin natürlich nicht gelten ließ.
Maren bot mir ihre Hilfe an, falls ich in meiner Lebenskrise einen Weg zurück zum Glauben suchen wolle. Die liebevolle Zaghaftigkeit ihres Antrages hielt mich von einer flapsigen Antwort ab. Sie kannte meinen Standpunkt und wusste, dass es mir nicht möglich war, eine übergeordnete Instanz anzuerkennen. Dabei wäre ein bisschen Feigheit vor dem Feind in der aktuellen Situation sicher hilfreich gewesen. Nun, da der Feind sich konkret in mein Leben drängte, hätte mir der Glaube eine Flucht vor der Auseinandersetzung mit der Endgültigkeit des Todes ermöglicht und mich zumindest teilweise von der Verantwortung für das eigene Leben entbunden. Leider war der Apfel der Erkenntnis, einmal geschluckt, nicht mehr auszuspucken. Dennoch verstand ich es als liebevolles Angebot, dass Maren, mit der ich mich oft genug über Religion gestritten hatte, mir gerade jetzt dieses Thema nahebringen wollte. Sie meinte, eine Krise wie die Krebsdiagnose könne ich ganz ohne Glauben nicht bewältigen.
»Ist ja nicht so, dass ich an gar nichts glaube«, versuchte ich zu trösten. »Ich glaube an die Liebe – und damit kann man auch ganz viel aushalten.«
Maren blickte zu Boden, holte Luft, um dann doch nichts zu sagen. Carla massierte mit dem rechten Daumen ihre linke Handfläche. Irmgard schenkte uns nach und erkundigte sich nach meinen weiteren Plänen.
Als ich von meiner Reiseidee berichtete, verkündete Carla, sie gehe auf die Terrasse, um zu rauchen. Der Kampf gegen mich selbst war kurz.
»Ich komm mit, spendierst du mir eine?«
Irmgard, die seinerzeit die Torturen des Entzugs mit mir geteilt hatte, protestierte heftig. Ich murmelte etwas von ausnahmsweise und flüchtete.
Die Luft war mild und die Zweisamkeit mit meiner Kleinen wie nach Hause kommen. Auch Carla war nicht geplant gewesen, entstanden in einer Phase, als das Fremdsein in der Ehe schon deutlich und Sex zur einzig störungsarmen Kommunikationsform geworden war. Wegen Maren hatte ich geheiratet, geblieben war ich wegen Carla. Ich sah sie noch vor mir, wie ich sie, zwei Monate zu früh in die Welt geworfen, zum ersten Mal in den plötzlich riesigen Händen hielt, sie mich mit geballten Fäustchen anbrüllte und mir dabei direkt in die Augen sah. Die Liebe auf den ersten Blick war unverwüstlich geblieben.
Carla drehte die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und wippte mit dem rechten Fuß.
»Mach dir nicht so viel Sorgen«, setzte ich an.
Ohne mich anzusehen, blickte sie angestrengt auf ihre wechselweise blau und grünmetallisch lackierten Fußnägel. Dann hob sie ruckartig den Kopf. »Bitte, Papa, ich muss dich das jetzt fragen – machst du diese Reise, um dich umzubringen?«
»Spinnst du?« Ich erschrak, als ich ihre Tränen bemerkte. Dann fiel mir die weihnachtliche Familiendebatte um Herrndorfs Selbstmord ein. Der Schriftsteller, dessen Glioblastom ich selbst mikroskopiert hatte, war mit achtundvierzig Jahren tot am Landwehrkanal aufgefunden worden. Nicht am Hirntumor gestorben, sondern an einer Kugel. Was bei uns zu heftigem Streit geführt hatte. Bei Eingriffen in die Zuständigkeiten des Herrn kannte Maren kein Pardon, schon gar nicht, wenn man denen per Schusswaffe zuvorkam.
Carla packte mich am Oberarm. »Du hattest damals Verständnis für Herrndorf, nur so unappetitlich wolltest du es nicht haben, mit Kopfschuss und in der Nähe von zu Hause. Deshalb dachte ich, du trittst diese Reise vielleicht an, damit wir das nicht mitkriegen müssen.«
Ich drückte die Zigarette aus und meine kleine Tochter fest an mich. »So ein Quatsch, dafür gibt’s doch überhaupt keinen Grund.«
Ihr erleichtertes Lächeln hielt einige Sekunden. »Versprichst du, dass du dich nie umbringst?«
Ich ließ sie los und nahm ihr Gesicht in beide Hände. »Nope! Nie sollte man nie versprechen. Manchmal braucht man die Exit Option, um weitermachen zu können. Option heißt noch lange nicht, dass man es tut.«
Ihre Stirnfalte vertiefte sich und sie blinzelte eine Träne aus den rauchblau getuschten Wimpern. »Wie Schlaftabletten in der Schublade?«
»So etwa, und jetzt lass uns reingehen, bevor wir Ärger mit deiner Mutter kriegen.«
»Wäre ja nicht das erste Mal, dass du Mama ärgerst«, meinte Carla und fügte mit maliziösem Grinsen hinzu: »Und übrigens, wusstest du, dass deine Exfrau sich auf einem Datingportal namens Premium-Singles 45 plus herumtreibt?«
»Echt jetzt? Woher weißt du …?«
»Hat sie Maren erzählt, die sucht nämlich auch, bei Parship.«
»Tratschtochter«, tadelte ich und knuffte Carla, die entzückt quietschte.
Der Ärger lag schon in der Luft, als wir zurückkehrten. Irmgard saß kerzengerade auf dem Sofa, ihre Stimme war schneidend.
»Schön, dass ihr uns wieder mit eurer Gegenwart beehrt. Und in einer solchen Situation wieder loszuquarzen, ist ja besonders sinnvoll.«
Ausgerechnet Maren fiel ihr in den Rücken. »Rauchen ist zwar beschissen, aber wenn jemand Krebs hat, soll man ihm nichts verbieten.«
»Mag sein. Aber nur, wenn der Krebs unheilbar ist«, widersprach die Hausärztin.
Carla knallte die Zigarettenschachtel auf den Tisch. »Egal wie es ausgeht, der Krebs ist für Papa vielleicht die Chance, endlich mal alles zu tun, was er immer schon tun wollte.«
Ich hielt die Luft an und fragte mich erneut, ob das wirklich meine Chance wäre. Aber Maren war schneller. »Ich gönne Papa ja alle Laster, solange er nicht schwul wird oder sich an Kindern vergeht.«
Klares Signal zum Aufbruch. Auf dem Heimweg im Taxi schrieb ich an Alex.
Ich fühlte mich so fremd, weil alles so war wie immer. Ich glaube ihnen, dass sie für mich da sein wollen, aber nicht, dass das hilft.
Die Antwort kam umgehend.
Du bist undankbar und voreilig. Sich darauf verlassen zu können, dass jemand immer für dich da sein wird, ist mehr Hilfe, als vielen Menschen jemals zuteilwird!
Bei undankbar musste ich noch grinsen, voreilig war eher gut für Gänsehaut.
Die ersehnte freie Zeit war am nächsten Morgen wie ein schwarzes Loch, das mich einsog und die Ruhe zu bleierner Stille werden ließ. Aus dem Kühlschrank schlug mir der Geruch nach schlecht verpacktem Käse entgegen, der Macchiato musste in den Ausguss, die Milch war sauer. Damit hatten sich die Frühstücksoptionen erschöpft. Eine Dose Cola und ein Eiweißriegel schafften Abhilfe.
In der Mail fand ich Alex.
Bin ja kein Wolffsjünger, deshalb habe ich die Leitlinie zur Therapie des Prostatakarzinoms runtergeladen, um zu sehen, worauf sich die Fachgurus in ihren aktuellen Empfehlungen geeinigt haben. Die Sache mit der Hormontherapie finde ich verwirrend. Habe ich es richtig verstanden, dass man euch armen Kerlen früher die Eier abgeschnitten hat und so was Ähnliches jetzt mit Medikamenten macht? Klär mich doch bitte mal auf, was daran positiv ist?? Luv Alex.
Gerührt, dass Alex, seit Jahrzehnten nicht mehr mit klinischer Medizin befasst, sich meinetwegen mit der Leitlinie herumgeschlagen hatte, schrieb ich zurück:
Geliebte Nervensäge, Testosteron macht nicht nur Männer aggressiv, sondern auch die Zellen des Prostatakarzinoms. Statt also die Hoden zu entfernen, spritzt man heute zur Zellbefriedung eine Substanz zur chemischen Kastration, die die Testosteronproduktion verhindert. Ich würde ein Medikament namens Bicalutamid nehmen, bei dem »mann« seinen normalen Testosteronspiegel behält. Das geht häufig mit einer Brustschwellung einher, das wären dann meine Titten auf Kasse. Danke für deine Sorge. Kiss Kris.
Damit war alle Energie verbraucht, so ließ ich die restlichen Mails unbeantwortet und tappte rastlos durch die Wohnung. Die Homöopathie empfiehlt, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen und so griff ich zu Leonhard Cohen. You want it darker, ermunterte er mich in meiner Suche nach der halbvollen Zigarettenschachtel. Tobacco is food, hatte Frank Zappa schließlich gesagt.
Ich klickte mich auf YouTube, fand sein letztes Interview kurz vor dem Tod. Zappas ehemals strotzende Kraft war mit zweiundfünfzig Jahren einer würdevollen Zerbrechlichkeit gewichen, aber selbst in seinen letzten Tagen strahlte er eine unzerstörbare Stärke aus. I am totally unrepentant, antwortete er auf die Frage, ob es Dinge in seinem Leben gebe, die er bereue. Beneidenswert. Nie hätte Frank seine Frankie versteckt, hätte es denn eine gegeben. Und dann warf er noch nonchalant hinterher, dass es ihm vollkommen gleichgültig sei, ob sich jemand an ihn erinnere. I don’t care, it’s not important to be remembered.
Ich fand keine Taschentücher, also griff ich zum Geschirrtuch. Bei der Suche in Sachen eigener Reue fand ich eher Unterlassenes als Getanes. Auch nicht viel Erinnerungswürdiges. Und wenn es nicht darauf ankam, erinnert zu werden, musste zumindest das Konto der eigenen Erinnerungen aufgestockt werden. Ein Konto, das niemand abräumen kann, quasi als Anlage fürs Restleben.
Zum Beispiel mit einem Roadtrip.
Wie immer, wenn ich keinen Anfang fand, schrieb ich eine Checkliste; diesmal um zu sortieren, was wichtig war nach Wolffs Diagnose. Aufschreiben, was zu tun ist, schafft die Illusion, etwas getan zu haben, auch wenn nichts erledigt ist.
To do – vor der Reise
• Zweitmeinung Radioonkologe
• Ergebnisabhängig: zweites Gespräch mit Wolff
• Abschiedsfete Institut
• Petra – Finissage
To do – Roadtrip
• Stuttgart: Klassentreffen, Testlauf Coming-out? Manfred wg. Vorsorgevollmacht für Mutter
•Heidelberg: Mathias wg. Unterstützung bei Statistik im
• Buch. Testlauf II.
• Köln: Otto. Vortrag und romanische Kirchen, Testlauf III.
• Hamburg: Mutter Vorsorgevollmacht, Testlauf IV?
• Hallig Hooge: Kontemplation, Erlebnis-Verdauung. Experiment: Wie kommt Kristina auf dem Land zurecht?
• Lissabon über Frankreich, Spanien → BUCH
Zwar hatte Manfred an jenem Wochenende eigentlich keine Zeit, da seine Frau ein verlängertes Wellness-Wochenende plante und er sich um die Kinder kümmern sollte. Er ließ sich dann aber doch zu einem Treffen breitschlagen. Ich verkniff mir jeden Kommentar in Erinnerung an den anhaltenden Zorn meines kleinen Bruders, als Mutter vor einigen Jahren angemerkt hatte, so sei das eben, wenn man mit Frauen im Alter einer Tochter Kinder zeuge, die selbst als Enkel anstrengend wären. Manfreds zweiter Frühling war mit Anfang vierzig in Gestalt einer blonden Bachelor-Aspirantin in sein Leben getreten. Nachdem sie im Rahmen ihres dualen Studiums ein Praktikum in seiner Firma absolviert hatte, verzichtete sie nach dem Bachelor auf das Masterstudium und schenkte ihrem älteren Lover zwei lebhafte Kinder.
Mein alter Studienfreund Mathias stimmte dem vorgeschlagenen Termin sofort zu und versprach, seine Statistikexpertise zu meinem Buch beizusteuern. Ich vermisste allerdings jegliche Begeisterung über unser erstes Wiedersehen nach zehn Jahren Sendepause und ahnte einen Zusammenhang zu seiner kryptischen Andeutung, körperlich nähere er sich der Schrottreife.
Wenigstens Otto und Conchita zeigten sich enthusiastisch. Am einfachsten gestaltete sich Punkt eins: ein Telefonat, und der Termin beim Radioonkologen stand.
»Professor Schön erwartet Sie, darf ich Espresso, grünen Tee oder ein Kaltgetränk anbieten?« J. F. Lemontin stand auf dem Namensschild des hoch gewachsenen jungen Mannes mit gepflegten Rastazöpfen und französischem Akzent. Der schwarze Sekretär begleitete mich in das lichtdurchflutete Sprechzimmer des Radioonkologen, der ohne Arztkittel noch drahtiger wirkte. Unbefangen lächelnd begrüßte er mich mit festem Händedruck und meinte, für die Begegnung von Starck und Schön hätte er eine Kneipe bevorzugt. Was mir nicht anders ging. Über seinem Schreibtisch hing eine Lithographie von Josef Albers, eine seiner tausend Homages to the Square.
»Soll Albers’ gelbe Studie dem Betrachter Ihre Strahlen nahebringen?«
Um seine Augen kräuselten sich Lachfältchen. »Der Titel des Bildes ist ›Joy‹, aber ich bin begeistert, dass Sie darin die Strahlen sehen.«
Nach einem Moment entspannter Stille griff Schön zu den Unterlagen. »Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich nur grundsätzlich über die Strahlentherapie informieren wollen. Kollege Wolff hat Ihnen bestimmt die Operation empfohlen?«
Er wirkte erstaunt, dass ich eher zur primären Bestrahlung tendierte. Meine Vorbehalte gegen die Operation kommentierte er nicht, meinen Hinweis, dass die Erhaltung der Potenz mir nicht unwichtig sei, quittierte er dagegen mit einem spontan-empathischen Kopfnicken.
Dann goss er Wasser in den Wein. Einem Mittfünfziger würde er eher die Operation als primäre Therapie empfehlen, da im Falle eines Rezidivs nach der Operation die Bestrahlung problemlos sei – umgekehrt würde es hingegen schwieriger. Auch bei der Strahlentherapie wäre der Potenzerhalt keinesfalls gewährleistet, obwohl mein relativ jugendliches Alter sich hier günstig auswirken könne. Ausführlich schilderte er die möglichen Nebenwirkungen der Strahlentherapie, wobei Irritationen von Blase und Darm sich für mich deutlich harmloser anhörten als Pamperpinkeln. Dann demonstrierte er mit glänzenden Augen am Bildschirm einige typische 3D-Bestrahlungspläne, deren leuchtende Farben sich buntflächig und in welligen Linien mit fließenden Übergängen an Prostata, Blase und Darm schmiegten. Seine offensichtliche Begeisterung an der Kunst der eigenen Disziplin war ansteckend. Die Frage, ob es möglich sei, nach einer Prostatabestrahlung eine geschlechtsangleichende OP durchzuführen, lag mir schon auf der Zunge. Aber wieder war die Angst stärker und wieder schluckte ich meine Frage herunter. Dann war der Moment vorbei. Schön beendete seine Ausführungen. »Sie melden sich einfach, wenn Sie sich endgültig entschieden haben.«
Auf dem Weg durch die gekachelten Gänge wurde ich schwach und kaufte im Klinikkiosk Zigaretten. Meine Präferenz für Strahl statt Stahl war verwischt statt bestätigt worden. Aber ein Operationsroboter namens da Vinci? You want it darker, ohrwurmte es durch mein Hirn. If you are the healer, means I’m broken and lame?
Eine halbe Stunde später war der Himmel aufgerissen; als ich die Tür aufschloss, fiel durch das Dachfenster die Spätnachmittagssonne und tauchte die Wohnung in warmes Licht. Missmutig steckte ich die Zigaretten wieder ein. Frau Jablonski war noch nichtfertig. Der erdige Geruch der Politur, mit der sie das A horn parkett pflegte, mischte sich mit dem Old Spice Aftershave, das sie sich von ihrem Gatten Horst ausborgte, um ihre Transpiration zu bekämpfen.
Frau Jablonski war ein Schatz. Ich hatte sie aus Irmgards Hausarztpraxis übernommen; binnen Kürze hatte sie erkannt, wie nötig ich sie brauchte und dies mit einer stetigen Ausweitung ihrer Zuständigkeiten quittiert, was hin und wieder über ihre bezahlten Dienste hinausging. Regelmäßig deponierte sie gesundes Selbstgekochtes in meinem Kühlschrank, damit der Professor auch mal was anderes als Fertiggerichte futterte, bei denen alle Vitamine weg waren.
Artig bedankte ich mich für den mitgebrachten Weißkohlauflauf mit Hackbällchen und schützte Kopfschmerzen vor, um sie kränkungsfrei in den vorzeitigen Feierabend zu entlassen.
Die Ruhe währte nur kurz. Auf dem Anrufbeantworter wartete Petras Nachricht: Ich dachte, in deinem Sabbatical hättest du endlich mal Zeit für mich. Ich glaube, wir sollten reden.
Mein erster Impuls war, mich tot zu stellen. Doch die Checkliste machte mich rastlos, seit Wolffs Diagnose quälte das nagende Bedürfnis, die Prioritäten im Leben neu zu ordnen. So griff ich zum iPhone und tippte eine Nachricht mit meinem Terminvorschlag. Wir hatten uns beim Pilates kennengelernt. Petra wurde meist als Enddreißigerin geschätzt, war aber siebenundvierzig und damit nach Alex’ Analyse in dem Alter, in dem frau es noch mal wissen möchte; in jener Lebensphase, in der die Menopause in ahnbare Nähe rückt und die Libido gierig und furchtlos wird. Ich schätzte nicht nur Petras trainierten Sportlehrerinnen-Body, sondern auch ihren aggressiven Sexhunger, den sie in zupackender Weise auslebte. Doch bei unseren Begegnungen war mir zunehmend die Illusion abhandengekommen, mit Sex Nähe zu erleben, ohne mich selbst zu exponieren. Umso mehr, als ich sicher war, dass Petra nie mit Kristina zurechtkommen würde, deshalb hatte ich die beiden einander nie vorgestellt. Auch das würde sich nun erledigen.
Ihre Antwort kam prompt.
Ich freu mich total und hab so was von Hunger …
Heute würde ich sie leider hungern lassen. Aber wer könnte einem Tumorpatienten böse sein? Schließlich ist Trennung wegen Krebs nichts Persönliches.
Petra ließ sich aus dem Mantel helfen, und noch bevor ich ihr etwas anbieten konnte, klickte sie mit einem routinierten Ruck sämtliche Druckknöpfe ihrer Bluse auf. Der getigerte Push-upBH ließ die Hälfte der Brustwarzen frei. Sie schob den kurzen Lederrock hoch, die Strapse störten nicht und den Slip hatte sie wieder einmal schon im Aufzug ins Außenfach ihrer Handtasche gestopft. Ich griff nach ihren Händen. »Nein, warte, langsam!«
Sie schien meinen Einwand als Verzögerungsvorspiel zu begreifen, ging nicht darauf ein, sondern bugsierte mich mit ihren muskulösen Armen in Richtung Lümmelsessel, warf mich in dessen kuschelige Tiefe und setzte sich auf mich.
Ihr Apfelshampoo, das vanillige Parfum, eine Prise frisch gewaschener Möse – ich musste sie nur riechen und mein Vorsatz, keinesfalls schwach zu werden, verpuffte. Falls der Schöpfer für Kopf und Schwanz nur einen Blutzufluss vorgesehen hatte, so war dies eindeutig der Moment der hirnfernen Blutversorgung. Mit geübtem Griff prüfte Petra die Willigkeit meines Fleisches und stülpte sich ohne weitere Umschweife über mich.
Als wir danach wieder zu Atem gekommen waren, servierte ich den Champagner und eröffnete es ihr ohne Schnörkel. Trennung wegen Krebs, nichts Persönliches, Wertschätzung des Gewesenen.
Sie bekam feuchte Augen, schüttelte ungläubig den Kopf und entschuldigte sich ins Bad. Als sie zurückkam, hatte sie sich in ein Handtuch gewickelt und war sehr blass.
Ich legte ihr nahe, ein krebskranker, alternder Mann, in absehbarer Zeit womöglich dem Zerfall ausgeliefert, sei für eine Frau ihres Kalibers als Partner keine attraktive Option.
Mit dem zweiten Glas Champagner kehrte langsam die Farbe in ihr Gesicht zurück. »Ich wäre selbstverständlich jederzeit für dich da gewesen. Auch mit Krebs. Aber wenn du deinen Weg lieber allein gehen möchtest, muss ich das natürlich respektieren.«
Damit holte Petra ihren Slip aus der Handtasche, zog sich an und klickte die Druckknöpfe der Bluse zu. Sie küsste mich flüchtig, wünschte mir alles Gute und ging.
Ich nahm noch einen großen Schluck und wartete auf die Erleichterung, die flüchtiger ausfiel als die nagende Erkenntnis, die eigene Bedeutung überschätzt zu haben.
Ich hatte Mitleid erwartet und den Kümmerreflex gefürchtet – erlebt hatte ich den Impuls, schnellstmöglich Land zu gewinnen von mir und dem Krebs. Schwamm drüber, immerhin war damit wieder ein Punkt auf der Liste erledigt.
Ich stand in Socken im Schuhgeschäft, als mein Handy klingelte. »Opa, du musst heute zum Friedhofskuchen kommen, bitte!« Mickys Stimme klang aufgeregt. Ihre Mutter übernahm und berichtete, in der Schule kursierten wilde Gerüchte über den Krebs von Mickys Großvater und sie sei ganz verunsichert. Tina, die pickelige Zwölfjährige aus der Nachbarschaft, habe sogar behauptet, bald hätte sie keinen Opa mehr. Ob ich ihr das alles erklären und sie beruhigen könne?
Eine Ablenkung von den trüben Gedanken und lästigen Reiseeinkäufen war hochwillkommen. Wir liebten es beide, nach dem Kuchen im Café beim Dorotheenstädtischen Friedhof das Grab der Uroma zu besuchen und durch die Galerie der Prominentengräber zu spazieren, während Maren das Grab pflegte. Fasziniert hörte Micky meinen Storys über die Verstorbenen zu, auch wenn ihre Mutter unsere Touren eher skeptisch beobachtete. Sie hatte es unpassend gefunden, als ich versuchte, meiner sechsjährigen Enkelin am Grab von Fritz Teufel das Prinzip der Kommune zu erklären.
Micky hielt mir ihren abgegessenen Teller vor die Nase, als ich zwanzig Minuten nach der vereinbarten Zeit im Café ankam. Von der Torte war nur noch ein Häufchen abgekratzter Bitterschokoladeschnipsel übrig. »Das ist für dich, Opa, mehr gibt’s nicht, du bist mal wieder zu spät!«
Mit sanftem Schütteln hob ich sie hoch und fletschte die Zähne. »Na gut, mein Schokokrümel, wenn’s so ist, fress ich eben dich.«
Micky quietschte und fletschte dagegen. Ihre Mutter schimpfte: »Du sollst doch nicht Schokokrümel sagen.«
Maren fand meinen Kosenamen für ihre Tochter rassistisch. Außerdem wurde sie ungern daran erinnert, dass Micky das Resultat einer ekklesiogenen Ekstase mit einem Gläubigen der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche auf dem evangelischen Kirchentag war, einem Event, das Maren seit ihrer ersten Verliebtheit in einen CVJM-Jungmann alle zwei Jahre besuchte.
»Lass Opa doch!«, vermittelte Micky, die den Spitznamen mochte und die Entrüstung ihrer Mutter zu genießen schien. Maren schüttelte den Kopf, nannte uns Kindsköpfe und brach auf, um Heideröschen fürs Grab zu kaufen.
Micky schnappte meine Hand und ließ mich nur kurz los, solange ich zahlte.
Der Friedhof verbannte den Hauptstadtlärm hinter seine Mauern und ließ uns in die grüne Stille mit schattigen alten Bäumen eintauchen. Ich mochte den Kontrast zwischen der bombastischen Dekadenz mancher Mausoleen und der rohen Schmucklosigkeit anderer Gräber, die den Ruhm ihrer Namensträger verspottete oder auch betonte.
Kaum war ihre Mutter außer Hörweite, blieb Micky abrupt stehen, schaute mich aus großen Augen an und fragte mit brüchigem Stimmchen: »Tina sagt, wer Krebs kriegt, kratzt bald ab. Stimmt das?«
»Quatsch. Tina ist ’ne blöde Kuh und weiß gar nicht, was Krebs bedeutet. Den Krebs gibt es sowieso nicht, Krebs ist einfach ein Wort, mit dem dumme Menschen ganz verschiedene Krankheiten in einen Topf werfen. So wie Auto, das kann ein Sportflitzer sein oder ein dicker Lastwagen …«
Micky nickte und sah mich hoffnungsvoll an.
»Beim Krebs gibt es dicke Hummer, wie bei Omas Geburtstag, oder Nordseekrabben.«
Micky war noch nicht ganz überzeugt und wollte wissen, warum man mit Krebs krank würde. Ich zeigte ihr ein üppig bepflanztes Grab, das offensichtlich schon einige Zeit nicht mehr gepflegt wurde. »Schau mal, hier: viele schöne Blumen, aber auch einige Unkräuter. Wenn zu viel Unkraut wächst, gehen die Blumen kaputt. So was Ähnliches passiert bei manchen Krankheiten, wenn im menschlichen Körper etwas wächst, das da nicht hingehört. Dann muss der Patient zum Arzt, und der muss dafür sorgen, dass das Unkraut ausgerupft wird oder wenigstens nicht weiterwächst.«
»Dein Krebs ist hoffentlich eine Nordseekrabbe?«
»Na ja, sagen wir mal eine kleine Garnele.«
Das Strahlen kehrte in Mickys Augen zurück und sie umarmte mich gewohnt stürmisch. Dann zerrte sie mich weiter.
Am Grab von Bert Brecht blieb ich kurz stehen und erzählte ihr, dass da ein berühmter Dichter und seine Frau, eine Schauspielerin, ruhten. Micky fand dieses Grab langweilig – Brechts Grabstein, den unbehauenen Felsblock in Form einer aufragenden Bergspitze, daneben Helene Weigels Stein: nur halb so hoch wie der ihres Mannes, dafür aber von geduckter Breite.
»Der Dichter hat sich einen Grabstein gewünscht, an den jeder Hund pinkeln möchte, deshalb ist der so einfach.«
Sie runzelte die Stirn. »Dann kriegt der Dichter die schönen Bernhardiner und seine Frau nur die blöden Pinscher.«
Zurück am Grab meiner Ex-Schwiegermutter stürmte Micky in die ausgebreiteten Arme ihrer Mutter.
»Mami, Opa hat gesagt, er hat gar keinen Krebs, sondern bloß eine Krabbe. Er stirbt auch nicht; und Tina ist ’ne blöde Kuh.«
Meine Tochter sah mich erst verständnislos, dann dankbar an, bevor sie mich in die Umarmung einschloss.
Verstohlen sah ich mich um, ehe ich das Schweizermesser zückte und ein Adonisröschen auf einem der Gräber abschnitt.
Wolfgang Herrndorfs Grab trug nur einen schmucklosen Betonstein mit minimalistischer Aufschrift, eingezwängt lag es zwischen einem sozialistischen Wirtschaftswissenschaftler und einem Ost-Opernintendanten, dem hundertzwei Lebensjahre vergönnt gewesen waren. Ich legte mein Röschen zwischen Flaschenpost und Bleistift zu den anderen Devotionalien.
Hi Mann, gegen dein Glioblastom hattest du keine Chance. Ob ich mit meiner Prostata fertig werde? Du hast es immerhin geschafft, die Kürze deines Restlebens in ein Kunstwerk zu verwandeln. Wann fängt man damit an, jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte, wenn man die eigene Restlaufzeit nicht einschätzen kann? Ich wüsste zu gern, was du an meiner Stelle getan hättest. Zumindest kenne ich einen sanfteren Exit als Kopfschuss. Aber nicht so bald. Friedhof macht hungrig auf Leben.
Die kupferblonde Perücke machte mich zu blass, also griff ich zu aschblond. Ich verzichtete auf die Netzstrumpfhose und stieg in die Lackstiefel. Dann schlüpfte ich in das Kleid aus der neuen Diane-von-Fürstenberg-Kollektion. Mit seinem Eingriff bietet das klassische Wickelkleid den Zugriff bei voller Bekleidung; unter anderem deshalb hatte es mich fast mein ganzes Leben lang begleitet. Ihren ersten Auftritt hatte die Kultklamotte in den Siebzigern, in einem nachtblau geblümten Seidenexemplar aus einer der ersten Serien hatte Mutter in der Stuttgarter High Society damit Aufsehen erregt. Jahre später rangierte sie es aus, nachdem Vater ihr versehentlich ein Glas Negroamaro ins Dekolleté geschüttet hatte. Klammheimlich hatte ich es aus dem Karton für die Kleiderspende geklaubt. Als ich mich das erste Mal in den schmeichelnden Stoff wickelte, machte die antizipierende Erregungdas Handanlegen überflüssig. Bis zum Studium prägte Mutters Kleid mein Ritual, dann tauschte ich es gegen ein neues, für dessen Finanzierung ich zehn Nachtwachen absolvieren musste. Später ging ich alle paar Jahre mit Alex shoppen, wenn eine neue Kollektion auf den Markt kam, bis der Internethandel uns diese Mühe abnahm und direkt an ihre Adresse lieferte.
Zufrieden betrachtete ich vor dem Ganzkörperspiegel, wie der zarte Stoff zu beiden Seiten an mir herunterfloss. Bei der Schminke blieb ich minimalistisch, Lippenstift, ein Strich Kajal unter die Augen, auf Wimpertusche verzichtete ich. Puder verbot sich, da er auf Bartstoppeln kalkig wirkt und ich zu faul war, mich noch mal zu rasieren. Ein Tropfen Femme kam auf das linke Handgelenk, für die rechte Hand musste ein rot lackierter Mittelfingernagel genügen.
Aber diesmal ließ sich Ypsilon nicht vertreiben: Als ich in den Spiegel schaute, sah ich weder mich noch Kristina, da erschien nur der alternde Männerbody von Kris, noch dazu teilweise im Streikmodus. Weder zartes noch härteres Streicheln, auch nicht der Anblick des rotlackierten Nagels auf der Schaftvorderseite oder das Schnüffeln von Femme am Gelenk der freien Hand konnten den Schwanz heute seiner Sollgröße näherbringen, geschweige denn ihm zum Stand verhelfen.
Also Kopfkino. Ich sitze hinter Gemma auf der Harley, die sie ihrem mörderischen Alten geklaut hat. Sie ist nur mit Lederhelm und Stiefeln bekleidet, ihr praller Hintern schmiegt sich in den harten Sattel, der holprige Highway lässt ihre Titten schwappen. Doch zu mehr als lustlosem Wippen konnte selbst Gemma meinen Schwanz heute nicht inspirieren.
Filmwechsel – ich visualisierte die Kathoey-Zwillinge aus Bangkok, Sanya mit der Mädchenmuschi, Suna mit dem Prachtschwanz.
Meiner verharrte im Streik. Von wegen Eros als Lebenstrieb!
Frustriert schminkte ich mich ab und entfernte den Nagellack. Die Rückkehr in mein Kris-Leben war diesmal nicht die gewohnte schmerzliche Selbstvertreibung aus dem Paradies – stattdessen eine trostlose Leere, in der sich ein Friedhof zwischen mich und mein eigentliches, nie gelebtes Leben schob.
Als ich die Truhe schloss, zitterte der Schlüssel in meiner Hand und mein Herz raste, als hätte ich mein Ritual erfolgreich zu Ende gebracht. Kalte Schweißperlen bahnten sich ihren Weg durch die Augenbrauen und meine Brust fühlte sich an wie in einer Schraubzwinge. Als das Rasen auch nach Minuten nicht nachließ, dachte ich kurz an die Notaufnahme, entschied mich aber für Noah’s Mill statt Notarzt.
Tatsächlich gelang es dem alten Bourbon mühelos, mein Herz wieder in Takt zu bringen, nicht aber den Kopf. In Dauerschleife drehten sich schwarze Spiralen von Krankheit, Gebrechlichkeit und Alter; doch plötzlich war das Alter kein Schreckgespenst mehr, sondern erschien nun wie ein Geschenk, ein Glücksfall, dessen man sich keinesfalls sicher sein konnte.
Auch der Schlaf brachte keine Erlösung, verschleppte mich in eisige Traumwüsten, deren horizontlose Weite mich panisch und ziellos herumirren ließ, die Lungenflügel brennend von der dünnen Luft. Erst die Morgendämmerung beendete die trostlose Odyssee. Ich schälte mich aus dem schweißnassen Pyjama und rief Alex an.
Sie klang empathisch, aber nicht beunruhigt.
»Typische Panikattacke, das passiert besonders den Coolen. Kommt sicher irgendwann wieder, geht sicher auch wieder vorbei. Tagsüber kannst du deine Ängste in Sarkasmus ertränken, aber nachts bist du wehrlos. Mit Whisky kannst du vielleicht die Panik betäuben, aber nicht die Angst besiegen.«
»Dann hab ich lieber Panik.«
Ihr Lachen klang unbekümmert. »Kann ich mir denken, Attacken pariert man, Panik geht vorbei. Aber Angst ist bekanntlich eine Grundbefindlichkeit des Daseins, dagegen ist dein Bourbon machtlos.«
»In meiner Grundbefindlichkeit vertrage ich keine Heidegger-Zitate, schon gar nicht morgens vor acht! Außerdem haben Pathologen keine Angst vor dem Tod.«
»Nee klar, Pfarrer gehen auch nicht in den Puff. Und wir gehen zum Franzosen.«
Schon als sich die Schwingtür zum Institut hinter mir schloss, konnte ich es riechen: Alle wussten Bescheid. Berger und Martens, beide Assistenzärzte, standen plaudernd am Kopierer; als sie mich sahen, unterbrachen sie ihr Gespräch, rafften hastig die Kopien zusammen und murmelten, »Hallo, Herr Professor«, bevor sie blitzschnell in ihren Zimmern verschwanden.
»Selbstverständlich werden wir uns sofort darum kümmern«, hörte ich Leo aus dem Vorzimmer. Mit ihrem unbeugsamen Charme hatte Frau Leonhard selbst notorische Nervensägen souverän im Griff. Bei meinem Eintreten legte sie auf.
»Herr Professor, schön, dass Sie da sind. Ich war bei Aldi, der Schampus steht kalt, die Häppchen kommen in zehn Minuten und auf Ihrem Schreibtisch liegen noch zwei Unterschriftsmappen.«
Untypischer Wortschwall – und das auch noch, ohne mich anzusehen. Leos Augen waren blau wie Kobalt und meist strahlten sie auch so. Heute nicht. Sie schaute weg, üblicherweise ein Zeichen, dass sie etwas verheimlichte oder, um mich zu schonen, unangenehme Sachverhalte geringfügig modifizierte.
»Danke, Leo, schicken Sie bitte Henning rein. Über alles andere sprechen wir später.«
Nun sah sie mich kurz an und wirkte verlegen.»Sehr gerne, aber nur, wenn Sie drüber sprechen wollen. Ich finde es scheiße, wie hier getratscht wird. Sie hätten Krebs, heißt es, und Ihr Sabbatical wäre bloß ein Manöver, um Ihre Stelle zu behalten, und dass Sie vielleicht gar nicht mehr zurückkommen. Keiner spricht offen darüber und ich glaub auch nicht, dass sich jemand traut, Sie direkt zu fragen.«
Jetzt schimmerten ihre Augen verdächtig.
»Leo, haben Sie gerade wirklich Scheiße gesagt?«
Sie nickte. »Da sehen Sie mal, wie durcheinander ich bin.«
Seine Sekretärin war das einzige Privileg, worum ich meinen Chef beneidete. Ansonsten war ich zufrieden mit meinem Stellvertreterposten, ich genoss Gestaltungsspielraum, hatte wenig mit der Administration zu tun und keine wirtschaftliche Verantwortung. Als ich es seinerzeit nach einigen halbherzigen Versuchen aufgegeben hatte, mich um einen Chefposten zu bewerben, hatte Irmgard das maliziös mit »kein richtiges Alphatier« kommentiert und fand meinen mangelnden Ehrgeiz umso befremdlicher, als sie angeblich ihre eigene Karriere »um der Familie willen« hintangestellt hatte. Auch Alex’ Kommentar war nicht gerade aufbauend gewesen: Alpha- und Ypsilon-Gene lägen nahe beieinander, insofern entspräche es meinen femininen Anteilen, mich mit der zweiten Reihe zu begnügen. Ausgerechnet Alex, die mir eigentlich immer gepredigt hatte, Zuordnungen in die Kategorien weiblich / männlich als konventionsgesteuert zu hinterfragen; Alex, die selbst eine Alpha war, ohne das je als unweiblich zu empfinden.
»Wir reden nach dem Umtrunk«, wiederholte ich und ging in mein Zimmer.
Auch Henning wirkte verdruckst. Meinem ehrgeizigsten Doktoranden hatte ich versprochen, vor Antritt des Sabbaticals die nächsten Experimente für seine Promotionsarbeit mit ihm durchzusprechen. Ob er sich in meiner Abwesenheit an Kalkofen wenden könne, wollte er wissen.
Ich sortierte seine Datenblätter zu einem ordentlichen Stapel und reichte sie ihm über den Tisch. »Machen Sie das, wie Sie es für richtig halten.«
»Also nur, falls ich allein gar nicht weiterkomme«, stammelte Henning. Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, checkte ich Mails, signierte Befunde, unterschrieb zwei Anträge und starrte auf die Korallenfische, die sich auf dem Bildschirmschoner durch ein blaues Riff blubberten. Abschiedsgefühle kamen auf, als ließe ich Unwiederbringliches hinter mir, obwohl es nur eine vorübergehende Abwesenheit war. Nun musste ich mich auch noch mit der Frage herumschlagen, ob ich Wolffs Diagnose offenlegen oder mir das ersparen sollte – wenn es sowieso alle schon wussten.
Bis auf den Chef, der in Tokio einen Vortrag hielt und beim Feiern sowieso nicht zur Stimmung beitrug, waren um 17 Uhr alle zusammengekommen. Ich begrüßte das Team, bedankte mich fürs Kommen, ließ den ersten Korken knallen und eröffnete das Buffet.
Erst Häppchen, dann Hiob.
Unsere feierfreudige Gang – ein Team aus schrulligen Individualisten, die der gruppenidentitätsfördernde Aldi-Champagner zu einer verschworenen Spaßvogeltruppe zusammenwachsen ließ. Alle, außer Kalkofen, dem wissenschaftlichem Windhund mit dem Sozialverhalten eines Pitbulls. Heute waren die Stimmen gedämpft, Lachen verebbte im Ansatz, die Anzüglichkeiten blieben aus. Ein Stimmungspegel wie beim Leichenschmaus, bevor Alkohol die Trauer in schrille Albernheit umschlagen lässt.
Ich wollte gerade mit dem Messer an mein Glas klopfen, als Frau Schröder, die dienstälteste Assistentin, im Nebenraum verschwand und mit einem Paket wiederkam. Aber noch bevor sie mit Räuspern fertig war und zum Sprechen ansetzen konnte, fiel Kalkofen ihr ins Wort: Lassen Sie mich mal«, und nahm das Geschenk an sich.
Kalkofen hatte mir schon einige Kongresstrips verdorben. Wenn er mitreiste, traute Kristina sich nicht heraus. Als dritter Mann in der Hierarchie war er schon lange scharf auf meine Position, vermutlich spekulierte er seit meiner Diagnose auf die Nachfolge.
»Lieber Kollege Starck«, begann er, distanzlos wie immer.
»Wir sind ja alle wahnsinnig froh, dass dies kein echtes Abschiedsgeschenk ist, und wir Sie hoffentlich schon bald, wohlbehalten wiedersehen«, flötete er mit kunsthonigklebriger Scheinheiligkeit.
»Wir wissen nicht, wohin Ihre Reise jetzt geht, aber wir wissen, dass Sie in Ihrer Jugend eine Vorliebe für Afrika hatten. Deshalb habe ich Ihnen dies hier im Namen des Teams besorgt.«
Unter dem Geschenkpapier mit den roten Herzen kam ein knallroter Rettungsrucksack hervor, ausgestattet mit allem, was zur professionellen Ersten Hilfe nötig ist. Während ich noch mit dem Geschenkpapier beschäftigt war, konnte ich Berger hinter mir flüstern hören: »Hat der Geizkragen bestimmt auf eBay ersteigert.«
Ich bedankte mich bei Herrn Privatdozent Doktor Kalkofen für die Reminiszenz an meine vergangene Jugend und betonte, wie schmeichelhaft ich es fand, dass man mir als Pathologen die Notfallversorgung noch zutraute.
Dann sah ich Kalkofen direkt an und prostete ihm zu. »Sie haben freundlicherweise Ihre Hoffnung bekundet, mich nach meinem Sabbatical wiederzusehen. Da werde ich Sie nicht enttäuschen.«
Kalkofens Blick flackerte, ich stellte mein Glas ab. »Gerüchte sind wie Ambrosia, sie wuchern wild und richten Unheil an. Deshalb fürs Protokoll: Zu Beginn meines Sabbaticals habe ich einen Routine-Gesundheitscheck absolviert, als Zufallsbefund wurde ein Prostatakarzinom des Stadiums T2NO diagnostiziert, Sie kennen die Prognose. Falls nicht, wäre dies eine gute Gelegenheit, nachzulesen. Ich werde mich demnächst leitliniengerecht therapieren lassen, und so wird meine Performance hier im Institut weder von der Erkrankung noch von der Therapie beeinflusst. Und damit wünsche ich uns, dass dieser Umtrunk jetzt endlich unbeschwert wird.«
Der Applaus war herzlich. Wieder ein Haken auf der Liste. Auch wenn die Leichtigkeit, die frühere Events so vergnüglich gemacht hatte, nicht wiederkehrte, kam zumindest in Leos Augen wieder ein bisschen Kobalt.
»Als Krebskranker darf man doch sicher ein bisschen zu spät kommen, solange man überhaupt noch kommt?«, fragte ich in der Hoffnung auf Milde, als ich, unpünktlich wie immer, im Restaurant eintraf.
»Imbécile! Du mieser Manipulator!«, murmelte Alex über ihrem Glas Champagner, das schon fast leer war, aber ihr Grummeln klang fast zärtlich. Ihre Vorliebe für französische Flüche war eine Reminiszenz an ihre gescheiterte Ehe mit einem belgischen Kriegskorrespondenten.
Wir küssten uns und ich genoss die Kühle ihrer Hand auf meiner Wange. Alex trug einen schmal geschnittenen, moosgrünen Hosenanzug aus Kaschmirseide, dazu Stiefeletten in passendem Grün mit schwarzen Streifen und Stiletto-Absätzen; sonst bevorzugte sie flache Schuhe oder Sneakers. Der neue Stufenhaarschnitt und ein leichtes Make-up zeichneten ihr Gesicht weicher, der Concealer, den sie mir vor Kurzem einvernehmlich entwendet hatte, kaschierte die Ringe unter ihren Augen.
»Du siehst hinreißend aus, ich finde, wir sollten noch mal Sex haben, bevor ich womöglich impotent werde.«
Alex grinste. »Das wär’s mir wert, schon um dein Gesicht zu sehen, wenn ich ja sage.«
»Begleite mich doch einfach auf meiner Reise, ich werfe mich in mein schärfstes Weiber-Outfit, dann ziehen wir durch alle Transkneipen.«
Obwohl Alex schon über Jahrzehnte meine Transvertraute war, hatte sie mich noch nie bei einem meiner Escapes als Kristina begleitet.
»Wird ja Zeit, dass du mich mal mitnimmst«, sagte sie so leichthin, dass es nicht ernst gemeint klang – aber auch nichts ausschloss. Ihr schalkhaftes Grinsen machte sie Jahrzehnte jünger und erinnerte mich an die Zeit unserer Studentenliebe, als ich ihr erstmals meine Transtendenzen gebeichtet hatte. Sie hatte das spannend gefunden und mich vorbehaltlos darin bestärkt, als Frau zu leben. Die Selbstverständlichkeit ihrer Akzeptanz hatte mich sogar hoffen lassen, sie kenne eine solche Disposition aus der eigenen Biografie, zumal sie auf Kindheitsfotos eher knabenhaft aussah. Auf meine Frage, ob sie sich je gewünscht hätte, ein Junge zu sein, hatte sie lachend den Kopf geschüttelt. Allenfalls hätte sie davon geträumt, erster weiblicher Häuptling eines wilden Indianerstammes zu werden – oder erste Kapitänin der männlichen Fußballnationalmannschaft.
In unserem sechsten Lebensjahrzehnt war ich eigentlich keinen Schritt weiter, noch immer gefangen in meinem sporadischen Doppelleben, von dem ich manchmal nicht mehr wusste, ob es nicht längst zum bloßen Liebäugeln mit einer Option geworden war, die ich gar nicht mehr ernsthaft anstrebte. Aber immerhin eine Option, über die ich selbst entscheiden konnte und die ich keinesfalls missen wollte. Bis kürzlich der Krebs in meinen Entscheidungsspielraum eingebrochen war und ihn einengte wie eine Würgepflanze. Und der damit die Bequemlichkeit zerschmetterte, mit der ich mich in einem nicht wirklich erfüllten, aber auch nicht unglücklichen – und mit regelmäßigen Escapes durchaus erträglichen Leben zurechtgekuschelt hatte.
Wir genossen die Vorspeise, klauten uns gegenseitig Froschschenkel und Entenstopfleber von den Tellern, aber irgendwann ließ sich die Frage des Abends nicht weiter hinauszögern: Ob ich mein Karzinom operieren oder bestrahlen lassen wollte. Ob die Reise anschließend meine Belohnung wäre.
»Wahrscheinlich bestrahlen, aber erst Reise und gleichzeitig antiandrogene Therapie.«
»Das ist aber nicht das, was dir Wolff empfohlen hat?«
»Du hast ja die Leitlinie gelesen, so kann man’s prinzipiell auch machen.«
Der Kellner servierte Blutwurst und Kalbsbäckchen, die mir einen kurzen Aufschub verschafften, bevor das eigentliche Thema zur Sprache kam. Nach einigen Minuten genießerischen Schweigens eröffnete Alex: »So, mein Lieber, Butter bei die Fische: Was deine Bereitschaft zum Coming-out betrifft, hat die Diagnose daran etwas verändert?«
Ich stach meine Gabel in ein Bäckchen. Schwierig. Einerseits: Wann, wenn nicht jetzt, wo es wenig zu verlieren gab? Sollte die Angst vor dem Tod nicht die Angst vor dem Coming-out pulverisieren? Eigentlich ja, allerdings nur im Kopf.
Alex nickte nachdenklich. Ich spülte das Bäckchen herunter. »Meinst du, man muss erst Krebs kriegen, um erwachsen zu werden?«
»Erwachsen ist man, wenn man sich hinter sich hat. Stand neulich in meinem Sprüchekalender.«
»Hinter sich klingt ja tröstlich für einen Krebskranken!«
Alex schüttelte den Kopf. »Sich hinter sich zu haben hat nichts mit Sterben zu tun, denn sterben kann man auch, ohne vorher erwachsen zu werden. Sich hinter sich zu haben könnte zum Beispiel bedeuten, dass es dich nicht mehr interessiert, was andere von dir denken. Oder von Kristina.«
»Recht hast du, wie immer«, sagte ich, »fehlt nur noch dein Rezept für die Umsetzung.«
Wir prosteten uns zu und widmeten uns ein paar Minuten schweigend dem Essen, bevor Alex den Gesprächsfaden wieder aufnahm. »Also, auf dem Rezept könnte stehen: erst mal Test-Outing auf einer Reise, in sicherer Distanz zu allen vertrauten Menschen. Und wann willst du Kristina deiner Familie vorstellen?«
Ich musste an Marens Reaktion beim Klopsdinner denken und an Mort Pfefferman, den Protagonisten in Transparent, der mit siebzig Jahren beschließt, fortan als Maura zu leben, und dessen neurotisch auf sich selbst fixierte Kinder die neue »Mapa« dann überraschend beiläufig akzeptieren. Leider war ich nicht so mutig wie Maura – die hatte allerdings auch keine vaterlos aufwachsende Enkelin, für die der Großvater wichtig war. Ob Micky mit einer Zweitoma klarkäme, oder ob Maren ihr dann den Umgang mit mir verbieten würde?
Alex blieb dran. Ich hätte das Transthema vor mir her geschoben und mich vom beruflichen Stress ablenken lassen. Und nun die Krankheit. Eigentlich sollte es jetzt nur darum gehen, die Heilungschancen optimal auszuschöpfen. Andererseits hätte ich vielleicht nicht mehr beliebig Zeit, wenn ich mein restliches Leben als Frau verbringen wolle, denn man könne den Krankheitsverlauf nicht wirklich einschätzen …
Sie brach ab, wir hielten uns einen Moment stumm an der Hand.
»Du sagst es. Im Moment weiß ich gar nichts. Vielleicht bringt mir der Roadtrip ein paar Klarheiten. Ich werde einfach üben, herauszugehen, die Reise quasi als Trainingscamp nutzen.«
Alex schwenkte den Rotwein. »Dann wird das dein Zarathustra Trip.«
Meinen verständnislosen Blick kommentierte sie mit einem Kopfschütteln. »Banause! Nietzsche! Also sprach Zarathustra: Werde, der du bist.«
Auch wenn ich ihre Philosophiezitate mitunter anstrengend fand, lieferte dieses ein perfektes Reisemotto.
Den üblichen Wettstreit um die Bezahlung umging sie, indem sie die Rechnung beim Rückweg von der Toilette hinterrücks beglich, wofür ich sie anschließend rituell beschimpfte.
Lufthungrig machten wir uns Hand in Hand auf den Weg zum nächsten Taxistand, schweigend in Gedanken versunken. Warum waren wir eigentlich kein Paar geblieben, obwohl wir uns in fast allen Grundsatzfragen einig waren und die wesentlichen Prioritäten für die Lebensgestaltung teilten. Unverändert, seit der Studentenzeit, auch wenn wir damals hatten einsehen müssen, dass unsere Studentenliebe wegen divergierender erotischer Präferenzen nicht zukunftsfähig war. Alex mochte Machos im Bett, Kerle, die sich im sonstigen Leben als komplett beziehungsuntauglich erwiesen, ich bevorzugte eher Frauen mit androgynen Manieren, Rockerbräute, die dem Manne untertan sind, indem sie ihn unterwerfen. Dennoch hatte es im Laufe unseres weiteren Lebens sporadische Episoden gegeben, in denen wir einander Trost im Bett gespendet und uns gefragt hatten, ob sich für zwei Menschen, die sich so gut kannten und einander zugetan waren wie Geschwister, die Freundschaft nicht doch zum ultimativen Beziehungshafen eigne. Den wir dann aber doch nicht anliefen, da wir spürten, dass allzu große Vertrautheit keine Leidenschaft mehr zuließ – die wir für eine emotionale Heimat noch immer unabdingbar fanden. Irgendwann hatten wir nach einigen Drinks verabredet, uns dieser Frage mit siebzig noch einmal zu stellen.
Zum Abschied umarmten wir uns lange und innig.
Seit ihre neue Segmental Body Composition-Waage ein ungünstiges Fett-Muskel-Verhältnis angezeigt hatte, ackerte Irmgard zwei bis drei Mal pro Woche in unserem Fitnessclub.
Vom Total Abdominal Trainer, einem Neuerwerb des Studios, mit dem neben dem Sixpack auch die Hüftbeuger modelliert werden sollen, warf Irmgard mir einen Blick zu, den ich als Symptom der Qual ihrer abdominalen Fronarbeit wertete. Statt mit ihrem üblichen Hi-Hi begrüßte sie mich mit »Guten Tag, Kris«, und sofort war klar, dass nicht das Gerät ihr die Laune verdarb. Ohne mir einer Verfehlung bewusst zu sein, ging ich reflexhaft in den Befriedungsmodus und erkundigte mich nach ihrem Befinden.
»Ich bin ja nur deine Exfrau und Hausärztin«, schnappte sie und ließ die Griffe des Bauchtrainers los, die ruckartig nach oben schnalzten. Beim Thema Hausärztin war Irmgard empfindlich, schließlich hatte auch sie von einer Facharztkarriere nach dem Studium geträumt. Doch dann hatte uns eine Pillenpanne Maren beschert. Damit bekam nicht nur ihre medizinische Laufbahn einen Knick, auch die musikalische Leadership als Sängerin bei der Pankower Freiheit blieb auf der Strecke. Beides hatte sie uns beiden übelgenommen.
»Es ist immer dasselbe mit dir – du merkst einfach nicht, was du mit Menschen machst, die es gut mit dir meinen.«
Ich wäre geflohen, hätte ich die Endorphine nicht so nötig gehabt, außerdem verlangte die Röllchenbildung an meiner Mitte nach regelmäßigem Workout. Schon immer hatte ich es als Ungerechtigkeit der Schöpfung empfunden, dass die männliche Wampe die Körperästhetik so viel mehr stört als das Bäuchlein der reiferen Frau.
»Lass mich einfach in Ruhe trainieren, solange ich noch fit genug bin«, versuchte ich, mich in Richtung Laufband davonzustehlen. Aber Irmgard hielt mich fest. So sei das ja nicht gemeint gewesen. Ob ich sie nach dem Training zu einem Eiweißdrink einladen mochte.
»Wir trinken einen Smoothie«, stimmte ich zu. In unseren Ehejahren hatte ich gelernt, Friedensangebote auch dann nicht auszuschlagen, wenn ich den Kriegsgrund nicht verstand.
Für das Warm-up stellte ich das Laufband auf fünf Prozent Steigung. Nach einigen Minuten tippte Rüdiger mir auf die Schulter und lobte meinen geschmeidigen Flow. Als Physiotherapeut und begeisterter Sportpädagoge hatte er kürzlich ein Optimierungspotenzial an meinem Laufstil entdeckt. Sein beiläufiger Hinweis, meine schlanke Athletik eröffne noch erhebliches läuferisches Optimierungspotenzial, hatte mich schlagartig motiviert, seine Trainingsanregungen aufzunehmen und das Zusammenspiel von Schulter- und Hüftbewegung zu harmonisieren.
Nach zwanzig Minuten Fatburning trabte ich zufrieden zum Kurs Power Pilates für fortgeschrittene Anfänger, als einziger Mann genoss Kris die besondere Zuwendung der Damen, und Kristina liebte die Eleganz der fließenden Bewegungen. Doch heute floss gar nichts, ich mühte mich missmutig, meine eins achtundsiebzig zu den anmutigen Positionen zu falten, in die sich die Damen anstrengungslos zurechtbogen.
Als ich kurz vor der vereinbarten Zeit Richtung Dusche ging, wartete Irmgard schon an der Bar. Wie ihr Latschenkieferduft verriet, hatte sie sich bereits einen Saunagang gegönnt. Ich roch nach Männerschweiß. In der Hoffnung, sie habe in der Sauna ihren Groll auf mich weggeschwitzt, fragte ich nach dessen Ursache.
Nach einem strafenden Blick sprudelte sie los. Dass ich nach dem Abendessen stundenlang mit Carla verschwunden und dann überstürzt aufgebrochen sei, spreche nicht gerade für meine Wertschätzung ihrer Person. »Und mit Maren hast du auch allein gesprochen. Nur mit mir nicht. Wenn es um Bagatellen geht, bin ich dir immer gut genug, aber wenn es mal ernst wird …«
»Sorry, sei nicht so kleinlich, als Kollegin müsste dir schließlich klar sein, dass ich mit meiner Krankheit momentan andere Sorgen habe.«
Ein Schleier aus Schuldgefühl huschte über ihr saunagerötetes Gesicht. »Weiß ich doch, Kris. Du willst ja nie jemanden brauchen. Ist ja auch okay für einen gesunden Single. Bei Single mit Krebs wird’s schon schwieriger. Du solltest schon mal drüber nachdenken, was du machst, falls es nicht so gut laufen sollte …«
Ich kriegte Gänsehaut. »Willst du mir gerade beibiegen, ich sollte eine Patientenverfügung schreiben? Zu deiner Beruhigung: Ein Testament habe ich schon.«
Sie richtete sich auf. Mit ihrer Stimme hätte man einen Eisblock schneiden können. »Dass du dich nicht schämst, Kristian! Erst machst du mir Schuldgefühle, damit ich dir nicht mehr böse bin, und wenn ich dann auf dich zugehe, bügelst du das mit einem sarkastischen Spruch ab.«
Ich bat um Verzeihung. Schweigend nuckelten wir unsere Smoothies, dann stellte Irmgard ihr Glas ab und murmelte: »Dabei wollte ich gerade sagen …«
Sie geriet ins Stocken, ihr Blick flackerte. »Obwohl unsere Ehe nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, sind wir immer noch Freunde. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Und falls du deine Therapie schlecht verträgst oder allein nicht zurechtkommst, kannst du auch eine Weile bei mir wohnen und ich versorge dich.«
Dass sie dem Ex, der sich gerade benommen hatte wie ein Elefant im Porzellanladen, nun dennoch die Wohnungstür öffnete, machte mich sprachlos. Wir umarmten uns. Wenn auch die Denkbarkeit fehlte, so war doch die Dankbarkeit echt.
»Sag bloß nicht, dass du wieder rauchst!«
Schnüffelnd trat Wolff einen Schritt zurück und schüttelte mit der Entrüstung eines militanten Exrauchers den Kopf.
»Ist meine Krebsdiät. Frei nach Frank Zappa.«
»Zappa wäre auch ohne Zigaretten gestorben, bei ihm hat man die Diagnose verschlampt und dann war der Tumor schon inoperabel. Deiner beschränkt sich auf die Prostata, und die kann ich dir rausmontieren.«
Ich holte tief Luft und teilte ihm meine Entscheidung mit: Drei Monate neoadjuvante Hormontherapie mit Bicalutamid und erst im Anschluss daran endgültige Festlegung der primären Therapie. Ich begründete den Wunsch nach Aufschub und schloss meine weitschweifige Erklärung mit der Bitte um eine Empfehlung für die geeignete Viagra-Dosis, falls das Medikament sich auf meine Potenz auswirken sollte.
»Spinnst du?« Wolff schüttelte den Kopf und versuchte mich umzustimmen. Wenn schon keine OP, dann wenigstens eine »richtige« Hormontherapie.
Ich blieb stur. Keine Kastration.
An Wolffs massigem Hals spannten sich die Sehnen und sein Kiefer mahlte. »Wie kann ein wissenschaftlich versierter Pathologe so mit dem Schwanz denken, wenn es um sein Überleben geht?«
Ich lehnte mich zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Schon mal was von Psychoonkologie gehört? Gerade einem Urologen sollte doch wohl einleuchten, dass der Schwanz nicht nur dem Vergnügen dient, sondern auch zum Pinkeln– und zwar, wann und wohin man will und nicht aus Versehen in die Hose.«
Ich starrte auf die wuchtige Eiffelturm-Lampe auf seinem Schreibtisch. Schon als Studenten in der alten Clique waren Wolff und ich selten im selben Raum gewesen, ohne binnen Kürze in einem verbalen Schlagabtausch zu landen. Als Kickboxer traf Wolff zielgenau ins Empfindliche, wohingegen ich eher den Florettfechter gab, der mit rhetorischer Ironie die Lacher auf seine Seite zog. Wie er allerdings mit Kristina umgesprungen wäre, hätte er sie kennengelernt, mochte ich mir nicht ausmalen.
»Starck, du bist ein Spacken, aber der Patient ist Souverän der Therapieentscheidung.«
Auf meine Frage, ob weitere Untersuchungen zum Ausschluss von Metastasen sinnvoll wären, meinte er, das sehe die Leitlinie bei meinem PSA nicht vor, und es sei auch überflüssig, da ich sowieso ein Medikament nehmen wolle, das im gesamten Körper wirke. Diese Aussage fand ich sowohl beruhigend als auch beängstigend, hakte aber nicht nach. Nachdem ich versprochen hatte, in sechs Wochen eine PSA-Kontrolle durchführen zu lassen und ihm das Ergebnis mitzuteilen, bekam ich das gewünschte Rezept mit dem Kommentar, Ärzte als Patienten seien eine Strafe Gottes, immerhin aber mit der Aufforderung: »Melde dich gefälligst, wenn du zurück bist – oder sonst auch, anytime.«
Als wir nach der Verabschiedung unseren Händedruck lösten, fiel das beklemmende Unbehagen von mir ab. Ich hatte mich nicht gegen meinen Willen umstimmen lassen.
Und nun konnte der Roadtrip beginnen.