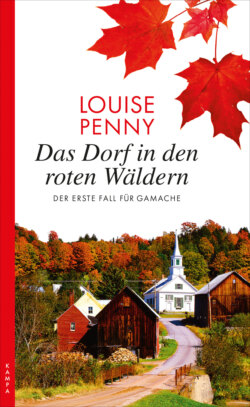Читать книгу Das Dorf in den roten Wäldern - Louise Penny - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDer Anruf erreichte Armand Gamache, als er gerade seine Wohnung in Montréal verlassen wollte. Seine Frau Reine-Marie saß schon im Auto, und nur weil er noch einmal auf die Toilette gemusst hatte, waren sie noch nicht auf dem Weg zur Taufe seiner Großnichte.
»Oui, allô?«
»Monsieur L’Inspecteur?«, fragte eine höfliche junge Stimme am anderen Ende. »Hier spricht Agent Nichol. Der Superintendent hat mich gebeten, Sie anzurufen. Es gab einen Mord.«
Selbst nach den vielen Jahren in der Sûreté du Québec, die meisten davon in der Mordkommission, jagten ihm diese Worte noch einen Schauer über den Rücken. »Wo?« Er hatte bereits Papier und Bleistift in der Hand, die neben jedem Telefon in der Wohnung lagen.
»Ein Dorf in den Eastern Townships. Three Pines. Ich könnte in einer Viertelstunde bei Ihnen sein und Sie abholen.«
»Hast du diesen Menschen umgebracht?«, fragte Reine-Marie, als er ihr erklärte, dass er nicht während des Zwei-Uhr-Gottesdienstes neben ihr auf einer der harten Bänke in einer fremden Kirche sitzen würde.
»Wenn ich es getan habe, werde ich es herausfinden. Möchtest du mitkommen?«
»Was würdest du eigentlich machen, wenn ich jemals ja sage?«
»Ich würde mich freuen«, antwortete er wahrheitsgemäß. Nach zweiunddreißig Ehejahren konnte er immer noch nicht genug von Reine-Marie kriegen. Sollte sie ihn jemals bei einer Morduntersuchung begleiten, würde sie genau das Richtige tun, davon war er fest überzeugt. Sie schien immer genau zu wissen, was notwendig war. Es gab nie irgendwelche Dramen mit ihr, irgendein Durcheinander. Er vertraute ihr.
Und wieder einmal tat sie das Richtige und lehnte seine Einladung ab.
»Ich sage ihnen einfach, dass du wieder einmal betrunken bist«, erwiderte sie auf seine Frage, ob ihre Familie wegen seines Ausbleibens nicht enttäuscht wäre.
»Hast du ihnen beim letzten Mal, als ich einem Familientreffen fernblieb, nicht erzählt, ich wäre auf Entzug?«
»Dann bist du eben wieder rückfällig geworden.«
»Traurig für dich.«
»Ich opfere mich eben für meinen Ehemann auf«, sagte Reine-Marie und rutschte auf den Fahrersitz. »Pass auf dich auf, Schatz.«
»Das werde ich, mon cœur.« Er ging zurück in sein Arbeitszimmer in ihrer Wohnung im ersten Stock und stellte sich vor die große Karte von Québec, die an die Wand gepinnt war. Sein Finger glitt von Montréal über die Eastern Townships nach Süden und blieb an der Grenze zu den Vereinigten Staaten hängen.
»Three Pines … Three Pines«, murmelte er vor sich hin. »Könnte es auch anders heißen?«, fragte er sich, da er das erste Mal auf seiner detaillierten Karte einen Ort nicht finden konnte. »Trois Pins, vielleicht?« Nein, auch das war nicht verzeichnet. Aber das war nicht weiter schlimm, da es Nichols Aufgabe war, den Ort ausfindig zu machen. Er lief durch die große Wohnung, die sie damals in Outremont gekauft hatten, als die Kinder auf die Welt gekommen waren. Inzwischen waren sie längst ausgezogen und hatten selbst Kinder, aber trotzdem vermittelte die Wohnung nie einen verlassenen Eindruck. Er fühlte sich auch allein mit Reine-Marie wohl darin. Auf dem Klavier standen Fotos und die Regalbretter bogen sich unter den Büchern. Zeugnisse eines glücklichen Lebens. Reine-Marie hätte auch seine Auszeichnungen aufgehängt, aber das hatte er nicht gewollt. Jedes Mal, wenn sein Blick auf die gerahmten Urkunden in dem Schrank in seinem Arbeitszimmer fiel, erinnerte er sich nicht an deren feierliche Überreichung, sondern an die Gesichter der Toten und Lebenden, die mit den einzelnen Fällen verbunden waren. Nein. Sie hatten keinen Platz an den Wänden seines Zuhauses. Und seit dem Fall Arnot gab es sowieso keine Belobigungen mehr. Aber seine Familie war Belohnung genug.
Agent Yvette Nichol rannte auf der Suche nach ihrer Brieftasche aufgescheucht in der Wohnung herum.
»Komm schon, Dad, du musst sie gesehen haben«, sagte sie flehentlich mit einem Blick auf die Wanduhr und den unbarmherzig vorrückenden Minutenzeiger.
Ihr Vater erstarrte auf seinem Stuhl. Er hatte ihre Brieftasche gesehen. Vorhin erst hatte er sie in der Hand gehabt und zwanzig Dollar hineingesteckt. Das war ein kleines Spiel zwischen ihnen. Er gab ihr ein bisschen Taschengeld, und sie tat so, als bemerkte sie es nicht; nur dann und wann, wenn er von der Nachtschicht in der Brauerei nach Hause kam, fand er im Kühlschrank ein Eclair mit einem Zettel, auf dem in ihrer klaren, fast kindlichen Schrift sein Name geschrieben stand.
Vor ein paar Minuten hatte er die Brieftasche genommen und das Geld hineingesteckt, aber als der Anruf für seine Tochter kam, mit dem sie zu dem Mordfall abkommandiert wurde, hatte er etwas getan, was er sich nie hätte träumen lassen. Er hatte die Brieftasche versteckt, zusammen mit ihrem Sûreté-Ausweis. Für dieses kleine Dokument hatte sie jahrelang geackert. Er beobachtete sie dabei, wie sie die Sofakissen auf den Boden schleuderte. Sie würde auf der Suche nach ihrer Brieftasche noch die ganze Wohnung auseinandernehmen.
»Hilf mir doch, Dad. Ich muss sie finden.« Sie drehte sich zu ihm um, die Augen vor Verzweiflung weit aufgerissen. Wie konnte er nur so dasitzen und nichts tun? Das war ihre große Chance, der Moment, von dem sie seit Jahren geredet hatten. Wie viele Male hatten sie über ihren Traum gesprochen, dass sie es eines Tages in die Sûreté schaffen wollte? So war es schließlich auch gekommen, und jetzt hatte sie dank einer Menge harter Arbeit und, offen gesagt, ihrer angeborenen Begabung als Ermittlerin die Chance erhalten, mit Gamache an einem Mordfall zu arbeiten. Ihr Dad wusste alles über ihn. Er verfolgte jeden seiner Fälle in der Zeitung.
»Dein Onkel Saul, der hätte die Gelegenheit gehabt, zur Polizei zu gehen, aber er hat es vermasselt«, hatte ihr Vater ihr erzählt und den Kopf geschüttelt. »Was für eine Schande. Und du weißt doch, was mit Versagern geschieht?«
»Sie bezahlen mit ihrem Leben.« Yvette kannte die richtige Antwort. Praktisch seit dem Tag ihrer Geburt war ihr immer wieder die alte Familiengeschichte erzählt worden.
»Wie Onkel Saul, deine Großeltern. Alle. Aber jetzt bist du ja da, mein kluges Mädchen, wir zählen auf dich.«
Yvette hatte jede Erwartung übertroffen, als sie in die Sûreté aufgenommen wurde. Innerhalb einer Generation war ihre Familie von den Opfern der tschechoslowakischen Regierung zu jenen aufgestiegen, die andere herumkommandierten. Jetzt hielten sie das Heft in der Hand.
Das gefiel ihr.
Allein ihre unauffindbare Brieftasche samt Ausweis stand in diesem Moment zwischen der Erfüllung ihrer Träume und kläglichem Scheitern wie bei dem dummen Onkel Saul. Die Uhr tickte. Sie hatte dem Chief Inspector gesagt, sie wäre in fünfzehn Minuten bei ihm. Das war fünf Minuten her. Damit blieben ihr zehn Minuten, um ans andere Ende der Stadt zu gelangen und auf dem Weg noch Kaffee zu besorgen.
»Hilf mir doch«, flehte sie erneut und leerte den Inhalt ihrer Handtasche auf dem Wohnzimmerboden aus.
»Hier ist sie.« Ihre Schwester Angelina kam aus der Küche, die Brieftasche und den Sûreté-Ausweis in der Hand. Yvette stürzte auf Angelina zu und küsste sie, dann eilte sie in den Flur, um ihren Mantel überzustreifen.
Ari Nikulas sah seinem jüngsten Kind zu, versuchte jeden Quadratzentimeter ihres geliebten Gesichtes im Gedächtnis zu bewahren und der erbärmlichen Furcht, die in seinem Herzen lauerte, nicht nachzugeben. Was hatte er nur getan, als er ihr diese lächerliche Idee in den Kopf gesetzt hatte? Er hatte niemanden in der ehemaligen Tschechoslowakei verloren. Die ganze Geschichte war ein Produkt seiner Fantasie und diente einzig dem Zweck, ihm in ihrer neuen Heimat Bedeutung zu verleihen, einen Anstrich von Heldentum. Aber seine Tochter hatte ihm geglaubt, glaubte noch immer, dass es einen dummen Onkel Saul und eine hingeschlachtete Familie gegeben hatte. Und jetzt war es zu spät. Er konnte ihr die Wahrheit nicht mehr sagen.
Sie umarmte ihn, küsste ihn auf die stoppelige Wange. Er hielt sie einen Moment zu lang fest, und sie sah ihm verwundert in die müden, traurigen Augen.
»Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich werde dich nicht enttäuschen.« Und mit diesen Worten war sie weg.
Er konnte gerade noch sehen, wie eine kleine Locke ihres dunklen Haars an ihrem Ohr hängen blieb.
Fünfzehn Minuten nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte, klingelte Yvette Nichol an der Tür. Verlegen stand sie da und sah sich um. Das war ein schickes Haus, in dem Gamache wohnte, umgeben von viel Grün und in bequemer Gehweite zu den Läden und Restaurants an der Rue Bernard. In Outremont hatte sich die intellektuelle und politische Elite des französischen Québec niedergelassen. Sie hatte den Chief Inspector im Polizeipräsidium gesehen, hastig durch die Flure eilend, stets eine Gruppe von Leuten in seinem Kielwasser. Er war schon ewig dabei und stand in dem Ruf, die Rolle eines Mentors für die Leute zu übernehmen, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie konnte froh sein.
Er rückte noch schnell seine Tweed-Kappe zurecht, dann öffnete er die Tür und lächelte Nichol freundlich an. Nach kurzem Zögern ergriff sie seine ausgestreckte Hand.
»Ich bin Chief Inspector Gamache.«
»Es ist mir eine Ehre.«
Als sie die Beifahrertür des Zivilfahrzeugs für ihn öffnete, bemerkte Gamache sogleich einen unverkennbaren Geruch: Kaffee in Pappbechern. Und dazu noch einen anderen Duft. Brioche. Die junge Frau hatte ihre Hausaufgaben gemacht. Er trank diesen Kaffee nur, wenn er mit einem Mordfall betraut war. In seinem Kopf war er so sehr mit der Ermittlungsarbeit verbunden, den langen Stunden, die er und sein Team in der Kälte auf durchweichten Feldern herumstanden, dass sein Herz jedes Mal wild zu klopfen begann, wenn ihm der Geruch von Kaffee und feuchter Pappe in die Nase stieg.
»Ich habe den vorläufigen Bericht vom Tatort heruntergeladen. Der Ausdruck ist in der Akte da hinten.« Nichol deutete auf die Rückbank, während sie den Wagen über den Boulevard St. Denis in Richtung Autobahn steuerte, die sie zur Champlain Bridge und von dort aufs Land bringen würde.
Den Rest der Fahrt schwiegen sie, während er die knappen Informationen las, an seinem Kaffee nippte, das Brioche aß und auf das flache Ackerland vor den Toren Montréals hinaussah, das zunächst sanft geschwungenen Hügeln wich und schließlich höheren Bergen, deren Hänge von leuchtendem Herbstlaub bedeckt waren.
Ungefähr zwanzig Minuten nachdem sie die Autobahn verlassen hatten, kamen sie an eine Abzweigung mit einem kleinen verwitterten Schild, auf dem zu lesen war, dass es noch zwei Kilometer bis Three Pines waren. Ein, zwei Minuten später, die sie auf einer von Schlaglöchern übersäten unbefestigten Straße entlanggeholpert waren, bot sich ihnen ein zwangsläufig widersprüchliches Bild: eine alte steinerne Mühle neben einem Teich, deren Mauern von der warmen Vormittagssonne vergoldet wurden, um die Mühle herum Ahornbäume und Birken und Wildkirschen, deren bunt gefärbte Blätter ihnen bei ihrer Ankunft wie Tausende von Händen fröhlich zuwinkten. Und Polizeiautos. Die Schlangen im Garten Eden. Doch die Polizei war nicht das Böse, wie Gamache wusste. Die Schlange war schon vorher da.
Gamache schritt auf die versammelte Menge zu, die ihm erwartungsvoll entgegenblickte. Beim Näherkommen sah er, dass die Straße sanft in Richtung eines pittoresken Dorfes abfiel. Die Leute standen auf dem Kamm des Hügels, einige sahen zu dem Wald hinüber, wo man die Bewegungen der Polizisten in ihren hellgelben Jacken ausmachen konnte, aber die meisten hatten sich ihm zugewandt. Gamache hatte den Ausdruck auf ihren Gesichtern schon unzählige Male gesehen, auf den Gesichtern von Leuten, die auf Nachrichten warteten, die sie lieber nicht hören wollten.
»Wer ist es? Können Sie uns sagen, was passiert ist?« Ein großer, stattlicher Mann machte sich zum Sprecher der Menge.
»Tut mir leid, ich hatte selbst noch nicht die Gelegenheit, etwas Näheres in Erfahrung zu bringen. Sobald ich mehr weiß, werde ich Sie informieren.«
Der Mann schien nicht zufrieden mit der Antwort zu sein, nickte jedoch. Gamache warf einen Blick auf seine Uhr: 11 Uhr, der Sonntag des Thanksgiving-Wochenendes. Er wandte sich von der Menge ab und ging in die Richtung, in die nun alle starrten, auf das geschäftige Treiben im Wald zu und die eine Stelle, an der, wie er wusste, völlige Stille auf ihn wartete.
Um die Leiche herum war in einem großen Kreis gelbes Plastikband gespannt worden. Innerhalb dieses Kreises waren die Leute von der Spurensicherung zugange, die Rücken gebeugt wie in einem heidnischen Ritual. Mit den meisten von ihnen arbeitete Gamache schon seit Jahren zusammen, aber er hielt immer einen Platz für einen Neuling frei.
»Darf ich vorstellen – Inspector Jean Guy Beauvoir, das ist Agent Yvette Nichol.«
Beauvoir nickte ihr freundlich zu. »Willkommen.«
Mit seinen fünfunddreißig Jahren war Jean Guy Beauvoir seit mehr als einem Jahrzehnt Gamaches engster Mitarbeiter. Er trug Cordhosen und einen Wollpullover unter seiner Lederjacke und hatte sich lässig einen Schal um den Hals geschlungen. Er vermittelte den Eindruck von gewollter Nonchalance, die zu seinem durchtrainierten Körper passte, aber zugleich durch seine angespannte Haltung konterkariert wurde. Hinter dem legeren Auftreten von Jean Guy Beauvoir steckte eiserne Entschlossenheit.
»Danke, Sir.« Nichol fragte sich, ob sie sich jemals so selbstverständlich an dem Schauplatz eines Mordes verhalten würde wie diese Leute.
»Chief Inspector Gamache, das ist Robert Lemieux«, stellte ihm Beauvoir einen jungen Polizisten vor, der außerhalb der Polizeiabsperrung stand. »Agent Lemieux ist der diensthabende Beamte von der Sûreté Cowansville. Er nahm den Anruf entgegen und kam sofort hierher. Sicherte den Tatort und erstattete Meldung.«
»Gut gemacht.« Gamache schüttelte dem jungen Polizisten die Hand. »Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, als Sie hier eintrafen?«
Lemieux sah ihn verblüfft an. Er hatte bestenfalls darauf gehofft, hier bleiben und zusehen zu dürfen und nicht vom Tatort weggescheucht zu werden. Aber niemals hätte er erwartet, den legendären Chief Inspector kennenzulernen, gar nicht davon zu reden, ihm eine Frage zu beantworten.
»Bien sûr, ich sah diesen Mann dort. Ein Anglais, seiner Kleidung und seiner Blässe nach zu urteilen. Die Engländer haben, wie ich feststellen musste, einen schwachen Magen.« Lemieux freute sich, diese Erkenntnis dem Chief Inspector mitteilen zu können, auch wenn er sie eben erst gewonnen hatte. Er hatte keine Ahnung, ob Les Anglais eher zur Blässe neigten als die französischstämmigen Kanadier, aber es klang gut. Allerdings hatte Lemieux die Erfahrung gemacht, dass die Engländer keinen Stil in Kleiderfragen hatten, daher konnte dieser Mann in seinem schlichten Flanellhemd unmöglich frankofon sein. »Er heißt Benjamin Hadley.«
Auf der gegenüberliegenden Seite der Absperrung sah Gamache einen Mann mittleren Alters, der in der Hocke an einem Baum lehnte. Groß, schlank und sehr, sehr blass. Beauvoir folgte dem Blick von Gamache.
»Er hat die Leiche entdeckt«, sagte Beauvoir.
»Hadley? Wie in Hadley’s Mill?«
Beauvoir lächelte. Er hatte keine Ahnung, wie Gamache das wissen konnte, aber er wusste es. »Ganz genau. Kennen Sie ihn?«
»Nein. Noch nicht.« Beauvoir sah seinen Chef fragend an und wartete. Gamache erklärte: »Auf dem Gebäude der Sägemühle war ein verblasster Schriftzug zu lesen.«
»Hadley’s Mill.«
»Gut geschlossen, Beauvoir.«
»Nur ein Schuss ins Blaue.«
Nichol hätte sich ohrfeigen mögen. Sie war die ganze Zeit über mit Gamache zusammen gewesen, und er hatte es bemerkt und sie nicht. Was sah er noch, was sie nicht sah? Verdammt. Sie warf Lemieux einen misstrauischen Blick zu. Er versuchte sich offensichtlich beim Chief Inspector einzuschmeicheln.
»Merci, Agent Lemieux«, sagte sie und hielt ihm die Hand hin, während der Chief Inspector mit ihr zugewandtem Rücken dastand und den armen Anglais musterte. Lemieux ergriff ihre Hand, wie sie gehofft hatte. »Au revoir.« Unsicher verharrte Lemieux einen Moment lang und sah abwechselnd auf sie und auf Gamaches breiten Rücken. Dann zuckte er die Achseln und ging weg.
Armand Gamache wandte seine Aufmerksamkeit von den Lebenden der Toten zu. Er ging ein paar Schritte und kniete sich neben der Leiche nieder, die ihn hierher geführt hatte.
Eine Haarsträhne war über Jane Neals offene Augen gefallen. Gamache hatte den Impuls, sie wegzustreichen. Das mochte eine alberne, sentimentale Anwandlung sein. Aber dann war er eben albern und sentimental. Was das anging, erlaubte er sich mittlerweile gewisse Freiheiten. Beauvoir dagegen war ein reiner Vernunftmensch, und das machte sie zu einem perfekten Team.
Gamache starrte Jane Neal schweigend an. Nichol räusperte sich, weil sie dachte, er könnte vergessen haben, wo er sich befand. Keine Reaktion. Nichts. Er und Jane standen in der Zeit still und starrten einander an, er von oben, sie von unten. Dann wanderte sein Blick über ihren Körper, zu der abgetragenen Mohair-Strickjacke, dem hellblauen Rollkragenpullover. Kein Schmuck. War sie ausgeraubt worden? Er musste Beauvoir danach fragen. Ihr Tweed-Rock saß genauso, wie man es vermutete, wenn jemand zu Boden gestürzt war. Ihre Strumpfhose war an einer Stelle gestopft, ansonsten heil. Sie mochte ausgeraubt worden sein, aber man hatte ihr keine Gewalt angetan. Außer dass sie umgebracht worden war, natürlich.
Seine dunkelbraunen Augen verweilten auf ihren mit Altersflecken übersäten Händen. Kräftige, braun gebrannte Hände, die von Gartenarbeit zeugten. Keine Ringe an den Fingern und auch keine blassen Stellen, die darauf hinwiesen, dass sie welche getragen hatte. Er empfand immer einen gewissen Schmerz, wenn er die Hände eines kürzlich Verstorbenen ansah und sich vorstellte, welche Dinge und Menschen diese Hände angefasst hatten. Das Essen, die Gesichter, die Türklinken. All die Gesten, mit denen sie Traurigkeit oder Freude ausgedrückt hatten. Und die letzte Geste, um den tödlichen Schlag abzuwehren. Am schlimmsten waren die Hände von jungen Menschen, die sich damit später niemals gedankenverloren eine Strähne ihres ergrauten Haars aus der Stirn streichen würden.
Er erhob sich mit Beauvoirs Hilfe und fragte: »Wurde sie ausgeraubt?«
»Vermutlich nicht. Mr. Hadley sagt, sie trug niemals Schmuck und hatte nur selten eine Handtasche bei sich. Er meint, wir fänden sie bei ihr zu Hause.«
»Hausschlüssel?«
»Nein. Kein Schlüssel. Aber auch dafür hat Mr. Hadley eine Erklärung, er sagt, dass die Leute hier in der Gegend ihre Häuser niemals abschließen.«
»Das werden sie von nun an wohl tun.« Gamache beugte sich über die Leiche und starrte auf die winzige Wunde, kaum groß genug, dass daraus das Leben aus einem Menschen entweichen konnte, sollte man meinen. Sie war nur wenig größer als die Spitze seines kleinen Fingers.
»Irgendeine Ahnung, was diese Wunde verursacht haben könnte?«
»Es ist Jagdsaison, vielleicht war es ein Gewehrschuss, obwohl ich noch nie eine solche Schusswunde gesehen habe.«
»Die Jagdsaison für Gewehrschützen fängt erst in zwei Wochen an, bislang sind nur Bogenschützen unterwegs«, sagte Nichol.
Die beiden Männer sahen sie an. Gamache nickte, und dann blickten alle drei auf die Wunde, so als könnten sie sie zum Sprechen bringen, wenn sie sich nur fest genug darauf konzentrierten.
»Und wo ist der Pfeil?«, fragte Beauvoir.
»Gibt es eine Austrittswunde?«
»Keine Ahnung«, sagte Beauvoir. »Die Gerichtsmedizinerin konnte die Leiche bislang noch nicht bewegen.«
»Sie soll mal herkommen«, sagte Gamache, und Beauvoir winkte einer jungen Frau in Jeans und Parka zu, die einen Arztkoffer bei sich trug.
»Monsieur L’Inspecteur«, sagte Dr. Sharon Harris, nickte ihm zu und kniete sich neben die Leiche. »Sie ist seit ungefähr fünf Stunden tot, vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist nur eine grobe Schätzung.« Dr. Harris rollte Jane herum. Am Rücken ihrer Strickjacke hing trockenes Laub. Ein würgendes Geräusch war zu vernehmen, und Nichol sah zu Ben Hadley, der ihnen seinen bebenden Rücken zugewandt hatte und sich übergab.
»Ja, da ist eine Austrittswunde.«
»Danke, Doktor. Sie gehört Ihnen. Gut, Beauvoir, kommen Sie mit, und Sie auch, Agent Nichol. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen.«
Nach all den Jahren, die Jean Guy Beauvoir nun schon mit Gamache zusammenarbeitete, nach all den Morden und Mordversuchen, erfasste ihn immer noch eine gewisse Erregung, wenn er diesen schlichten Satz hörte: »Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen.« Damit war die Jagd eröffnet. Er war der Anführer der Meute. Und Chief Inspector Gamache war der Jagdmeister.
»Ihr Name ist Jane Neal. Alter sechsundsiebzig. Unverheiratet. Diese Informationen haben wir von Mr. Hadley. Er sagt, sie sei genauso alt gewesen wie seine vor einem Monat verstorbene Mutter.«
»Interessant. Zwei alte Damen, die innerhalb eines Monats in einem so kleinen Dorf sterben. Das ist merkwürdig.«
»Ja, ich fand es auch merkwürdig, deshalb habe ich nachgefragt. Seine Mutter starb nach einem langen, schweren Krebsleiden. Es sei seit einem Jahr abzusehen gewesen.«
»Na gut. Weiter.«
»Mr. Hadley ging heute Morgen gegen acht im Wald spazieren, was er regelmäßig tut. Miss Neal lag auf dem Pfad. Praktisch nicht zu übersehen.«
»Was hat er getan?«
»Er sagt, er habe sie sofort erkannt. Er kniete sich hin und schüttelte sie. Er dachte, sie hätte einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten. Seinen Worten zufolge wollte er gerade mit der Mund-zu-Mund-Beatmung beginnen, als er die Wunde entdeckte.«
»Hat er denn nicht gemerkt, dass sie mit leerem Blick in die Luft starrte und eiskalt war?« Nichols Selbstvertrauen wuchs.
»Würden Sie es merken?«
»Natürlich. So etwas ist ja wohl kaum zu übersehen.«
»Es sei denn …« Gamache forderte sie gewissermaßen auf, Einwände gegen ihre eigene Behauptung zu formulieren. Dazu hatte sie jedoch keine Lust. Sie wollte recht haben. Und er glaubte offensichtlich, dass sie das nicht hatte.
»Es sei denn … es sei denn, ich stünde unter Schock, dann vielleicht nicht.« Sie musste zugeben, dass diese Möglichkeit bestand.
»Sehen Sie sich den Mann an. Es ist drei Stunden her, dass er sie gefunden hat, und ihm ist immer noch hundeelend. Er musste sich gerade übergeben. Diese Frau hat ihm etwas bedeutet«, sagte Gamache, während sein Blick auf Ben Hadley ruhte. »Vorausgesetzt, er macht uns nichts vor.«
»Wie meinen Sie das, Sir?«
»Nun, es ist ja wohl nicht schwer, sich einen Finger in den Hals zu stecken und sich zu übergeben. Macht immer Eindruck.« Gamache wandte sich an Beauvoir. »Weiß sonst noch jemand von Jane Neals Tod?«
»Da waren ein paar Dorfbewohner auf der Straße, Sir«, sagte Nichol. Gamache und Beauvoir sahen sie an. Sie hatte es schon wieder getan, stellte sie fest. Statt Eindruck zu schinden und ihren Fehler wiedergutzumachen, hatte sie das Gegenteil erreicht. Sie hatte eine Frage beantwortet, die nicht an sie gerichtet war, einen Vorgesetzten unterbrochen, um ihm eine Beobachtung mitzuteilen, die von einer Dreijährigen hätte stammen können. Inspector Gamache hatte diese Leute ebenso gesehen wie sie. Verdammt! Nichol überlief eine Gänsehaut, als ihr bewusst wurde, dass sie mit ihrem Verhalten genau das Gegenteil von dem bewirkte, was sie beabsichtigte: ihre Intelligenz unter Beweis zu stellen. Sie machte sich nur zur Idiotin.
»Entschuldigung, Sir.«
»Inspector Beauvoir?«
»Ich habe den Tatort abgeriegelt.« Er wandte sich an Nichol. »Also keine Außenstehenden und keine Gespräche über das Verbrechen außerhalb der Absperrung.« Nichol lief dunkelrot an. Dass er meinte, ihr das erklären zu müssen, machte sie wütend. Noch viel wütender machte es sie jedoch, dass sie diese Erklärung tatsächlich nötig hatte.
»Aber –« Beauvoir zuckte mit den Schultern.
»Es ist wohl an der Zeit, ein paar Worte mit Mr. Hadley zu wechseln«, sagte Gamache und ging gemessenen Schritts auf ihn zu.
Ben Hadley hatte sie beobachtet, und es war ihm sofort klar gewesen, dass der Boss eingetroffen war.
»Mr. Hadley, ich bin Chief Inspector Armand Gamache von der Sûreté du Québec.«
Ben hatte einen frankofonen Kriminalbeamten erwartet, der möglicherweise ausschließlich Französisch sprach, daher hatte er die letzten paar Minuten damit verbracht, Französisch zu üben und sich die Worte zurechtzulegen, mit denen er das Geschehen beschreiben konnte. Doch nun sah ihn dieser distinguiert aussehende Mann im tadellos geschnittenen Dreiteiler (war das darüber tatsächlich ein Burberry?) mit Tweed-Kappe über den ergrauenden, kurz geschnittenen Haaren und einem sorgfältig gestutzten Schnurrbart über den Rand seiner Brille an, streckte ihm seine große Hand entgegen, als sei dies ein Geschäftstreffen, und sprach Englisch mit britischem Akzent. Aber er hatte Bruchstücke des Gesprächs mit seinen Kollegen mitbekommen, und das hatte definitiv in schnellem und flüssigem Französisch stattgefunden. In Québec war es keineswegs ungewöhnlich, dass die Leute zwei Sprachen sprachen, ja, sie sogar perfekt beherrschten. Es war allerdings ungewöhnlich, einem Frankofonen zu begegnen, der wie ein Mitglied des britischen Oberhauses sprach.
»Das sind Inspector Jean Guy Beauvoir und Agent Yvette Nichol.« Sie schüttelten sich die Hände, wenn auch Nichol ein wenig misstrauisch, da sie sich nicht ganz sicher war, womit er sich den Mund abgewischt hatte, nachdem er sich übergeben hatte.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen.« Gamache deutete auf den Pfad durch den Wald. »Ein Stück weg von hier.«
»Danke«, sagte Ben, und er war tatsächlich dankbar.
»Mein Beileid zum Tod von Miss Neal. War sie eine enge Freundin von Ihnen?«
»Sehr eng. Sie war schon meine Lehrerin in der Schule.«
Gamache hielt seinen Blick ruhig auf Bens Gesicht gerichtet, beobachtete ihn aufmerksam und hörte ihm zu, ohne zu urteilen oder anzuklagen. Ben merkte, dass er sich das erste Mal seit Stunden entspannte. Gamache sagte nichts, wartete einfach, bis Ben fortfuhr.
»Sie war eine wunderbare Frau. Ich wünschte, ich fände die richtigen Worte, um sie zu beschreiben.« Ben drehte den Kopf zur Seite, er schämte sich der Tränen, die ihm erneut in die Augen stiegen. Er ballte die Hände zu Fäusten und spürte den erwünschten Schmerz, als sich seine Fingernägel in seine Handballen gruben. Diesen Schmerz begriff er. Der andere war jenseits seines Fassungsvermögens. Seltsamerweise war er um vieles größer als der, den er beim Tod seiner Mutter verspürt hatte. Er riss sich zusammen: »Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Jane ist keines natürlichen Todes gestorben, oder?«
»Nein, Mr. Hadley, das ist sie nicht.«
»Jemand hat sie getötet?«
»Erzählen Sie uns bitte von heute Morgen.«
Sie waren immer langsamer gegangen und blieben jetzt ganz stehen.
»Ich fand Jane, wie sie –«
Gamache unterbrach ihn. »Von dem Zeitpunkt an, als Sie aufstanden, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Ben hob eine Augenbraue, tat aber, worum er gebeten wurde.
»Ich bin so gegen sieben Uhr aufgewacht. Ich stehe immer bei Sonnenaufgang auf. Die Sonne scheint direkt in mein Schlafzimmer, ich habe es nie für nötig befunden, mir Vorhänge zuzulegen. Ich stand also auf, duschte und rasierte mich und dann fütterte ich Daisy.« Er sah sie fragend an, wartete auf ein Zeichen, ob er zu ausführlich oder zu knapp in seinem Bericht war. Die Frau machte einen unsicheren Eindruck, genau wie er sich fühlte. Der große, gut aussehende Inspector (Ben hatte die Namen bereits wieder vergessen) schrieb alles mit. Und der Chef blickte ihn interessiert und aufmunternd an. »Dann gingen wir nach draußen, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen, aber sie leidet unter Arthritis, und heute Morgen ging es ihr besonders schlecht. Daisy ist übrigens mein Hund. Jedenfalls habe ich sie wieder ins Haus gelassen und bin allein losgegangen. Da war es Viertel vor acht.« Ben ging richtigerweise davon aus, dass sie die präzisen Uhrzeiten interessierten. »Man braucht nur ein paar Minuten bis hierher, die Straße hoch, an der Schule vorbei und dann ist man schon im Wald.«
»Sind Sie auf dem Weg irgendjemandem begegnet?«
»Nein. Es ist möglich, dass mich jemand gesehen hat, aber ich habe niemanden bemerkt. Ich laufe allerdings immer völlig gedankenverloren und mit gesenktem Kopf durch die Gegend. Ich bin sogar schon an Leuten vorbeigegangen, ohne sie zu sehen. Meine Freunde wissen das und sind auch nicht beleidigt, wenn ich sie nicht grüße. Ich ging also den Pfad entlang, bis mich plötzlich etwas veranlasste aufzublicken.«
»Versuchen Sie sich bitte zu erinnern, Mr. Hadley. Wenn Sie normalerweise immer mit gesenktem Kopf gehen, warum haben Sie ihn dann in diesem Moment gehoben?«
»Seltsam, nicht wahr? Aber ich erinnere mich nicht. Leider bin ich, wie gesagt, meistens in Gedanken versunken. Nicht etwa tiefe oder bedeutende Gedanken. Meine Mutter hat mich oft ausgelacht und gesagt, manche Leute würden immerzu versuchen, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Ich sei allerdings im Allgemeinen an keinem.« Ben lachte, aber Nichol dachte bei sich, dass das eine schreckliche Bemerkung von einer Mutter war.
»Sie hatte natürlich recht. Nehmen Sie einen Tag wie heute. Strahlender Sonnenschein. Ich gehe durch diesen prachtvollen Wald. Ein schöneres Bild kann man sich nicht vorstellen, aber ich bemerke es nicht einmal und genieße es nicht, höchstens später, wenn ich schon wieder woanders bin und an diesen Spaziergang zurückdenke. Es ist, als befände sich mein Geist ständig einen Schritt hinter meinem Körper.«
»Sie blickten also auf, Sir«, erinnerte ihn Beauvoir.
»Ich weiß wirklich nicht, was mich dazu veranlasste, aber ich habe es glücklicherweise getan. Sonst wäre ich vielleicht noch über sie gestolpert. Merkwürdig, mir kam überhaupt nicht in den Sinn, dass sie tot sein könnte. Ich hatte Angst, sie zu stören. Ich schlich mich sozusagen auf Zehenspitzen heran und rief ihren Namen. Dann fiel mir auf, dass sie vollkommen still dalag. Ich konnte überhaupt keinen klaren Gedanken fassen. Ich dachte, dass sie vielleicht einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt gehabt hat.« Er schüttelte noch immer fassungslos den Kopf.
»Haben Sie die Wunde berührt?«, fragte Beauvoir.
»Könnte sein. Ich erinnere mich nur noch, dass ich aufgesprungen bin und mir die Hände an der Hose abgewischt habe. Ich geriet in Panik und lief wie, na ja, wie ein hysterisches Kind immerzu im Kreis herum. Idiotisch! Dann habe ich versucht, mich am Riemen zu reißen, und rief über mein Handy den Notruf an.«
»Aus reiner Neugier«, warf Gamache ein, »warum haben Sie ein Handy auf Ihren Waldspaziergang mitgenommen?«
»Dieser Wald befindet sich im Besitz meiner Familie, und im Herbst dringen hier regelmäßig widerrechtlich Jäger ein. Ich bin zwar leider kein besonders mutiger Mann, aber ich ertrage es nicht, wenn ein Lebewesen getötet wird. Egal welches. Einige der Spinnen in meinem Haus tragen Namen. Wenn ich morgens zu einem Spaziergang aufbreche, stecke ich immer mein Handy ein. Zum einen, weil ich Angst habe, dass mich irgendein betrunkener Jäger anschießen könnte und ich vielleicht nach Hilfe rufen muss, aber auch, um im Forstamt anzurufen, damit sie einen ihrer Leute herschicken, wenn ich einen Wilderer entdecke.«
»Und wie lautet die Nummer?«, fragte Chief Inspector Gamache höflich.
»Keine Ahnung. Ich habe sie vorsichtshalber gespeichert. Sie müssen wissen, dass meine Hände zu zittern beginnen, sobald ich nervös werde.« Ben sah zum ersten Mal besorgt aus, und Inspector Gamache nahm ihn am Arm und führte ihn weiter den Weg entlang.
»Wir sind leider zu dieser Befragung gezwungen. Sie sind ein wichtiger Zeuge und, offen gestanden, steht derjenige, der die Leiche findet, immer recht weit oben auf der Liste unserer Verdächtigen.«
Ben blieb abrupt stehen und starrte den Inspector ungläubig an.
»Verdächtig? Was reden Sie denn da?« Er drehte sich um und blickte in die Richtung, aus der sie gekommen waren, dorthin, wo der Leichnam lag. »Dort hinten, das ist Jane Neal. Eine pensionierte Lehrerin, die Rosen züchtete und Vorsitzende des Vereins anglikanischer Frauen war. Es kann nur ein Unfall gewesen sein. Ich glaube, Sie haben das nicht richtig verstanden. Kein Mensch würde sie mit Absicht umbringen.«
Nichol hatte den Wortwechsel genau mitverfolgt und wartete nun darauf, dass Chief Inspector Gamache etwas sagte, das den dummen Kerl eines Besseren belehrte.
»Sie haben vollkommen recht, Mr. Hadley. Das ist die bei Weitem wahrscheinlichste Erklärung.«
Yvette Nichol traute ihren Ohren nicht. Warum stieß er Hadley nicht klar und deutlich Bescheid, damit sie endlich ihren Job machen konnten? Schließlich war er so blöd gewesen, den Leichnam anzufassen und dann herumzurennen und die ganzen Spuren zu verwischen. Es stand ihm wohl kaum zu, einem so überlegenen und respektablen Mann wie Gamache einen Vortrag zu halten.
»Haben Sie in der Zeit, die Sie sich hier aufhielten, etwas bemerkt, das Ihnen an der Umgebung oder an Miss Neal seltsam erschien?«
Gamache stellte beeindruckt fest, dass Ben nicht das Nächstliegende sagte. Stattdessen dachte er kurz nach.
»Ja. Lucy, ihr Hund. Ich erinnere mich nicht, dass Jane jemals ohne Lucy spazieren gegangen ist, noch dazu am Morgen.«
»Haben Sie sonst noch jemanden mit Ihrem Handy angerufen?«
Ben sah aus, als hätte man ihn auf eine vollkommen neue und brillante Idee gebracht.
»Oh, was bin ich doch für ein Idiot! Ich fasse es nicht. Es war mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, Peter oder Clara oder sonst jemanden anzurufen. Ich stand hier im Wald, ohne eine Menschenseele, wollte Jane nicht allein lassen und musste andererseits der Polizei den Weg zeigen. Aber es ist mir nicht eingefallen, einen meiner Freunde zu Hilfe zu rufen. Gott, das muss der Schock gewesen sein.«
Oder du bist tatsächlich ein Idiot, dachte Nichol. Ein nutzloserer Mensch als Ben Hadley ließ sich wohl kaum finden.
»Wer sind Peter und Clara?«, fragte Beauvoir.
»Peter und Clara Morrow. Meine besten Freunde. Sie sind die unmittelbaren Nachbarn von Jane. Jane und Clara waren wie Mutter und Tochter. Oh, die arme Clara. Glauben Sie, die beiden haben es schon erfahren?«
»Nun, das werden wir bald wissen«, sagte Gamache und ging plötzlich in raschem Tempo den Pfad zurück zum Fundort der Leiche. Dort angekommen, wandte er sich an Beauvoir.
»Inspector, Sie übernehmen das hier. Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Agent Nichol, Sie bleiben bei Inspector Beauvoir und unterstützen ihn. Wie spät ist es?«
»Elf Uhr dreißig, Sir«, sagte Nichol.
»Gut. Mr. Hadley, gibt es im Dorf ein Restaurant oder ein Café?«
»Ja, Oliviers Bistro.«
Gamache wandte sich erneut an Beauvoir. »Das Team soll um halb zwei ins Bistro kommen. Dann ist der Mittagsansturm vorbei, und wir sollten das Lokal fast für uns haben. Was meinen Sie, Mr. Hadley?«
»Schwer zu sagen. Es ist möglich, dass sich das ganze Dorf dort versammelt, wenn die Leute von Janes Tod erfahren. Das Bistro ist so etwas wie die Nachrichtenbörse von Three Pines. Aber es hat ein Hinterzimmer, das normalerweise nur abends geöffnet ist. Es geht auf den Fluss hinaus. Olivier stellt es Ihnen und Ihren Leuten bestimmt zur Verfügung.«
Gamache sah Ben interessiert an. »Das ist eine gute Idee. Inspector Beauvoir, ich werde bei Monsieur Olivier vorbeischauen und –«
»Er heißt Olivier Brulé«, unterbrach ihn Ben. »Er und sein Partner Gabriel Dubeau betreiben das Bistro und die einzige Pension im Ort.«
»Ich erkundige mich, ob wir zum Mittagessen einen Raum für uns haben können. Darf ich Sie ins Dorf begleiten, Mr. Hadley? Ich war noch nicht dort.«
»Ja, selbstverständlich.« Beinahe hätte Ben noch hinzugefügt: »Es ist mir ein Vergnügen«, aber er verkniff es sich. Dieser überaus höfliche Polizeibeamte forderte geradezu zu einer gewissen Förmlichkeit heraus. Sie mussten zwar ungefähr im gleichen Alter sein, aber Ben hatte das Gefühl, mit seinem Großvater zu sprechen.
»Dort drüben steht Peter Morrow.« Ben deutete auf die Menge, die sich, einer geheimen Choreografie folgend, in ihre Richtung gewandt hatte, als sie sich ihr näherten. Er zeigte auf den großen, besorgt aussehenden Mann, der Gamache zuvor angesprochen hatte.
»Ich werde Ihnen alles mitteilen, was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann«, wandte sich Gamache an die etwa dreißig Dorfbewohner. Er sah, dass sich Ben zu Peter Morrow gesellte.
»Der Name der toten Frau lautet Jane Neal.« Gamache wusste, dass es falsche Rücksichtnahme gewesen wäre, einen Schlag wie diesen abmildern zu wollen. Ein paar der Leute fingen an zu weinen, andere schlugen sich die Hand vor den Mund, so als wollten sie eine Wunde bedecken. Die meisten ließen den Kopf hängen, als wäre die Nachricht kaum zu ertragen. Peter Morrow starrte zuerst Gamache an, dann Ben.
Gamache nahm das alles wahr. Mr. Morrow zeigte keine Überraschung. Und keine Trauer. Besorgnis, ja. Betroffenheit, zweifellos. Aber Traurigkeit?
»Was ist passiert?«, fragte jemand.
»Das wissen wir noch nicht. Jedenfalls starb sie keines natürlichen Todes.«
Die Leute stöhnten unwillkürlich auf. Bis auf Peter Morrow.
»Wo ist Clara?« Ben sah sich um. Es war ungewöhnlich, einen der Morrows ohne den anderen zu sehen.
Peter deutete mit dem Kopf in Richtung Dorf. »St. Thomas.«
Die drei Männer fanden Clara in der Kapelle. Sie saß allein da, mit geschlossenen Augen und gesenktem Kopf. Peter stand in der offenen Tür und sah auf ihren gebeugten Rücken. Es sah aus, als ob sie sich vor dem Schlag, der sie treffen würde, schützen wollte. Leise ging er zwischen den Bankreihen entlang, wobei er meinte, über seinem Körper zu schweben und sich selbst von dort oben zu beobachten.
Der Pfarrer hatte einige Zeit zuvor die Nachricht bekannt gegeben, dass im Wald hinter dem Schulhaus die Polizei zugange sei. Die Unruhe nahm während des Erntedank-Gottesdienstes immer mehr zu. Schon bald hatte sich in der winzigen Kirche das Gerücht von einem Jagdunfall wie ein bösartiger Virus verbreitet. Eine Frau. Verletzt? Nein, tot. Keine Ahnung, wer. Furchtbar. Furchtbar. Und ganz tief in ihrem Innern wusste Clara, wie furchtbar es tatsächlich war. Jedes Mal, wenn sich die Kirchentür öffnete und Sonnenlicht hereinfiel, betete sie, dass Jane auftauchen möge, verspätet, aufgeregt, verlegen. »Ich habe verschlafen. Wie dumm von mir. Lucy, die Arme, hat mich mit ihrem Bellen geweckt, weil sie hinauswollte. Es tut mir wirklich leid.« Der Pfarrer sprach einfach immer weiter, entweder weil er von dem sich anbahnenden Drama nichts mitbekam oder weil er ratlos war.
Die Sonne schien durch die Kirchenfenster, auf die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg gemalt waren, und warf blaue, dunkelrote und gelbe Flecken auf den Kiefernboden und die Eichenbänke. In der Kapelle roch es so wie in jeder kleinen Kirche, die Clara kannte. Nach Heilsversprechen und Holz und verstaubten alten Büchern. Als sich die Leute erhoben, um den nächsten Choral zu singen, drehte sich Clara zu Peter.
»Könntest du nachsehen, was da los ist?«
Peter nahm Claras Hand und stellte überrascht fest, dass sie eiskalt war. Er rieb sie einen Moment lang zwischen seinen Fingern.
»Natürlich. Es ist sicher alles in Ordnung. Sieh mich an«, sagte er, um sie davon abzuhalten, sich in den schlimmsten Vermutungen zu ergehen.
»Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«, sang der Chor.
Clara blinzelte. »Es ist alles in Ordnung?«
»Ja.«
»Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret.«
Das war vor einer Stunde gewesen, und inzwischen waren alle gegangen, auch der Pfarrer, der für den Erntedank-Gottesdienst in Cleghorn Halt ohnehin schon etwas spät dran war. Clara hörte, wie sich die Tür öffnete, sah, wie das helle Viereck im Mittelgang immer länger wurde und ein Schatten darin erschien, vertraut, selbst in der Verzerrung.
Peter zögerte kurz, dann schritt er langsam auf ihre Bank zu.
Da wusste sie es.