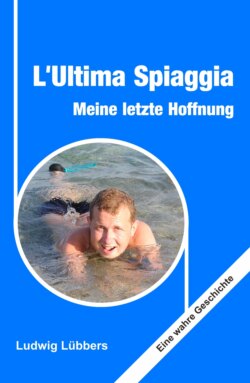Читать книгу L'Ultima Spiaggia - Meine letzte Hoffnung - Ludwig Lübbers - Страница 5
ОглавлениеKapitel 1
12. November 2012.
Ist es der Beginn oder ist es das Ende meines Lebens? Wie wird es werden? Werde ich sterben oder werde ich weiterleben? Meine Gedanken sind mit solchen Fragen übersät. Diagnose: Haarzellleukämie.
Ungläubig schaute ich meiner behandelnden Ärztin in die Augen. Blutkrebs? Wie konnte das sein? Ich war doch erst zweiundvierzig und zu jung, um zu sterben. Die Endlichkeit meines Lebens wurde mir in einer Millisekunde vorgeführt. Ich hatte einen Feind in mir, der mich besiegen wollte, und ich sollte als Verlierer vom Platz gehen. Ich würde ab jetzt langsam von den bösen Zellen eingenebelt und aus der Sichtweite der Gesellschaft verschwinden. Solche Gedanken würden mich nun die restliche Zeit meines Lebens beschäftigen. Ich hatte es mit einem Feind zu tun, der mir unbekannt war.
In meinem jetzigen Leben konnte ich alle Dinge selbstbestimmt regeln. Selbstbestimmung ist eines der größten Ziele, die ich immer zu erreichen und zu verwirklichen versucht habe. Selbstbestimmung ist das größte Gut, denn es bedeutet für mich ein Höchstmaß an Freiheit und Lebensqualität. Jedoch bedeutet Freiheit für mich auch, nicht nur seinem egoistischen Antrieb zu verfolgen. Gleichzeitig ist es ein Gut, welches ich gerne mit anderen teilen möchte. Denn nur so kann Freiheit auch einen Sinn haben, indem man sich auch anderen öffnet. Doch Haarzellleukämie und Selbstbestimmung – wie sollte das gehen? Würde ich dieses Mal gewinnen oder verlieren? Wie lange würde ich noch haben, um meine Selbstbestimmung und die damit einhergehende Freiheit ausleben zu können? Was war überhaupt Haarzellleukämie? Diese Erkrankung war mir bisher nicht bekannt. Ich kenne mich in vielen Dingen aus: Wie man versucht, seine Freiheit und Lebensqualität selbst zu bestimmen. Wie man sich Lebensqualität erarbeitet. Wie man seine Lebensqualität steigern kann. Wie man erfolgreich ist. Ginge das auch mit Haarzellleukämie?
Man hatte die Haarzellen in mir bei einer Knochenmarkspunktion festgestellt. Wie konnte ich über die Erkrankung eine Selbstbestimmung und damit auch neuen Lebenswillen erlangen? War dies möglich? Ich brauchte also zunächst einmal reichlich Informationen. Dieses war für mich nichts Neues, denn durch Informationen konnte ich in der Vergangenheit immer an Lebensqualität gewinnen. Informationsvorsprünge und eine gewisse Neugier auf das Leben zu haben sowie den Mitmenschen offen zu begegnen, das waren bisher die Erfolgsrezepte und Stärken, die mein Leben prägten.
Also wurde ich wieder zum Jäger – zum Jäger nach Informationen über diese Erkrankung. Mit welchem Feind hatte ich es zu tun? Und wie hatte ich ihn zu analysieren?
Haarzellleukämie ist eine Blutkrebserkrankung, eine sehr seltene, bei der sich die sogenannten Haarzellen langsam und stetig im Körper vermehren und sich in der Milz ablagern. Ich spürte die Ansammlung der Haarzellen in Form einer Anschwellung meiner Milz, sodass die Diagnose der Ärzte im Uniklinikum wohl zutreffend war.
Die Haarzellleukämie ist wissenschaftlich bisher sehr wenig untersucht und man weiß derzeit nicht viel darüber. Die Haarzellen sollten also nun bestimmen, was in meinem Blut, in meinem Körper und auch in meiner Seele geschah. Haarzellen führen dazu, dass das Immunsystem weiter geschwächt wird und dass die Kondition durch einen Abfall der Hb-Werte immer weiter nachlässt. Ein Prozess von drei bis fünf Jahren. Danach käme der Exitus und die Selbstbestimmung hätte ein Ende. Doch ich wollte selbstbestimmt überleben!
Also surfte ich weiter. Dem Internetzeitalter sei Dank. Es gab „Brotkrümel“, die ich auflesen konnte. Haarzellleukämie bekommen nur vier Männer von einer Million Menschen und nur eine Frau von einer Million. Der Feind war also äußerst selten und keine Massenware, für die man in der Apotheke einfach ein Medikament kaufen konnte. Kein Husten, keine Erkältung, nein, es war Blutkrebs. Wie ging es weiter? Ich suchte in den entlegensten Regionen des Internets nach weiteren „Krümeln“. Ich versuchte, meine akademischen und analytischen Fähigkeiten zu bündeln, auf der Spur nach sämtlichen Informationen, die ein längeres Weiterleben ermöglichen könnten. Ich versuchte, das Internet auszuwringen wie einen nassen Waschlappen. Was konnte man gegen diese Haarzellleukämie tun? Nach der Diagnose in der Klinik hatten mir die Ärzte gesagt, dass man mit einer Chemotherapie warten könne. Man würde nach einer „Watch-and-Wait-Strategie“ verfahren. Das hieß, alle vier Wochen würde man das Blutbild überprüfen und erst handeln, wenn die Blutwerte bestimmte Grenzwerte unterschritten hätten. Also hatte ich augenblicklich noch Zeit. Physikalisch gesehen. Aber irgendwie begann die Uhr zu ticken und etwas passierte in meinem Kopf. Dort stand auf einmal eine große Unbekannte. Chemotherapie – ein Gedanke, mit dem ich mich gar nicht anfreunden wollte, andererseits hatte ich ja noch Zeit, relativ betrachtet.
Wie sollte ich diese Zeit nutzen? So tun, als ob gar nichts wäre? Einfach so weiter meinem Lebenstrott nachgehen und weiterhin alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann? Spaß am Leben haben? Nein, so war es nicht. Ich wollte weiter funktionieren, meiner Arbeit nachgehen und meine Freundschaften pflegen. So normal wie möglich alle Dinge des alltäglichen Lebens erledigen und niemanden merken lassen, dass irgendetwas Besonderes mit mir geschehen war. Wie sollte aber meine weitere Lebensplanung aussehen, wenn mir das Wasser schon fast bis zum Halse stand?
Haarzellleukämie bestimmte ab sofort meine Gedanken. Zum ersten Mal hatte ich eine Erkrankung, die man nicht unmittelbar sieht. Etwas, das für mich völlig neu war. Sollte ich diese Nachricht meinen Freunden mitteilen oder sollte ich so tun, als sei gar nichts geschehen? Für mein Umfeld war ich nach meinem Empfinden schon immer etwas Besonderes gewesen. Aufgeschlossen, offen für Neues und lebensfroh. Dieses waren Eigenschaften, die mich von jeher in ein besonderes Licht gestellt hatten. Menschen sahen mich vielleicht immer schon mit anderen Augen, ohne dass es mich in irgendeiner Form gestört hatte. Vielleicht konnte man auch von einer Art Sympathie sprechen, die ich als offener, hilfsbereiter und zugänglicher Mensch ausstrahlte. Würde die Nachricht der Leukämie etwas verändern? Konnte Neutralität im Umgang mit dieser Erkrankung zunächst der bessere Weg sein?
Zum Glück hatte ich eine Krebserkrankung, die jetzt wissentlich nicht auf einem Gendefekt basierte und nicht zu weiteren, anderen mutierten Krebsarten führte. Die Kollateralschäden waren also ein wenig überschaubarer, wenn man nur an Blutkrebs erkrankt war. Irgendwie hatte ich es ja nur mit einem Feind im Körper zu tun, den es zu besiegen galt. Würde ich psychisch so stark sein, wenn es im Leben nur noch diese eine Richtung gab? Oder würde meine Psyche in der Lage sein, abermals Kurven zu schlagen, um einen anderen Weg, vielleicht einen lebenserhaltenden Umweg, zu nehmen? Würde ich jemanden an meiner Seite haben, der mir mit Leidenschaft und Hingabe in den letzten Wochen, Tagen, Stunden und Minuten meines Lebens zur Seite stehen würde; genauso, wie ich es schon bei einer im Sterben liegenden guten Freundin von mir gemacht hatte?
In meinem Fall bestand derzeit zum Glück kein akuter Handlungszwang. Ich hätte wahrscheinlich noch rund ein bis zwei Jahre Zeit, bis die erste Chemotherapie beginnen würde. Eigentlich war das, zumindest im Moment, eine sehr luxuriöse Ausgangssituation, in der ich mich befand. Welche Strategie wäre jetzt die beste für mich? Sich zu öffnen oder in dieser Angelegenheit eher verschlossen zu bleiben, um ein normales Leben weiterführen zu können? Wie konnte ich mich dem Einfluss der Krankheit entziehen? Aber es gab kein Entziehen, es war ja keine Droge, an der ich erkrankt war, sondern der schleichende Exitus, der mich begleitete. Bedeutete Haarzellleukämie überhaupt das Todesurteil? Ich fand eine Selbsthilfegruppe, der Haarzell-Leukämie-Hilfe e. V. (HLH),
Doch ich merkte, dass die Lust, mich mit dieser Krankheit zu beschäftigen, erstaunlicherweise irgendwie immer weiter erlahmte. Also ließ ich die Recherche zunächst einmal ruhen und versuchte zu verdrängen, dass mich der Krankheitsverlauf irgendwann einholen würde. Nur so viel: Die Krankheit würde mich mein Leben lang begleiten und war nicht heilbar, jedoch gab es verschiedene Therapiemethoden.
Also bemühte ich mich, zu funktionieren, wie ich es immer tat. Also: verdrängen statt aktiv angehen. Es standen ja nach wie vor wichtige Aufgaben an, die ich bewältigen wollte. Aufgaben zu haben, dies war ein wichtiger Aspekt, der mir die Verdrängung ermöglichte. Dem Leben weiterhin ins Auge schauen zu können und etwas zu bewirken, lenkte mich ab. Es ging also darum, gedankliche Handlungsalternativen zu finden. Ich arbeitete in dieser Zeit seit über zehn Jahren als Gymnasiallehrer für die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium in Münster. Die Bewerbung für eine Beförderung an der Schule stand an. Sollte ich mich überhaupt noch bewerben und die Strapazen auf mich nehmen? Der Tod könnte ja bald vor der Haustür stehen – würde sich dann der Aufwand noch lohnen?
Die „Watch-and-Wait-Strategie“ würde es schon richten. Ich versuchte, so weiter zu machen, wie ich es immer getan hatte. Ich ging zur Schule, fuhr in den Urlaub, ging schwimmen und traf mich mit meinen Freunden. Meinen besten Freunden berichtete ich von meiner Erkrankung. Was sollte ich auch anderes tun? Ich lebte allein, war wie viele in meiner Stadt Single und hatte irgendwie auch ein Mitteilungsbedürfnis, mich jemanden anzuvertrauen. Ich lebte schon seit mehreren Jahren allein. Diese Lebensform hatte in vielen Bereichen ihre Vorteile, doch ich lernte auch schnell ihre Schattenseiten kennen.
In den letzten Jahren hatte ich vergeblich nach einer Partnerin gesucht und hätte in meiner jetzigen Lebenssituation, in der der Krebs mein Denken und Handeln beherrschte, gerne jemanden an meiner Seite gehabt. Ich ging in dieser Zeit sehr häufig aus und versteckte mich nicht. Ich stellte mich der Gesellschaft immer wieder und machte mich sichtbar und berührbar. Ich suchte jemanden, dem ich mich anvertrauen konnte, jemanden, der sich mit mir beschäftigte und sich für mein Überleben einsetzte, also eigentlich jemanden zum Lieben. Ich wollte die Wärme und Geborgenheit spüren, die mir den Abschied von dieser Welt erleichtern würden. Dieser Wunsch wurde mir aber nicht erfüllt und ich musste nach anderen Wegen suchen, diese Gefühlslücke zu schließen.
In Abständen von vier Wochen fanden nun die Blutkontrollen statt. Man konnte nun also den stetigen Zerfall meiner guten Zellen beobachten, doch erledigte ich diese Prozedur wie in einem Automatismus. Ich versuchte zu verdrängen, was da wohl vor mir stehen würde, und richtete den Blick auf den Alltag. Doch ich merkte schnell, wie sich diese Untersuchungen mit Bleistücken an mich hängten. Bleistücke, die versuchten, meine Psyche in die Tiefe zu ziehen. Hatte ich noch die Kraft, mich dagegen zu wehren? Von Untersuchungszyklus zu Untersuchungszyklus schienen auch die Bleistücke mehr zu werden. Die Kraft in mir, von der ich immer so viel gehabt hatte, schien immer mehr zu verschwinden. Zum ersten Mal in meinem Leben traten Gedanken auf, das Leben vorzeitig zu beenden. Diese Stimmung hatte ich noch nie gespürt. Ich fing an, vor etwas zu kapitulieren und die Kontrolle zu verlieren. Die klaren farbigen Gedanken, die mein Bewusstsein immer geprägt hatten, wichen grauen und trüben Chaosfäden. Alles wurde verschwommener und das Ziel, glücklich zu sein, wich einer sich langsam einschleichenden Traurigkeit. Und so änderte sich auf einmal das Blatt. Der Akku schien leerer und leerer zu werden und das Leben pulsierte in stetig kleiner werdenden Amplituden, gleichgültiger. Ärzte würden wohl sagen, dass ich depressiv war. Ich verlor immer mehr den Halt, denn dieser Lebensumstand überforderte mich. Mein ganzes Leben war komplexer als das von anderen gewesen, jedoch hatte ich bisher Strategien entwickelt, die mir geholfen hatten, meine Selbstbestimmung voranzutreiben. Der Gedanke, mich zeitnah einer Chemotherapie unterziehen zu müssen, widerstrebte mir sehr. Jede Blutkontrolle jedoch zeigte, dass eine Behandlung unwiderruflich vor mir stand.
Nach der letzten Blutbildkontrolle in der Uniklinik im Winter 2014 stand fest, dass eine Chemotherapie in naher Zukunft durchgeführt werden müsste. Es ging also jetzt nicht mehr um Monate, sondern um Wochen. Es gab nun kein Entrinnen mehr, sich dieser Prozedur zu unterziehen. Dieser Prozedur mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Ich war nun zum Handeln gezwungen und konnte nicht mehr so tun, als sei nichts geschehen. Ich brauchte nun mehr Informationen und konkrete Hilfen und erinnerte mich an den Haarzellleukämie-Selbsthilfeverband. Wie sollte die Chemotherapie durchgeführt werden, mit welchem Präparat, mit welcher Behandlungsabfolge – Port oder kein Port, um die Blutentnahme oder Medikamentengabe zu erleichtern? Könnte ein Port meine persönliche Lebensgestaltung beeinflussen? Blutentnahmen waren bei mir immer wie ein Lotteriespiel. Es gab nur wenige und schlechte Venen. Ein Port könnte in dieser Hinsicht mehr Zuverlässigkeit bringen. Aber ein Port könnte mich vielleicht auch daran hindern, alltägliche Dinge zu tun, mich einschränken, mich daran hindern, frei zu sein. Und auch hier bestand ein Infektionsrisiko. Die Selbstbestimmung und die damit einhergehenden Freiheiten waren für mich immer die wichtigsten Lebensgrundlagen, die ich bis heute hatte und die es zu verteidigen galt. Frei entscheiden zu können, wann ich esse, wann ich schreibe, wann ich Freunde besuche oder wann ich aufstehe. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen, akzeptiert zu werden und gleichwertig zu sein – eines der größten Ziele, die ich schon in meinem ganzen bisherigen Leben verfolgt hatte. Konnte ein Port eine Gefährdung darstellen?
Ich ging also zu mehreren Ärzten und wollte wissen, ob meine Bedenken berechtigt waren. Wie immer im Leben eine PattSituation: Zwei Ärzte meinten, sie wüssten es nicht und zwei Ärzte sahen so gut wie kein Risiko. Es kam also wieder auf mich selber an. Ich musste entscheiden, was mit mir geschehen sollte, ich wollte es nicht in die Hände von Dritten geben, aber dies war nichts Neues für mich. Ich musste wieder wichtige Entscheidungen treffen. Entscheidungen über Leben oder Tod? Oder Abhängigkeit oder Unabhängigkeit? Wollte ich das Risiko eingehen und eventuell meine Selbstbestimmung verlieren? Diese Gedanken dominierten mich. Lieber würde ich vorher sterben, als meine Entscheidungsfreiheiten zu verlieren. Und damit war die Entscheidung ziemlich schnell gefallen: gegen einen Port.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, mit dieser Entscheidung dieser Erkrankung meinen Stempel aufzudrücken. Es existierten somit auch Regeln, die ich eigenständig aufstellen konnte, um einen persönlichen Umgang mit dieser Haarzellleukämie zu erzielen. Und es war mir auch ein wichtiges Anliegen, bei den anstehenden Behandlungen noch selbst ein Wort mitreden zu können. Irgendwie war das auch ein Erfolg, den ich für mich verbuchen konnte.
Im Januar 2014 war es nun an der Zeit, meiner Chefin in der Schule reinen Wein einzuschenken. Die Kollegen und Kolleginnen sahen mir an, dass etwas nicht stimmte. Ich war blass und müde und spürte, dass eine Behandlung bald beginnen müsste. Der Hämoglobin-Wert sank immer weiter ab und lag jetzt nur noch bei ungefähr 9 g/dl. Das ist medizinisch die ultimative Untergrenze, an die sich der Körper noch gewöhnen konnte. Der Normalwert liegt zwischen 13 und 17 g/dl. Eine Behandlung schien nun immer unausweichlicher, jedoch wollte ich diese nochmals ein wenig hinauszögern. Das teilte ich auch so meiner Schulleiterin mit.
Am Ende dieses Monats hatte ich Geburtstag und wollte mit allen Freunden noch einmal stilvoll feiern, bevor ich mich den Chemotherapien stellen musste. Denn alle Freunde und Bekannte sollten mich ja als lebenslustigen, attraktiven sowie charmanten Menschen in Erinnerung behalten.
Für meine Geburtstagsfeier wählte ich ein passendes Motto: Ich liebe den Film „Titanic“ von David Cameron und erinnerte ich mich an die Szene mit den drei älteren Herren, die noch kurz vor dem Untergang in stilvoller Kleidung das letzte Glas Whiskey trinken, bevor sie von den Wassermassen weggespült werden. Diese Wassermassen hatten ja auch etwas mit meiner Haarzellleukämie zu tun. Diese Haarzellen spülten meine gesunden Zellen weg und sammelten sich in meinem Bauch. Sie wollten ja nichts Gutes für mich, sie wollten meinen Untergang besiegeln. Also sollten sich meine Gäste in die Zwanzigerjahre versetzen und ähnlich schick gekleidet sein wie die gehobenen Passagiere der Titanic. Freiheit und Selbstbestimmung bedeuteten in manchen Momenten für mich auch nichts anderes, als gefühlt attraktiv und in der Lage zu sein, optische Reize für mein Lebensumfeld eigenständig setzen zu können. Zudem fühlten diese optischen Veränderungen sich so an, als würde ich der Krankheit wiederum ein Schnippchen schlagen.
Also feierte ich am dreißigsten Januar meinen vielleicht letzten Geburtstag stilvoll in einem titanicähnlichen Ambiente. Die meisten Freunde und Gäste hielten sich an die Kleidervorgaben. Es war ein glücklicher Abend und die anstehende Behandlungsprozedur schien auf einmal in weiter Ferne zu sein. Ich glaube, dass meine Gäste sich darüber auch bewusst waren und darum wurde es auf der Party fast gar nicht thematisiert. Ich erstrahlte in meinem Nadelstreifenanzug und meiner roten Fliege. Obwohl man mir im Gesicht die innerlichen Strapazen und das innerliche Chaos in meinem Blut ansah. Aber ich war ein guter Schauspieler und lebte diesen Abend nach dem Motto „Life must go on“! So verging die Zeit im Nu.
Ich bot meinen Gästen wieder Mirto an, wie ich es in jedem Jahr tat. Mirto ist ein sardisches Getränk, welches ich bei einem Studienseminar auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien kennengelernt und mitgebracht hatte. Ich verbrachte dort in den letzten Jahren auch noch einige Urlaube, deren Erlebnisse mich bis heute prägen. Aber dazu später mehr.
Nach meiner Geburtstagsfeier realisierte ich jedoch sehr schnell, dass es nun ernst wurde. Aus Wochen wurden jetzt langsam abzählbare Tage, bis die Therapie beginnen würde. Die Ärzte meinten, es sollte jetzt so langsam mit der Chemotherapie begonnen werden, doch ich zögerte noch. Ich wollte meinen beruflichen Verpflichtungen nachkommen, das heißt, meinen Abiturjahrgang bis zu den Osterferien betreuen. Zudem stand die Entscheidung an, wo ich die Therapie durchführen lassen wollte, und es gab eine entscheidende Wende, die mir eine weitere Selbstbestimmung über die Behandlung ermöglichte. Ich stellte einen Kontakt zum Haarzellleukämie-Selbsthilfeverband her. Dort telefonierte ich mit der Vorsitzenden des Vereins. Der Erfahrungsaustausch mit ihr fühlte sich so an, als hätte ich im Lotto gewonnen. Es gab circa dreihundert Mitglieder in diesem Verein und sie meinte, dass eigentlich noch keiner bei ihnen an der Haarzellleukämie gestorben sei. Dieses war schon mal für mich eine sehr beruhigende Nachricht. Zudem konnte sie mir weitere entscheidende Hinweise geben, wie die Behandlung erfolgen könnte. Durch sie erfuhr ich, dass man das Chemopräparat Cladribin auch subkutan, also über die Bauchdecke, verabreichen konnte. Dieses bestärkte mich darin, mich gegen den Port zu entscheiden, wie es die Uniklinik in Münster vorsah. Und sie sagte mir, man könne die Behandlung auch ambulant durchführen. Mal eben ein paar Chemotherapien durchzuführen und dabei zu Hause bleiben zu können, das entsprach ganz meinem Lebensprinzip. Es könnte zwar sein, dass ich mich nicht mehr mit so viel Freunden würde treffen können, da nach einer Chemotherapie die Leukozyten im Blut, also die Blutabwehr, wegfallen würden und die Infektionsgefahr rapide ansteigen könnte. Dies waren nun einmal die normalen Begleiterscheinungen einer solchen Therapie. Aber ich befand mich weiterhin in meiner gewohnten Umgebung, in der ich ja selbstbestimmt leben konnte. Ich konnte ausschlafen und ins Bett gehen, wann ich wollte, laut Musik hören und mich sonstigen Lebensgenüssen hingeben. Es gab keine Mitpatienten im Krankenzimmer, die mich durch Schnarchen und sonstige Aktivitäten stören (und ich sie auch nicht) würden, denn ich war nur gesetzlich krankenversichert.
Nur in der ersten Therapiewoche musste ich mir täglich eine Chemospritze in der Arztpraxis abholen, der einzige fixe Termin außerhalb meiner Wände. Zudem sollte ich Menschenansammlungen und die Begegnung mit Kranken meiden. Und ich traf letztlich die Entscheidung, mich nicht in der Uniklinik behandeln zu lassen. Die Uniklinik in Münster ist mir schon immer sehr unsympathisch gewesen. Dieses Gebäude vermittelte mir keine Wärme und Herzlichkeit. Es sah aus wie ein industriell-maschineller Komplex aus grauem Beton und Stahl. Der Baustil und die komplette Klimatisierung des Gebäudes stellten für meinen Kopf ein Problem dar. Sollte ich doch ins Krankenhaus müssen, so wollte ich zumindest ein Fenster öffnen können. Zudem bestand die Gefahr, sich aufgrund der Klimaanlage einen Infekt einzufangen. Der Infekt war die größte Gefahr in dieser Zeit und er konnte über Leben und Tod während so einer Chemotherapie entscheiden.
Also, irgendwie war die erste Schlacht schon wieder geschlagen, obwohl sie noch gar nicht begonnen hatte. Die fachlichen Vorteile der Uniklinik wurden durch mein eigenes Wissen und mein Lebensgefühl übertrumpft. Die Krankheit war „sowas“ von selten, sodass ich immer mehr selbst zum Experten wurde. Ich wusste mehr als die behandelnden Ärzte und damit strahlte ich auch eine Sicherheit aus. Es war erneut ein Erfolg und ich klopfte mir selbstbewusst auf die Schultern. Zumindest virtuell. Ich hatte auch hier wieder ein selbstbestimmtes Element in meinem Leben gefunden, dessen Spannbreite doch manchmal größer war, als mir selber bewusst war.
Ich vergleiche meine Selbstbestimmungsgedanken und –prinzipien gerne mit den Filmen von Tom und Jerry. Dabei schlüpfe ich lieber in die Rolle der Maus als in die der Katze. Die Katze ist für mich ein Symbol für die Gesellschaft, die mich irgendwie einfangen und kriegen will. Ich bevorzuge daher die Rolle der kleinen, zierlichen, wendigen und schlauen Maus, die die Katze austrickst, damit die nicht über ihren Tod bestimmen kann. Gerne streut eine Gesellschaft bzw. das Leben für mich „Krümel“ aus, die geradewegs in die Falle führen, so hinterhältig und unbewusst. Ich vergleiche es gerne mit den Fallen, die ein Supermarkt für die Kunden aufstellt: zum Beispiel Sonderangebote vor dem Eingangsbereich, um damit in den Markt zu locken. Und dann muss man erst den gesamten Laden durchqueren, um die Ware bezahlen zu können. Aus Marktleitersicht befinden sich die Kassen also strategischerweise erst am Ende des Weges, auf dem man zu weiteren Käufen verführt wird. Als Kunde wird man an dieser Stelle also ausgetrickst. Aber das sollte nicht mein Weg sein. Als intelligente Maus wollte ich doch lieber selbst die „Krümel“ verstreuen und selbst das Ziel bestimmen, welches eine Gesellschaft verfolgte bzw. anstrebte. Übertragen auf dem Supermarkt würde ich zum Beispiel auf eine Bewusstseinsänderung des Inhabers hinarbeiten wollen. Er sollte lieber bei seinen Angeboten vor dem Eingangsbereich dazuschreiben, dass der Weg zur Kasse noch über dreihundert Meter durch den Supermarkt führt. Insbesondere für Menschen mit einer Gehbehinderung wäre dieses doch eine faire Geste.
Die Realität holte mich jedoch immer weiter ein. Die Ärzte berichteten mir, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, mich einer Behandlung und damit etwas für mich Unbekanntem zu unterziehen. Manchmal fühlte ich mich so, als wenn die Haarzellleukämie mir einen Strick um den Hals legen würde und diesen langsam zuzöge. Und umgekehrt war es manchmal so, als würde mich die Gesellschaft künstlich beatmen wollen, und mit beiden Situationen konnte ich mich nicht anfreunden. Gab es bei der Haarzellleukämie auch eine Art „Katz und Maus“-Spiel? Konnte ich die Haarzellen austricksen und ihnen „Krümel“ hinwerfen? Würden diese Manipulationsversuche zum Erfolg führen? Ich wusste es in diesem Moment noch nicht, denn ich musste wichtige Entscheidungen treffen. Die „Watch-and-Wait-Strategie“ hatte ich in der Uniklinik begonnen und war dort schon seit über einem Jahr Patient. Auf fachlicher Ebene war sie mit Sicherheit das Nonplusultra, jedoch gefiel mir der Gedanke, mich dort stationär behandeln zu lassen, einfach nicht und belastete mich sehr.
In Absprache mit den Ärzten der Uniklinik und den von mir geschilderten Bedenken entschied ich mich, die Behandlung in einem anderen Krankenhaus in Münster, dem St. Franziskus-Hospital, durchführen zu lassen. Diese Entscheidung fühlte sich schon einmal ganz gut an. Denn es war der erste Schritt, den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen bzw. anzunehmen.
Der 10. März 2014 wurde für mich zu einem der Tage im Leben, die man wohl nie vergessen wird. Es war der Tag, an dem ich mit der Chemotherapie beginnen sollte. Meine in den vergangenen Monaten gesammelten Informationen führten zu dem Ergebnis, mich ambulant mit dem Chemopräparat, einem Zytostatika namens Cladribin, behandeln zu lassen. Der Feind in mir bekam nun einen Gegner. Ich wusste zwar nicht haargenau, was das Cladribin in meinem Körper anstellen würde, die Ungewissheit wich jedoch bald der Gewissheit: Die üblichen Nebenwirkungen von Chemotherapien wie Übelkeit und Gewichtsverlust. Zudem werden bei einer Chemotherapie nicht nur die Tumorzellen beseitigt, sondern auch ein Großteil der gutartigen Zellen. Dies führt dazu, dass das Immunsystem heruntergefahren wird. Also waren in diesem Moment nicht mehr die Tumorzellen mein größter Feind, sondern eine mögliche Infektion. Daher meine Strategie, die Therapie ambulant durchzuführen und sich den im Krankenhaus befindlichen Keimen zu entziehen.
Die Krankenkasse übernahm das Taxi und so ließ ich mich in die ambulante Onkologie des St. Franziskus-Hospitals fahren. Mir war nicht mulmig, ich war gespannt, welche Auswirkungen die Chemospritze auf meine physische und geistige Verfassung haben würde. Zumindest war die Geschichte mit dem Port vom Tisch und ich konnte mir, wie in einem Selbstbestimmungsakt, die Spritze in die Bauchdecke geben lassen. Ich empfand es als Erfolg, denn ich konnte meiner Erkrankung den ersten Stempel selbst aufdrücken.
Also spritzte mir die Krankenschwester 600 ml Cladribin. Da das Cladribin kühl gelagert werden musste, fühlte ich zunächst nur eine Kälte in meiner Bauchdecke. Wie schnell würde es sich in meinem Körper verbreiten? Ich war gespannt, was mit mir passieren würde. Hinzu kam noch eine Blutabnahme. Dann war der erste Tag in der Klinik überstanden und ich fuhr mit dem Taxi wieder zurück. Ich hatte mich so gut wie möglich auf alles vorbereitet: Das Mittagessen kam nun von einem Lieferservice und für meine engsten Freunde und Mitarbeiter hatte ich Handschuhe und Mundschutze organisiert. Einkäufe wurden von Freunden und Bekannten erledigt. Ich durfte zwar die Wohnung verlassen und spazieren gehen, sollte jedoch auf Anweisung der Ärzte auf jeden Fall Menschenansammlungen und insbesondere kranke Menschen meiden.
Zu Hause angekommen legte ich mich erst einmal auf mein Sofa. Es war geschafft! Die erste Hürde, mit der ich mich seit anderthalb Jahren hatte auseinandersetzen müssen, war genommen. Ich war sehr entspannt und irgendwie erleichtert, denn nun war der Druck aus dem Kessel heraus und es gab kein Zurück mehr.
Noch weitere vier Tage, an denen es jeweils eine Spritze gäbe, und dann wäre die Prozedur überstanden. Also schaltete ich erst einmal den Fernseher ein, ein wenig Ablenkung konnte nicht schaden. Ich hoffte darauf, dass mir nicht übel würde und ich die Nacht gut überstünde. Meine Mutter und meine Geschwister riefen mich an und erkundigten sich nach meinem Befinden. Aber es gab nichts Auffälliges zu berichten. Ich hatte Appetit und eine Menge Freizeit vor mir. Komplikationen schienen zunächst in weiter Ferne. Ich studierte also durch Zappen erst einmal das Fernsehprogramm und stellte fest, dass der Sender DMAX in diesem Moment genau das Richtige für mich war. Ein Männerprogramm, in dem sich starke Kerle tummelten. Es gefiel mir, weil ich ja nun auch, auf dem Sofa liegend, Stärke demonstrieren wollte. Ich sah Abenteurer, die nach Gold suchten, ohne zu wissen, ob sie Erfolg haben würden. Auch mein Cladribin sollte in der Hoffnung auf Erfolg etwas finden; und zwar restlos alles. Es durfte keine Ausnahmen bei der Beseitigung der Haarzellen geben, um den Jackpot zu gewinnen. Der Jackpot war in diesem Fall so etwas wie das Überleben. Die Schlacht hatte begonnen und ich fühlte mich ihr eher gewachsen als ausgeliefert.
Der nächste Tag begann, ich hatte die Nacht gut überstanden. Keine Übelkeit oder sonstige Nebenwirkungen. Prophylaktisch überprüfte ich, ob ich Fieber hatte, denn kein Fieber bedeutete: keine Infektion! Ich aß normal zum Frühstück und gegen dreizehn Uhr würde mich das Taxi wieder zur Klinik bringen. Da ich nach der ersten Chemospritze keine großen Veränderungen wahrgenommen hatte, konnte ich der zweiten Spritze gelassen entgegensehen. Ich setzte mir wieder meinen Mundschutz auf und ließ in der Klinik die bereits bekannte Prozedur über mich ergehen. 600 ml Cladribin, der neu gewonnene Stoff meiner Träume, verabreicht von einer gut gelaunten Krankenschwester. Es hatte in diesem Moment etwas Wunderbares, denn es gab keine größeren Nebenwirkungen und die Haarzellen in mir würden nun schon unbemerkt verschwinden.
Am dritten Tag wachte ich am Morgen jedoch mit einem unguten Gefühl auf. Ich fühlte mich schlapp und fiebrig. Mir war zwar nicht übel, jedoch fühlte ich mich sehr warm. Also überprüfte ich die Temperatur und musste feststellen, dass ich 38,5 Grad Fieber hatte. Es wirkte, als hätte sich das Blatt nun gewendet. Nun schien mir die Krankheit doch ihren eigenen Stempel aufdrücken zu wollen. Ich nahm also prophylaktisch die bereits Tage zuvor gepackte Tasche zum nächsten „Impftermin“ mit ins Krankenhaus, denn mir schwante nichts Gutes. In der Klinik wurde die erhöhte Temperatur bestätigt und mein behandelnder Arzt wollte die nächste Chemotherapie aussetzen und mich auf die Onkologiestation überweisen. Es war nicht klar, wo das Fieber herkam. Ich hatte weder Husten noch grippale Symptome, die auf einen Infekt schließen konnten. Meinen Plan, die Therapie ambulant durchzuführen, konnte ich nun wohl nicht weiter verfolgen.
Ich landete letztendlich auf einem Drei-Bett-Zimmer der Station 5 des St. Franziskus-Hospitals in Münster. Jetzt machte ich mir zum ersten Mal Gedanken darüber, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Es gab momentan keine Erklärung dafür, warum ich Fieber hatte und zum ersten Mal blickte ich sorgenvoll in die Zukunft. Die einzige Trumpfkarte, die ich nun hatte, war, einen Kontakt zu den beiden renommiertesten Professoren, empfohlen von der Vorsitzenden des Haarzellleukämie-Selbsthilfeverbandes, herzustellen. Sie waren in Deutschland die größten Koryphäen, was meine Erkrankung betraf, und würden vielleicht auch Erklärungen für meine fiebrige Komplikation haben. Was sie allerdings nicht wussten: dass ich ein Mensch mit einer Behinderung bin. Eine Haarzellleukämie ist nun schon eine sehr seltene Erkrankung und jetzt traf sie auch noch einen Menschen, dem von Geburt an ein Bein und beide Hände fehlten. Eine sehr spezielle Situation. Die damalige Nachricht über die Haarzellleukämie machte mich fassungslos, denn ich hatte mein Leben bis dahin trotz Behinderung sehr gut im Griff gehabt. Mit meinen beiden Armstümpfen sowie mit meinem Mund konnte ich Dinge greifen und gehen konnte ich mithilfe einer modernen, elektronisch gesteuerten Beinprothese. Zudem fuhr ich ein spezielles Auto und ein spezielles Fahrrad, welche mir die nötige Mobilität und die damit verbundene Freiheit brachten. Außerdem ging ich einer geregelten Tätigkeit nach und verfügte über ein Einkommen, mit dem man sein Leben selbst gestalten konnte. Des Weiteren hatte ich noch mehrere Assistenten beschäftigt, die mich in der Ausübung meines Lebensalltags unterstützten.
Nun jedoch befand ich mich auf einmal auf unbekanntem Terrain. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Nacht auf der Krebsstation verbringen musste. Eine Station, auf der einem der Tod sehr schnell begegnen kann. Außerdem fühlte ich mich in meiner eigenen Wohnung autonom, weil ich mein Leben dort selbstständig führen konnte, was im Krankenhaus nicht so ohne Weiteres möglich war. Auf der Station war ich wohl ein sehr außergewöhnlicher Fall, was aber ausnahmsweise nicht mit meiner Krebserkrankung zu tun hatte. Mein Aufenthalt hier war für die behandelnden Ärzte und die Schwestern wohl eine sehr ungewöhnliche Situation. So brauchte ich beispielsweise ein Ladegerät für meine Beinprothese. Eine Beinprothese begleitete mich nun schon mein ganzes Leben. Auf einer Krebsstation dürfte das Tragen einer Beinprothese ja eigentlich kein außergewöhnliches Phänomen sein, da ja auch Amputationen in Folge von Krebserkrankungen vorgenommen werden. Es gab jedoch noch eine weitere Komponente, die ich nicht so einfach verschleiern konnte. Ich war von Geburt an ohne Hände aufgewachsen. Dies führte dazu, dass mir die Schwestern zum Beispiel das Essen kleinschneiden mussten und mir beim Toilettengang behilflich sein mussten. Ich verlor also gravierende Elemente meiner Selbstständigkeit und plagte mich mit den Behandlungsrisiken und -strategien einer Haarzellleukämie herum.
Das alltägliche Leben war für mich, trotz Behinderung, nie ein Problem gewesen. Die verschiedenen Hilfsmittel, aber auch Institutionen in Münster, wie zum Beispiel die Mensa, ermöglichten mir ein autonomes Leben. Auf der Station jedoch verlor ich meine gefühlte Selbstständigkeit und musste mich den dort vorgegebenen Regeln anpassen. Dieses Gefühl war schrecklich für mich, jedoch konnte ich ihm momentan nicht entrinnen. Ich musste einen Teil meiner Selbstständigkeit aufgeben, um mein Überleben zu sichern. Aber die Schwestern und Pfleger waren sehr nett und hilfsbereit, um mich als „Ohnhänder“ zu unterstützen.
Der Verlust meiner Selbstständigkeit, meine Krebserkrankung und die Situation im Krankenhaus führten immer mehr zu einem Unwohlsein. Ich lag nun in einem Drei-Bett-Zimmer mit zum Teil schwer an Krebs erkrankten Menschen. Die erste Nacht hatte es auch wirklich in sich. Gegen halb eins wurde ich wach und musste Wasser lassen. Das ging jedoch nur mit Hilfe. Um am Bett Wasser zu lassen, musste ich aufstehen. Die Krankenschwester merkte sehr schnell, dass etwas nicht stimmte, ich sackte nämlich am Bett zusammen wie ein nasser Sack. Wie mir die Schwester sagte, war ich kreideweiß im Gesicht. Sie holte sofort den diensthabenden Arzt, um mich durchchecken zu lassen. Dieser stellte fest, dass mein Blutdruck zu niedrig war und dass sie am kommenden Tag unbedingt einmal Blut abnehmen mussten. Allerdings blieb die Nacht weiterhin unruhig. Im Krankenzimmer schrie ein Patient fast stündlich, dass er große Schmerzen habe. Die Krankenschwester verabreichte ihm daraufhin mehrmals eine höhere Dosis an Schmerzmitteln, soweit ich das mitbekommen habe. Nun war ich wohl angekommen in der harten Realität einer Krebsstation, wo es um viel Schmerzen und auch um den Tod ging. Oder auch darum, wie die Medizin versuchte, den Tod hinauszuzögern. Es war kein schrecklicher Traum, sondern die knallharte Realität. Ich hatte zum Glück keine Schmerzen und versuchte, weiterzuschlafen, was mir nur zum Teil gelang. Endlich war der Morgen da. Das Leben auf so einer Station begann ungefähr um sieben Uhr. Man wurde obligatorisch geweckt und es gab gegen acht Frühstück. Ich hoffte, dass wir an diesem Tag klären würden, woher das Fieber bei mir kam und in welcher Form die Chemotherapie weitergeführt werden würde. So versuchte ich, am Vormittag Prof. Dr. Wörmann zu kontaktieren, den Experten für die Krebserkrankung „Haarzellleukämie“. Dieser arbeitete, wie gesagt, mit meinem Selbsthilfeverband, bei dem ich auch Mitglied wurde, eng zusammen. Über die Vorsitzende des Selbsthilfevereins bekam ich dann auch seine Handynummer. Ich hatte Glück; ich erreichte ihn und erklärte ihm den Komplikationsverlauf meiner Behandlung. Er kam sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das Fieber sehr wahrscheinlich durch den sehr schnellen Zerfall der Haarzellen verursacht wurde, welches eine Reaktion auf das Cladribin war.
Zudem machte ich mir auch Gedanken darüber, dass die Behandlung weniger Wirkung zeigen könnte, wenn man den normalen Behandlungsablauf unterbricht. Aber auch in dieser Hinsicht beruhigte mich Prof. Dr. Wörmann. Eine Streckung der Behandlung, also das Verlassen des Fünf-Tage-Korridors, stellte nicht unbedingt ein Problem dar. Man sollte nun erst einmal beobachten, ob das Fieber wieder sinken würde und sich keine Anzeichen von Infekten zeigen würden. Gegen Mittag erreichte mich dann mein behandelnder Arzt. Er erzählte mir, dass er gute Nachrichten habe. Er hätte mit dem auf die Haarzellleukämie spezialisierten Prof. Dr. Rummel gesprochen, um die aufgetretenen Komplikationen mit ihm zu diskutieren. Ich war gespannt darauf, zu welchen Ergebnissen mein behandelnder Arzt gekommen war: Zum Glück herrschte Übereinstimmung zwischen den beiden Koryphäen. Meine Vorbereitungen hatten sich nun zum ersten Mal ausgezahlt.
Ich hatte an diesem Morgen kein Fieber mehr, fühlte mich jedoch immer noch ein bisschen schlapp, dennoch ich konnte aufstehen und mir meine Prothese anziehen. Sollten keine weiteren Komplikationen einsetzen, würde man die Chemotherapie am übernächsten Tag fortsetzen.
An diesem Tag schaute ich mir zunächst einmal die onkologische Station etwas genauer an. Vor acht Wochen war ich schon einmal hier gewesen, um mir ein Bild davon zu machen, wo ich eventuell landen würde, falls doch etwas nicht nach Plan liefe. Es war eine ganz normale Station in einem Krankenhaus, jedoch gab es einen neuen Anbau, wo Privatpatienten versorgt wurden. Es gab einen schön hergerichteten Aufenthaltsraum und einen alten und neuen Flur. Der Aufenthaltsraum gehörte schon zu dem neuen Teil der Station und war nur für Privatpatienten vorgesehen. Er verfügte über eine Kaffeemaschine, Obst, angenehme Stühle und einen sehr schönen Ausblick auf die Silhouette von Münster. Die Trennung zwischen privat- und gesetzlich versicherten Menschen beschränkte sich jedoch nur auf die Zimmerauswahl. Im Neubau gab es Einzelzimmer, die sehr geschmackvoll eingerichtet und die nur für die Privatpatienten vorgesehen waren. Aber im Gemeinschaftsraum funktionierte die Trennung nicht so richtig. Es gab hier auch keinen Privatpatienten, der sein Anrecht darauf durchsetzen wollte. In dieser Situation schien uns die Erkrankung eher zu solidarisieren. Denn wir alle hatten ein gemeinsames Schicksal, dem wir uns unausweichlich stellen mussten. Am Nachmittag besuchte mich mein Arzt nochmals, um mir einen zentralen Venenzugang am Hals zu legen, einen sogenannten „ZVK“. Dieser war sehr wichtig für mich, denn nur durch ihn war es möglich, mir Antibiotika gegen das Infektionsrisiko geben zu können. Da die Ärzte sich nicht hundertprozentig sicher waren, wo das Fieber herkam, war dies eine rein prophylaktische Maßnahme. Außerdem wurde so in meinem Fall die Blutentnahme erleichtert. Schien es sich nun gerächt zu haben, dass ich mir keinen Portzugang legen lassen hatte? Da ich mit meinen beiden Armstümpfen die Hände beziehungsweise die Greiffunktion ersetzte, war mir der Erhalt dieser Funktion sehr wichtig. Ein Portzugang in der Brust, direkt verkabelt mit der Herzarterie, hätte laut Ärzten eventuell zu Einschränkungen dieser Funktionalität führen können. Deshalb hatte ich mich damals gegen diese Form des Portzugangs entschieden. Aber als Mensch ohne Hände und als Beinprothesenträger stellte die Blutabnahme immer eine besonders große Herausforderung dar. Den roten Saft in die Kanüle zu kriegen, glich immer einem Lottospiel. Es gab nur das rechte Bein und meinen linken Armstumpf, an dem sich noch eine kleinere Vene befand.
Ich stimmte also dem „ZVK“ zu – wie schon einige Wochen vorher mit dem Arzt besprochen. Am Nachmittag sollte dann in einem kleinen Operationszimmer der Klinik dieser Zugang gelegt werden. Ein junger Assistenzarzt durfte hierbei seine Fähigkeiten unter Anleitung eines erfahrenen Arztes unter Beweis stellen und diese für einen Arzt kleine Operation durchführen. Die gesamte Aktion dauerte keine dreißig Minuten. Zwar fühlte es sich an, als ob mein Hals nicht mehr ganz so beweglich wäre, jedoch verspürte ich keine Schmerzen und meine beiden Arme konnte ich weiterhin, wie von mir geplant, beschwerdefrei nutzen. Danach wurde direkt der Tropf mit den Antibiotika angeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt war ein Infusionsständer mein ständiger Begleiter. Man führ mich mit meinem Bett zwar wieder auf die Station zurück, jedoch musste ich nicht im Bett bleiben und konnte das Zimmer auch wieder verlassen.
An diesem Nachmittag kam es zu einer weiteren, eher surrealen Begegnung auf der Station. Ich traf eine ehemalige Freundin auf der Station wieder. Sie hieß Anja und ich hatte sie seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen. Ich hatte sie in der Universität Münster beim Hochschulsport, genauer gesagt beim Volleyballspielen, kennengelernt. Zudem kannte ich ihren Mann Clemens ganz gut, mit dem ich gemeinsam an der Universität Münster Mathematik studiert hatte. Ich betrieb damals sehr viele Sportarten und war eigentlich in dieser Hinsicht immer sehr gut integriert. Man braucht nicht unbedingt Hände, um Volleyball spielen zu können. Ich erledigte diese Aufgabe mit meinem Kopf und meinen Unterarmen. Ich schob also meinen Infusionsständer durch den Flur, immer langsam und sehr behutsam, denn ich konnte ihn als „Ohnhänder“ ja nur vorsichtig schieben und nicht festhalten. Anja war über unsere Begegnung natürlich genauso erstaunt wie ich. Anja erzählte mir, dass sie schon seit einigen Jahren an Krebs erkrankt sei. Sie hatte in der Vergangenheit schon einige Chemotherapien hinter sich und nun hatte man Metastasen im Kopf und anderen Stellen ihres Körpers festgestellt. Der Krebs hatte sie wohl fest im Griff und mir war klar, dass sie vielleicht ein viel größeres Problem hatte als ich. Die Bildung von Metastasen und damit die unkontrollierte Vermehrung von Tumoren im Körper führten nach meiner Erfahrung letztendlich über kurz oder lang zum Tode.
Da Anja und ich uns schon seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatten, kam es zu einem regen Gedankenaustausch, insbesondere was unseren Erkrankungsstatus betraf. Aber wir unterhielten uns auch darüber, wie das Leben für uns gelaufen war.
Das Bewundernswerte an Anja war, dass sie immer noch ein Lächeln auf den Lippen hatte. Sie erzählte mir, dass sie ein Kind habe und dass sie mit Clemens, meinem ehemaligen Studienfreund, verheiratet sei. Zudem arbeitete sie auch wie ich selbst als Lehrerin an einer Schule. Sie war Privatpatientin und sie zeigte mir ihr schönes Zimmer. Ich war ein wenig neidisch darauf. Wir beide waren Beamte, jedoch konnte ich mich aufgrund meiner Behinderung nicht privat versichern und war somit nicht beim Land NRW beihilfeberechtigt. Private Versicherungen hätten meine jetzigen, behinderungsbedingten Erkrankungen nicht mitversichert, sodass für mich nur die gesetzliche Versicherung übrig blieb. Sämtliches Versicherungsrisiko musste ich über eine freiwillige Mitgliedschaft absichern, deren Beiträge gegenüber einem normalen Versicherten doppelt so hoch waren. Betrachtete man jedoch die Ausgangssituation zwischen uns beiden, konnte ich gerne auf diese Ungerechtigkeit und den damit verbundenen Luxus verzichten.
Ich erzählte Anja, dass ich eine Haarzellleukämie hatte und mich mitten in einer Chemotherapie befand. Anja fand das auch schon sehr krass, dass ich mich als schwerbehinderter Mensch auch noch mit einer Blutkrebserkrankung herumschlagen musste. Aber meine Überlebenschancen waren diesmal wohl größer als ihre. Ich sagte ihr das natürlich nicht ins Gesicht. Andererseits fand ich es ganz schön, jemanden auf der Station zu haben, zu dem ich eine persönliche Beziehung hatte. Aber man merkte Anja an, dass sie sehr müde war und auch ihre Ruhe brauchte.
So trennten sich unsere Wege auf der Station und ich ging wieder in mein Zimmer zu meinen zwei Mitpatienten zurück. In diesem Moment dachte nur, dass es im Leben manchmal außergewöhnliche Umstände gibt, die man nie vergessen wird. Dieses war wohl so einer.
So nahte die zweite Nacht in meinem Drei-Bett-Krankenzimmer, in der es wieder sehr turbulent zuging. Mir ging es zwar gut, einem Mitpatienten jedoch nicht. Ich habe auf Geräusche schon immer sehr sensibel reagiert, doch das Schreien im Zimmer war eher brutal. Es schockte mich sehr. Es war so etwas wie ein Höhepunkt eines Krimis, bei dem man hellwach blieb. So war diese Nacht für mich wieder eher durchwachsen. Es wurde erneut hell und auch an diesem Freitag um sieben Uhr kamen die Schwestern zum Wecken vorbei. Um acht Uhr gab es das Frühstück, die Schwestern schmierten mir nach meinen Wünschen das Brötchen und schenkten mir den Kaffee ein.
Tagsüber war die Situation im Krankenzimmer eher friedlich. Wir waren drei Patienten mit unterschiedlichen Krebsarten. Ich hatte Blutkrebs, der Patient in der Mitte des Zimmers hatte einen wahrscheinlich nicht zu entfernenden Tumor an der Niere und der Dritte am Fenster irgendeinen Magen-Darm-Krebs, der nachts mit unerträglichen Schmerzen verbunden war. Jedoch hatten wir wohl eines gemeinsam: Es begleitete uns eine Ungewissheit der Dinge, die auf uns zukommen würden und wir waren nun dem Krankenhausapparat unmittelbar ausgeliefert.
Am Nachmittag verabreichte man mir dann die dritte Chemospritze, nicht venös, sondern subkutan, also wieder über die Bauchdecke. Also hatte ich jetzt das „Chemobergfest“ erreicht und neben den Haarzellen ging es nun auch weiteren Zellen an den Kragen. Den Zellen, die einen Infekt auslösen könnten, aber auch den Zellen, die mich beschützen würden. Im Krankenhaus wurde mir allerdings sehr schnell klar, wie rapide ich meine Selbstbestimmung verlor. Das beste Beispiel hierfür war, dass ich nun beim Toilettengang Hilfe brauchen würde. Ich hatte in meiner Wohnung für dieses Problem einen sogenannten „Closomaten“, also eine Toilette mit Wasserstrahl, mit der ich meine Notdurft unabhängig erledigen konnte. Ich verfügte zwar auch über einen Toilettenstab, mit dem man auch ohne „Closomat“ dieses Problem lösen konnte, jedoch war dieses keine Dauerlösung. Dieser Verlust tat mir doch schon sehr weh, da es ja um die Intimsphäre ging, aber ich merkte auch sehr schnell, dass es sich bei den Krankenschwestern und Pflegern um Profis handelte, die mich dezent und professionell unterstützten.
Insbesondere fiel mir die junge Schwester Lisa auf, die ein einjähriges Praktikum auf der Station absolvierte. Für ihr Alter wirkte sie sehr reif und ich war erstaunt, dass so eine junge Frau schon auf einer solchen „Hardcore“-Station eingesetzt wurde. Ich sprach mit ihr darüber und sie bestätigte mir, dass der häufige Tod auf dieser Station für sie das Belastendste an ihrem Job war. Lisa wollte in Zukunft Medizin studieren, hierfür konnte sie auf der Krebsstation sehr wertvolle Erfahrungen sammeln und sich in ihrem jungen Leben Gedanken darüber machen, wie sie vielleicht den Krebs in Zukunft besiegen konnte. Und so, wie ich Lisa einschätzte, würde sie dazu fähig sein, das Leid von anderen zu lindern. Sich Menschenkenntnis anzueignen, ist eine Fähigkeit, die ich aufgrund meines Handicaps gelernt habe. Denn ich musste schon immer auf Menschen zugehen, um mich ihnen anzuvertrauen und von ihnen Hilfe zu erhalten.
Gegen Mittag bekam ich überraschenden Besuch von meinem Arzt. Das Ergebnis der Blutentnahme am Vormittag war, dass sich meine Leukozytenwerte auf ein Level reduziert hatten, dass eine Infektion für mich nun lebensbedrohlich sein würde. Die Konsequenz dieser Nachricht war, dass ich ab diesem Zeitpunkt isoliert werden musste. Mir war zunächst gar nicht klar, ob ich diese Nachricht als positiv oder negativ einordnen sollte. Eigentlich war nun etwas eingetreten, was bei einer Chemotherapie durchaus üblich ist. Die guten Zellen wurden gleichermaßen zerstört wie die bösen Zellen und damit war mein Immunsystem quasi schutz- bzw. wehrlos.
Die Ärzte und Krankenschwestern zögerten auch nicht lange und verlegten mich in ein Einzelbettzimmer, das zuvor gründlich gereinigt und desinfiziert worden war. Die größte Gefahr war jetzt wohl, einen bösen, hartnäckigen Keim zu erwischen und im Krankenhaus gibt es ja bekannterweise viele davon. Dennoch gewann ich der neuen Situation auch etwas Positives ab. Denn endlich hatte ich Ruhe und konnte in dem Zimmer eigentlich machen, was ich wollte. Ich brauchte auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen und konnte frei entscheiden, wo mein ganzes Equipment im Raum verstaut werden sollte. An einer Wand des Zimmers fand ich einen guten Platz, um meine Beinprothese aufladen zu können. Zwar war es kein luxuriöses Zimmer, wie es Anja hatte, jedoch gab es ein abgetrenntes Badezimmer. Der Unterschied unserer Zimmer beschränkte sich nur auf das farbliche Ambiente und auf die unterschiedlichen Fernseher. Sie hatte einen schönen großen Flachbildfernseher, ich jedoch nur einen kleinen alten Röhrenfernseher. Wir beide jedoch konnten die Fenster unserer Zimmer öffnen. So fühlte ich mich auch nicht ganz so eingesperrt.
Umgekehrt fehlte mir jetzt die Kommunikation mit den Mitpatienten, aber auch auf diesen Fall war ich vorbereitet, denn ich hatte mir vor der Behandlung noch ein neues Smartphone gekauft. Damit konnte ich die Kommunikation mit der Außenwelt über SMS, Internet und Telefonate aufrechterhalten. Alle Menschen, die mich besuchen wollten, mussten sich steril anziehen. Professoren, Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sowie Freunde und Verwandtschaft tauchten jetzt wie grüne Frösche vor mir auf. Sie trugen Überziehschuhe, einen Mundschutz, Handschuhe und außerdem einen grünen Kittel. Meine Mutter und meine Geschwister kamen nicht jeden Tag in die Klinik, da sie hundert Kilometer entfernt wohnten. Ich war der Einzige in der Familie, der die Heimat verlassen hatte, und es gab für mich auch keinen Grund, irgendwann zurückzukehren. Die medizinische Versorgung in Münster war erstklassig und meine Beinprothesen wurden in Dortmund gebaut, was nur eine halbe Stunde Autofahrt von Münster entfernt lag. Zudem gab es hier viel mehr kulturelle Angebote und Freizeitaktivitäten, die ich im Laufe der letzten Jahre sehr zu schätzen gelernt habe. Essen in der Mensa, Schwimmen im nahen Freibad mit einer geräumigen Behindertenumkleide. Alles Dinge, die mir halfen, meine behinderungsbedingten Nachteile zu kompensieren. Speziell beim Kochen von Essen stellten meine Armstümpfe ein unüberbrückbares Hindernis da. Das einzige Projekt, meinen Single-Status hier in Münster zu beenden, war mir bisher jedoch nicht gelungen. Insbesondere in dieser Lebenssituation fehlte mir die menschliche Nähe ganz besonders. Eine menschliche Nähe, die mir auch Kraft geben könnte, diese unbekannte Situation zu meistern.
Die vielen Eindrücke, die ich in den letzten zwei Tagen im Krankenhaus gesammelt hatte, konnte ich alleine auf meinem Zimmer erst einmal in Ruhe verarbeiten. Es fühlte sich paradoxerweise ein wenig so an, als hätte ich ein Stück Freiheit zurückgewonnen, obwohl sich das kahle und optisch kalt gehaltene Krankenzimmer manchmal wie ein Gefängnis anfühlte.
Ich entfloh dem Krankenzimmer auch dadurch, dass ich meine Vergangenheit Revue passieren ließ und mir Momente heraussuchte, die mir wichtig waren und die mir in meiner jetzigen Situation besonders Kraft geben konnten. Ich suchte mir Momente, in denen ich die Lust aufs Leben gespürt hatte. Ich suchte mir Momente, in denen ich Nähe und Wärme gespürt hatte. So reiste ich jetzt virtuell, also in meinen Gedanken, zu meiner Trauminsel Sardinien. Vor zwanzig Jahren hatte ich die Insel im Rahmen eines Mathematikseminars mit ungefähr hundert Studenten zum ersten Mal kennengelernt.
In meiner Kindheit und Jugendzeit hatte ich nie große Reisen unternommen, denn meinen Eltern fehlten die finanziellen Mittel. Mein Vater war Alkoholiker und meine Mutter musste mit ihrer Heimarbeit die Familie durchbringen. Die einzig größere Reise war die Abschlussfahrt meiner Schulzeit nach Prag gewesen. Dorthin wurde ich von meiner großen Schwester begleitet.
Während des Studiums hatte ich ein eigenes Auto und war entschlossen, an diesem Seminar teilzunehmen und mit meinem eigenen Wagen nach Sardinien zu fahren. Dieser Wagen bedeutete mir sehr viel: Freiheit und Unabhängigkeit. Dafür hatte ich drei Jahre mit den Behörden gestritten. Meine Mutter war zwar von der Sardinienreise nicht begeistert, aber als Begleitung fuhr wieder meine Schwester mit, die mir auch bei meinen intimsten Problemen behilflich sein konnte.
Außerdem hatte ich bis hierher so gut wie keine Beziehung gehabt. Ich spürte, dass meine Behinderung eher ein Beziehungskiller war. Die Erwartungshaltung, die junge Menschen zu dieser Lebenszeit einfach hatten, war doch manchmal sehr hoch. Allerdings hatte das Jugendalter auch gewisse Vorteile, denn es gab auch Ideale und Werte, die besonders diese Menschen noch anstrebten. Junge Menschen sind wohl weniger von der Gesellschaft verdorben als ältere Menschen. So bestimmen zum Beispiel häufig die Gefühle das Handeln und nicht das rationale und durchkalkulierte Denken, um nach bestimmten Lebenszielen zu streben. Vielleicht sind auch die Erwartungshaltungen nicht so hoch und die Vorstellung noch weit davon entfernt, gleich eine Familie zu gründen. Dies zumindest konnte ein Vorteil für mich sein, denn ich sah nicht schlecht aus, mir fehlten halt nur ein Bein und die beiden Unterarme, gleichwohl ich war ein junger, charmanter Mann mit blauen Augen und blonden Haaren, der sich nicht versteckte.
Meine ersten Fahrten nach Sardinien und Korsika klappten problemlos. Dennoch war es manchmal lästig, immer Verwandtschaft für Toilettengänge dabei haben zu müssen. Aber auch für dieses Problem fand ich zum Glück eine Lösung, den sogenannten „Toilettenstab“. Man wickelte einfach Klopapier um eine Art gewinkelten Stab und führte damit die Reinigung durch. Diese Lösung war zwar nicht perfekt, jedoch erledigte den Rest das Mittelmeer, welches ich „Popo-Waschmaschine“ im Urlaub einsetzte. Dieses war wohl der erste Schritt in meiner großen, individuellen Freiheit. Ich konnte mit diesem technischen Hilfsmittel nun endlich autonom agieren und überall hinfahren, wohin ich wollte, ohne die Familie gleich mit einspannen zu müssen. Im Nachhinein glaube ich, dass dies wohl das beste Beispiel dafür ist, was Selbstbestimmung bedeuten kann. Es wäre mir selbst auch unangenehm gewesen, dieses Problem auf andere Leute abzuwälzen. Damit war der Weg frei, sich fremden Menschen öffnen zu können, denn alle anderen Hilfestellungen, die ich brauchte, waren eher menschlicher Natur, also etwas, was jeder andere auch für jeden anderen tun würde. Mal ein Brötchen zu schmieren, das Handtuch beim Duschen zu halten, das Zelt aufzubauen oder auch das Auto zu be- oder entladen. Alles Dinge, die die Menschen für einen gerne tun, wenn man keine Hände oder auch ein Bein weniger hat.
Aber während einer meiner ersten Reisen nach Sardinien, die im Rahmen des Studienseminars stattfand, packten mich die Sehnsucht und die Neugier, länger in Sardinien zu verweilen. Ich war zu der Zeit ungefähr vierundzwanzig Jahre alt und hatte schon über mehrere Jahre keine Beziehung mehr gehabt und ich merkte, wie mir die Insel Sardinien diese Wärme schenkte, die ich so sehr vermisste. Ich verglich Sardinien gerne mit einer sehr hübschen blauäugigen Frau. Das große blaue Meer waren ihre Augen, die Klarheit des Wassers war wie die Seele dieser Frau, die mich am ganzen Körper berührte. Es war eine Art Magie, die zwischen uns beiden herrschte und der ich mich nicht entziehen konnte. Die Insel liebte mich und ich wollte unbedingt mehr davon erleben. Also flog ich in meinen Erinnerungen wieder nach Sardinien, entfloh der Stille, dem gefängnisähnlichem kleinen Krankenzimmer und versuchte, meiner Selbstbestimmung neuen Glanz zu verleihen und in eine Freiheit zu entschweben, die ab jetzt in meinem Kopf stattfand.
So trat ich im Jahre 2001 mein persönliches Abenteuer oder auch Experiment an. Konnte ich auf der Insel Sardinien eine unbestimmte Zeit alleine, ohne Familie und Freunde, überleben und frei sein? Konnte ich mit der Hilfe von vielen fremden Menschen meine Freiheit gewinnen? Konnte ich meine Freundin Sardinien, die mir in der Vergangenheit schon so viel Liebe geschenkt hatte, über einen längeren Zeitraum besuchen?
Dieses würde wohl eins der waghalsigsten Experimente werden, die ich in meinem Leben jemals durchgeführt hatte. Aber durch meine vorherigen Sardinienurlaube kannte ich die Gegebenheiten dort sehr gut und ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Als Startkapital standen mir fünftausend Mark zur Verfügung und ich war entschlossen, erst zurückzukehren, wenn das Geld aufgebraucht war. Neben einigen Ersatzteilen für meinen Pkw nahm ich unter anderem noch eine Ersatzprothese mit. Denn ein Auto- oder auch Prothesendefekt hätte das ganze Projekt gefährden können. Zudem nahm ich zwei Toilettenstäbe mit, falls ich einen doch einmal verlieren sollte. Ich versuchte also meine Reise so präzise wie möglich vorzubereiten, um auf alle Eventualitäten gefasst zu sein. Meine Familie half mir, meinen damaligen Golf II zu packen. Ich kaufte noch einen Dachkoffer, um das ganze Equipment mitführen zu können.
Zudem machte ich kurz vor der Reise noch einen Tauchschein, denn ich wollte meinem geliebten Meer und damit meiner geliebten Frau unter Wasser möglichst lange nahe sein. So besorgte ich mir entsprechendes Tauchequipment, welches ich mit nach Sardinien nehmen wollte.
Auch einige behördliche Probleme waren noch zu lösen: Ich hatte in diesem Jahr an einer Schule gearbeitet (eine sogenannte „Geld-statt-Stellen-Stelle“, die noch bis zu den Sommerferien lief). Die Stelle wurde nicht verlängert. Danach hatte ich weder eine Kranken- noch eine Pflegeversicherung. Also versicherte ich mich freiwillig bei meiner Krankenkasse und teilte dem Sozialamt mit, von dem ich das Pflegegeld damals bezog, dass ich für unbestimmte Zeit verreisen wollte. Arbeitstechnisch und behördentechnisch war ich somit jetzt auch frei und ungebunden. Dieses war als Mensch mit Behinderung zu dieser Zeit nicht ganz selbstverständlich. Aber ich hatte in diesem Moment auch den Mut, auf gewisse ökonomische Annehmlichkeiten des Staates zu verzichten, denn meine dadurch gewonnene Freiheit und Ungebundenheit waren mit Geld nicht aufzuwiegen.