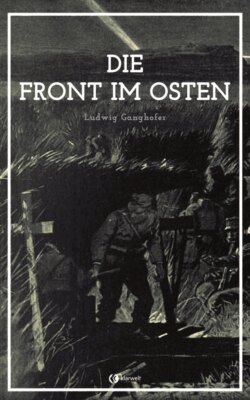Читать книгу Die Front im Osten - Ludwig Ganghofer - Страница 5
2.
Оглавление22. April 1915.
ieder glänzt ein schöner Morgen, dessen reine Sonne die galizischen Wälder und Fluren schimmern lässt wie eine Kostbarkeit des lieben Herrgotts! Doch schon in den ersten Frühstunden qualmen alle Straßen vom Kolonnenstaub, in dem auch die roten Dragonerhosen grau werden. Drei Landsturmmänner bringen vom Dunajec1 einen Trupp von etwa zwanzig russischen Gefangenen; der kleine Zug sieht malerisch aus, alle Gestalten sind blau vom Morgenschatten, sind mit goldenen Lichtlinien gesäumt und werfen lange Schwarzbilder über das Ackerfeld. Es sind kräftige Leute, gut gekleidet und gut genährt; jeder hat seinen Mantel oder eine wollene Decke; keiner ist verwundet, aber bei jedem, der vorne den Kittel und das Hemd offen trägt, sind Blutflecken an der Brust zu sehen — so zerkratzt sind die armen Kerle, so zerbissen vom Ungeziefer. Ihre Gesichter schauen finster und verdrossen; es lässt sich mit Sicherheit nicht feststellen, ob diese Misslaune der edle Zorn besiegter Helden ist oder nur das Unbehagen über die Insektenplage.
Der Zug verschwindet im Kolonnenstaub, und unsere Fahrt geht von Bochnia seitwärts gegen die Raba hin, zum Pferdespital, in dem die abgerackerten, von der Räude übel mitgenommenen Gäule kuriert werden. Vierhundert Patienten füllen die praktisch eingerichteten Holzbaracken. Die Kranken, die man einliefert, sehen zum Erbarmen aus, sind klapperdürr, können sich kaum noch aufrecht erhalten, sind überzogen von den seltsamen Arabesken des Haarfraßes und haben trübe, fast schon gebrochene Augen. Durch viele Wochen muss sich hier der gerechte Mensch seines Viehes erbarmen, bis die Kurierten aus der letzten Baracke gesund und mit klar gewordenen Augen wieder heraustreten. Das erste Heilwerk, das an den neuen Patienten vorgenommen wird, ist das Abscheren des von der Räude zerfressenen Haarpelzes.
Ich sehe zu, wie einem Eisenschimmel der Kopf und die Ohren rasiert werden; der Gaul hält unbeweglich still, drückt in Behagen die Augen zu und zieht das Maul von den Zähnen zurück, dass es aussieht wie ein Grinsen der Zufriedenheit — ein Bild, so komisch, als wär‘ es von Busch gezeichnet.
Der Krieg verschlingt so viele Pferde, das man noch unter dem Kanonendonner an reichlichen Nachwuchs denken muss. Im Beschälhofe bei Bochnia steht ein Lipizaner Zuchthengst, ein Schimmel, der so schön ist, dass man an die Silberrosse des Sonnengottes erinnert wird. Und wie fleißig man für das Erscheinen kommender Pferdegeschlechter sorgt, das ist im Fohlenhof zu sehen. Ein entzückendes Bild: wenn die Mutterstuten in der Sonne ihren Morgenspaziergang machen und die neugeborenen Füllen daran gewöhnt werden, sittsam neben der Mutter zu gehen. Verläuft sich ein Kindlein, so ist die Mutter noch viel aufgeregter als die Dragoner, die den kleinen Ausreißer wieder einsaugen. In allem, was zappelt und ein schlagendes Herz hat, brennt das Geheimnis der ewigen Liebe.
Neben dem Fohlengarten hört man ein vielstimmiges Muhen und Brüllen. Da ist der Schlachthof. Zu Hunderten schieben sich die fetten, braun und weiß gesprenkelten Buckel aneinander vorüber, und neben den gesenkten Köpfen der schwarzen Büffel ragen die ungarischen Ochsenschädel mit den mächtigen Hörnern. Das ist ein beruhigender Anblick. Die Graublauen in den Schützengräben werden zu essen haben. Und die zartesten Bissen, die aus dem Schlachthause kommen, wandern in die Lazarette.
Ich sehe das Typhusspital, darf aber nicht eintreten, nur durch offene Fenster hineingucken in saubere, von der Morgensonne durchleuchtete Räume. Es stehen hier viele Betten; nur wenige sind belegt. Reichlicher Proviant, verbesserte Unterkunft, mildere Jahreszeit, ärztliche Fürsorge und der Segen der Impfung haben zusammengeholfen, um der bösen Seuche fast völlig Herr zu werden.
Auch das Lazarett der Schwerverwundeten ist schwach besetzt. Stuben und Betten sind weiß, Operationsraum, Verbandhalle, Röntgenkammer und Apotheke von musterhafter Einrichtung. Das große stille Haus ist umgeben von einem Garten, in dem der Frühling seine Wunder zu wirken beginnt. Es geht mir wieder, wie es drüben im Westen immer war: wenn ich einem Arzt oder einer Schwester die Hand drücke, kann ich nicht reden, kann diesen rastlosen Schutzengeln des leidenden Lebens nur mit stummer Dankbarkeit in die Augen blicken.
Aber jetzt — Gott soll mich beschützen! — jetzt kommt eine Sache, die mir gänzlich neu und sehr unerquicklich ist. Wir stehen vor einem Hause, das ich erst nach einigem Zögern zu betreten wage. Die Entlausungsanstalt! Auf der Schwelle gruselt‘s mir über die ganze Haut, und mein Haarboden leidet unter hysterischen Symptomen. Aber gleich die Sauberkeit des Entkleidungsraumes beginnt meinen Epidermisreiz zu beruhigen. Im „Rasiersalon“, wo den Patienten alles abgenommen wird, was Haar heißt, liegt nicht die kleinste Locke auf dem Boden, und die Raseure in ihren weißen Leinenkleidern sehen wie appetitliche Köche aus. Die Salbungshalle ist erfüllt von einer gar nicht unangenehmen Duftmischung aus Seife, Naphthalin und Anisol. Und in der Neubekleidungsstube — wahrhaftig, es gibt ein Wiedersehen schon auf dieser Welt! — stehen in Reih und Glied die zwanzig russischen Gefangenen, die früh am Morgen auf der Straße sehr übellaunig an mir vorüberzogen. Nun sind sie erlöst von allem Ungeziefer, stecken in frischen Hemden und Unterhosen, die von Vaselin glänzenden Gesichter lachen in breiter Heiterkeit, und in den friedsam gewordenen Asiatenaugen leuchtet ein dankbares Wohlgefühl, das ebenso innig, nur nicht so komisch ist, wie das Behagen des Eisenschimmels, dem die räudigen Ohren rasiert wurden. Ein beruhigendes Kulturbild inmitten aller Schrecken des Krieges! Ich bin überzeugt, dass die mitteleuropäische Zivilisation um zwanzig neue Verehrer bereichert wurde. Auch auf meiner eigenen Haut verschwindet der letzte suggestive Juckreiz — nun weiß ich: wenn iah im Laufe meiner östlichen Frontreise an diesem krabbelnden Leiden erkranken müsste, werde ich gründlich und schmerzlos geheilt werden. Kein Wunder, dass ich nach diesem Anschauungsunterricht mit einem Vorschuss von Dankbarkeit die zwei Entungezieferungsmaschinen betrachte, die dampfend und zischend im Hofe der Anstalt mit einem Druck von zwei Atmosphären und hundertfünfzig Grad Hitze alles vernichten, was in den Kleidern der Gefangenen als sechsfüßiges russisches Überläuferchen unsere Schützengräben überschritt.
Über löcherige Feldwege geht es hinaus zu einer Fliegerstation, die sich in einem Föhrenwalde gemütlich eingerichtet hat. Neben dem hübschen Blockhaus ist ein umzäuntes Gärtchen mit allen ersten Blumen des Frühlings bepflanzt. Und hier bekomme ich freundliche Kunst im Kriege zu sehen. Ein Freiwilliger, der von der Akademie entsprang und Soldat wurde, modelliert den Kopf eines Kameraden im Fliegerhelm. An Modellierton fehlt es in Galizien nicht. Wie überreich er vorhanden ist, das lässt sich auf der Weiterfahrt abschätzen. Die grundlose sumpfige Lehmstraße musste, um für Ross und Wagen passierbar zu sein, mit Tausenden von Baumprügeln belegt werden, Stamm an Stamm. Die Fahrt über diese Prügelgasse schüttelt einem fast die Seele aus dem Leib, aber man kommt doch vorwärts, früher blieb man stecken. Um das Versinken in der polnischen Suppe zu verhindern, musste ein großer Wald niedergeschlagen werden. Dem gestorbenen Walde hielt der Soldatenhumor eine Auferstehungspredigt — neben der von Astgewirr überschütteten Rodung, die keinen einzigen Baum mehr trägt, ist eine Tafel mit der Inschrift angebracht: „Das Fällen von Bäumen auf dieser Schonung ist streng verboten!“ Wie wohltuend ist ein Lachen, wenn man über ein paar Kilometer her die Kanonen donnern hört!
Der Richtung, aus der dieses Dröhnen her quillt, jagen wir in sausender Fahrt entgegen, tauchen in qualmende, den Hals beklemmende Staubwolken hinein und atmen wieder auf zwischen grünen, von der Sonne beglänzten Waldhügeln.
Wieder die polnischen Dörflein, die schwebenden Störche, die endlosen Kolonnenreihen und die vielen, neben der Straße rastenden Truppenzüge. Vor einem Häuschen sehe ich vier halbnackte Kinder eifrig damit beschäftigt, kleine Stäbchen in den Boden zu klopfen und mit Bindfaden zu umflechten — der Krieg hat ihnen einen neuen Zeitvertreib gegeben — sie spielen „Drahthindernis“. Aber die Landschaft des Krieges verfügt auch über minder freundliche Bilder: überall an der Straße haben die hungernden Pferde im Winter von allen Alleebäumen die Rinde heruntergeknappert. Auch die packendste Soldatenerzählung vermag den harten Lebenskampf und die Entbehrungen, welche die Truppen in Galizien während der vergangenen Wintermonate zu überwinden hatten, nicht so überzeugend darzustellen, wie es der stumme Todesgesang dieser abgefressenen und klaglos sterbenden Bäume fertigbringt, die auch im wärmsten Frühling nimmer erblühen werden! — Und wir daheim, wir saßen unter sicherem Dach in geheizter Stube und beim gutbestellten Tisch und schüttelten missbilligend die Köpfe über das unbegreifliche Siegeszögern in Galizien! — Jeder schmale, mannslange Grabhügel, den ich neben den kahlgebissenen Straßenbäumen im Acker sehe, weckt in mir die Reue über ein vorschnelles und unüberlegtes Wort. Ich habe hier, auf einem der härtesten aller Kampfböden dieses Krieges, noch wenig gesehen, fast nichts, und dennoch schon so viel, dass meinem blind gewesenen Urteil die Augen ausgehen.
Nun höre ich ein schönes Rauschen. Lärmlos gleitet das Auto über die glatten Bodenbalken des festen Pionierbaues, der an Stelle des von den Russen gesprengten Brückenbogens den breiten Dunajec überspannt. Wie ein ernstes, rätselvolles Lied ist die Stimme dieses ruhig fließenden gelben Wassers, in dem Millionen roter Blutstropfen zerflossen, ohne seine Farbe ändern zu können. Die kleinen Wellen blitzen in der Sonne wie tanzende Silberlichter. Für meine sinnenden Gedanken wird jedes reine Aufblitzen zu einem lebendigen Ding, zur lächelnden Seele eines Tapferen, der in diesen Wellen versank oder an ihrem Ufer die Augen schloss als treuer Wehrmann seiner Heimat.
Noch eine kurze Fahrt über grünes Land, von dem die Russen vertrieben wurden. Unter Obstbäumen, die zu blühen beginnen, erwarten uns die Pferde. Meinen alten Poetenknochen trauten die liebenswürdigen und fürsorglichen Gastfreunde wohl keine übermäßigen Reitkünste zu — ich bekomme ein kleines nettes kugelrundes und gutmütiges Räpplein, ein russisches Beutepferd. In welcher Steppe mag es das Licht der Welt erblickt haben? Das Gäulchen, während ich mit ihm schwatze und seine Nüstern streichle, sieht mich verständnisvoll an. Hat es schon Deutsch gelernt? Ruhig und sicher trägt es mich über den steilen Berghang hinauf und klettert s geschickt über die Lehmstufen und über die Prügelwege, als hätte ihm eine Tiroler Gemse das Bergsteigen beigebracht.
Hoch droben, bei einer Wendung des Weges, quillt mir ein Laut der Bewunderung über die Lippen. Ich sehe viele Meilen weit hinaus über ein breites sanft gehügeltes Tal von unbeschreiblichem Reiz. Felder und Wälder, Städtchen und Dörfer, alles von Sonne blitzend, alles wie feinste Ziselierarbeit des Schöpfers; und alle Nähe und Ferne ist miteinander verbunden durch das gleißende vielfach gewundene Silberband des Dunajec! In der Weite buckeln sich die schwarzblauen Hügelzüge empor, einer hinter dem anderen, wie die meisterhaft gestellten Kulissen einer Schaubühne. Immer höher wachsen sie gegen den Himmel empor, bis das wundersame Bild in der Ferne abgeschlossen wird durch die höchste Kette der Karpaten mit ihren verschneiten Gehängen und ihren milchweißen Schimmergipfeln. — Land von Habsburg, wie schön bist du!
Der Himmel ist klar, doch immer donnert es, als hinge unsichtbar ein schweres Gewitter in den Lüften. Mein Rößlein klettert, nun wendet sich der Weg, und ich sehe ein Bild, das mich erfreut bis ins Herz. Höher als der Waldkamm, über den ich hinüberreite, hebt sich da drüben mit steilem Kahlgehänge ein breiter Bergwall in die sonnige Luft hinauf. Hinter ihm ist nichts mehr zu sehen, nur dieses dröhnende Blau. Ader der ganze Steilhang wimmelt von Leben, ist besät mit hundert, nein, mit tausend kleinen, graublauen Punkten, die sich bewegen, sich sammeln und wieder auseinandergleiten. Wie flinke schillernde Käferchen sehen sie aus; aber während ich näher komme, wachsen sie, werden schlanke, aufrechte Männer und Jünglinge, sind österreichische Soldaten, sind die Kaiserjäger von Meran und Bozen — eins von den vier mit Edelweiß geschmückten Tiroler Regimentern, denen die Russen aus hart empfundenen Gründen den Namen „Die Blumenteufel“ gaben. Zwischen den vielen, völlig in den Berg hineingewählten Unterständen schreiten sie hurtig auf dem Steilhang hin und her, sammeln sich in Gruppen um die Feldküchen, sitzen in Reihen und speisen bedächtig nach Tiroler Bauernart, liegen im Gras und schlafen, hocken zu dreien beisammen und summen ein Liedchen ihrer Heimat, oder kauern auf einem Baumstock und kritzeln über dem Knie eine Feldpostkarte. Ich höre ihr heiteres Lachen, höre ihre Sprache, die mir lieb und vertraut ist wie ein Klang der eigenen Heimat. Und wo die führenden Offiziere mit mir vorübergehen, straffen sich die prächtigen Kerle auf, und aus den glänzenden Augen der gesunden, von Schnee und Sonne verbrannten Gesichter blickt eine freundliche Neugier. An keinem von ihnen ist eine verwildernde Wirkung des Krieges wahrzunehmen, sie sind im Soldatenrock die gleichen geblieben, die sie daheim in der Bergjoppe waren. Und wo sie stehen und leben, wo sie schlafen und essen, mitten zwischen ihren Tischen und Unterständen, dicht neben dem ruhigen Atem ihrer frohen Kraft, liegt der pietätvoll geschmückte Soldatenfriedhof ihres Regiments. Ein Künstler aus dem Volke, ein Bildschnitzer, hat für jedes Grab ein hölzernes Marterl geschnitten, jedes anders, jedes mit einer sinnigen Deutung. Ein Grab steht offen und wartet. Ich frage einen Schwarzbärtigen, der bei der Feldküche sein Blechschüsselchen füllen ließ: „Wer kommt da hinunter?“ Ruhig sagt er: „Dös woaß ma no nit. Taat’s ebba mi treffen, und‘s waar guat für ünser Landl, in Gottes Namen halt!“ Er bekreuzt die braune Stirn und trägt den dampfenden Erdäpfelschmarren mit dem festen Brocken Rindfleisch zu seiner Erdhöhle und hockt sieh nieder auf ein sonniges Flecklein. Wie dieser Eine ist, so sind die Tausend, die graublau den kahlen Berghang des „Wal“ überwimmeln.
Abseits von den vielen, halb versteckt zwischen knospenden Stauden, sitzen einzelne, den Oberkörper nackt bis zum Hosenbund hinunter. Jeder von ihnen beschäftigt sich mit der gleichen Sache, hat das ausgezogene Hemd auf dem Schoß liegen, untersucht es aufmerksam, hebt es manchmal gegen die Sonne und macht dann mit zwei Fingern einen flinken Griff. Einer bemerkt, dass ich ihm zusehe, und wird blutrot übers ganze Gesicht. „Geh“, sag ich, „deshalb brauchst du doch nicht verlegen zu werden!“ Er lacht ein bisschen: „No jo, ´s ischt wohr, aber schenieren tuat ma si holt doch! A richtiger Mensch ischt allweil an Reinlachkeit geweant. Was üns die Russen über die Grenz ummibracht hobn — da muaß eahnen ünser güatiger Herrgott vill verzeich’n!“
Immer Dröhnen die Granatenschläge, und ruhelos knattern die Gewehrschüsse von einer Stelle her, die hinter der Kappe des Berges liegt. Alle Runsen des Ganges sind noch angefüllt mit großen Schneeflecken, durch die wir waten müssen. Nun tauchen wir über den Kamm der Höhe hinüber und sind im Schützengraben. Mannstief ist er in den Bergboden eingeschnitten; auf und nieder steigend, klettert er zur Linken und zur Rechten über das Gebirge hin, nach beiden Seiten ohne Ende, unübersehbar. Bei den Scharten stehen die Graublauen Mann an Mann, mit den schussbereiten Gewehren in den klobigen Fäusten, mit aufmerksamen, heißfunkelnden Späheraugen. Beim ersten Blick über diese hartköpfige Mannsreihe überkommt mich das gleiche Gefühl der Sicherheit und Ruhe, wie ich es an der westlichen Front in jeder Stellung empfunden habe. Der Graben, erst nach Beginn der Schneeschmelze vollendet, ist eine verlässliche, unbezwingbare Erdfestung. Die Beweise liegen unterhalb der Drahtverhaue aus dem steilen Gehäng umher — sie sehen wie bräunlichgraue Aschensäcke aus, die ein nachlässiger Fuhrmann verlor. Erst durch das Glas erkennt man, dass es tote Menschen in braunen Mänteln sind, gefallene Russen, die Opfer eines nutzlosen Sturmversuches. Als sie fielen, versanken sie im tiefen Bergschnee; jetzt hat der warme Frühling ihr weißes Leichentuch fortgeschmolzen, und die Versunkenen sind wieder an den Tag gekommen, mit so gelben Gesichtern, dass man sie für Japaner halten könnte, wenn sie etwas zierlicher wären.
In der Tiefe drunten beginnt ein schmales, von kleinen Wäldchen durchwürfeltes Wiesentat zu grünen. Zerschossene, halbverbrannte und noch ganze Bauernhäuser stehen im Tal umher, alle verlassen und still. Und drüben steigen die waldigen Berggehänge wieder empor, durchwühlt von den gelben Wallstrichen der russischen Gräben. Granate um Granate schlägt da drüben ein, über den feindlichen Verhauen plagen die Schrapnellgeschosse zu Rauchballen, die halb weiß und halb rot sind; und zerriss ein Mörsergeschoss das Dach eines russischen Unterstandes, will da drüben ein Häuflein der Überlebenden entspringen, dann tacken flink die Maschinengewehre der Kaiserjäger, und ein hurtiges Schussgeknatter fliegt über die Reihe der fleißigen Tiroler hin. Dann ist es wieder leer da drüben; es rollen nur noch ein paar bräunlichgraue Klümplein von der feindlichen Kappe gegen der Waldsaum herunter, bleiben in der Sonne liegen oder verschwinden hinter einem Busch· — Menschen verbluten, Menschen sterben. Aber die Zeit ist so, dass man sich freuen muss darüber, weil es Feinde waren.
Während wir hinsteigen durch den Graben, hört man immer wieder ein kurzes und scharfes Kleschen — so klang es immer in unserer Bubenzeit, wenn wir die Gewehrkapseln auf den Steinen zerschlugen. Es ist der Einklatsch der feindlichen Kugeln in den Grabenwall. Keiner von den Graublauen achtet dieses Geräusches. Ich schwatze mit vielen. In allen ist die gleiche Ruhe. Von keinem hör‘ ich eine Klage oder einen Zweifel. Einer sagt: „Hart ischt‘s woll, aber mier verkraften‘s leicht.“ In einem sonnigen Grabenwinkelchen sitzen drei und spielen mit abgegriffenen Karten ein „Preseranzl“. Ich frage, warum sie nicht bei den Gewehren stehen? Weil sie Ablösung und Rastzeit haben. „Seht ihr da nicht hinaus zu den Unterständen?“ Alle drei schütteln den Kopf, und einer antwortet: „Mier bleiben lieber. Draußen kunnten mer ebbes versaumen!“ Das gilt mir als das beste von allen Zuversichtsworten, mit denen dieser Tag mich beschenkte. Wenn die Stunde der Entscheidung kommt, werden die Kaiserjäger nichts versäumen.
Der Tag sank einem leuchtenden Abend entgegen, als wir hinunterritten ins Tal. Auf dem ganzen Rückwege ging‘s immer vorüber an einer endlosen Karawane von Saumtieren, welche Balken und Stacheldrahtrollen, Wolldecken und Zelttücher, Geschirr und Holzwolle, Reis- und Kartoffelsäcke, Wasserbutten und Weinfässer, Brot, Konserven, Gefrierfleisch und viele, viele Kisten mit Patronen herausschleppten über den steilen Hang. Solch ein Karawanenbild muss man gesehen haben, um zu ahnen, welch einen immensen, für den Laien fast unausdenkbaren Berg von Schwierigkeiten der Krieg auf diesem Boden dem Heer und der Heeresleitung bereitet. Ein Grauen überrieselt mich bei dem Gedanken an die Nachtstürme und an die übermannstiefen Schneemengen des Karpatenwinters. Auch jetzt noch, im Frühling, können ein paar grobe Regentage diese Lehmwege so grundlos und unpassierbar machen, dass alle Verpflegung stockt, jede Truppe in Not gerät und auch das beste Beginnen versagen muss. Und wie leicht ist uns zu Hause die krittelnde Frage geworden: „Warum geht es da so langsam vorwärts?“ Auf solchem Boden bedeutet es in widrigen Wetterzeiten schon einen ruhmvollen Sieg, wenn es gelang, die Tage und Wochen der Gefahr zu überdauern und die hart bedrängten Kräfte wieder aufzufrischen für eine neue, mutige Tat! —
Scheine, du liebe Sonne! Bleibe den Unseren treu und hilfreich!
Groß, ein goldroter Feuerball, hängt sie strahlend im reinen Schimmer des westlichen Abendhimmels, schon nahe dem Grat der schwarzgewordenen Waldberge. Nun berührt sie die Wipfelsäge der fernsten Höhe, ihre Gestalt verändert sich, wird zu einem riesenhaften blutfarbenen Ei — und jetzt, gemildert durch einen zarten Baumschleier, leuchtet sie uns schön und verheißungsvoll entgegen wie ein in Freude lachendes Glanzgesicht.
1 Siehe die Karte von Westgalizien am Schluss des Buches.