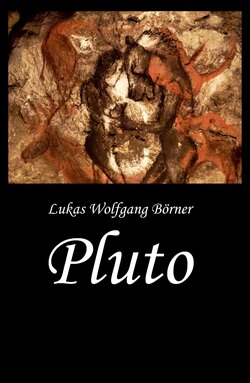Читать книгу Pluto - Lukas Wolfgang Börner - Страница 5
ОглавлениеI.
Sagte ich es nicht? Ich wusste doch, dass ihr mich kennt!
Die Geschichte vom Zauberamulett, mit dem ein Jäger, wann immer er möchte, Tiergestalt annehmen kann, ist ja bereits bis zum Land der grün tanzenden Lichter vorgedrungen. Das wurde mir zumindest so erzählt.
Es ist die Geschichte, die am besten bei den Leuten ankommt, aber Elian, der Mächtige, weiß, dass es durchaus nicht meine beste Geschichte ist. Denn die beste Geschichte ist jene, die von meinem eigenen Leben handelt und die ich euch, sofern ihr Lust darauf habt, erzählen will. Und ja, ihr dürft euch freuen, denn ihr werdet die Einzigen sein, die sie je von der Zunge des Geschichtenerzählers zu hören bekommen. Denn im Anschluss an meine Erzählung werde ich mein Herz zum Stillstand bringen.
Doch, so wird es passieren. Nein, nein, nein, ich will jetzt keine Widerworte hören!
Ich habe den Entschluss nicht eben jetzt und aus einer Laune heraus gefasst, sondern tatsächlich schon vor vielen Monden. Jeden Morgen bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, was mich wohl am glücklichsten machen würde. Ob ich Lust hätte, jagen zu gehen oder Fischfallen zu basteln, ob ich Lust hätte, mich in der Herbstsonne zu erquicken oder mich umzubringen. Oder ob ich nicht lieber mein Flötenspiel verbessern wollte.
Diese Nacht werde ich nun endlich ein Leben beenden, das schon lange keinen Wert mehr besitzt. Ich werde ein Leben beenden, das ich schon damals hätte beenden sollen. Damals, als Wilder Schwan geopfert wurde. Das wäre ein stimmiger Tod gewesen und ich hätte gemeinsam mit meiner Liebsten den Weg ins Innere des gewaltigen Eispanzers antreten können. Ja, das wäre der rechte Zeitpunkt gewesen. Und eines Geschichtenerzählers würdig. Nun aber habe ich ihn versäumt.
Deshalb bitte ich euch: Versagt mir nicht diesen letzten Funken Frohsinn. Die Geschichte von Wilder Schwan und mir – diese wundersame Geschichte von heiß züngelnder Liebe, rauchspeiender Auslöschung und eisiger Unterwelt – zu erzählen, ist die letzte Tat, die meinem glücklosen Leben noch einen Sinn zu geben vermag. Also beerdigt eure falsche Menschlichkeit und lasst nicht zu, dass mich die Enttäuschung auch im Sterben noch heimsucht. Im Übrigen sind die Kochsteine schon lange heiß und die Suppe wartet.
Mein Name ist Gefleckte Hyäne. Meine Mutter hatte den Wunsch, mich so zu nennen, aufgrund meiner hyänenhaften ersten Laute und der Sommersprossen, die ich offenbar bereits als Säugling besessen habe. Mein Vater – der Anführer und beste Speerwerfer unseres Stammes – war zufrieden. Er hatte Wölfe und Hyänen zeit seines Lebens für Wiedergeburten des Menschen gehalten, gewiss aufgrund ihrer Art, sich wie Menschen zusammenzurotten, strategisch zu jagen und Gräser als Nahrung zu verschmähen.
Meine Heimat liegt unzählige Tagesreisen entfernt in Richtung der aufgehenden Sonne. Wälder, wie ihr sie besitzt, kennt man dort nur aus Erzählungen. Euer Feuer ernährt sich, wie ich sehe, ausschließlich von Holz – bei uns wurde das kostbare und äußerst seltene Birkenholz im Bestfall zum Anfeuern verwendet. Danach mussten die Flammen mit getrockneten Tierknochen am Leben erhalten werden.
Und doch will ich nicht jammern. Verglichen mit dem Leben unserer Ahnen war unser Alltag geradezu beschaulich. Die Sommer wurden von Jahr zu Jahr länger, die Flüsse schmolzen immer früher im Jahr und zuweilen regnete es sogar. Wir besaßen nicht weniger als neun tüchtige Jagdhunde und litten keinen Hunger.
Unser Stamm war immer in Bewegung. Immerfort zogen wir den Mammuts hinterher, verloren den riesigen Eispanzer jedoch niemals aus den Augen. Ich nehme an, dass auch ihr ihn schon gesehen habt, gleichwohl er von hier aus relativ weit entfernt liegt. Hm? Die Jüngeren nicht?
Seid unbesorgt. Ihr werdet ihn auf euren ersten größeren Wanderungen erblicken. Und es wird euch die Sprache verschlagen und Tränen der Gottesfurcht werden euch in die Augen steigen. Stellt euch einen riesigen weißen Hang vor, höher als alle Berge, die ihr je gesehen habt, ausufernder als jede Steppe und jedes Grasland, das ihr jemals betreten werdet, und gleißender noch als das Winterfell des Fuchses.
Das aber ist das Reich Gilmors, des Totengottes, der die Seelen der Menschen wie Pferde in einem Talkessel zusammentreibt. Ich bin schon einmal dort gewesen und habe Dinge gesehen, die mir kein lebender Mensch jemals glauben wird und bei deren Vorstellung allein die Organe meines Leibes zu vereisen beginnen.
Und doch gibt es keinen Weg zurück. Noch bevor Pafal, der Kraftspender, seinen Rundgang beginnt, werde ich Gilmors Reich betreten.
Wilder Schwan fiel mir das erste Mal in unserer Kindergruppe auf. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt oder irgendetwas Vergleichbares. In unserem Stamm war es auf jeden Fall üblich, die vier bis sechs, manchmal auch sieben Kinder immer morgens für einige Zeit in einem eigens hierfür aufgestellten Tipi spielen und malen zu lassen. Das hatte den Vorteil, dass nur eine Mutter aufpassen musste und die anderen derweil auf Nahrungssuche gehen konnten. Das Tipi war groß und breit, aber keine Schönheit. Die uralten Fetzen von Bären- und Rinderleder, aus denen es bestand, waren nur notdürftig zusammengeflickt und die Fellisolation der Wände fehlte vollends. Der Sinn daran war, die Kinder spielerisch an die Kälte der Welt zu gewöhnen – und tatsächlich tobten wir stets so ausgelassen herum, dass uns die Kälte kaum störte.
Diese alltäglichen Vormittage gehören zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Ich mag wohl erst zwei oder drei Sommer gezählt haben, aber ich weiß noch genau, wie ich bereits beim Morgengebet vorfreudige Blicke mit den anderen Kindern tauschte, ohne mich vom Gejodel und Gerassel des Druiden weiter beeindrucken zu lassen. Mein Vater hatte mir, nebenbei bemerkt, früh schon den Unterschied zwischen der Lobpreisung Berimas im gemeinschaftlichen Rundzelt und der inneren Einkehr erklärt.
„Berima“, sagte er einmal und zeichnete mir eigenhändig die drei Beschützerlinien auf die Stirn, „ist die Heiligste und Gewaltigste aller Gottheiten. Alles Lebende ist in ihrem Inneren entstanden und alles Leblose kehrt in ihr Inneres zurück. Das ist der Grund, warum man auch nur im Inneren zu ihr sprechen kann. Der Druide leiert seine Lobrede in die Lüfte und erreicht damit durchaus das Bewusstsein und im Bestfall auch die Eintracht des Stammes – Berima aber, unsere gute Mutter Erde, erreicht er damit nicht.“
Aber ich schweife ab.
In unserem Kindertipi gab es alles, was man sich nur wünschen konnte: Einen Ball aus Schweinedarm zum Hin- und Herwerfen, Stöcke, Kugeln, Strohpuppen, schwarze Rußstifte, mit denen man die Wände oder sich selbst bemalen durfte und – das Tollste – Spielfiguren! Da gab es Pferde, Hirsche, Bisons, Mammuts, Nashörner und sogar einen aus Stoßzahn geschnitzten Löwen, mit dem jeder von uns spielen wollte und dessentwegen mich Wilder Schwan an einem meiner ersten Kindergruppentage bereits blutig schlug.
Ja, wirklich!
Ich glaube, es war eine Steinkugel, die sie mir auf die rechte Augenbraue knallte, bevor sie von Fliegender Stern, unserer Betreuerin, mit einem derben Kniff ins Genick zurechtgewiesen wurde. Das war die übliche Strafe für Vergehen dieser Art. Bei schlimmeren Vergehen wurde man mitunter vom Mittagessen ausgeschlossen, das je nach Jahreszeit aus Beeren, Schlehen, Nüssen oder Pilzen bestand – und natürlich einem großen Schluck aus der Brust der jeweiligen Betreuerin.
Ich weiß noch, dass ich Wilder Schwan lange Zeit für einen Jungen hielt, weil sie nicht wie Gelbes Fünfblatt und Nasenantilope, die die Tochter von Fliegender Stern war – und ihren Namen tatsächlich ihrer großen Nase verdankte –, mit Puppen spielte, sondern immerzu jagen wollte. Und wenn es mit dem beliebten Löwen nicht ging, dann ergriff sie einen Stecken und rief: „Hey, Kleiner!“
Ich blickte mich um, weil ich dachte, sie meinte jemand anderen – aber hinter mir stand niemand.
„Ich bin doch größer als du“, gab ich zur Antwort.
„Her mit der Klinge!“, befahl Wilder Schwan und ich sah, dass ihre gletscherblauen Augen gefährlich glitzerten. Schnell ergriff ich einen Knochensplitter auf dem Boden und reichte ihn rüber.
„Und Klebepech!“, donnerte sie und streckte ihre schwarzen Finger aus. Ohne darüber nachzudenken, beugte ich mich über ihre Hand und spuckte hinein.
„Uääh!“, machte sie und wir beide lachten.
Wilder Schwans Mutter war bei ihrer Geburt gestorben. Ihr Vater und ihre Großmutter, die sich die Erziehung des Mädchens seither teilten, waren ihre einzigen Verwandten. Als die Großmutter starb, waren die heiteren Tage der Kindergruppe vorbei – die Zeit der Nahrungssuche mit den Müttern hatte begonnen.
Noch drei oder vier Monde nach der Beerdigung ihrer Großmutter trottete Wilder Schwan mürrisch hinter Fliegender Stern und ihrer Tochter her, zupfte absichtlich unreife Beeren von den Sträuchern und blieb, wann immer sie an den Grabhügeln vorüberkam, stehen, wo sie sich die Lippen blutig biss und nicht bereit war weiterzugehen.
In jener Zeit hörte ich viele Erwachsene über Wilder Schwan und ihren Vater sprechen, teils aufrichtig mitleidig, in den meisten Fällen aber Mitleid heuchelnd oder geradezu abfällig. Ich verstand ja nicht, was da geredet wurde, aber ich spürte, dass da … nun, wie soll ich es sagen? … eine unsichtbare Linie zwischen jenen beiden und dem Rest des Stammes gezogen wurde. Und ich spürte, dass die Aura dieses Mädchens, das ich nach wie vor für einen Jungen hielt, der dunkelvioletten Distel entsprach. So nannte ich sie denn auch, wann immer ich die Freundschaftsbande zu anderen Kindern stärken wollte.
Entschuldigt, dass ich unterbreche – aber sagt mal, ist das Riesenhirsch in der Suppe? Echt?! Das gibt’s doch nicht! Wie im Namen der Götter habt ihr den erwischt? Nur ein einziges Mal ist es einem Jäger unseres Stammes gelungen, einen Riesenhirsch zu töten, und auch nur deshalb, weil der im Eis eingebrochen war.
Ihr … treibt die Hirsche in die Wälder? Ha, und dort bleiben sie mit ihren Geweihen in den Ästen hängen! Respekt!
Aber zurück zur Geschichte.
Sicherlich fragt ihr euch, warum Wilder Schwan und ihr Vater mehr und mehr in Verruf gerieten. Ich hatte mir diese Frage nie gestellt, da ich zu jener Zeit ja kaum sieben Sommer zählte – aber ich sollte dennoch dahinterkommen.
Ich war nun schon ein kleiner Jäger. Mein Haar war braun und borstig und reichte mir bis über die Brust. Die Milchzähne hatten scharfen Fleischzähnen Platz gemacht und meine Körpergröße entsprach bereits der meiner Mutter. Meine Tage verbrachte ich nun an der Seite meines Vaters oder in der Schule mit den anderen Jungen, wo man uns beibrachte, Klingen anzufertigen, Feuer zu machen, Birkenpech zu gewinnen und Hunde abzurichten.
Aber ich war, wie ich schmerzlich erkennen musste, von Berima nicht gerade mit Talent gesegnet worden. Scharfe Speerspitzen oder Harpunenklingen gingen mir erst nach etlichen Fehlversuchen von der Hand und der Gebrauch von Speerschleudern ist mir, offen gestanden, noch heute ein Mysterium. Das Feuermachen fiel mir indes leichter, wenngleich es mir nur in den seltensten Fällen gelang, den mühsam hergestellten Zunderlappen beim Aufflammen des Grases vor dem vollständigen Verkohlen zu retten. Das war bitter – besonders, wenn ich die anderen Jagdlehrlinge zuvor aufgrund ihrer Langsamkeit beim Feuermachen verspottet hatte.
Der Tag der Jägerprüfung war ein schwüler Sommertag. Jeder von uns Jungen – vier waren wir an der Zahl – sollte losziehen und mit so viel Fleisch zurückkehren, dass er außer seinem eigenen Magen auch noch zwei weitere würde füllen können. Denn wer das nicht vermag, der wird bekanntlich niemals als Mann bezeichnet, geschweige denn vollends respektiert werden.
Also zogen wir los, jeder mit seinem Speer und seinem Faustkeil bewaffnet. Der Gruppenstreber trug obendrein einige wuchtige Wurfhölzer im Gepäck – und ich weiß noch, wie ich ihn dafür verachtete. Einerseits, weil ich fand, dass es unnötig war, sich derart zu plagen – größeren Jagderfolg würde man auf diese Weise auch nicht haben. Andererseits, weil ich vermutete … dass man auf diese Weise größeren Jagderfolg haben würde.
Meine Mutter drückte mich an jenem Morgen zärtlicher an sich als sonst. Es machte ihr Angst, mich so allein in der Wildnis zu wissen. Sie hielt von der Jägerprüfung ohnehin wenig, weil sie fand, dass es darauf ankäme, gemeinsam zu jagen und nicht alleine. Ihr lacht – aber das ist Frauenlogik. Frauen werden nie begreifen, dass die Jagd auf eigene Faust die Basis der strategischen Gruppenjagd bildet. Und überhaupt: Sollen denn alle Frauen und Kinder verhungern, wenn durch gewisse Unglücksfälle nur mehr ein Jäger zur Verfügung steht?
Dennoch genoss ich ihre Zärtlichkeiten, denn auch ich fürchtete mich. Nicht vor Löwen, Wölfen und Hyänen – in wildreichen Zeiten geht von denen bekanntlich keine Gefahr aus und es waren wildreiche Zeiten –, nein, ich fürchtete mich davor, die Prüfung zu vermasseln. Ich fürchtete mich davor, mich vor meinen Lehrern, meinen Kameraden und meinem Vater zu blamieren.
„Wenn du heute Nacht da draußen schlafen musst,“ – ihre Hände hielten mein Gesicht umfasst und ich sah, wie eine Träne die braune Mückensalbe aus ihrem Gesicht wusch – „dann vergiss nicht, Pollum zu bitten, dass sie dir ihr Licht schenkt. Und vergiss nicht, dass die Welt nicht untergeht, auch wenn du keinen Erfolg haben solltest.“
Ich liebte meine Mutter für diese Worte. Aber sie stimmten nicht. Denn die Welt würde untergehen, wenn ich mit leeren Händen zurückkäme. Es war einer der besten Sommer, den unser Stamm je erlebt hatte. Überall sah man das Wild in schäbig zerschlissenen Sommergewändern über das grüne Tupfenkleid der Steppe ziehen und sich die Bäuche vollschlagen, Vögel sangen in den krummen Ästen der Büsche und zahlreiche Bäche sprudelten eisfrei durch das weite Land. Wer in dieser Fülle des Sommers kein Tier zu erlegen vermag, ist ein Scharlatan und verdient, für alle Zeit aus der Gemeinschaft verstoßen zu werden.
Meine Kameraden suchten die Nähe der Bisons oder Schafsochsen, obwohl es – wie ihr wisst – beinahe unmöglich ist, denen ohne Strategie nahe genug zu kommen, um seine Waffen sinnvoll einsetzen zu können. Und tatsächlich sah ich auch bald meinen Freund, Mondenfleck, in einiger Entfernung seinen Speer nach einem ockerfarbenen Bisonkalb schleudern. Er verfehlte es um Längen, sorgte mit dieser Ungeschicktheit aber dafür, dass die Herde in Panik geriet und schließlich unter lautem Dröhnen hinter dem Horizont verschwand. Das würde Ärger geben.
Es war Makrulu, das Böse selbst, dessen Fratze nun aus meinem Gesicht grinste. Ja, es gab noch Hoffnung. Ich war nicht der Einzige, der ungeschickt war. Und vielleicht würde ich sogar der sein, der sie alle an der Nase herumführte. Eben weil ich klein beginnen wollte, und meine Augen nach Hasen, Füchsen und Hühnern zucken ließ.
Um möglichst alles anders zu machen als meine Kameraden, lenkte ich meine Schritte nicht über die Weiten der Steppe, sondern suchte die Nähe des Eispanzers, an dessen Seite ich der aufgehenden Sonne entgegenwanderte.
Aber mein Optimismus versank nach und nach in demselben Morast, in dem meine Füße versanken, denn das tauende Wasser des Gletschers hatte die Erde in ein schwarzes Moor verwandelt. Die Sonne war kaum eine halbe Strecke Richtung Himmelsmitte gewandert – als ich bereits einen meiner Schuhe verlor. Der Morast hatte mein rechtes Bein verschluckt und ich musste all meine Kräfte aufbringen, um ihm zu Hilfe zu eilen. Mit einem trotzigen Glup! gab das Monster es schließlich frei. Aber der Schuh war verloren und weder mit dem Arm noch mit dem Speer zu erreichen. Es war zum Heulen.
Nach unzähligen Versuchen, Verwünschungen und Tränen lief ich weiter, riss einige lange Gräser, Halme und Schilfblätter aus dem Boden, suchte mir einen Felsen und begann mit der Herstellung eines Ersatzschuhs. Aus je drei Halmen zwirbelte ich Schnüre, mit denen ich mir anschließend die langen Gräser und Schilfblätter um den Fuß band. Lange saß ich auf meinem Felsen, betrachtete mit einer Mischung aus Stolz und Trotz meinen Schuh und ließ meinen Blick endlich wieder nach etwas Essbarem schweifen.
Ich war in einen Hain von Sträuchern und dornenbesetzten, verkrüppelten Bäumchen geraten, in dem es unentwegt raschelte. Mein Magen knurrte. Ich dachte gar nicht mehr daran, möglichst bald ein großes Beutetier erlegen zu müssen, im Moment wollte ich nur rasch eine Kleinigkeit essen. Ich wand mich, ohne einen Laut zu machen, von meinem Felsen, legte mich flach auf den Bauch und blickte unter das Gesträuch. Zuerst sah ich nichts als welkes Laub, mit gelben und grauen Flechten verzierte Strauchwurzeln und einen kugelrunden Fliegenpilz, der sich kaum zwei Handlängen von meinem Gesicht entfernt durch das Moos schob. Dann huschte ein Lemming über die Erde, verschwand kurz in einem für meine Augen bis dahin unsichtbaren Bodenloch, tauchte wieder auf und verschwand wieder.
Ich fragte mich, ob es mir gelingen würde, ihn zu erwischen, ob ich etwa meinen Speer in das Bodenloch stoßen und ihn aufspießen könnte. Lange beobachtete ich das Treiben von zuletzt vier Lemmingen, wobei ich immer tiefer unter die Sträucher kroch, so langsam und geduldig, dass die Lemminge mir keine Beachtung schenkten. Gelb und grau waren sie, ganz wie die Flechten, mit denen sie ihren Lebensraum teilten.
Endlich war ich tief genug ins Unterholz geglitten, um meinen Plan in die Tat umzusetzen. Als die vier eben das Bodenloch passierten, ruckte ich merklich mit dem Kopf – und beobachtete mit Genugtuung, wie sich die furchtsamen Tiere allesamt in ein und denselben Eingang zwängten. Ich begab mich, so gut ich es eben vermochte, in die Hocke und stieß den Speer mit ganzer Kraft in den Lemmingbau hinein. Und tatsächlich glaubte ich, ein Quieken aus dem Leibe Berimas zu vernehmen – als ich den Speer jedoch herauszog, fand ich ihn leer vor. Nicht einmal Blut klebte an der Klinge. Ich beschloss, bis fünfmalzehn zu zählen und dann wieder zuzustechen. Aber mein Unterfangen blieb erfolglos. Noch ganze sieben Male wiederholte ich den Versuch – irgendwann mussten die Lemminge ja wieder Richtung Ausgang klettern.
Naja, sparen wir uns das – heute weiß ich, was ihr natürlich auch wisst. Dass die Lemminge ebenso wie die Mäuse mehrere Eingänge zu ihren Bauen haben und die vier mit Sicherheit längst das Weite gesucht hatten.
Ich wollte meiner Enttäuschung bereits Luft machen, als ich zwei Schuhe bemerkte, die sich durch das Dickicht tappend näherten. Es waren noch kleine Schuhe, auch die Waden unter den ledernen Hosenröhren waren noch dünn und kindlich. Das konnte nur Mondenfleck sein, denn der war der Schmächtigste von uns Schülern.
Allem Anschein nach war er gerade nicht auf der Pirsch, denn er trat so unbedacht auf, dass das Knicksen und Knacksen der Zweige von den Felsen widerhallte. Ich beschloss, ihm eine Lektion zu erteilen und einen Löwen zu imitieren.
Ich wartete, bis er ganz nah war, dann machte ich mit den Händen eine Höhle, hielt sie vor die Lippen und gab ein tiefes, stimmloses Grollen von mir, wie man es zuweilen in der Schwärze der Wintertage oder beim Klingengebirge hört. Die Wirkung blieb nicht aus. Mondenfleck versteinerte. Ich musste meinen Mund fest mit der Hand versiegeln, um mich nicht durch ein schadenfreudiges Quietschen zu verraten. Dann aber zwickte mich ein Gedanke – und meine Freude verpuffte.
Was, wenn Mondenfleck sich mit seinem Speer verteidigen würde? Was, wenn er meinen Standort bereits herausgehört hatte und nur mehr auf ein Rascheln oder eine andere Bestätigung seiner Vermutung wartete, um mir vermeintlichen Löwen den Speer durchs Genick zu treiben? Das war, länger darüber nachgedacht, im Grunde sogar das Vernünftigste, was er machen konnte.
Eigentlich hatte ich aufspringen und meinen Freund mit einem lauten Bah! erschrecken wollen, nun aber war ich ebenso wie er versteinert.
Ich könnte etwas sagen, mich als Mensch bemerkbar machen, dachte ich. Das allerdings kann meinen Tod bedeuten, denn Mondenfleck wird bei der ersten Bestätigung meines Standorts zustechen, schneller noch, als er das Gehörte verarbeiten kann.
Ich entschied mich, keinen Laut von mir zu geben, sondern zu warten, bis er weiterziehen würde. Aber ach! ich hatte nicht mit meinem hungrigen Bauch gerechnet. Nach kaum zwölf Atemzügen, die ich so still und langsam tat, wie es mir eben möglich war, heulte mein Bauch so laut auf, dass ich instinktiv Augen und Zähne zusammenpresste und die Hände vor meinen Nacken hielt. Aber es war kein Speerhieb, den ich empfing. Es war eine Stimme, die ängstlich und feierlich zugleich klang.
„Großer Elian, bist du das?“
Mondenflecks Stimme war das nicht.
Ich fuhr hoch. Die Zweige des Gesträuchs kratzten mir das Gesicht blutig, aber ich spürte es gar nicht. Ich blickte nur mit offenem Mund auf Wilder Schwan, die mich ihrerseits mit offenem Mund betrachtete. Enttäuschung und Erleichterung wechselten sich in dem von Salbe gänzlich gebräunten Kindergesicht ab.
„Ach, Gefleckte Hyäne – ey!“, sagte sie endlich.
Ich konnte gar nichts sagen. Ich blickte nur auf das Fellsäckchen, das sie am Arm trug. Und auf die Fliegenpilze darin.
Wilder Schwan folgte meinem Blick. Rasch zog sie das Fellsäckchen zu, erkannte aber schon währenddessen die Sinnlosigkeit dieser Tat. Sie war verraten. Einen letzten kläglichen Versuch, ihre Lage zu verbessern, unternahm sie dennoch: „Weißt du, was das für Pilze sind? Kann man die essen?“
„Nein“, sagte ich. „Das weiß doch jedes Kind.“
„Ach so,“ erwiderte sie. „Dann kann ich sie ja wieder wegwerfen.“
Ich wartete. Sie rührte sich nicht.
„Dann wirf sie doch weg“, sagte ich.
„Mach ich nachher“, sagte sie.
„Warum nicht jetzt?“
„Weil ich’s nachher mache.“
Ich blickte in die eisigen Gletscher ihrer Augen. Wie oft hatten ich und meine Freunde doch schon über Wilder Schwan gelästert und wie oft hatten wir auf sie gedeutet, wenn sie mit den Frauen vorbeigetrottet war. Aber in diese Augen, in diese abgrundtief schönen Augen hatte ich lange nicht mehr geblickt.
Dann fragte ich etwas, was ich nicht fragen wollte: „Wieso gehst du nicht mit in die Schule?“
Ich erwartete eine verschämte oder aggressive Erwiderung, immerhin konnte der Grund ja ausschließlich ihre Familiensituation sein – doch das Gegenteil war der Fall.
„In die Schule?“, lachte sie. „Was soll ich denn da?“
Ich erwiderte nichts. Ich fragte mich, ob ich mich gerade lächerlich gemacht hatte. Und ich fragte mich, warum es für mich so unerträglich war, mich vor Wilder Schwan lächerlich zu machen.
„Hast du Jägerprüfung?“, fragte sie.
„Ja“, sagte ich.
„Schon Erfolg gehabt?“, fragte sie.
„Nein“, sagte ich.
„Bist du talentlos?“ fragte sie.
„Hau ab!“, sagte ich.
Ich drehte mich um und entfernte mich einige Schritte. Und verfluchte mich noch im selben Moment, denn nun konnte Wilder Schwan meinen provisorischen, zur Hälfte bereits zerfledderten Schuh sehen.
„Ich wäre bestimmt ein besserer Jäger als du“, rief Wilder Schwan.
„Lass mich in Ruhe!“, gab ich zur Antwort und trampelte weiter Richtung Morgen. „Ach so, dort unterm Strauch steht übrigens noch ein Fliegenpilz – lass dir’s schmecken!“
Eine Weile war es still. Dann hörte ich Wilder Schwans Schritte hinter mir.
„Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich kann mit dem Speer umgehen.“
„Das kann ich auch“, erwiderte ich, ohne sie anzusehen.
„Das mit den Pilzen darfst du niemandem erzählen. Sonst ist der gute Ruf meines Vaters ruiniert.“
„Welcher gute Ruf?“, lag mir auf den Lippen. Aber ich sagte es nicht.
Bitte seht es mir nach, liebe Freunde, dass ich euch einige abstoßende Details über das Berauschen mit Fliegenpilzen verschweige. Dass man nicht mehr Herr seiner Sinne und Worte ist, dass man unter Lebensgefahr erbeutete Speisen wieder hervorwürgt und – ja, ihr werdet gewiss schon davon gehört haben – seine Körperflüssigkeiten zu trinken beginnt, sind tatsächlich keine Lügengeschichten.
Meine letzte Erzählung soll aber keine Hässlichkeiten enthalten und ich will meinen lange schon verstorbenen Schwiegervater nicht mit schimpflichen Behauptungen entehren. Außer seiner Tochter hatte er keinerlei Verwandte in unserem Stamm. Er, seine Frau und seine Mutter waren drei der wenigen Überlebenden des entsetzlichen Makrulu-Winters gewesen und kurz vor Wilder Schwans Geburt bei uns aufgenommen worden. Er fühlte sich einsam und unglücklich, berauschte sich zunehmend mit Pilzen, konnte immer häufiger nicht mehr an den Jagden teilnehmen, musste mitversorgt werden, wurde noch unglücklicher, berauschte sich noch mehr und so weiter und so weiter.
Das Beste, was ich hätte tun können, wäre gewesen, kehrtzumachen und das Thema mit den Fliegenpilzen meinen Eltern zu erzählen. Die hätten das Problem im Rundzelt mit den Ältesten erörtern und dem armen Mann wieder auf die Beine helfen können. Aber genau das tat ich nicht.
Somit trage ich eine Teilschuld an dessen Tod und an Wilder Schwans weiterem Lebensweg.
Am Absturz zur Schlucht turtelten zwei Tauben im Geäst. Der Eispanzer hatte eine breite Schneise in die Landschaft gefressen, statt seiner schlängelte sich in diesem Sommer aber ein trübtürkiser, laut brausender Bach durch das Felsental.
„Schau, wie beschäftigt der Tauberich ist“, sagte Wilder Schwan, als wir uns den Vögeln auf vielleicht zweimalzehn Schritte genähert hatten. Und tatsächlich scherte er sich nicht im Geringsten um uns. Wir beobachteten ihn, wie er um sein Taubenliebchen herumflatterte, seinen schönen, unwetterfarbenen Hals blähte und wieder und wieder dasselbe Liedlein gurrte: Huhuhu huhu, huhuhu huhu.
„Darf ich ihn töten?“, wisperte Wilder Schwan, sowie sie neben mir in die Hocke gegangen war.
Der Gedanke, Wilder Schwan könnte mit meinem Speer Erfolg haben, war mir unerträglich. Allerdings weit weniger unerträglich, als mich meinerseits vor ihr zu blamieren. Also musste ich es schaffen … nun ja … dass sie sich vor mir blamierte.
„Kannst du denn nur eine von beiden töten?“, spöttelte ich. „Ich habe in der Schule schon drei Tauben mit einem Wurf durchbohrt.“
Ich knirschte stolz mit den Zähnen, als ich ihr meinen Speer überreichte. Keine Ahnung, ob Wilder Schwan mir glaubte – in jedem Fall gefiel ihr die Idee, beide Tauben gleichzeitig niederzustrecken.
„Es wäre ja auch traurig, wenn einer übrigbleiben würde“, flüsterte sie, sowie sie meinen Speer in den Händen wog.
„Wieso?“, fragte ich.
„Na,“ – sie runzelte die Stirn – „weil sich die beiden so liebhaben.“
Ich weiß noch, dass ich diese Logik nicht verstand. Wieso sollte es denn besser sein zu sterben, als ohne seinen Liebling weiterzuleben? So traurig das Leben auch eine Zeitlang sein würde – irgendwann würde es schon wieder bergauf gehen. Der Tod aber würde keinem von beiden nützen.
Ja, so dachte ich. Und wisst ihr warum?
Weil ich jung und dumm war und die wahre Liebe noch nicht kannte.
Langsam näherten wir uns den Tauben, blieben dabei aber immer in der Hocke und achteten peinlich darauf, die Stetigkeit unserer Bewegungen nicht durch einen raschen Seitenblick oder irgendwelche Gesten zu unterbrechen. Aber ich glaube, wir hätten ihnen auch fest entgegentreten und dabei jodeln können – die Tauben waren ja ganz mit sich selbst beschäftigt.
Wilder Schwan kniff die Augen zusammen, zielte bemerkenswert fachkundig und – versteinerte.
„Was ist?“, wisperte ich.
„Ich muss doch warten, bis er vor ihr sitzt“, gab Wilder Schwan durch die Zähne zurück.
„Oder hinter ihr.“
„Ich glaube, sie ist aufmerksamer als er. Besser, ich warte, bis er ihr die Sicht versperrt.“
Also warteten wir. Der Tauberich gurrte, ruckte mit dem Kopf, näherte sich seiner Liebsten immer wieder und entfernte sich. Auf den gewünschten Zweig vor ihr setzte er sich aber nicht. „Das kann ja ewig dauern“, nörgelte ich in mich hinein. Meine Oberschenkel schmerzten von der langen Hockerei und ich hatte – wie ihr wisst – ohnehin kein Interesse an einem Jagderfolg ihrerseits.
Wilder Schwan fixierte ihre Beute und atmete dabei so leise, dass ich mich fragte, ob sie überhaupt atmete.
Ich unterbrach die Stille mit dem jähen, wenn auch gedämpften Ausruf: „Jetzt! Jetzt sitzt er vor ihr!“
Tatsächlich hatte der Tauberich allein den Kopf vor die nackten Füße seines Weibchens gestreckt, doch Wilder Schwan tappte mir in die Falle. Mit einem kräftigen Stoß ließ sie den Speer fliegen – und es war offensichtlich, dass sie dies nicht zum ersten Mal in ihrem Leben tat.
Den Tauberich aber verfehlte sie. Der flatterte geräuschvoll auf, während der Speer die Brust seiner Angebeteten durchbohrte und sie mit sich fort in den Abgrund riss. Wir standen da wie festgefroren und konnten uns erst rühren, als wir den Speer mehrmals in der Schlucht aufschlagen hörten.
„Du bist ja dumm!“, rief ich und mimte den Geschädigten.
Wilder Schwan sah beschämt aus. „Das wollte ich nicht.“
Wir bahnten uns einen Weg durch das Gebüsch, in dem die Vögel geturtelt hatten. „Soll ich dort runtersteigen?“, fragte Wilder Schwan. Wir standen am Abgrund und suchten mit den Augen die Klippen ab.
Aber wir erblickten nicht allein den Speer mit der aufgespießten Taube, der dort unten, im Uferkies des Baches, steckte. Ach, es war entsetzlich! Neben ihm war der Tauberich gelandet, betrachtete mit aufmerksamen Seitenblicken seine Liebste und ruckte gleichsam träumend mit dem Kopf, als wollte er das Geschehene nicht wahrhaben.
Es war schon Abend, als wir den Bach erreichten, denn wir hatten auf dem Weg nach unten einige Umwege nehmen müssen. Zwei- oder dreimal waren wir gezwungen gewesen, uns an den Händen zu fassen, um nicht abzustürzen – und ich weiß noch genau, dass ich es schön fand, ihre warme Hand in meiner zu halten.
Erst jetzt suchte der Tauberich das Weite. Ich hob den Speer auf. Die Klinge war abgebrochen.
„Und was machen wir jetzt?“, stöhnte ich.
Wilder Schwan grinste. „Was sollen wir schon machen? Wieder hochsteigen und heimgehen, bevor’s dunkel ist.“
Ich tappte unentschlossen von einem Fuß auf den andern. „Ich kann noch nicht zurück. Mit nur einer Taube kann ich meinen Lehrern nicht unter die Augen treten.“
„Wie viel brauchst du denn?“
„Nahrung für wenigstens drei Mäuler.“
Gespannt beobachtete ich, wie Wilder Schwan zum Wasser schlenderte, in die Hocke ging und trank. „Na gut“, erwiderte sie endlich und spreizte die Hand zum Jägergruß. „Dann viel Glück dir. Mögen die Jagdgötter dir zur Seite stehen.“
Das war das letzte, was ich hören wollte. Wie ein niedergebrannter Baum stand ich da und musste zusehen, wie Wilder Schwan die Felsen wieder emporstieg.
„Du hast meinen Speer kaputtgemacht!“, plärrte ich ihr hinterher.
„Was?“ Wilder Schwan drehte sich um.
„Meine Klinge ist weg. Und das ist deine Schuld!“
Ich muss gestehen, dass ich eine gewisse Genugtuung empfand, Wilder Schwan damit offensichtlich verwundet zu haben. Für solcherlei Speerwürfe hatte ich Talent.
Um ihre Augen herum, wo keine Salbe war, konnte ich ihre Haut erröten sehen. „Weißt du was?“, fuhr sie mich an. „Du bist der dümmste Jäger, den ich kenne. Dein Speer ist genauso wie dein Schuh – das Werk eines Versagers.“
Das ließ ich nicht auf mir sitzen. Ich schleuderte den Speer in den Kies, stürmte auf sie los und stieß sie um. Sie sprang aber gleich wieder auf die Beine, packte mich bei Haar und Ohr und riss so heftig daran, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Wir stürzten auf den Boden, zerrten, schlugen und verprügelten uns, dass unser Gekreisch und Gekeuche die Schlucht gänzlich erfüllte. Nur einmal hielten wir inne, als wir ein Bärenjunges bemerkten, das hoch oben auf den gegenüberliegenden Felsen stehen geblieben war, um zuzusehen. Erst auf den Ruf der Mutter reagierte es und trottete widerwillig weiter.
„Hast du das gesehen?“, rief ich. Wilder Schwans Gletscheraugen funkelten. Dann fielen wir wieder übereinander her, verprügelten uns nach Strich und Faden, bis wir endlich, endlich voneinander abließen, uns auf verschiedene Steine setzten und unsere Wunden versorgten. Ich trug vier blutige fingerlange Kratzer im Gesicht und Wilder Schwan hatte sich augenscheinlich das Bein verstaucht.
Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Und noch immer saßen wir auf unseren Steinen und noch immer bebte jedem von uns die Brust.
„Das hat Spaß gemacht“, sagte ich.
Wilder Schwan rieb sich den Oberschenkel und grinste von einem Ohr zum anderen. „Respekt, du bist stärker, als ich dachte.“
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, und schwieg. Dann aber brach es aus mir heraus: „Bitte bleib doch diese Nacht bei mir. Wir suchen uns eine Höhle und teilen uns die Taube, ja?“
Nun … und das taten wir denn auch.
Wilder Schwan war auf eine Übernachtung natürlich nicht vorbereitet gewesen und ich musste mein Bärenfell mit ihr teilen. So saßen wir lange. Zusammengekuschelt an der Glut unseres Feuers, betrachteten das von Pollums Licht tief verschneite Felsental, knabberten Röhrlinge und gingen unseren Gedanken nach.
Ich fragte mich, wie ich das mit der Jagd anstellen sollte. Einfach den Speer zuspitzen und hoffen, damit Erfolg zu haben? Oder lieber doch eine neue Klinge und Birkenpech herstellen? Oder einfach den Geiern nach durch die Steppe streifen und hoffen, frisches Aas zu finden? Das wäre gemogelt, aber viele Erstjäger haben – wenn man den Geschichten im Rundzelt trauen darf – auf diese Weise schon Respekt erlangt.
Ich wusste es nicht. Ich hoffte, dass Wilder Schwan mich noch ein wenig begleiten würde – neue Pilze und Früchte musste sie ohnehin finden.
„Elian“, sagte Wilder Schwan irgendwann. „Siehst du?“ Sie deutete mit zwei Fingern nach dem Sternenbild des Löwengottes. Ich hatte Probleme, ihn zu erkennen.
„Ich habe mir sein Bild auf den Körper tätowiert, weißt du?“, sagte sie.
„Wirklich?“, erwiderte ich. „Wo denn?“
Wilder Schwan zeigte mir verschiedene Punkte an Hand, Schulter, Bauch und Fußknöchel. „Hast du schon mal einen Löwen gesehen?“, fragte sie, als sie sich wieder zugedeckt hatte.
„Nur einmal. Und auch nur von ganz weit weg.“
Eigentlich hatten ihn bei dem Ausflug, von dem ich sprach, nur meine Eltern gesehen. Ein Sprichwort unseres Stammes besagt: Wo Menschen sind, werden Löwen zu Luft. Denn sie ziehen weiter, sobald sie unsereinen kommen sehen.
„Stell dir mal vor, das hier wäre eine Löwenhöhle“, flüsterte Wilder Schwan und freute sich an der vogelgleichen Haut, die ihren Körper augenblicklich überzog. Auch ich gruselte mich, obwohl die Höhle kaum einen Speerwurf tief war und nach nichts als nacktem Stein gerochen hatte.
Ich stand auf, kletterte ein wenig über die Felsen, riss so viele Zweige, Wurzeln und Blätter aus, wie ich auf die Schnelle finden konnte, und fütterte die Glut damit. Nur zur Sicherheit.
Sowie die Flamme sich neu belebte und die Höhle und nahe Umgebung in feuchten Rauch hüllte, legten wir uns nieder. Wir drehten einander den Rücken zu, flüsterten unsere Gebete und warteten auf den Schlaf. Irgendwann drehte ich mich um, legte meine Arme auf ihre und berührte mit der Stirn ihren Hinterkopf.
„Du riechst wie ein Mädchen“, sagte ich.
„Ich bin ein Mädchen“, murmelte sie zurück.
„Sehr witzig“, sagte ich.
„Was ist witzig?“
Einige Augenblicke war nichts als das Knacken des Feuers zu hören.
„Dass du sagst, dass du ein Mädchen bist.“
„Was denkst du denn, was ich bin?“
Erst jetzt kamen mir Zweifel. Erst jetzt erinnerte ich mich daran, dass Wilder Schwan die Schule nicht besuchte und darin gar kein Problem sah. Ohne darüber nachzudenken, griff ich mit der Hand nach ihrem Geschlecht – aber noch bevor ich sie richtig berührt hatte, drehte mir Wilder Schwan die Hand um, dass ich vor Schmerzen heulte.
Und das war – da werdet ihr mir recht geben – der bei Weitem bessere Beweis für ihre Weiblichkeit.
Von da an kuschelten wir nicht mehr. Ich hielt eine Unterarmlänge Abstand, überließ ihr das größte Stück des Bärenfells und fror. Und doch war nicht die Kälte der Grund, warum ich keinen Schlaf in jener Nacht fand.
Ich kehrte von der Jagd heim. Meine Kleider waren blutig und zerschlissen, meine Lippen zitterten, meine Seele schlug mir heftig gegen die Brust, wollte mir aus dem Leib fahren. Meine Lehrer und mein Vater traten mir entgegen. Sie waren bestürzt über meine Erscheinung. „Was ist geschehen?“, riefen sie mir schon von Weitem zu.
Ich bebte vor Zorn: „Wie viele Sommer habt ihr mir nicht von den Bestien dieser Welt und deren fürchterlichem Verhalten erzählt? Und wie oft habt ihr mich nicht auf die Gefahren hingewiesen, die von Bären, Löwen und hungrigen Leoparden ausgehen? Die wahre Bestie, das wahre Übel und entsetzlichste Scheusal, das unser Land mit Hinterlist durchstreift, habt ihr indes vor mir verheimlicht.“
Die Männer umkreisen mich, tauschen Blicke miteinander, packen mich hart an der Schulter: „Wovon sprichst du? Bei allen Göttern – welche Bestie hat dich heimgesucht?“
Ich stürze auf die Knie, kann meinen Mund nicht öffnen – meine Seele würde mir ja sonst entfliehen.
„So sprich doch, Junge! Es gibt Tränke und heilende Kräuter, die wir dir auflegen können! Aber sage uns, welche Bestie es war!“
Die Steppe flimmert vor meinen Augen. Ich fasse mir ans Herz, winke die Männer heran, hauche in ihre Ohren: „Die … Liebe war’s.“
Ich erwachte aus meinem Traum. Die Sonne stand hoch am Himmel, das Bärenfell bedeckte nur mich allein.
Ich wusste nicht, wo ich war, wusste nicht, warum mein Fell nach verbranntem Laub stank. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich mich in wenigen Augenblicken elend fühlen würde.
Wilder Schwan war fort. Mit einem halbverbrannten Taubenknochen hatte sie eine Nachricht auf den Felsen gezeichnet. Das Tipi ihres Vaters und die Umrandung ihrer Handfläche für eine erfolgreiche Jagd.
Ich setzte mich auf, blickte in das Tal hinab und lauschte dem Plätschern des Baches. Was war mit mir geschehen? Wieso konnte ich mich an der Sonne und dem herrlichen Ausblick nicht erfreuen?
Wilder Schwan ist ein Mädchen.
Na und? Was scherte mich das? Ich würde ohnehin kaum noch etwas mit ihr zu tun haben – der Spott der Kameraden würde mich nicht heimsuchen.
Warum aber hatte ich diesen seltsamen Traum gehabt? Was wollte mir Berima damit sagen? Ich empfand doch, außer für meine Eltern und die Götter, keinerlei Liebe in meinem Herzen. Und schon gar nicht Wilder Schwan gegenüber. Für sie empfand ich nur eines: Hass. Abgrundtiefen Hass.
Hass darauf, dass sie mir nie gesagt hatte, dass sie ein Mädchen war, Hass darauf, dass sie ein besserer Jäger war als ich, Hass darauf, dass sie mir in der Nacht die Hand verdreht hatte. Und Hass darauf, dass sie gegangen war und mich alleine gelassen hatte.
Ich hatte keine Lust mehr zu jagen. Ich hatte auch gar keinen Hunger mehr. Und nach Hause wollte ich auch nicht mehr gehen. Ich stand auf, schlüpfte in meine Schuhe, betrachtete den kaputten selbstgebastelten Schuh – „das Werk eines Versagers“ –, riss ihn herunter und zerfetzte ihn.
So humpelte ich denn mit nur einem Schuh vorwärts, immer am Bach entlang in jene Richtung, wo die Sonne niemals zu sehen ist. Und ich genoss den Schmerz, den mir die Kieselsteine bereiteten. Ach, was sage ich, ich genoss ihn? Tatsächlich empfand ich eine wahre Lust daran, die Qualen meines Herzens in Qualen des Leibes zu verwandeln. Das tat auf perverse Weise gut.
Der Bach erhielt zunehmend seitliche Verstärkung, wurde tiefer und klarer. Ich sah, sowie ich mein Spiegelbild beim Leiden beobachtete – was ebenfalls guttat –, einige gepunktete Fische seelenruhig im Wasser stehen, als gäbe es keinerlei Strömung. Sobald ich aber ein paar schnelle Bewegungen in ihre Richtung tat, verschlüpften sie sich zwischen die Steine und waren nicht mehr zu sehen.
Ich überlegte, ob es mir wohl gelingen würde, einen davon mit dem Speer zu erwischen. Dass man Fische essen konnte, wusste ich – auch wenn der Druide und die älteren Leute unseres Stammes Fisch als Nahrung verschmähten, weil sie dem Eispanzer und somit dem Reiche Gilmors entspringen. Ihr kennt den alten Aberglauben gewiss auch, dass Fische die Wiedergeburten der frevelnden Seelen sind und mit einem Leben im Eiswasser bestraft werden.
Ich sehe in euren Gesichtern, ihr Weisen des Stammes, dass auch ihr diesem Glauben anhängt und ich würde gewiss niemals wagen, mit euch in Streit zu geraten – wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, was mit den frevelnden Seelen in Wirklichkeit geschieht. Oh, könnte ich das alles nur vergessen!
Einige Male versuchte ich mein Glück. Doch erst nach unzähligen Fehlversuchen verstand ich, dass das Wasser trügerisch ist, dass man den Speer deutlich tiefer in den Bach stoßen muss, um den Fischen auch nur nahe zu kommen. Doch diese Erkenntnis nützte mir rein gar nichts. Die Biester waren einfach zu flink für meinen Speer. Hinzu kam, dass ich immer wieder die Spitze schärfen musste, die sich durch den Aufprall auf den Bachkieseln und die Nässe wieder und wieder verbog. Und alles nur ihretwegen!
„Fotze!“, plärrte ich, nachdem ich mich sicherheitshalber nach allen Seiten gedreht und vergewissert hatte, dass ich alleine war. „Dumme, blöde Fliegenpilzfotze! Wenn ich hier zugrunde gehe, soll mein Rachegeist dich heimsuchen!“
Ich weiß, ich weiß – das sind verbotene Flüche und das ist auch gut so. Ich werde sie auch nicht wiederholen. Aber ich war in jenem Moment des Zorns tatsächlich nicht mehr zurechnungsfähig. Und ich wollte meinem Traum und dem Wort Liebe, das ich nicht mehr aus dem Kopf bekam, etwas ebenso Starkes entgegensetzen.
Einmal mehr schleuderte ich den Speer von mir – ich hätte ihn in Stücke hauen können. Stattdessen stürzte ich in den Uferkies und heulte.
Ich war kein Jäger, ich war ein Versager. Ich war unfähig, unfähig zu allem. Ich konnte nicht heimkehren, würde aber auch nicht alleine überleben können. Es war aus. Ich hatte die Jägerprüfung vermasselt, hatte mein Leben vermasselt.
Ich blickte zurück, erblickte den gleißenden Eispanzer, die Felsen, wo wir übernachtet hatten. Die Mücken kamen, umschwirrten mit höhnischem Gesumm mein Gesicht und taten sich an den Stellen, die von meinen Tränen reingewaschen worden waren, gütlich. Ich erschlug sie nicht einmal. Ich blickte zurück.
Dort hinten, inmitten der Felsen, die nun vollends im Schatten ihrer selbst lagen, hatten wir gekuschelt, uns gegruselt und uns gerngehabt.
Wieso war nun alles anders? Was war in der Zwischenzeit geschehen? Ist es im Grunde nicht egal, welches Geschlecht man mit sich rumträgt?
Ich ließ meinen brennenden Fuß ins Wasser sinken und sah einen Fisch eilig das Weite suchen. Nein, nicht das Weite. Im Gegenteil. Er versteckte sich ganz in der Nähe unter einem handgroßen Felsensplitter. Ich konnte seine Schwanzflosse heraufblitzen sehen.
Gut, dass ich nicht mehr heimkehren werde, dachte ich. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich von nun an auf Wilder Schwan reagieren soll. Ich könnte hingehen und sie anschreien und ihr sagen, was sie für eine … naja, lassen wir das … ist. Ich könnte sie von jetzt an meiden, sie wie Luft behandeln, einfach durch sie hindurchsehen. Ich könnte ihr natürlich auch entgegentreten, ihr sagen, dass mein Herz tödlich verwundet ist, dass ich an nichts, und zwar tatsächlich an gar nichts Anderes denken kann als an sie, dass ich gerne wieder mit ihr einschlafen und mit ihr kuscheln würde. Dass ich es liebe, mit ihr zu streiten, mich mit ihr zu prügeln, dass ich ihre Tätowierung, ihren Geruch, ihr Gesicht, alles und einfach alles an ihr …
Moment … was passiert hier?! Was tun meine Lippen da? Ist das bereits der Sonnenstich? So früh am Tage?
Nein, nein und nochmals nein! Du hasst sie! Verstehst du das, Gefleckte Hyäne? Hass ist das Gefühl, das dich fortan leiten soll!
Ach, gut, dass ich für immer ein Verstoßener meines Stammes sein werde. Gut, dass ich fortan in der Wildnis umherstreifen und irgendwann zugrunde gehen werde. Dann bleibt es mir erspart, mich für eine der drei Optionen entscheiden zu müssen.
Wenn man sich doch nur von hinten an den Fisch heranschleichen könnte. Wenn man ihn am Schwanz packen und aus dem Bach ziehen könnte. Aber wer vermag das?
Wenn Wilder Schwan jetzt auftauchen würde, wenn sie sich, wie ich, als Löwe tarnen und hinterrücks anschleichen würde, nur um mich zu ärgern, im Grunde aber um nachzusehen, wie es mir geht, wie ich vorankomme …
Womöglich beobachtet sie mich gerade. Zuzutrauen wäre es ihr. Vielleicht sitzt sie irgendwo in den Klüften und wundert sich über mein verheultes Gesicht. Vielleicht sieht sie sich in der Annahme, ich wäre ein Versager, nun vollends bestätigt.
Ha! das hast du dir fein ausgedacht, du heimtückisches Weib! Wenn du denkst, ich bräuchte dich, wenn du denkst, ich käme ohne dich nicht zurecht, dann täuschst du dich gewaltig. Ich werde dir beweisen, dass ich kein Versager bin, ich werde hier vor deinen Augen einen Fisch aus dem Bach ziehen. Ohne meinen Speer.
Ich stand auf. Mein Mut war plötzlich übergroß. Ich streifte den Schuh und meine beiden Hosenröhren ab und versuchte, nicht daran zu denken, dass Wilder Schwan – sollte sie tatsächlich irgendwo lauern – meine furchtbaren Flüche gehört haben könnte. Ich glitt in den Bach hinein. Er war viel tiefer, als ich vermutet hatte, und die Kälte war, spätestens nachdem sie meine Leibesmitte umfing, kaum zu ertragen.
Dennoch war es die Fährte des Triumphs, der ich nun folgte – denn der Fisch hatte sich nicht gerührt, gleichwohl ich kaum eine Armlänge von ihm entfernt stand. Ich beschloss, nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Lautlosigkeit zu setzen.
So langsam und sacht ich konnte, ließ ich meine Hand nach dem Grund und dem Fischversteck gleiten. Dann packte ich zu und bekam – oh! ihr segensreichen Götter! – den Fisch tatsächlich am Schwanz zu fassen. Der Schwanz war schleimig und der Fisch entkam – aber es war ohne Zweifel ein Erfolg. Die Fische fühlten sich in ihren Verstecken sicher, das wusste ich jetzt.
Ich sprang aus dem Wasser und beschnupperte meine Hand. Sie roch nach Fisch. Ein sonderbarer Geruch, der sich schwer beschreiben lässt. Sehr intensiv und auch ein bisschen widerlich, weil er ein wenig an den Geruch des nackten Geschlechts erinnert – und ich weiß noch ganz genau, dass ich Hemmungen hatte, mir die Hand sauberzulecken.
Einige Zeit stand ich da, ließ mich von der Sonne trocknen und entwickelte eine Strategie. Die Vorstellung, Wilder Schwan könnte zwischen den grauen Felsen oder hinter irgendeinem Busch hocken und mich beobachten, gab mir dabei Kraft.
Hm, wie? Nein danke, ich bin satt. Es hat ja auch gar keinen Sinn, euch die ganze Suppe wegzuessen. Bevor das Feuer erloschen ist, bin ich ohnehin tot. Fahren wir lieber fort:
Nachdenklich wog ich den Speer in meinen Händen. Der Fischschwanz hatte sich ganz weich angefühlt – gewiss war es möglich, ihn mit einem langen Dorn oder spitzen Zweig zu durchbohren und somit festzuhalten.
Ich erhob mich, suchte die Büsche nach Fischfängern, wie ich sie fortan nannte, ab und kehrte bald an den Ort des Triumphs zurück. Ich hoffe, ihr glaubt mir, wenn ich euch sage, dass derselbe Fisch, den ich kurz zuvor am Schwanz gepackt hatte, nun abermals vor mir Reißaus nahm und dasselbe Versteck aufsuchte wie zuvor. Ich gebe zu, das klingt wie ein Wunder – im Laufe meines Lebens sollte ich aber feststellen, dass solch ein Verhalten normal ist und auf alle Fische der Welt zutrifft.
Mit zwei daumenlangen Dornen bewaffnet stieg ich ins Wasser – und ich musste mich zwingen, nichts zu überstürzen, Ruhe zu bewahren und alles genauso zu machen wie zuvor. Ich näherte mich dem Fischschwanz unter Aufbringung all meiner Geduld. Dann biss ich die Zähne zusammen und stach – so schnell es unter Wasser eben möglich ist – zu. Aber es war schnell genug. Der Fisch wand sich mit einer Kraft, die ich ihm niemals zugetraut hätte, die Dornen aber steckten tief in seinem Fleisch. Ich zog ihn aus dem Bach und schleuderte ihn mit einem Jubelschrei in den Kies, wo er umherhüpfte, mit der Schwanzflosse um sich schlug und sich überhaupt so drollig gebärdete, dass man meinen konnte, er würde an Land ertrinken. Bereits nach kurzer Zeit gab er das Springen und schließlich den Geist auf.
Ich drehte mich im Kreis, in der Hoffnung, irgendwo Wilder Schwan zu erblicken. Ja, es schien mir in jenem Moment des Erfolgs tatsächlich so, als würde ich sie hinter jedem Busch und jedem Strauch hervorlugen sehen.
Den ersten Fisch in meinem Leben aß ich ganz für mich allein. Die hintere Hälfte roh, die vordere gebraten über dem Feuer. Und obwohl der Fischgeschmack keinem anderen Geschmack, den ich je kennenlernen durfte, ähnelte, verliebte ich mich sofort in ihn. Das ist ja logisch, sagt ihr jetzt, weil ich ja mit jedem Bissen an meinen ersten Jagderfolg erinnert wurde – aber ich bin mir sicher, dass der Wille und die unendliche Weisheit Berimas dahintersteckten.
Noch einmal übernachtete ich in der Geborgenheit der Klippen. Und noch immer hoffte ich, Wilder Schwan würde erscheinen. Aber sie erschien nicht.
Morgen, so dachte ich, morgen werde ich heimkehren. Ich werde drei oder vier Fische aus ihren Verstecken reißen und mitnehmen. Das wird keinen Jubel erzeugen, aber bestanden hätte ich die Prüfung in jedem Fall.
Es stellte sich aber heraus, dass Akroton, der Chaos-Gott mit dem Stiernacken, meine Pläne, zumindest teilweise, vereitelte – sicherlich aus Zorn darüber, dass ich vergessen hatte, ihn während meines Abendgebetes anzurufen. Am nächsten Morgen – der Große Pafal hatte das Land noch nicht erobert – wurde ich von einem Trampeln, Scharren und Schnauben geweckt.
Ich setzte mich auf und blickte über den Felsenrand in die Tiefe. Zwei zottelige Nashornbullen hatten sich bis in die Enge dieses Tals verfolgt, wetzten ihre schweren Hörner an den Felsen und bedrohten sich, indem sie mit den Vorderbeinen hart aufstampften oder mit gesenkten Köpfen Angriffe vortäuschten. Dann endlich kreuzten sie die Hörner und es war offenkundig, wer der Stärkere war.
Mich faszinierte der Kampf. Ich machte es mir gemütlich, kuschelte mich in meine Decke und beobachtete das Treiben aus sicherer Entfernung. Vielleicht, dachte ich, sowie ich das Blut an der Wange des kleineren Nashornbullen bemerkte, vielleicht fällt zuletzt doch eine größere Mahlzeit für mich und meinen Stamm ab als erwartet.
Es war das erste Mal seit Wilder Schwans Verschwinden, dass ich nicht an sie dachte, so sehr fesselte mich der Kampf, dessen Spektakel sich im Widerhall der Felsen noch verstärkte. Seltsamerweise zeichnete sich aber auch nach langer Zeit kein Sieg ab. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als die Nashörner eine Verschnaufpause machten, ein wenig von den Blättern der Büsche fraßen oder sich niederlegten. Erst da erkannte ich, dass sie von Akroton geschickt worden waren, um mich zu bestrafen.
„Hey! Aufwachen!“, brüllte ich hinunter und tatsächlich erhoben sich die beiden. Aber sie schienen aufs Kämpfen keine Lust mehr zu haben, sondern taten sich wiederum an den Blüten und Kräutern gütlich oder rieben ihr Fell zufrieden prustend an den Felskanten. Ich schleuderte einige Steine nach ihnen, die sie aber gar nicht spürten. Zumindest zeigten sie keine Reaktion.
Wir müssen, liebe Freunde, das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen. Wichtig ist nur, dass die Nashörner erst gegen Abend das Weite suchten und ich somit auch erst da Gelegenheit erhielt, meine Fischjagd fortzusetzen. Ich watete noch im Wasser des Baches, als Pafals melancholische Schwester ihr Licht aussandte. Nur zwei Fische hatte ich erbeutet.
In dieser Nacht aß ich nichts, sondern schlief neben meinen totenstarren Fischen ein – natürlich erst, nachdem ich alle Götter um ihren Segen gebeten hatte.
Das allerdings verfehlte seine Wirkung nicht. Bereits am Morgen des nächsten Tages erbeutete ich zwei weitere Fische. Und es sollte sogar noch besser kommen. Ich fand heraus, dass man die versteckten Fische auch von vorne erwischen konnte – solange man sie nur am Spalt hinter der Wange zu fassen bekam.
Ihr könnt euch vorstellen, wie ich pfiff und mit den Füßen trommelte, als ich gegen Mittag sage und schreibe neun stattliche Fische auf einen Zweig fädelte und mir um den Hals hängte. Das war Nahrung für wenigstens sechs Mäuler.
Als ich die Zelte erreichte, kamen mir meine Eltern entgegengelaufen. Meine Mutter weinte und ja, sogar mein Vater schien seltsam einsilbig, als er mich am Nacken fasste und seine Stirn gegen meine drückte. Dann aber ging es nur mehr um meine Beute. Ich hielt den Zweig mit den Fischen hoch und freute mich, dass die Leute mit offenen Mündern staunten und auch der sonst so strenge Druide keine Einwände gegen meinen Fang vorbrachte.
Meine Tante, die zeit ihres Lebens bekannt für ihren Argwohn war, fragte mich, ob ich mir sicher wäre, dass man die essen kann – und ich erzählte von meinem ersten Fisch, der mir ja ausnehmend gut bekommen war. Ich traf auch meine drei Kameraden, die mir teils herzlich, teils neidisch entgegentraten. Allesamt waren sie am Abend des ersten Tages heimgekehrt. Donnergroll, der besagte Streber, hatte ein junges Schwein mit dem Speer erwischt und war einen halben Tag der Blutspur gefolgt, bis er es endlich niedermachen konnte. Brauner Bär hatte Bisonfleisch heimgebracht, von dem er stur behauptete, es selbst erbeutet zu haben. Aber es hatte so fürchterlich nach Aas gestunken, dass man es nur mehr an die Hunde verfüttern konnte. Noch schlimmer aber hatte sich mein Freund Mondenfleck blamiert. Er war nämlich nach kurzer Zeit bereits in eine Mammutfalle gestürzt und hatte sich die Hand gebrochen. Mit bleichem, schmerzverzerrtem Gesicht trat er mir entgegen und zeigte mir seinen Arm, um den die Medizinfrau einen Stock und reichlich Heilkräuter gewunden hatte.
Im Rundzelt wurden ich und Donnergroll für unseren Erfolg geehrt und feierlich zu Jägern erklärt. Ich war stolz, als ich in das Antlitz meines Vaters blickte, der mir mit zuckendem Mundwinkel seine blutenden Hände ins Gesicht drückte, als Symbol dafür, dass seine Stärke ab jetzt abnehmen und meine zunehmen würde. Ich versuchte, unter den Anwesenden Wilder Schwan auszumachen, aber der Rauch trübte mir die Sicht.
Nach einigen Gesängen fand die Zeremonie ihren Ausgang in einem Festmahl, das ich bis heute nicht vergessen kann. Es gab Mammut, Schwein, Fisch und Vogeleier – die Krönung des Ganzen aber war das Geschenk, das wir beiden Jungjäger erhielten: Ein kopfgroßes Stück reinen Mammutfetts und das glückverheißende Gebot, dieses mit niemandem teilen zu dürfen, wie es sich doch eigentlich gehören würde.
Ich weiß noch genau, wie ermattet und glücklich ich nach diesem Festmahl war. Und ich weiß noch genau, dass ich meine Kameraden bei der erstbesten Gelegenheit fragte, wo denn eigentlich Wilder Schwan sei – ich hätte sie doch allzu gern mit der Tatsache konfrontiert, dass ich von nun an ein Jäger und kein Versager war.
„Hat dir das denn noch keiner erzählt?“, erwiderte Donnergroll mit dieser altklugen Art, die mich schon immer abgestoßen hatte. „Ihr Vater ist am Tag unserer Jägerprüfung verschwunden und keiner weiß wohin. Sie ist erst einen Tag später heimgekehrt, hat erfahren, was passiert war, und ist direkt aufgebrochen, um ihn zu suchen.“
Es war, als hätte mir Donnergroll seinen Faustkeil ins Herz gerammt. Wie ihr euch denken könnt, waren von jenem Zeitpunkt an das Fest und alle Lust und alle Freuden für mich vorbei. Und zwar für Tage und Monde.
Denn Wilder Schwan und ihr Vater kamen niemals zu uns zurück.
Wenn ihr wollt, können wir an dieser Stelle gerne eine kurze Pause machen. Ich sehe schon, dass einige unter euch lange schon darauf warten, sich zu erleichtern – mir geht’s ja auch nicht anders.
*