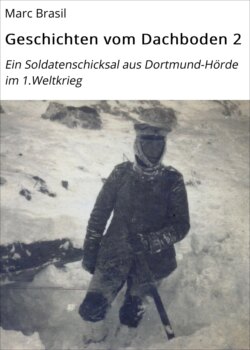Читать книгу Geschichten vom Dachboden 2 - Marc Brasil - Страница 2
Spurensuche
ОглавлениеAm Mittwoch, den 28.Dezember 2016 nehme ich kurz nach 19 Uhr den Hörer zur Hand und wähle nun die dritte Nummer aus dem Raum Hamburg, welche unter dem Familiennamen Thomaschki in einer Telefonauskunft eingetragen ist. Die ersten beiden Nummern waren bereits nicht mehr aktuell und so versuche ich bei dem letzten verbleibenden Eintrag Erfolg zu haben. Endlich ein Freizeichen und nach kurzer Zeit meldet sich tatsächlich eine alte Dame mit:„Thomaschki“. „Guten Abend Frau Thomaschki“, erwidere ich und stelle mich kurz vor. „Ich rufe aus Erlangen in Bayern an. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit der Auswertung historischer Belege und Briefkonvolute. Dabei ist mir in meiner Sammlung eine Fotopostkarte mit dem Absender Leutnant Siegfried Thomaschki aufgefallen und ich suche nach Verwandtschaft“, beginne ich das Gespräch. „Aber ja“, antwortet die alte Dame verwundert, „Siegfried Thomaschki ist mein Vater. Wie haben Sie eigentlich meine Adresse gefunden? Wissen Sie, ich bin 93 Jahre alt und wohne schon lange nicht mehr unter meiner ursprünglichen Adresse - ach, ich weiß schon, ich konnte ja meine Telefonnummer mit an den neuen Wohnort übernehmen. Das geht ja heute. Da haben Sie aber Glück gehabt! Sie sind aus Erlangen? Das kenne ich gut. Ich habe dort eine Zeit lang studiert. Ich heiße übrigens Urte Thomaschki!“ „Ute?“ hake ich noch einmal nach, da ich glaube mich verhört zu haben. „Nein, Sie haben schon richtig gehört! Urte Thomaschki!“
Urte, ein ungewöhnlicher Vorname, geht mir kurz durch den Kopf bevor ich fortsetze: „Hätten Sie denn Interesse an einer guten Kopie der Fotopostkarte? Diese ist übrigens auf den März 1915 datiert und der Absender gibt als Ortsangabe Karpaten an“, füge ich hinzu. „Das ist ja interessant! Wissen Sie, heut zu Tage werden ja keine Briefe und Karten mehr geschrieben. Alle Nachrichten werden nach dem Absenden gleich wieder gelöscht. Mein Vater war 1915 Soldat. Die Karte muss aus seiner Militärzeit während des Ersten Weltkrieges sein“, ergänzt Frau Thomaschki und erinnert sich: „Er war bei den alten 52er Artilleristen und später, während des 2.Weltkriegs dann General der Artillerie, das war der höchste Dienstgrad zu dieser Zeit. Und er hatte auch das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen bekommen!“, fügt Sie stolz hinzu. Sie bittet mich kurz zu warten, da sie das Fernsehgerät abschalten möchte, welches im Hintergrund dröhnt. Dann setzt sie fort: „Aber groß helfen bei Ihren Recherchen kann ich wohl nicht. Ich sehe schon schlecht und habe vor allem Schwierigkeiten mit dem Schreiben.“ Ich sehe auf die Fotopostkarte und kann ihr bestätigen: „Ja, der Absender der Karte gibt Leutnant Thomaschki und Feld-Artillerie-Regiment 52 an“, und frage: „Gibt es in Ihrer Familie vielleicht Verwandtschaft, welche sich mit Ahnenforschung befasst?“. Die alte Dame erwidert: „Meine Mutter hatte handgeschriebene Tagebücher, hat viel dokumentiert und beschäftigte sich auch intensiv mit Ahnenforschung. Wissen Sie, damals brauchte man ja nur seine arische Abstammung nachzuweisen und dann ging alles einfacher. Leider sind bei einem späteren Umzug alle Aufzeichnungen meiner Mutter weggeworfen worden. Wie schade! Morgen besucht mich meine Nichte, aber ich glaube die ist weniger an der Familiengeschichte interessiert.“ Frau Thomaschki schreibt sich meine Telefonnummer auf und teilt mir Ihre Adresse in einer Hamburger Seniorenwohnanlage mit. Wir verabschieden uns und ich wünsche Frau Thomaschki noch einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Gleich nach dem Telefonat fertige ich die Kopie der Fotopostkarte mit einem kurzen Anschreiben für die alte Dame an. Ich weiß, dass sich Urte Thomaschki sehr über das Foto Ihres Vaters freuen wird, welches dieser vor mehr als 100 Jahren im Alter von 21 Jahren anfertigen ließ
Ich betrachte mir nochmals die Fotopostkarte, auf der Siegfried Thomaschki so schön in die Kamera lächelt. Nicht selten sind solche Belege Unikate gewesen. Sie wurden entweder für die im Feld stehenden Soldaten von Kriegsfotografen hinter der Front angefertigt und verkauft oder es gab Soldaten, die bereits einen eigenen Fotoapparat besaßen und die Bilder als Fotopostkarte entwickeln ließen. Fotografieren war bereits vor dem Kriege zum Freizeitvergnügen geworden. Die technischen Weiterentwicklungen hatten es möglich gemacht, dass der Kauf eines Fotoapparates für nahezu alle Schichten der Gesellschaft erschwinglich war. Mitunter wurde auch ein begabter Soldat von seinen Kameraden zum Regimentsfotografen „gekürt“ und konnte sich durch den Besitz eines Fotoapparates mit dem Verkauf der entwickelten Bilder einen schönen Zuverdienst zum Sold erarbeiten.
Ein späterer General ist Leutnant Thomaschki, der Absender der Fotopostkarte, also geworden. Ich recherchiere mit den neuen Erkenntnissen nun weiter nach Siegfried Thomaschki und finde heraus: General der Artillerie Siegfried Paul Leonhard Thomaschki wurde am 20.März 1894 in Miswalde geboren. Nach dem Abitur trat er am 4. März 1913 als Fahnenjunker in das 2.Ostpreußische Feldartillerie-Regiment Nr. 52 ein und zog als Ordonnanzoffizier der I. Abteilung seines Regiments 1914 in den Ersten Weltkrieg. Die Fotopostkarte von Siegfried Thomaschki wurde am 29.März 1915 aus den Karpaten geschrieben. Zu dieser Zeit war das mit dem Deutschen Reich verbündete Österreich-Ungarn an der Ostfront in eine bedrohliche Situation geraten. Die russische Armee war seit August 1914 auf dem Vormarsch und tief nach Österreich-Ungarn einmarschiert. Dabei drangen die Russen über die Karpaten, ein europäisches Hochgebirge, vor und belagerten die Festung Przemysl. Ein großer Teil Galiziens wurde von russischen Soldaten besetzt und das Deutsche Reich entschloss sich seinen Bündispartner mit zwei Divisionen zu unterstützen, darunter die 1.preußischen Infanterie-Division, in der sich auch Thomaschkis Artillerie-Regiment befand. Die beiden Divisionen formierten sich Anfang Januar 1915 zur „Deutschen Südarmee“. Am 22. März 1915 fiel die Festung Przemysl in russische Hände. Das deutsche Generalkommando zögerte einen Gegenangriff noch hinaus, da man in dem schwierigen Gelände auf günstigere Wetterbedingungen angewiesen war. Nach längerer Wartezeit konnte am 9.April 1915 mit umfangreicher Artillerievorbereitung der Gegenangriff auf die russischen Gebirgsstellungen in den Karpaten eingeleitet werden. An diesem Angriff war Leutnant Thomaschki als Angehöriger des Stabes der 1.Abteilung seines Feldartillerie-Regiments beteiligt. Während der Vorbereitungen für den Angriff hatte Siegried Thomaschki wohl etwas Zeit gefunden, die Fotopostkarte anfertigen zu lassen. Unter das Foto schrieb er noch mit Ausrufezeichen „Frieden im Krieg!“, was wohl darauf schließen läßt, dass es durchaus auch angenehmere Ruhe-Phasen während dieser Zeit gab. Auf der Rückseite bedankt er sich bei seinem Onkel für ein erhaltenes Paket: „Mit herzlichsten Dank für das schöne Frühstück, dass mir köstlich gemundet, sendet aus dem fernen Karpatenlande einen fröhlichen Ostergruß, euer stolzer Neffe Siegfried!“
Siegfried Thomaschki wird noch weitere 3 ½ Jahre im Felde stehen. Nach dem Ersten Weltkrieg bleibt er beim Militär und wird am 15. Oktober 1919 als Regimentsadjutant in das Reichswehr-Artillerie-Regiment 1 übernommen. In die neue geschaffene Wehrmacht eingegliedert, wird er am 16.Oktober 1935 zur Heeres- und Luftwaffen-Nachrichtenschule in Halle an der Saale kommandiert. Im zweiten Weltkrieg ist er seit Januar 1942 Kommandeur der 11. Infanterie-Division und erhält für die Erfolge in der Ladoga-Schlacht und der Schlacht am Wolchow am 1. November 1942 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Am 1.März 1945 noch zum Kommandierenden General ernannt, gerät er im Kurland-Kessel am Tag der Kapitulation in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1949 wird er in Russland zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt und nach Workuta in die Ostukraine deportiert. Erst mit Adenauers „Heimkehr der Zehntausend“ entläßt man ihn im Jahre 1955 aus der Gefangenschaft. Bei seiner Heimkehr warten die alten Kameraden auf den Bahnstationen vom Lager Friedland bis Hamburg, um ihren „Onkel Thom“ in der Freiheit willkommen zu heißen. Er lebt mit seiner Frau Herta und den drei Kindern Urte, Claus-Jürgen-Siegfried und Wilhelm bis zu seinem Tod am 31.Mai 1967 in Hamburg und findet seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Hamburg-Ohlsdorf.
Seine Tochter Urte, Jahrgang 1923, ist erfreulicherweise also noch am Leben und konnte mir mit einer für das Alter erstaunlichen Rüstigkeit bei meinen Nachforschungen weiterhelfen. „Urte“ – ich muss mich doch noch einmal über den Vornamen informieren und finde heraus, dass er dem baltischen Sprachgebrauch entstammt und „Die mit dem Schwert Vertraute“ bedeutet. Am 11.Januar 2017 erhalte ich am Abend einen Anruf von Frau Thomaschki. Sie hat meinen Brief mit der Kopie der Fotopostkarte erhalten. Ich habe wegen ihres schlechten Augenlichts alles in sehr großen Lettern geschrieben und die Fotokarte auf DINA4-Format vergrößert. Sie hat sich sehr darüber gefreut und bedankt sich mehrfach.
Unermüdlich schippen die Kanoniere den Sand zur Seite, um die Telefonleitung zu legen. Der neue Beobachtungsstand auf der Düne liegt nur 200 Meter vom Schützengraben des Feindes entfernt und mit dem Scherenfernrohr hat man von dort einen großartigen Blick auf das Gewirr der feindlichen Stellungen, Schanzen und Gräben. Von der Beobachtung aus muss nun eine mehrere Kilometer lange rückwärtige Telefonverbindung geschaffen werden. Es ist stockdunkel und links und rechts von den Soldaten krepieren immer wieder Granaten, doch unbeirrt schuften die Männer weiter. Am Fuß der Düne wird der Boden lehmig bis sumpfig und ist von dürren Büschen durchsetzt. Eine unendliche Plagerei ist es dort zu graben. Zumindest ist das Wetter etwas besser geworden und es hat aufgehört zu regnen. Die letzten Tage mussten die Männer unter freien Himmel ausharren, gestern konnten Sie am Fuß der Düne endlich einen bombensicheren Unterstand errichten, indem Sie nun auch schlafen können. Ab und zu holt einer der jungen Soldaten eine feldgrau lackierte Taschenlampe aus der Jacke und leuchtet kurz den Weg, um dann wieder weiter zu graben. Das neue Taschenlampen-Modell mit Abblendvorrichtung und Schraube zum Andrehen ist wesentlich praktischer als das mit dem Knopf zum Einschalten, welches ihm in der Jackentasche ständig von selbst angegangen ist. Als der Morgen graut, schleppen sich die Kanoniere an den Minenwerferstellungen vorbei zu ihrem Unterstand und sinken todmüde auf die Strohsäcke. An den Donner der Geschütze sind sie bereits gewöhnt und fallen trotz der zahlreichen Granateinschläge und dem Rattern der Maschinengewehre in einen tiefen Schlaf. Morgen ist Ablösung und endlich hat die Schufterei, zumindest für einige Tage, ein Ende.
Am nächsten Morgen zündet einer der Soldaten eine Kerze im Unterstand an und schiebt die leichten Lederschuhe von den Füßen. Die völlig verdreckte Wäsche packt er in einen Sack und zieht sich die lehmigen Stiefel an. Jeden Moment erwartet er die Ablösung und er muss dringend einige Kilometer zurück zur Batterie, um beim Marketender etwas einzukaufen, die Wäsche abzugeben und nach Post zu sehen. Die Feldpostkarte, die er vor einigen Tagen begonnen hatte, steckt immer noch unvollendet in der Jackentasche. Auch ans fotografieren war überhaupt nicht zu denken und den Apparat hat er gleich im Unterstand zurückgelassen. In der Batterie sind bestimmte Lebensmittel noch günstig zu bekommen: Bevor er die Feldpostkarte hastig fertig schreibt und dem Postboten, der gerade die Post verteilt, in die Hände drückt, kauft er sich drei Eier zum Stückpreis von 8 Pfennige, einen Liter Milch zu 16 Pfennige und ein halbes Pfund Butter für eine Mark. Auch für ihn sind heute ein großes Paket und ein Brief aus der Heimat dabei, welche er sogleich erwartungsvoll öffnet. Die Eltern haben an alles gedacht: etwas Käse, Wurst und zwei Fischdosen holt er heraus. Die Zigaretten und Zigarren haben auf dem Transport sehr gelitten und sind ziemlich plattgedrückt. Schon mehrmals hat er nach Hause geschrieben, die Waren doch besser zu verpacken. Die drei Kerzen, welche unversehrt im Paket liegen, kann er dringend gebrauchen, da sie hier kaum zu bekommen sind. Ein kleines Büchlein, eine Kriminalhumoreske, löst bei ihm nicht gerade Begeisterung aus. Der Brief mit den Neuigkeiten aus der Heimat, die der junge Kanonier sofort liest, enthält erfreulicherweise noch zwei Mark Taschengeld vom Vater. Die nächsten Tage in Ruhe will der sportliche junge Mann mit Lesen und trotz der zurückliegenden anstrengenden Tage mit Aktivitäten wie Reiten und Fußballspielen verbringen.
Seine eilig abgeschickte Feldpostkarte wird einige Tage später seine Eltern erreichen, die sich wegen ausbleibender Post ihres Sohnes schon Sorgen gemacht haben und sehnsüchtig auf Nachricht warten.
9.Juli 1915, Pierre Kapelle
Liebe Eltern!
Auf Lektüre warte ich mit Schmerzen. Ich möchte auch meinen alten Wunsch zum 1000ten Male wiederholen, mir einen Kriminalroman zu schicken. Es gibt doch diese Serien à einer Mark, zum Beispiel Lux oder irgendeine andere. Wenn er auch von Conan Doyle ist, so einen möchte ich sogar am liebsten. Tut mir doch den Gefallen. Stattdessen bekomme ich immer diesen Blödsinn von Reclam: Kriminalhumoresken, etc. Sonst gibt es nichts Neues zu vermelden. Mit Kriegsgruß, euer Wolf.
Der Absender der Feldpostkarte schreibt aus St. Pierre Kapelle, in der Nähe der kleinen belgischen Stadt Dixmuiden in Wesflandern, welche ungefähr zehn Kilometer vom Ärmelkanal entfernt liegt. Als im Oktober 1914 die ersten deutschen Truppen auf ihrem Vormarsch Dixmuiden erreichen, wird von den Belgiern durch Öffnen der Schleusen des Flusses Yser die Region komplett geflutet. Die ganze Ebene, welche bei Flut unter dem Meeresspiegel liegt, verschlammt völlig. Der deutsche Vormarsch kommt in der „Schlacht an der Yser“ zum stehen und der Bewegungskrieg entwickelt sich zum Grabenkrieg. Ende April 1915 werden durch deutsche Batterien zum ersten Mal in großer Anzahl Giftgasgranaten verschossen, um den Widerstand des Gegners vor der Stadt Ypern zu brechen. Tausende Engländer und Franzosen verlieren Ihr Leben oder werden durch die umherziehenden Giftgasschwaden schwer verletzt. Zu einem entscheidenden Durchbruch kommt es aber nicht und der Frontverlauf stabilisiert sich wieder. Gut zwei Monate später, im Juli 1915, ist St. Pierre Kapelle Sitz einer Batterie-Stellung der schweren Korpsartillerie des deutschen Marinekorps.
Der Absender der zitierten Feldpostkarte, der sich „Wolf“ nennt, ist Kanonier in seiner Batterie und bittet seine Eltern um Zusendung von Kriminalromanen. Der Stellungskrieg bietet in den Erdbunkern zu den dienstfreien Zeiten oder im Ruhequartier weiter hinter der Front hin und wieder die Möglichkeit bei teilweise elektrischem Licht oder Kerzenschein ein gutes Buch zu lesen. Dabei bevorzugt „Wolf“ ausdrücklich die Werke des englischen Arztes und Schriftstellers Arthur Conan Doyle. Sicher ein Name, der durch die weltweit erfolgreiche Kriminalserie des Sherlock Holmes jedem geläufig ist. Der Name des englischen Schriftstellers steht also vor mehr als 100 Jahren auf einer in Belgien abgeschickten Feldpostkarte eines deutschen Soldaten. Eine seltsame Kombination, wie ich finde und möchte die näheren Umstände verstehen.
Arthur Conan Doyle, der am 22.Mai 1859 in Edinburgh geboren wurde, veröffentlicht ab 1887 die Geschichten des Detektivs Sherlock Holmes und seines Freundes Dr. Watson. 1903 erscheint sein größter Erfolg aus der Detektivserie, „Der Hund von Baskerville“. 1912 erschafft er mit dem Roman „Professor Challenger – Die vergessene Welt“ neben der Sherlock Holmes-Serie einen weiteren großen Erfolgsroman. Seine Bücher werden in viele Sprachen übersetzt und erfreuen sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Im Deutschen Reich wird England während des Krieges als Hauptschuldiger für den Ausbruch des Weltkrieges angesehen. Die deutsche Propaganda mit Parolen wie „Gott strafe England“ oder auf englischer Seite veröffentlichte „Greueltaten der deutschen Hunnen“, schüren den Haß der beiden Völker aufeinander. Romane englischer Schriftsteller sind zwar während des Krieges im Deutschen Reich und an der Front nicht verboten, aber zumindest unstatthaft. Sicher ein Grund, weshalb der Kanonier seine Eltern mehrfach auffordern mußte, doch endlich Conan Doyle-Romane zu besorgen, was aus seiner Wortwahl „Wenn er auch von Conan Doyle ist…“ entnommen werden kann. Ob er sie wohl erhalten hat?
Arthur Conan Doyle, der bei Ausbruch des Krieges mit 55 Jahren zu alt für das Militär ist, versucht sich dennoch aktiv für England einzubringen. Ab 2.September 1914 wird er mit weiteren englischen Schriftstellern für das neu geschaffene englische Propaganda-Büro tätig und veröffentlicht mehrere Texte, die sich kritisch mit dem Kriegsgegner Deutschland auseinandersetzen, als sein Schwager Malcolm Leckie an der Westfront fällt. Doyle besucht im Mai und Juni 1916 erstmals die Fronten in Frankreich und Italien und trifft dort mehrere französische Generäle und höhere englische Offiziere. An der Westfront besucht er dabei seinen Bruder John Francis Innes Doyle und seinen Sohn Kingsley, welcher an der Somme steht. Einen Monat später wird Kingsley Doyle durch einen Schrappnellsplitter am Nacken verletzt und zur Genesung nach England zurück gebracht. Arthur Conan Doyle schreibt nach seiner Rückkehr nach England den Roman „His Last Bow“, welcher im September 1917 veröffentlicht wird und indem seine Hauptfigur Sherlock Holmes, einen deutschen Spion enttarnt. Im Januar 1918 wird Kingsley Doyle nach seiner Genesung an die Westfront nach Frankreich zurückversetzt. Sein Vater Arthur Conan Doyle besucht von September bis Anfang Oktober 1918 ein weiteres Mal die Westfront. Am 28.Oktober 1918 stirbt Kingsley Doyle in einem Lazarett an den Folgen der „Spanischen Grippe“, einer Epidemie, die ab Mai 1918 drei Mal mehr Menschen das Leben kostet, als die 15 Milionen Weltkriegsopfer. Vier Monate nach Kingsleys Tod, bereits nach Kriegsende, fällt am 19.Februar 1919 auch Arthur Conan Doyles Bruder Innes in einem belgischen Lazarett der Spanischen Grippe zum Opfer. Der Tod seines Sohnes und enger Verwandter zeichnen Doyle. Er widmet sich nach dem Krieg verstärkt dem Spiritismus und Mystizismus und stirbt in seiner Heimat England am 7.Juli 1930 infolge eines Herzinfarktes.
Es ist Montagabend, der 14.Dezember 1914 als Carl Spitteler im Zunfthaus „zur Zimmerleuten“ in Zürich an das Rednerpult tritt. Der Erste Weltkrieg tobt im vierten Monat in Europa und den Kolonien, aber die neutrale Schweiz ist bisher nicht in den Völkerkrieg verwickelt. Widerwillig hat der Schweizer nach mehrfacher Aufforderung des Vereins „Neue Helvetische Gesellschaft“ der Bitte nachgegeben und sich bereit erklärt, mit einem Vortrag an die Öffentlichkeit zu treten. Eigentlich steht er lieber im Hintergrund. Er ist kein Mann politischer Reden, aber die beunruhigenden Tendenzen seiner schweizer Landsleute offen Partei für eine der Kriegsparteien zu ergreifen und der zunehmend schroffere Ton zwischen der Deutsch- und der Westschweiz haben ihn veranlasst nun doch diesen Schritt zu gehen. Heute tritt er ans Rednerpult und erhebt sein Wort vor einem großen Publikum und den geladenen Presseleuten:
„Meine Herren und Damen,
So ungern als möglich trete ich aus meiner Einsamkeit in die Öffentlichkeit, um vor Ihnen über ein Thema zu sprechen, das mich scheinbar nichts angeht. Es würde mich auch in der Tat nichts angehen, wenn alles so wäre, wie es sein sollte. Da es aber nicht der Fall ist, erfülle ich meine Bürgerpflicht, indem ich versuche, ob vielleicht das Wort eines bescheidenen Privatmannes dazu beitragen kann, einem unerquicklichen und nicht unbedenklichen Zustand entgegenzuwirken. Wir haben es dazu kommen lassen, dass anlässlich des Krieges zwischen dem deutschsprechenden und dem französischsprechenden Landesteil ein Stimmungsgegensatz entstanden ist. Diesen Gegensatz leicht zu nehmen, gelingt mir nicht. Es tröstet mich nicht, dass man mir sagt: „Im Kriegsfall würden wir trotzdem wie ein Mann zusammenstehen.“ Das Wörtchen „trotzdem“ ist ein schlechtes Bindewort. Sollen wir vielleicht einen Krieg herbeiwünschen, um unserer Zusammengehörigkeit deutlicher bewusst zu werden? Das wäre ein etwas teures Lehrgeld. Wir können es billiger haben. Und schöner und schmerzloser. Ich kann jedenfalls in einer Entfremdung nichts Ersprießliches erblicken, vielmehr das Gegenteil. Oder wollen wir, wie das etwa Ausländer tun, die Stimmungsäußerungen unserer anderssprachigen Eidgenossen einfach außeracht lassen, weil sie in der Minorität sind? „Abgesehen von dem Bruchteil der französischen Schweiz, die ganz in französischem Fahrwasser schwimmt …“ In der Schweiz sehen wir von niemandem ab. Wäre die Minorität noch zehnmal minder, so würde sie uns dennoch wichtig wägen. Es gibt in der Schweiz auch keine Bruchteile. Dass aber die französische Schweiz „ganz in französischem Fahrwasser“ schwimme, ist ein unverdienter Vorwurf. Sie schwimmt so gut wie die deutsche Schweiz in helvetischem Fahrwasser. Das hat sie oft genug mit aller Deutlichkeit bewiesen. Verbittet sie sich doch sogar den Namen „französische“ Schweiz. Also, ich glaube, wir sollen uns um das Verhältnis zu unsern französisch sprechenden Eidgenossen freilich kümmern, und das Missverhältnis soll uns bekümmern.
Ja, was ist denn eigentlich vorgefallen?
Nichts ist vorgefallen. Man hat sich einfach gehen lassen. Wenn aber zwei nach verschiedener Richtung sich gehen lassen, so kommen sie eben auseinander. Entschuldigung liegt vor. Sie heißt: Überraschung. Wie auf den übrigen Gebieten, so hat auch in unserm Gemüts- und Geistesleben die Plötzlichkeit des Kriegsausbruches gleich einer Bombe eingeschlagen. Die Vernunft verlor die Zügel, Sympathie und Antipathie gingen durch und liefen mit einem davon. Und der nachkeuchende Verstand mit seiner schwachen Stimme vermochte das Gefährt nicht aufzuhalten. Beobachte ich übrigens richtig, so ist der Verstand schließlich doch angekommen. Wir sind jetzt, wie ich glaube und hoffe, in der Stimmung der Umkehr und Einkehr. Damit ist die Hauptsache gewonnen, das Schlimmste verhütet. Allein eine gewisse Meinungsverwirrung, eine gewisse Ratlosigkeit und Richtungsverlegenheit ist noch vorhanden. Da hinein ein bisschen Ordnung zu stiften, ist die Aufgabe der Stunde, mithin auch meine Aufgabe.
Vor allem müssen wir uns klar machen, was wir wollen. Wollen wir oder wollen wir nicht ein schweizerischer Staat bleiben, der dem Auslande gegenüber eine politische Einheit darstellt? Wenn nein, wenn jeder sich dahin mag treiben lassen, wohin ihn seine Privatneigung schiebt und wohin er von außen gezogen wird, dann habe ich Ihnen nichts zu sagen. Dann lasse man’s meinetwegen laufen, wie es geht, und schlottert und lottert. Wenn aber ja, dann müssen wir inne werden, dass die Landesgrenzen auch für die politischen Gefühle Marklinien bedeuten. Alle, die jenseits der Landesgrenze wohnen, sind unsere Nachbarn, und bis auf weiteres liebe Nachbarn; alle, die diesseits wohnen, sind mehr als Nachbarn, nämlich unsere Brüder. Der Unterschied zwischen Nachbar und Bruder aber ist ein ungeheurer. Auch der beste Nachbar kann unter Umständen mit Kanonen auf uns schießen, während der Bruder in der Schlacht auf unserer Seite kämpft. Ein größerer Unterschied lässt sich gar nicht denken.
Wir werden etwa freundnachbarschaftlich ermahnt, die politischen Grenzen nicht so stark mit dem Gefühl zu betonen. Wenn wir dieser Ermahnung nachgäben, so würde folgendes entstehen: Anstelle der überbrückten Grenzen nach außen würden sich Grenzen innerhalb unseres Landes bilden, eine Kluft zwischen der Westschweiz und Südschweiz und der Ostschweiz. Ich denke, wir halten es lieber mit den bisherigen Grenzen. Nein, wir müssen uns bewusst werden, dass der politische Bruder uns nähersteht als der beste Nachbar und Rassenverwandte. Dieses Bewusstsein zu stärken, ist unsere patriotische Pflicht. Keine leichte Pflicht. Wir sollen einig fühlen, ohne einheitlich zu sein. Wir haben nicht dasselbe Blut, nicht dieselbe Sprache, wir haben kein die Gegensätze vermittelndes Fürstenhaus, nicht einmal eine eigentliche Hauptstadt. Das alles sind, darüber dürfen wir uns nicht täuschen, Elemente der politischen Schwäche. Und nun suchen wir nach einem gemeinsamen Symbol, das die Elemente der Schwäche überwinde. Dieses Symbol besitzen wir glücklicherweise. Ich brauche es Ihnen nicht zu nennen: die eidgenössische Fahne. Es gilt also, näher als bisher um die eidgenössische Fahne zusammenzurücken und dementsprechend denen gegenüber, die zu einer andern Fahne schwören, auf die richtige Distanz abzurücken; konzentrisch zu fühlen statt exzentrisch.
Ohne Zweifel wäre es nun für uns Neutrale das einzig Richtige, nach allen Seiten hin die nämliche Distanz zu halten. Das ist ja auch die Meinung jedes Schweizers. Aber das ist leichter gesagt als getan. Unwillkürlich rücken wir nach einer Richtung näher zu dem Nachbarn, nach anderer Richtung weiter von ihm weg, als unsere Neutralität es erlaubt. Den Westschweizern droht die Versuchung, sich zu nahe an Frankreich zu gesellen, bei uns ist es umgekehrt. Sowohl hier wie dort ist Mahnung, Warnung und Korrektur nötig. Die Korrektur aber muss in jedem Landesteil von sich aus, von innen heraus geschehen. Wir dürfen nicht dem Bruder seine Fehler vorhalten; das führt nur dazu, dass er uns mit unsern Fehlern bedient, am liebsten mit Zinsen. Wir müssen es daher unsern welschen Eidgenossen vertrauensvoll anheimstellen, aus ihren eigenen Reihen die nötigen Ermahnungen laut werden zu lassen, und uns einzig mit uns selber befassen.
Das Distanzgewinnen ist für den Deutschschweizer ganz besonders schwierig. Noch enger als der Westschweizer mit Frankreich ist der Deutschschweizer mit Deutschland auf sämtlichen Kulturgebieten verbunden. Nehmen wir unter anderm die Kunst und Literatur. In wahrhaft großherziger Weise hat Deutschland unsere Meister aufgenommen, ihnen den Lorbeer gezollt, ohne einen Schatten von Neid und Eifersucht, ja sogar diesen und jenen über die Heimischen erhoben. Unzählige Bande von geschäftlichen Wechselbeziehungen, von geistigem Einverständnis, von Freundschaft haben sich gebildet, ein schönes Eintrachtsverhältnis, das uns während der langen Friedenszeit gänzlich vergessen ließ, dass zwischen Deutschland und der deutschen Schweiz etwas wie eine Grenze steht.
Wollen Sie mich als Beispiel und Rebus annehmen? Ich glaube, mancher von Ihnen kann mir nachfühlen. Es gab in meinem Leben eine Periode, die Periode der edlen Jugendtorheiten, da ich über den Rhein nach dem unbekannten, sagenhaften Deutschland sehnsüchtig wie nach einem Märchenlande hinüberblickte, wo die Träume sich verwirklichen, wo die Gestalten der Poesie verkörpert im hellen Sonnenschein herumwandeln: die edlen, treuherzigen Jünglinge der Romantiker, die sinnigen Jungfrauen des Volksliedes, wo die Leute im täglichen Leben ähnlich reden, wie unsere Klassiker schrieben, wo Berg und Tal, Hain und Quell uns mit Heimataugen grüßen. Das waren freilich naive, kindliche Vorstellungen. Aber heute, wo ich längst weder naiv noch kindlich mehr bin: heute blüht mir Sympathie und Zustimmung wie ein Frühling aus Deutschland entgegen, unabsehbar, unerschöpflich. Aus den entferntesten Gauen erwachsen mir Freunde, zu Hunderten, zu Tausenden. Erscheine ich zur Seltenheit dort persönlich, so treffe ich auf gutartige, liebenswürdige, wohlwollende, zuvorkommende Menschen, deren Gefühls- und Ausdrucksweise ich unmittelbar verstehe. Scheide ich von ihnen, so nehme ich schöne Erinnerungen mit heim und hinterlasse meinen warmen Dank.
Meine französischen Freunde dagegen kann ich an den Fingern der linken Hand abzählen, ich brauche nicht einmal den Daumen dazu und den kleinen Finger auch nicht. Und die übrigen drei kann ich einbiegen. In Frankreich reise ich als ein einsamer Niemand, umgeben von kalter, misstrauischer Fremde.
„Nun also!“ Ja, inwiefern „nun also“?
Meine politische Überzeugung meinen privaten, persönlichen Freundschaftsbeziehungen nachwerfen? Aus individuellen Beweggründen einer fremden Fahne, dem Symbol einer fremden Politik, mit offenen Armen jubelnd entgegenfliegen? Oder nimmt etwa jemand daran Anstoß, dass ein Deutschschweizer die Fahne des deutschen Kaiserreiches eine fremde Fahne nennt?
Sagen Sie mir doch, warum stehen eigentlich unsere Truppen an der Grenze? Und warum stehen sie an allen Grenzen, auch an der deutschen? Offenbar, weil wir keinem einzigen unserer Nachbarn unter allen Umständen trauen. Warum aber trauen wir ihnen nicht? Und warum wird das Misstrauen von unsern Nachbarn nicht als beleidigend empfunden, sondern als berechtigt anerkannt? Deshalb, weil eingestandenermaßen politische Staatengebiete keine sentimentalen und keine moralischen Mächte sind, sondern Gewaltmächte. Nicht umsonst führen die Staaten mit Vorliebe ein Raubtier im Wappen. In der Tat lässt sich die ganze Weisheit der Weltgeschichte in einen einzigen Satz zusammenfassen: Jeder Staat raubt, soviel er kann. Punktum. Mit Verdauungspausen und Ohnmachtsanfällen, welche man „Frieden“ nennt. Die Lenker der Staaten aber handeln so, wie ein Vormund handeln würde, der vor lauter Gewissenhaftigkeit alles und jedes für erlaubt hielte, was seinem Mündel Vorteil bringt, keine Freveltat ausgeschlossen. Und zwar je genialer ein Staatsmann, desto ruchloser. Bitte, diesen Satz nicht umkehren. Unter solchen Gewissensverhältnissen wäre Empfindlichkeit gegen Misstrauen allerdings übel angebracht.
Während nun andere Staaten sich durch Diplomatie, Übereinkommen und Bündnisse einigermaßen vorsehen, geht uns der Schutz der Rückversicherung ab. Wir treiben ja keine hohe auswärtige Politik. Hoffentlich! Denn der Tag, an dem wir ein Bündnis abschlössen oder sonstwie mit dem Auslande Heimlichkeiten mächelten, wäre der Anfang vom Ende der Schweiz. Wir leben mithin politisch im Dunkeln, bestenfalls im Halbdunkel. In Kriegszeiten, wo wir Gefahr wittern, befinden wir uns in der Lage des Bauern, der im Walde ein Wildschwein grunzen hört, ohne zu wissen, kommt es, wann kommt es, und woher kommt es. Aus diesem Grunde stellen wir unsere Truppen rings um den ganzen Waldsaum. Und dass nur ja niemand sich auf die Freundschaft verlasse, die zwischen uns und einem Nachbarvolke in Friedenszeiten waltet. Dergleichen kommt an den leitenden Stellen gar nicht in Betracht. Das sind Harmlosigkeiten des Zivil. Durch die militärische Disziplin haben heutzutage die Regierungen, zumal die mit den Scheinparlamenten, ihre Untertanen fest in der Hand, samt deren Köpfen und Herzen, und mit den eigenmächtigen Völkerverbrüderungen ist es aus. Oder können Sie sich ein Armeekorps vorstellen, das uns zuliebe den Gehorsam verweigerte: „Gegen die Schweizer marschieren wir nicht. Denn das sind Freunde.“ Vor dem militärischen Kommandoruf und dem patriotischen Klang der Kriegstrompete verstummen alle andern Töne, auch die Stimme der Freundschaft.
Darum sage jetzt ich: „Nun also!“ Damit meine ich:
Bei aller herzlichen Freundschaft, die uns im Privatleben mit Tausenden von deutschen Untertanen verbindet, bei aller Solidarität, die wir mit dem deutschen Geistesleben pietätvoll verspüren, bei aller Traulichkeit, die uns aus der gemeinsamen Sprache heimatlich anmutet, dürfen wir dem politischen Deutschland, dem deutschen Kaiserreich gegenüber keine andere Stellung einnehmen als gegenüber jedem andern Staate: die Stellung der neutralen Zurückhaltung in freundnachbarlicher Distanz diesseits der Grenze. Die nötige Zurückhaltung gegenüber dem deutschen Nachbar, die uns ohnehin schwer fällt, wird uns überdies noch durch mehr oder minder wohlmeinenden Zuspruch erschwert. Zunächst der bekannte Appell im Namen der Rassen-, Kultur- und Sprachverwandtschaft. Diese müsste ja, so wird uns bedeutet, von selber zur freudigen Parteinahme mit der deutschen Sache in diesem Kriege führen. Als ob es sich da um Philologie handelte! Als ob nicht sämtliche Kanonen aller Völker das nämliche gräuliche Volapük redeten! Als ob nicht gerade dieser Krieg die Inferiorität aller Nationalverbände gegenüber dem Staatsverbande predigte! Als ob es eine ausgemachte Sache wäre, dass die Kulturwerte eines Volkes mit seiner politischen Machtstellung steigen und fallen! – Dann das gefährliche Zischeln einer bösen Versuchung, die uns im Namen der Freundschaft und des Dankes verführen möchte, etwas zu tun, was selbst die beste Freundschaft und der wärmste Dank zu tun weder verpflichtet noch erlaubt: auf unsere Begriffe von Wahr und Unwahr zu verzichten, jemand zuliebe unsere Überzeugungen von Recht und Unrecht zu fälschen. – Noch etwas Böses und Gefährliches: Der Parteinahme winkt unmäßiger Lohn, der Unparteilichkeit drohen vernichtende Strafen. Mit elenden sechs Zeilen unbedingter Parteinahme kann sich heute jeder, der da mag, in Deutschland Ruhm, Ehre, Beliebtheit und andere schmackhafte Leckerbissen mühelos holen. Er braucht bloß hinzugehen, sich zu bücken und es aufzuheben. Mit einer einzigen Zeile kann einer seinen guten Ruf und sein Ansehen verwirken. Es braucht nicht einmal eine unbesonnene oder versehentliche Zeile zu sein. Ein mannhafter, wahrhaftiger Ausspruch tut denselben Dienst. Wir müssen uns eben die Tatsache vor Augen halten, dass im Grunde kein Angehöriger einer kriegführenden Nation eine neutrale Gesinnung als berechtigt empfindet. Er kann das mit dem Verstande, wenn er ihn gewaltig anstrengt, aber er kann es nicht mit dem Herzen. Wir wirken auf ihn wie der Gleichgültige in einem Trauerhause. Nun sind wir zwar nicht gleichgültig. Ich rufe Ihrer aller Gefühle zu Zeugen an, dass wir nicht gleichgültig sind. Allein da wir uns nicht rühren, scheinen wir gleichgültig. Darum erregt schon unser bloßes Dasein Anstoß. Anfänglich wirkt es unangenehm befremdend, allmählich die Ungeduld reizend, schließlich widerwärtig, verletzend und beleidigend. Vollends ein nicht zustimmendes Wort! Ein unabhängiges Urteil! Der patriotisch Beteiligte ist ja von dem guten Recht seiner Sache heilig überzeugt und ebenso heilig von dem schurkischen Charakter der Feinde. Alles in ihm, was nicht schmerzt, was nicht hofft und bangt, was nicht weint und trauert, knirscht Empörung. Und nun kommt einer, der sich neutral nennt, und nimmt wahrhaftig für die Schurken Partei! Denn ein gerechtes Urteil wird ja als Parteinahme für den Feind empfunden. Und kein Verdienst, kein Ansehen, kein Name schützt vor der Verdammnis. Im Gegenteil. Dann erst recht. Denn dann wird einem neben Untreue und Verrat noch Undank vorgeworfen. Wie im Felde nach den Offizieren, zielt man in den Schreibstuben nach den berühmten Leuten. Bald gibt es ihrer keinen mehr, der nicht schon verketzert und aus irgendeinem Tempel feierlich ausgeschlossen worden wäre. Man wird ganz konfus. Man weiss nicht mehr, gereicht man der Menschheit zur Zierde, oder gehört man zum Auswurf. Wie aber können wir so gefährlichen Drohungen begegnen? Wer schweigen darf, preise sich glücklich, dass er’s darf, und schweige. Wer es nicht darf, der halte es mit dem Sprichwort: Tue, was du sollst, und kümmere dich nicht um die Folgen. Um unsere neutralen Seelen zu retten, kommen uns ferner Propagandaschriften ins Haus geflogen. Meist überlaut geschrieben, öfters im Kommandoton, mitunter geradezu furibund. Und je gelehrter, desto rabiater. Dergleichen verfehlt das Ziel. Es wirkt wenig einladend, wenn man beim Lesen den Eindruck erhält, die Herren Verfasser möchten einen am liebsten auffressen. Haben denn die Herren die Fühlhörner verloren, dass sie nicht mehr spüren, wie man zu andern Völkern spricht und nicht spricht? Allen solchen Zumutungen gegenüber appellieren wir von dem wild gewordenen Freund an den normalen, friedlich-freundlichen, den wir nach Kriegsschluss wieder zu finden hoffen, wie überhaupt den gesamten frühern schönen, traulichen, unbefangenen Geistesverkehr.
Einer entgegengesetzten Versuchung hat sich unser Landesteil leider nicht genügend zu entziehen gewusst, einer unfreundlichen Gesinnung gegen Frankreich. Ich habe wiederholt aus dem Munde von Franzosen die schmerzlich überraschte Frage vernommen: „Was haben wir denn den Schweizern zuleide getan?“ Wirklich, ich weiß nicht, was sie uns zuleid getan haben. Wissen Sie’s? Oder hätten wir einen vernünftigen Grund, Frankreich besonders zu Misstrauen? Mehr zu misstrauen als jedem andern Nachbarn? Ich kenne keinen. Es handelte sich auch bei der unfreundlichen Gesinnung keineswegs um vernünftige Gründe patriotischer Art, sondern um instinktive Gefühle. Die Äußerungen der instinktiven Gefühle aber waren mitunter so, dass ich in den ersten Wochen des August den Wunsch seufzte, es möchte neben den milden Feldpredigten einmal ein kräftiger politischer Redner unsern Leuten mit Ruß und Salz die Grundsätze der Neutralität einprägen. Nun, das Pressebureau unseres Armeestabes hat ja jetzt das Wort. Und da doch so viel von Verwandtschaft die Rede ist, sind wir denn mit den Franzosen nicht ebenfalls verwandt? Die Gemeinsamkeit der politischen Ideale, die Gleichheit der Staatsformen, die Ähnlichkeit der gesellschaftlichen Zustände, ist das nicht auch eine Verwandtschaft? Die Namen „Republik“, „Demokratie“, Freiheit, Duldsamkeit und so weiter, bedeuten diese einem Schweizer etwas Nebensächliches? Es gab eine Zeit – ich habe sie erlebt –, da galten diese Namen in Europa alles. Heute werden sie nahezu als Null behandelt. Alles war zu viel. Null ist zu wenig. Jedenfalls verachten, nicht wahr? Wollen wir Schweizer deswegen die Franzosen nicht, weil ihnen die Kaiser, Könige und Kronprinzen gebrechen. Es sah nämlich fast ein bisschen danach aus.
Die richtige neutrale Einstellung zu den übrigen Staaten wäre für uns Deutschschweizer eigentlich leicht, da hier die Versuchungen zur Parteilichkeit wegfallen. Ja! Wenn wir nur immer auch als Schweizer fühlten und urteilten! Wenn wir nicht mit fremden Köpfen dächten und mit fremden Zungen sprächen! Wenn wir uns nicht unsere Meinung vom Auslande suggerieren ließen! Die tausend und abertausend geistigen Einflüsse, die tagtäglich von Deutschland her gleich einem segensreichen Nilstrom unsere Gauen befruchtend überschwemmen, sind in Kriegszeiten nur filtriert zu genießen. Eine kriegerische Presse ist überhaupt keine erhebende Literatur. Wie Großes auch sonst der patriotische Rausch zeitigen möge, auf das Sprachzentrum wirkt er entschieden ungünstig. Ist es überhaupt unumgänglich nötig, die blutigen Wunden, die ein Krieg schlägt, noch mit Tinte zu vergiften? Jedenfalls hat, wer für sein Vaterland stirbt, die edlere Rolle als wer für sein Vaterland schimpft. Ich sage das nicht im Sinne eines Urteils und meine es durchaus nicht überlegen. Wir würden es ja im Kriegsfall nicht anders machen. Ich sage es bloß als Warnung. Die Feinde des Deutschen Reiches sind nicht zugleich unsere Feinde. Wir dürfen uns daher von dem gleichsprachigen Nachbarn, weil wir seine Zeitungen lesen, nicht seine kriegerischen Schlagworte und Tagesbefehle, seine patriotischen Sophismen, Urteilskunststücke und Begriffsverrenkungen in unser Heft diktieren lassen. Und wir haben die Feinde des Deutschen Reiches, die nicht unsere Feinde sind, nicht nach der Maske zu beurteilen, die ihnen der Hass und der Zorn aufgesetzt, sondern nach ihrem wirklichen Gesicht. Mit andern Worten: Wir sind als Neutrale den übrigen Völkern die nämliche Gerechtigkeit des Urteils schuldig, die wir den Deutschen gewähren, deren Bild wir uns ja auch nicht in der französischen Verzerrung aufnötigen lassen.
Werfen wir doch einmal auf die Feinde des Deutschen Reiches einen flüchtigen Blick aus dem eigenen Gesichtswinkel, ohne Brille.
Gegen die Engländer richten, wie Sie wissen, die Deutschen gegenwärtig einen ganz besondern Hass. Zu diesem ganz besondern Hass haben sie ganz besondere Gründe, die wir nicht haben. Im Gegenteil. Wir sind den Engländern zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Denn mehr als einmal ist uns England in großer Gefahr schützend beigestanden. England ist zwar nicht der einzige, aber der zuverlässigste Freund der Schweiz. Und wenn man mir entgegenhält: „Eitel Egoismus!“, so bitte ich um mehr solcher Egoisten, die uns in der Not beistehen. Da täte verstärkter Geschichtsunterricht gut. Es muss ja nicht immer nur Sempach oder Morgarten sein, der Sonderbundskrieg und der Neuenburgerhandel gehören ebenfalls zur Schweizer Geschichte. Einstweilen erachte ich es für eine der nächsten Aufgaben der Schweizer Presse, mit dem aufgelesenen Gerede von Englands Hinterlist, das unser Volk durchseucht, endlich aufzuräumen. Für Italien im Gegenteil fließt drüben vorderhand lauter Milch und Honig. Falls etwa eines Frühlingstages die Milch plötzlich sauer werden sollte, brauchen wir dann nicht mitzugären. Wir führen mit Italien ein eigenes Konto. Bis dato lautet die Bilanz erfreulich. Von Frankreich haben wir bereits gesprochen. Kann ein westeuropäischer Christenmensch seiner Bildung nicht froh werden, ohne vor Russland einen Kulturschauder zu bekunden? Ich will mich nicht auf meine eigenen Beobachtungen berufen, der ich doch acht Jahre lang in Russland gelebt habe. Ich verweise auf das Zeugnis der Deutschen. Mit denselben Russen, die uns heute so asiatisch geschildert werden, die teuflischen Kosaken inbegriffen, hat ja Preußen nahezu ein Jahrhundert lang in minniglichem Ehebunde geschwelgt. Und wenn das Bündnis morgen wieder erhältlich wäre … Und dann verglichen mit den Türken und Bulgaren, den Kroaten, Slowaken und so weiter!
Von dem Wert und von der Lebensberechtigung kleiner Nationen und Staaten haben wir Schweizer bekanntlich andere Begriffe. Für uns sind die Serben keine „Bande“, sondern ein Volk. Und zwar ein so lebensberechtigtes und achtungswürdiges Volk wie irgendein anderes. Die Serben haben eine ruhmvolle, heroische Vergangenheit. Ihre Volkspoesie ist an Schönheit jeder andern ebenbürtig, ihre Heldenpoesie sogar überbürtig. Denn so herrliche epische Gesänge wie die serbischen hat seit Homers Zeiten keine andere Nation hervorgebracht. Unsere Schweizer Ärzte und Krankenwärter, die aus dem Balkankriege zurückkehrten, haben uns von den Serben im Tone der Sympathie und des Lobes erzählt. Aus solchen Zeugnissen haben wir uns unsere Meinung zu bilden, nicht aus der in Leidenschaft befangenen Kriegspresse.
Belgien geht uns Schweizer an sich nichts, dagegen durch sein Schicksal außerordentlich viel an. Dass Belgien Unrecht widerfahren ist, hat der Täter ursprünglich freimütig zugestanden. Nachträglich, um weißer auszusehen, schwärzte Kain den Abel. Ich halte den Dokumentenfischzug in den Taschen des zuckenden Opfers für einen seelischen Stilfehler. Das Opfer erwürgen war reichlich genug. Es noch verlästern ist zu viel. Ein Schweizer aber, der die Verlästerung der unglücklichen Belgier mitmachte, würde neben einer Schamlosigkeit eine Gedankenlosigkeit begehen. Denn genauso werden auch gegen uns Schuldbeweislein zum Vorschein kriechen, wenn man uns einmal ans Leben will. Zur Kriegsmunition zählt eben leider auch der Geifer.
Was endlich die Mitentrüstung über die düstern Hilfsvölker betrifft: Im Duell allerdings unterscheiden wir fair und unfair. Allein ein Krieg ist nicht eine militärische Mensur, wie etwa höhere Berufsoffiziere geneigt sind zu glauben, sondern ein bitterer Kampf um das Leben einer Nation. Wo es sich aber um Tod und Leben handelt, wird von jedermann jeder Helfer willkommen geheißen, ohne Ansehen der Person und der Haut. Wenn ein Einbrecher Sie mit dem Messer bedroht, so rufen Sie unbedenklich Ihren Haushund zu Hilfe. Und wenn Ihnen der Einbrecher adelig kommen wollte: „Schämen Sie sich nicht, ein unvernünftiges, vierfüßiges Tier gegen einen Mitmenschen zu benützen?“, so würden Sie ihm wahrscheinlich antworten: „Dein Messer hindert mich am Schämen“.
Und jetzt die Hauptsache: unser Verhältnis zur französischen Schweiz. Ich wiederhole: Wir hoffen und erwarten, dass dort zum Frommen der Eintracht und zur Wahrung der Gerechtigkeit und der Neutralität eine ähnliche eidgenössische Kopfklärung geschehe, wie wir sie bei uns anstreben. Eins ist sicher. Wir müssen uns enger zusammenschließen. Dafür müssen wir uns besser verstehen. Um uns aber besser verstehen zu können, müssen wir einander vor allem näher kennenlernen. Wie steht es mit unserer Kenntnis der französischen Schweiz? Und ihrer Literatur und Presse? Die Antwort darauf möge sich jeder selbst geben. Man hat immer von neuem das Heil in dreisprachigen Zeitschriften gesucht. Einverstanden. Nur kommt es nicht bloß darauf an, was geschrieben, sondern auch was gelesen wird. Ich möchte etwas anderes befürworten: unsere deutschschweizerischen Zeitungen sollten, meine ich, ab und zu ihren Lesern ausgewählte Aufsätze aus französisch-schweizerischen Zeitungen in der Übersetzung mitteilen. Sie wären es wohl wert. Der andersartige Gedankeninhalt kann uns etwa zur Ergänzung und Erfrischung dienen. Wir waren gar zu ängstlich vorsichtig, nach der einen Richtung. Ein Aufsatz wie „Le sort de la Belgique“ von Wagnière hätte auch uns angestanden. Der Stil, ich wage es auszusprechen, ist oft geradezu vorbildlich. Ich habe in den letzten Wochen zufällig ein paarmal das „Journal de Genève“ zu Gesicht bekommen, das ich vorher kaum dem Namen nach kannte, alles in allem nicht mehr als sechs Nummern. In diesen sechs Nummern nun traf ich viermal je einen Leitartikel, dessen literarische Eigenschaften mir bewunderndes Staunen abnötigten. Artikel von Wagnière, von Seippel, von Bonnard. Kurz, von Zeit zu Zeit ein Tropflein Welsch in unsere ernste Sachlichkeit könnte nichts schaden.
Zum Schluss eine Verhaltungsregel, die gegenüber sämtlichen fremden Mächten gleichmäßig Anwendung findet: die Bescheidenheit. Mit der Bescheidenheit statten wir den Großmächten den Höflichkeitsdank dafür ab, dass sie uns von ihren blutigen Händeln dispensieren. Mit der Bescheidenheit zollen wir dem todwunden Europa den Tribut, der dem Schmerz gebührt: die Ehrerbietung. Mit der Bescheidenheit endlich entschuldigen wir uns. „Entschuldigung? Wofür?“ Wer jemals an einem Krankenbett gestanden, weiß wofür. Für einen fühlenden Menschen bedarf es der Entschuldigung, dass er sich des Wohlbefindens erfreut, während andere leiden. Vor allem nur ja keine Überlegenheitstöne! Keine Abkanzeleien! Dass wir als Unbeteiligte manches klarer sehen, richtiger beurteilen als die in Kampfleidenschaft Befangenen, versteht sich von selber. Das ist ein Vorteil der Stellung, nicht ein geistiger Vorzug. Ernste Behandlung erschütternder Ereignisse sollte sich eigentlich von selber einstellen, eine leidenschaftlich heftige, wüste Sprache sich von selber verbieten. Es hört sich nicht schön an, wenn irgendein Winkelblättchen aus der Sicherheit unserer Unverletzlichkeit heraus einen europäischen Großstaat im Wirtshausstil anpöbelt, als handelte es sich um eine idyllische Stadtratswahl. Wenn da die Zensur mit einem Maulkorb beispringt, tut sie ein Werk des Anstandes. Die Tonart des Jubels und des Hohnes sollte bei uns unter keinen Umständen laut werden. Der Hohn ist an sich eine rohe Gemütserscheinung, wie er denn in den Reihen der Armeen kaum vorkommt. Einzig der Grimm entschuldigt den Hohn. Diese Entschuldigung geht uns ab. Den Jubel über eine triumphierende Nachricht mögen sich die Volksgenossen des Siegers erlauben, im Gefühl der Erlösung aus peinlicher Spannung. Wir bedürfen der Entspannung nicht. Beides, Hohn und Jubel, sind die denkbar lautesten Äußerungen der Parteilichkeit, schon darum auf neutralem Gebiet verwerflich. Überdies säen sie Zwietracht. Wenn zwei vor einer Siegesmeldung stehen und der eine darüber triumphiert, der andere darüber trauert, so schöpft der, der trauert, gegen den, der triumphiert, einen innigen, gründlichen Hass. Ich hatte lange gemeint, der Hohn wäre das Schlimmste. Es gibt aber etwas noch Schlimmeres: die boshaft kichernde Schadenfreude, die sich gelegentlich in hämischen redaktionellen Zwischenbemerkungen und Ausrufen Luft macht. Es gibt Stoßgebete und Stoßseufzer. Das sind Stoßrülpser. Auch der übliche Spott über die lügenhaften Schlachtberichte enthält eigentlich eine Überhebung. Wer lügt in den Schlachtberichten? Nicht diese oder jene Nation, sondern jeweilen der Geschlagene. Der Sieger hat es leicht, bei der Wahrheit zu bleiben. Dass aber der Geschlagene klar und deutlich mit lauter Stimme seine Niederlage im ganzen Umfange ankündige, darf man billigerweise nicht fordern. Denn das geht über Menschenkraft. Auch wir, die Spötter, würden es nicht können.
Und da wir doch einmal von Bescheidenheit sprechen, eine schüchterne Bitte: Die patriotischen Phantasien von einer vorbildlichen oder schiedsrichterlichen Mission der Schweiz bitte möglichst leise. Ehe wir andern Völkern zum Vorbild dienen könnten, müssten wir erst unsere eigenen Aufgaben mustergültig lösen. Mir scheint aber, das jüngste Einigkeitsexamen haben wir nicht gerade sehr glänzend bestanden.
Meine Herren und Damen,
Die richtige Haltung zu bewahren, ist nicht so mühsam, wie sich’s anhört, wenn mans logisch auseinanderlegt. Ja! wenn man’s im Kopf behalten müsste! Aber man braucht es gar nicht im Kopf zu behalten, man kann es aus dem Herzen schöpfen. Wenn ein Leichenzug vorüber geht, was tun Sie da? Sie nehmen den Hut ab. Als Zuschauer im Theater vor einem Trauerspiel, was fühlen Sie da? Erschütterung und Andacht. Und wie verhalten Sie sich dabei? Still, in ergriffenem, demütigem, ernstem Schweigen. Nicht wahr, das brauchen Sie nicht erst zu lernen? Nun wohl: eine Ausnahmegunst des Schicksals hat uns gestattet, bei dem fürchterlichen Trauerspiel, das sich gegenwärtig in Europa abwickelt, im Zuschauerraum zu sitzen. Auf der Szene herrscht die Trauer, hinter der Szene der Mord. Wohin Sie mit dem Herzen horchen, sei es nach links, sei es nach rechts, hören Sie den Jammer schluchzen, und die jammernden Schluchzer tönen in allen Nationen gleich, da gibt es keinen Unterschied der Sprache. Wohlan, füllen wir angesichts dieser Unsumme von internationalem Leid unsere Herzen mit schweigender Ergriffenheit und unsere Seelen mit Andacht, und vor allem nehmen wir den Hut ab.
Dann stehen wir auf dem richtigen neutralen, dem Schweizer Standpunkt.“
Eine Stunde hat Carl Spitteler zum Publikum gesprochen, als er seine Rede unter dem Applaus der Zuhörer schließt. Die epochalen Worte werden unter dem Titel „Unser Schweizer Standpunkt“ in die Geschichte eingehen. Carl Friedrich Georg Spitteler – ich muss zugeben, diesen Namen hatte ich vorher noch nie gehört und helfe mir über Wikipedia und Google weiter. Ein Schweizer Dichter, Schriftsteller und Kritiker ist er also und sogar Nobelpreisträger für Literatur im Jahre 1919. Er wurde am 24.April 1845 im schweizerischen Ort Liestal geboren und verstarb am 29.Dezember 1924 in Luzern. 1883 heiratet der deutlich ältere Spitteler seine erst 18-jährige ehemalige Schülerin Maria Op den Hooff, was ihm auch über die Landesgrenzen hinaus Kritik einbringt. In der Schweiz und in Deutschland war er durch seine Werke wie „Prometheus und Epimetheus“ bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein angesehener Schriftsteller. Besonderes Aufsehen erregte im Deutschen Reich seine vorstehende, am 14.Dezember 1914 vor der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Zürich gehaltene Streitrede „Unser Schweizer Standpunkt“. Spitteler hatte sich in einem politischen Vortrag für die konsequente Neutralität der Schweiz gegenüber den Kriegsparteien eingesetzt, da sich im Lande durch den Kriegsausbruch eine zunehmend gefährlichere Spaltung der Deutschschweiz von der französisch sprechenden Westschweiz bemerkbar machte. In seiner Rede kritisierte Spitteler insbesondere den deutschen Nationalismus, was zu vielen Gegen-Reaktionen in der damaligen deutschen Presselandschaft führte. In einer Dortmunder Zeitung wird Ende Dezember 1914 Spittelers Rede in einem Aufsatz aufgegriffen. Ein in Dortmund-Hörde lebender Professor, der Spitteler als Schriftsteller sehr schätzt und seine bisherigen Werke gut kennt, ist enttäuscht von Spittelers Sichtweise auf das Deutsche Reich. Dessen Streitrede wühlt ihn derart auf, dass er sich veranlasst fühlt, ihm am 30.Dezember 1914 einen Brief in die Schweiz zu schreiben. Der Dortmunder Professor hat eine Abschrift des Briefes aufbewahrt, welche erhalten geblieben ist. Die nicht minder interessante Antwort des Professors auf die veröffentlichte Rede des Schweizers liegt mir vor und hat mich auf die Spur Spittelers geführt:
Dortmund, 30.Dezember 1914
Sehr geehrter Herr Spitteler!
Als Drucksache übersende ich Ihnen einen Aufsatz der Dortmunder Zeitung, der Ihre Rede in Zürich kritisiert. Da wir Deutschen Ihre geistige Bedeutung von je her gewürdigt haben, beschäftigt uns umso lebhafter die Frage, wie ein Mann Ihrer Art sich so schroff auf die Seite der Gegner stellen kann. Für diese Gegner, ihre Zahl und ihre Motive, haben wir nur das Gefühl unsäglicher Verachtung, das heißt für die Drahtzieher ihrer heutigen Politik. Wenn wir untergehen sollten, was ich nicht fürchte, so werden wir mit dem Hohnlachen der primanen Sagen fallen, und der Feuerbrand, in dem die germanische Welt versinkt, soll gewaltiger aufkommen als die Glut der Hölle. Das alte Deutschland der Gefühlsduselei – das so bequeme, das sich die Fetzen vom Leibe reisen ließ – die Schweiz und Burgund und Brabant und Flandern gehören ja, glaube ich auch dazu – das alte, von Frankreich und dem so lyrisch-gemütstiefen England ach! so zärtlich gepriesenen Deutschland ist – Gott sei Dank! – endgültig und für immer vorbei. Und als unsere Regimenter eisenklirrend über die Grenze Belgiens rückten, da jauchzte das junge Deutschland: Endlich, endlich einmal der Mut zur Tat, zu rücksichtsloser Tat – à cortaire cortaire et demi [franz. „Auf einen Schelmen anderthalbe“ oder freier übersetzt: „Eine List ist der andern wert“ – Anm. d. Verf.]. Der kleinen schwachen Schweiz mag unbehaglich zu Mute sein neben dem deutschen Riesen, der jetzt die halbe Welt in Scherben haut – aber zu fürchten hat sie nichts. Der täppische Riese hat immer noch das alte goldene Kinderherz und tut ohne Not niemanden etwas zu Leide. Wir sind auch nicht ohne Verständnis für die Tragik des belgischen Schicksals und wir preisen mit Schillers Worten immer noch Hettors Los: „der für seine Hausaltare kämpfend, ein Beschirmer, fiel; krönt dem Sieger große Ehre, ehrt ihn das schöne Ziel“.
Aber Belgien ist – dank seiner Lage – nun einmal der Schauplatz aller europäischen Kriege gewesen und wird es bleiben, solange es nicht wieder zum Deutschen Reich gehört. Und gerade heraus: Wenn es für uns um Sein und Nichtsein geht, dann gibt es keine Neutralität – lesen Sie bitte Hugo Grotius, der nicht bloß Dichter, sondern auch ein Meister des Staatsrechts war. Wenn alles, was unseren Geist, unsere Freude, unseren Stolz ausmacht, mit Untergang bedroht wird, dann sollen wir uns geduldig erdrosseln lassen, bloß um ein Stück Papier nicht anzutasten? Wir sind Germanen und Männer und durch eine Meute raubgieriger Hunde, die uns seit Jahren umschleicht, vor die furchtbare Wahl gestellt, Amboss oder Hammer zu sein, wählten wir den Hammer, - und wenn es uns nach Wollen und Wünschen geht, so soll es Thors Hammer, der „Malmer“ sein. Sie haben das treffende Bild von den Haushunden gebraucht, die unbedenklich jeder gegen Einbrecher zu Hilfe ruft. Gestatten Sie mir ein nicht minder treffendes. Ein Mann von 70 Jahren soll kein 20-jähriges Mädchen heiraten – das ist dumm, und wenn er nachher gar selber die Hausfreunde einlädt, so ist es verächtlich. So verächtlich haben sich für alle Zeiten die Franzosen prostituiert, trotzdem sie mit uns ehelichen und dauernden Frieden haben könnten. Trotz all unserer Barbarei haben wir, sehr geehrter Herr Spitteler, immer noch so viel Gemüt, uns in die Seele eines Dichters zu versenken, und so bitte ich Sie: Schreiben Sie mir ein paar Zeilen der Aufklärung. Vielleicht waltet nur ein Missverständnis, und wenn nicht: wir Deutschen lassen uns zwar nicht gern besiegen, aber desto lieber überzeugen.
Mit dem Ausdruck meiner Hochschätzung,
Ihr sehr ergebener Professor
Ob der deutsche Professor je Antwort von Carl Spitteler erhalten hat, konnte ich nicht ermitteln. Hierzu stellte ich eine Anfrage an die Carl-Spitteler-Stiftung in Luzern, die den Nachlass des Nobelpreisträgers, darunter Fotografien aus verschiedenen Zeitabschnitten, Originalmanuskripte, Briefe, Urkunden und weitere Dokumente aufbewahrt und ausstellt. Leider gab es dort keine Hinweise auf eine Antwort Spittelers auf den mir vorliegenden Brief. Eine Kopie des obigen Briefes habe ich am 11.Februar 2017 der Stiftung zur Verfügung gestellt und diese wurde vom Schweizer Archivar dankend zu den Stiftungsdokumenten hinzugefügt.
Wir drehen das Rad der Zeit noch einmal weiter in die Vergangenheit. Es ist Dienstag, der 21.April 1903. Schulanfang am Königlichen Progymnasium zu Deutsch-Eylau im damaligen Westpreußen. Der überschaubare Ort mit seiner alten Ordenskirche, gut 50 Kilometer von Danzig entfernt, hat gut zehn Tausend Einwohner und erst im Jahr zuvor konnte auf Antrag der Bürgerschaft das kleine Gymnasium mit drei Klassen und 50 Schülern seinen Betrieb aufnehmen. Für den Hilfslehrer Dr. Heinrich Schucht ist es das zweite Jahr an der Schule. Mit seiner Frau Wanda und ihrem fünfjährigen Sohn sind sie in das kleine aufstrebende Städchen gezogen. Die vorzügliche Bahnverbindung, günstige Steuerverhältnisse und die herrliche Umgegend mit Wäldern und den fast 60 Seen rund um die Garnisonsstadt gefallen der jungen Familie. In den Kiefernschonungen und den Moorböden der Niederungen kann Heinrich Schucht bei ausgiebigen Spaziergängen seine botanische Sammlung vervollständigen.
Die vielen fruchtbaren Ablagerungen von Mergelboden des Umlandes eignen sich gut für den weit verbreiteten Ackerbau in dieser Gegend. Der leicht gewellte Boden, die sandigen mit Wald bestandenen Höhen und die flachen von Feldern eingenommenen Gebiete laden zum wandern ein. Der Raudnitzer Wald, daran anschließend der Schönberger Forst, der Finckensteiner Wald und viele weitere Forsten bilden einen Komplex von über 25 Tausend Hektar. In den tiefen Stellen des Geländes liegen breite und flache Seen, der größte davon ist der 34 Kilometer lange Geserichsee. Heinrich Schucht genießt mit seiner Frau Wanda die landschaftliche Schönheit, hat aber die Wahl seines Arbeitsplatzes auch davon abhängig gemacht, dass sich an einer kleinen Schule seine weitere Karriere positiv gestalten kann, was sich auch bald bestätigt. So wird er gleich im ersten Jahr zum Oberlehrer befördert und ihm kurz darauf die zweite Oberlehrerstelle am Gymnasium verliehen.
Heinrich Schucht sieht an diesem ersten Schultag des Jahres 1903 aus dem Fenster in den kleinen Schulhof hinunter. Es ist herrliches Wetter und die Schüler spielen während der Pause abwechselnd Cricket, Fußball oder Schleuderball. Das Progymnasium hat sich gut entwickelt. 86 Schüler sind für dieses Schuljahr angemeldet. Oberlehrer Ganske, der Leiter des Königlichen Progymnasiums, hat Heinrich Schucht als Klassenleiter für die Sexta, eine 5.Klasse, vorgesehen. Seine Lehrzeit steigt von wöchentlich 22 auf 26 Unterichtsstunden: In seiner Sexta hält er fünf Stunden Deutsch, acht Stunden Latein und zwei Stunden Erdkunde, in der Quinta, Quarta und der Untertertia, der 6. bis 8.Klasse, ist er noch zusätzlich für vier Stunden Rechnen und sieben Stunden Mathematik eingeteilt. Heinrich Schucht sieht noch einmal in den neuen Lehrplan für das Schuljahr 1903/1904, obwohl er diesen bereits während der Ferien gründlich studiert hat. In Deutsch liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt auf Grammatik und Geschichtserzählungen. Zudem müssen den Schülern Deklination und Konjugation, sowie die Lehre vom einfachen Satze und der dafür erforderlichen Zeichensetzung vermittelt werden. Es sollen hierzu Rechtschreibeübungen in wöchentlichen Diktaten durchgeführt werden. Aber auch das Lesen von Gedichten, Fabeln, Erzählungen und vaterländischen Sagen soll einen Schwerpunkt im Deutschunterricht bilden. Darauf freut sich der belesene Heinrich Schucht besonders, liebt er doch das Erklären der Texte und die anschließende Diskussion mit seinen Schülern. Die Lektüre wird für dieses Jahr im Lehrplan vorgegeben: „Barbarossa“ von Rückert, „Die Wacht am Rhein“ von Schneckenburger und „Des Knaben Berglied“ von Uhland sind darunter. In Erdkunde hat Oberlehrer Schucht die Grundbegriffe der allgemeinen Erdkunde zum Verständnis des Globus und von Landkarten zu vermitteln. Dann folgt die Länderkunde, die mit der deutschen Heimat beginnt und dann mit Europa fortgesetzt wird. In Latein ist für dieses Jahr Ostermanns Lateinisches Lese- und Übungsbuch vorgegeben. Die Leseabschnitte sollen im Unterricht unter Anleitung des Lehrers übersetzt und dann zunehmend die Selbstständigkeit der Schüler beim Übersetzen in Anspruch genommen werden. Wöchentlich wird hierfür eine halbstündige Klassenarbeit zum Lesestoff durchgeführt. Insbesondere die alten Sprachen Lateinisch und Griechisch, als auch die modernen Sprachen Englisch und Französisch sind Heinrich Schuchts Leidenschaft. In Latein hat er 1898 zum Doktor der Philosophie promoviert.
30 Schüler zählt seine Sexta heuer, deutlich mehr als die 17 Schüler, die er im letzten Jahr unterrichtete. Die kleine Schule hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen. Im Kollegium wurde die Einrichtung eines Schwimmkurses für den Sommer beantragt und duch das Ministerium für den Monat August genehmigt. Heinrich Schuchts Kollege, Zeichenlehrer Köller, soll dann den Schwimmunterricht leiten. An besonders heißen Tagen kann dann statt Turnuntericht auch mit den Schülern gebadet werden und im Winter bietet der nahe See Gelegenheit zum Schlittschuhlaufen. Weiterhin hat die städtische Behörde in Aussicht gestellt einen Bootssteg am Geserichsee zu errichten, um den Schülern Rudersport zu ermöglichen. Die vielen neu gegründeten Rudervereinen zeigen, dass diese Sportart in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit gewinnt und die Seenlandschaft der Umgegend von Deutsch-Eylau ist wie geschaffen zum Rudern.
Heinrich Schucht wird das prächtige Wetter in dieser Woche nutzen, um mit seiner Klasse gleich morgen Nachmittag für Turnspiele in die umliegenden Wälder zu gehen. Einmal in der Woche, wenn es das Wetter erlaubt, legen die Klassenleiter großen Wert auf das Spielen im Freien. Die Gräfliche Forstverwaltung hat das Gesuch von Schulleiter Ganske wohlwollend gestattet und lässt unter Aufsicht eines Lehrers den Klassen Zutritt zu den Waldungen und an den Geserichsee.
Heinrich Schucht geht aus dem Konferenzzimmer in die benachbarte Lehrerbibliothek hinüber. Diese konnte durch Eigenmittel und Schenkungen deutlich erweitert werden. Er blättert interessiert in einigen Neuerwerbungen: „Menschenart und Jugendbilder“ von Grube, „Ein griechisches Lesebuch“ von Palleske, „Turnspiele“ von Eitner, „Das Rudern an den höheren Schulen Preußens“ von Schulze und „Die antiken Schlachtfelder“ von Wickenhagen müssen unter anderem noch einsortiert werden. Eine Besonderheit stellt als Neuzugang ein Exemplar von „Deutschlands Seemacht“ dar, die die Schule im Januar des Jahres im Auftrag Seiner Majestät des Kaisers als Prämie für die besonderen schulischen Leistungen eines Schülers erhalten hat. Aber auch die Schülerbibliothek ist auf einen beachtlichen Bestand von fast 300 Büchern angewachsen. Im größten Maße wurde aber die naturwissenschaftliche Sammlung erweitert. Der örtliche Hotelbesitzer Thielemann allein hat einen präparierten Fischreiher, einen Turmfalken, eine Krähe und ein Wiesel übergeben. Weitere Deutsch-Eylauer Bürger und Schülereltern haben einen Seekrebs, eine Seespinne, eine Kreuzotter und viele weitere Tiere gespendet. Die botanische Sammlung, die im Regal steht, stammt vorallem von Heinrich Schucht selbst. Er hat seiner Schule eine große Anzahl von Bildern zur Verfügung gestellt, um für eine Belebung des Unterrichts und die Förderung der Anschauung zu sorgen. Zufrieden kehrt Heinrich zurück ins Konferenzzimmer, um vor Ende der Pause noch ein wenig auszuruhen. Mit den Vorbereitungen für den großen Schulausflug am 27.Mai will Heinrich Schucht gleich morgen Abend beginnen. Er möchte mit seinen Schülern gerne durch den Kiefernwald des Schöneberger Forstes wandern, den Silmsee besuchen und anschließend am Waldschlößchen rasten. An den Ufern des Sees brüten viele verschieden Vogelarten, Kraniche und abertausende von Wildenten sind hier zu Hause. Vielleicht können sie auch einige Hirsche und Rehe an dem stillen Waldsee entdecken. Heinrich freut sich schon auf das Naturerlebnis und während er in Gedanken ist, betritt Schulleiter Ganske das Konferenzzimmer. „Herr Dr. Schucht, ich möchte Sie bitten für dieses Schuljahr die Festrede zum Kaiser-Geburtstag zu halten. Es ist eine Veranstaltung im großen Saal des evangelischen Gemeindehauses geplant. Herr Oberpräsident Delbrück und einige weitere wichtige Herren werden uns besuchen.“ Heinrich Schucht willigt ein und beide Lehrer kehren in ihre Klassenräume zurück, um den Unterricht für die aus der Pause zurückkehrenden Schüler fortzuführen.