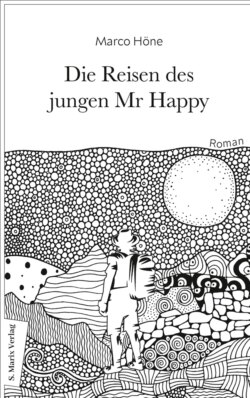Читать книгу Die Reisen des jungen Mr Happy - Marco Höne - Страница 5
REISE 1: GUNS AND MOSES IN ISRAEL
ОглавлениеIdealistische Menschen wirken unangreifbar, als trügen sie eine Wahrheit in sich, die nichts erschüttern kann. Meine erste Station sollte daher eine politische sein. Ich wollte etwas haben, das meine innere Kompassnadel streng ausrichtete, und von Ideen beseelt werden, die über mein Leben hinausweisen konnten. Es musste um Fragen von Krieg und Frieden, Menschenrechten und Gerechtigkeit gehen.
Nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt, im Einzugsbereich des Eurovision Songcontest, liegt Israel. Jenes Gebilde, das unter dem Eindruck des Holocaust den Juden als Heimstätte (wieder-)gegeben wurde. Im idealistischen Raum scheinen zwei Sichtweisen auf Israel vorzuherrschen: Die einen sehen dieses kleine Fleckchen Land als wichtige Schutzstätte der Juden. Ein Ort, an dem sie nicht Gefahr laufen, erneut Opfer eines Völkermordes zu werden. An dem sie sich selbst verteidigen können.
Die andere Sichtweise versteht Israel als ein imperiales Projekt. Im Westen am grünen Tisch ersonnen, den arabischen Völkern aufgezwungen und durch Vertreibung der Palästinenser errichtet.
Ein Reisetrend ist es, seinen Aufenthalt mit einem Ehrenamt zu verbinden. Ich nahm Kontakt zum Israel Comitee against House Demolitions (ICAHD) auf. Eine israelische Organisation, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. Die perfekte Dialektik. Sie fordern eine Zweistaatenlösung und bieten Widerstand gegen die israelische Praxis, palästinensische Häuser in den besetzten Gebieten abzureißen. Angeführt wird diese Nicht-Regierungs-Organisation von einem kleinen Weihnachtsmann namens Jeff Halper. Er wurde mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert. Angespuckt wurde er vermutlich noch häufiger.
Nach einem kurzen Skype-Interview war die Sache geritzt. Zwei Monate würde ich ohne Gegenleistung meine Arbeitskraft als Projektkoordinierer zur Verfügung stellen und erhoffte mir dafür einen Mindchanger.
Der Taxifahrer am Flughafen empfahl mir, meine Reise nicht in Tel Aviv zu beginnen, aber ich hörte nicht auf ihn. Ich begriff erst Wochen später, warum dieser Tipp richtig gewesen war.
Am Morgen nach meiner Anreise stand ich rauchend am Fenster meines Hotelzimmers und blickte auf die Israelfahnen, die überall am Strand wehten. Ein von vielen verteufeltes Land, stolz im Wind. Die Fahnen vermittelten mir ein Gefühl der Entschlossenheit eines Volkes, das am Abgrund der Vernichtung stand und es überlebt hatte. Im Fernsehen sangen U2 It’s a beautiful day. In der Tasche hatte ich die Nummer einer fetten Prostituierten, die ich aus Dankbarkeit in der Nacht zuvor fast aufs Zimmer mitgenommen hätte. Da ich keine Unterkunft reserviert hatte und Ferienzeit war, war ich die halbe Nacht umhergeirrt, um ein Zimmer zu finden. Ihre profunden Hotelkenntnisse hatten mich gerettet. Sie hatte gewusst, wo noch ein paar Betten frei waren. Im Nachbarzimmer stritt ein französisches Pärchen über einen Bordellbesuch.
Ich flanierte am Strand und war überwältigt von Lebensfreude und Toleranz. Übergroße Wandmalereien feierten die schwule Liebe. Die Menschen trugen trendige Klamotten. Es gab moderne Clubs. Die Leute schienen nicht nur zu leben. Sie feierten jeden Augenblick. Das sah nicht nach imperialer Unterdrückung aus, sondern nach Befreiung. Ein Ort, an dem Liebe und Träume blühen konnten. Die Steinzeit-Feinde ringsum versuchten es zu zertreten. Nur die Israel Defense Forces (IDF) hielten die dünne Front zwischen Freiheit und Zerstörung. Das Land ist nur wenige Kilometer breit. Hinter Tel Aviv war das Meer. Israel steht im Grunde immer mit dem Rücken zur Wand. Eine Drehtür der Gefühle geriet in Bewegung.
Was mich erschreckte, war, dass jeder kleine Laden eine eigene Security hatte. Das Sicherheitsbedürfnis war durch Jahrzehnte voller blutiger Anschläge maximal. Ich versuchte, mich nicht stressen zu lassen. Die Paranoia war mir fremd. Nach zwei Tagen ging ich zu Fuß mit meinem Rollkoffer zum Bahnhof von Tel Aviv. Bahnhöfe sind in diesem Land immer am Stadtrand zu finden.
Weil ich befürchtete, ich könnte nicht genug Facebook-Erinnerungen haben, fotografierte ich ein bisschen die Gegend. Ich dachte noch, dass die Häuser auf der anderen Straßenseite merkwürdig unecht aussahen, als seien sie nur aufgemalt. Dann schrie jemand hinter mir in kehligem Englisch, ich solle stehen bleiben. Verwundert drehte ich mich um und sah einen kleinen Mann, der aussah wie jemand, der Ladendiebe jagte, auf mich zusprinten. Beim Rennen sprach er in sein Funkgerät.
»Gibt es ein Problem?«, versuchte ich mich zu erkundigen. Barsch wurden mein Koffer und ich getrennt. Noch mehr Security erschien, wie Fliegen, die einen Scheißhaufen gefunden hatten. Einer schnappte sich meinen Koffer und legte ihn in eine Häuserecke. Zwei andere hielten mich an den Armen fest.
»Entschuldigung, ich will nur zum Bahnhof?«
Bis hierhin war ich begeisterter Zuschauer. Vor mir entrollte sich eine großartige Anekdote.
»Geben Sie uns den Schlüssel für Ihren Koffer.«
Ich holte den Schlüssel bemüht langsam aus meiner Tasche. Alle waren sehr nervös. Die Sonne brannte ihr Autogramm tiefrot in meine Stirn.
Mit dem Schlüssel in der Hand näherte sich die arme Sau vorsichtig meinem Koffer. Ich malte mir aus, was passieren würde, wenn ich wirklich ein Terrorist wäre. Dann würde er sich gleich zusammen mit meinen Unterhosen in der näheren Umgebung verteilen.
Nach einer ersten Prüfung meiner Unterwäsche wurde ich in ein naheliegendes Gebäude gebracht und auf einen Stuhl gesetzt. Am Eingangstor sah ich zum Hohn das große Schild »Fotografieren verboten«.
Es gab eine Theke, auf die mein Koffer gelegt und ausgeweidet wurde. Zwei schwarze Soldaten mit schlechtsitzenden Uniformen und Maschinengewehren standen missmutig herum. Ein dicker Polizeibeamter kam herein, ließ sich instruieren und begann mir immer dieselben Fragen zu stellen:
»Warum fotografierst du hier?«
»Wo willst du hin?«
»Wo hast du letzte Nacht geschlafen?«
Ich antwortete auf alles: »Keine Ahnung, ich bin nur Tourist.«
Eine Ahnung ließ mich mein Praktikum verheimlichen. Ich fühlte mich respektlos behandelt. Spätestens seit sie in meinen Koffer gesehen hatten, hätte das Ganze eine Wendung nehmen müssen. Aber sie hatten eine Lüge gerochen.
Der Polizist nahm meine Digitalkamera und sah sich ohne mein Einverständnis die Fotos an. Schnell war er bei Fotos aus Deutschland angelangt. Darauf zu sehen waren ich und Jannes. Er trug ein Metal-Shirt von mir.
»Wer ist das?«
»Das ist mein Boyfriend.«
Kurz vor meiner Abreise hatte ich Jannes kennengelernt. Einen jungen Tänzer, der aussah wie die polnische Version von Justin Bieber. Völlig betrunken war ich über mich hinausgewachsen und hatte ihn am Pissoir einer Kneipe, in der ich meine baldige Reise feierte, angesprochen. Er kam mit mir nach Hause, Neugierde trieb ihn. Meine betrunkene Selbstsicherheit hielt kaum fünf Minuten, nachdem wir die Bar verlassen hatten. Ich war völlig verschüchtert und unbeholfen. Wir verbrachten dann die Nacht zusammen. Es war eine Nacht, in der das Schicksal nach Sex verlangt hatte, aber ich war dazu nicht in der Lage gewesen, hatte mich nur weiter an meiner Hausbar betrunken, konnte keine Nähe zulassen. Immer wenn er an mich herangerückt war, war ich aufgesprungen. Trotzdem schlief er bei mir. Dafür hatte ich ihm das Metal-Shirt gegeben. Erst als er schlief, hatte ich mich langsam annähern können und ihn umarmt. Da war so viel Angst im Weg gewesen, soviel Unfähigkeit, meine Gefühle auszudrücken. Nun nannte ich ihn »Boyfriend«. Ich sprach es aus, ohne nachzudenken. Ich wollte keinen Millimeter in die Defensive geraten. Der Polizist war der erste Mensch, vor dem ich mich geoutet hatte.
»Dein Boyfriend? Du bist schwul?«
»Ja, bin ich.«
Auch im liberalen Israel schien er überrascht darüber zu sein, mit welcher Klarheit ich seine Fragen beantwortete. Das gab mir kurz Oberhand. Dann fanden sie mein Notizbuch.
Es entstand wilder Gesprächsbedarf. Der Polizist nahm das Notizbuch und schlug die Seite auf, auf der ich mir die Adresse von verschiedenen Hostels in Jerusalem notiert hatte.
»Warum ist hier eine Adresse in Ostjerusalem? Was willst du da?«, sein Ton wurde nun ernster.
»Das ist ein Hostel, wo ich vielleicht übernachten will.«
»Wen triffst du da?«
»Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich treffe da niemanden. Ich will nur gucken, ob es da ein freies Zimmer gibt.«
Er sah mir tief in die Augen.
»Für wen ist das Geld?«
Aus den letzten Seiten des Notizbuches rutschten dreihundert Euro in seine Hand.
»Das ist mein Geld.«
Ich bekam ein warnendes Gefühl. Die Indizien verwandelten sich in dieser Unterhaltung Stück für Stück in eine Realität, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte.
»Warum ist hier die Adresse von ICHAD aufgeschrieben? Kennst du diese Organisation?«
»Ja, ich kenne die.«
»Woher kennst du sie?«, er kam näher an mein Gesicht.
»Aus dem Internet. Ich habe Politik studiert. Ich interessiere mich für solche Sachen.«
Ich begab mich vollends auf das Glatteis einer Lüge. Ob das Eis trug, war ungewiss. In meinem Kopf tauchte die Frage auf, ob mein Touristenvisum rechtlich ausreichend war, um ein Praktikum zu machen?
Auf diese Weise vergingen zwei Stunden. Immer wieder dieselben Fragen, immer wieder dieselben Antworten. Sogar nach Jannes fragte er erneut. Es ging sicherlich darum, einen Widerspruch zu finden.
Nach vier Stunden betrat ein neuer Mann das Spielfeld. Trotz des Hemdes war erkennbar, dass er überall stark behaart war. Die Haare kräuselten aus jeder Ritze, guckten ihm hinten aus dem Kragen. Er nahm meinen Pass und auch meine Bankkarte und kopierte sie. Dann führte er mich nach draußen auf die Straße. Den Pass nahm er dabei mit, alles andere blieb im Raum. Er gestattete mir, eine Zigarette zu rauchen. Die perfekte Gelegenheit, um wegzurennen. Ob sie das wollten? Es wäre ein starkes Indiz für meine ansonsten noch nebulöse Schuld.
»Du hast gesagt, du kennst ICHAD. Dann sagst du, du triffst niemanden. Das ist Bullshit!«
Ein paar Tränen meldeten sich in meinen Augen. Es war so absurd.
»Nicht ›kennen‹, kennen. Nicht persönlich kennen. Ich habe im Internet darüber gelesen und fand es interessant.«
»Du hast dir ihre Adresse notiert. Willst du ihnen Geld bringen?«
»Nein, ich bin nur Tourist.«
»Bullshit!«, sagte er langsam.
Dadurch wirkten seine Worte umso grausamer. Sie hatten mich bei den Eiern. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir daraus einen Strick drehen würden.
Ich wurde wieder zurückgebracht. Man gab mir ein Glas Wasser, das komisch schmeckte. Drogen?, war ein spontaner Gedanke.
Dann betrat ein Mann den Raum, der aussah wie eine Mischung aus Mensch und Stier. Jemand, der mit einem Messer zwischen den Zähnen und einer Kalaschnikow dreißig Terroristen platt machen konnte. Auch er ließ sich erst instruieren, betrachtete alle meine Sachen, würdigte mich keines Blickes. Schließlich beugte er sich zu mir runter.
»Es ist deine letzte Chance.«
Ich schluckte unwillkürlich.
»Du musst jetzt die Wahrheit sagen.«
»Ich habe die …«
»Nein, du hast uns Scheiße erzählt und wir wissen das.«, sagte er bestimmt.
Ich senkte den Blick. Wieder aufsteigende Tränen. Ich drängte sie zurück. Hier entschied sich alles. Weinen bedeutete Schuld. Ich sah, wie eine Zigarette aus seiner Brusttasche zu Boden fiel.
»Das Gesetz gibt mir das Recht, dich 48 Stunden festzuhalten, bevor du einen Richter siehst. Diese 48 Stunden verbringen wir zwei in einem kleinen Raum. Nur wir zwei, ganz alleine. Würde dir das gefallen?«
Ich sagte nichts.
»Ich weiß, was du bist. Du bist ein Anarchist, der den Palästinensern Geld bringen will und diese 48 Stunden werden ein großes Vergnügen für mich sein. Du wirst niemanden anrufen. Niemand sonst wird dich sehen. Nur wir zwei. Alles klar?«
In meinem Kopf startete der Film, den er mir zeigen wollte. Ich sah mich auf einem Stuhl, eine Lampe blendete mich. Er würde über mir stehen und mir Ohrfeigen geben oder andere Schläge. Hauptsache man konnte später keine Spuren finden. Er würde mich wie ein nasses Handtuch auswringen. Mit dieser Gewissheit sagte ich:
»Ihre Zigarette ist runtergefallen.«
Er sah auf den Boden und hob sie auf. Dann sah er mich an und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum.
Es verging noch eine Stunde. Ich wartete darauf, zu meiner Folter aufgerufen zu werden. Die Soldaten boten mir Wasser an und sagten, dass ich rauchen dürfte, aber ich lehnte alles ab. Ich hatte beschlossen, mich in mir zu vergraben und die Außenwelt abzublocken. Meine Mutter würde die deutsche Botschaft anrufen. Sie würden mich schon nicht umbringen. Ich würde ausgewiesen werden und das Abenteuer wäre beendet. Scheiß drauf.
Wieder kam der behaarte Mann mit meinem Pass. Er führte mich nach draußen. Ein anderer Soldat folgte uns mit meinem Koffer.
Jetzt geht es los. Jetzt komme ich in die Folterzelle.
Zum ersten Mal erlaubte ich mir, den ganzen Gebäudekomplex zu betrachten. Überall waren Kameras und Stacheldraht. Es sah wirklich aus wie ein Gefängnis.
»Es tut mir leid, es ist wegen der Situation.«, sagte der Mann und gab mir meinen Pass.
Der Soldat stellte den Koffer neben mich. Dann gingen beide wieder hinein. Ich war frei. Benommen und entwürdigt stolperte ich zum Bahnhof und ahnte nicht, dass dies der erste Probierhappen von dem war, was mich in Jerusalem an Paranoia erwartete.
Tel Aviv wirkte europäisch und zukunftsorientiert. Jerusalem hingegen dünstete nach Nahem Osten und schwerer Vergangenheit, die das Land bremst, aber an der zugleich sein Herz hängt. Insbesondere die Altstadt von Jerusalem ist Wahnsinn in kompakter Form. Armenisches Viertel, jüdisches Viertel, christliches Viertel, muslimisches Viertel – auf engstem Raum reiben sich die Weltreligionen aneinander. Händler feilschten, als ginge es um ihr letztes Hemd, Gebetsgesänge erschallten mehrmals am Tag. Auf dem Dach einer äthiopischen Kirche hatte sich eine christliche Minisiedlung niedergelassen. Über den Weg, den Jesus zu seinem Tod schritt, ging es zur Klagemauer, über der die al-Aqsa-Moschee thronte. Orthodoxe Juden murmelten Litaneien zu den Steinen. Auf dem Vorplatz der Grabeskirche von Jesus Christus fanden hin und wieder Massenschlägereien zwischen verschiedenen christlichen Konfessionsgruppen statt. In ruhigen Momenten lief ein armenischer Patriarch mit Red-Bull-Dose und Halsketten wie ein Gangsterrapper an ihnen vorüber. Mönche gingen hinter orthodoxen Juden durchs muslimische Viertel, wo alle Händler einem Touristen mit »Free Palestine«-T-Shirt applaudierten. Eine jüdische Familie siedelte auch dort und musste hinter Maschinengewehren und Stacheldraht leben. An der Altstadtmauer lebte ein Obdachloser, der entweder im Gras schlief oder wilde Predigten hielt. Niemand sah in ihm einen neuen Heiland, alle suchten nach Spuren der etablierten Verkünder.
Das waren die Eindrücke eines halbstündigen Spazierganges. So eng war es dort. Vielleicht war es ein Blick in eine Dystopie: ein Schmelztiegel mit Zentrifugalkräften. Es gab keine schwulen Wandmalereien und keine französischen Pärchen im Liebesrausch.
Ich bezog für die Wochen meines Praktikums Quartier im Jaffa-Gate-Hostel. Es lag in einer kleinen Gasse hinter Wäscheleinen, unter denen den ganzen Tag lang arabische Männer beim Brettspiel palaverten und Tonnen von Tabak vernichteten.
Dieses Hostel war, wie alle in der Altstadt, ein Fels, an dem allerhand wirre Existenzen angeschwemmt wurden. Da war Hannah, eine New Yorker Jüdin, die nach ihrer Krebsdiagnose beschloss, Familie und Freunde hinter sich zu lassen, um in der Altstadt von Jerusalem langsam zu verrecken. Abends saß sie kichernd vor Cartoon-Sendungen im Fernsehraum. Ständig bestand sie darauf, mir – wann immer ich vorbeiging – eine Tasse Tee sowie Gespräche über Gott aufzuzwingen oder mir wiederholt für den Holocaust zu verzeihen. Ich bedankte mich dafür.
An der Rezeption saß Ryan. Er war angeblich Segellehrer in den USA gewesen. Ich hörte aber auch einmal, wie er mit den Besitzern sprach und ihnen versicherte, aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als CIA-Analyst genau bestimmen zu können, wer im Hostel ein verdeckter Spion sei. Auch ich wurde von ihm verdächtigt für den BND zu arbeiten.
Und dann war da ein orthodoxer Jude, den ich aufgrund seiner komischen Aussprache erst für behindert hielt. Später fand ich heraus, dass er sich beinahe jedes Wochenende mit der israelischen Polizei prügelte, um zu verhindern, dass ein Bezahlparkplatz am Shabbat, dem jüdischen Ruhetag, seinen Geschäften nachging. Dabei war ihm mehrfach der Kiefer gebrochen worden.
Mein Lieblingsgast aber war Peter. Es gab ein Schild in der Lobby, auf dem stand, dass der Konsum von Alkohol im Hostel zum sofortigen Rausschmiss führen würde. Aber jeder trank heimlich. Peter und ich trafen uns ein paar Mal in seinem winzigen Zimmer und machten zusammen eine Flasche Arak leer. Dabei erzählte er mir die Geschichte, wie er »gegen alle 10 Gebote« verstoßen hatte.
Er hatte in Italien gelebt und war in ein Mädchen verliebt gewesen. Aber nicht nur er, sondern auch ein zweiter Verehrer. Peter arbeitete als Hilfskoch in einem Restaurant, das einem italienischen Mafiaclan gehörte. Abend für Abend, während er Spaghetti mit Meeresfrüchten zubereitete, klagte er sein Leid. Der andere Mann wollte sich nicht zurückziehen, das Mädchen keine klare Entscheidung treffen. Eines Abends fragte einer der Schläger, die dort ein- und ausgingen, ob sie sich als »Freundschaftsdienst« dieses Problems annehmen sollten? Peter hatte genau gewusst, was das hieß und nicht abgelehnt, nur geschwiegen und vielleicht sogar genickt. Der Schläger nickte ebenfalls und es folgten bange Tage des Wartens. Was würde nun passieren?
Der andere Verehrer tauchte nie mehr auf. Peter verstand, was das zu bedeuten hatte und fragte nie mehr danach. Er eroberte sein Mädchen und packte die Schuld in seinen Rucksack. Wie ein Gewicht, das man trägt, wog die Schuld mit jedem Tag ein Stückchen schwerer. Nach nunmehr 40 Jahren war er gebeugt und ging zur Buße jeden Tag auf Golgatha. Sein Leben bestand daraus, jeden Tag Vergebung zu erbitten. Krebs hatte sein Mädchen dahingerafft. Eine weltliche Strafe hatte er nie bekommen.
Zu diesen Dauergästen kamen nicht weniger mysteriöse Tagesgäste. In Erinnerung blieb mir insbesondere ein Mann, der den ganzen Tag weinend durch die Flure lief und sich abends auf seinem Zimmer mit einer Bibel bei offener Tür auf den Kopf schlug.
Alle Bewohner hatten ein Kreuz, an das sie sich tagtäglich schlugen. Und alle hatten ihre Leidensgänge. Ryan ging jeden Tag auf den Ölberg, Hannah um 5.30 Uhr zur Klagemauer und Peter eben jeden Abend auf Golgatha. Mich marterte kein Gott, sondern die Erkenntnis, dass ich in 25 Lebensjahren noch nicht in der Lage gewesen war, meine zahlreichen Schwärmereien für Männer in eine einzige echte Beziehung zu überführen. In meinem Geist leierte eine Dauerschleife: »Es gibt keine Liebe für dich.« Es war eine plötzliche Erkenntnis beim Bier: Ich hatte mich in meiner Verklemmtheit maximal eingerichtet.
Für mich – wie für alle Hostel-Bewohner – schien Jerusalem nicht die Erlösung vom Leiden zu sein, sondern sein Verstärker. Wir krochen alle immer tiefer in unsere Abgründe. Peter bekam keine Vergebung, Hannah dachte nur an ihren schmerzhaften Tod, der orthodoxe Jude regte sich jeden Tag mehr über den Säkularismus in der Welt auf.
Ich schwärmte immer stärker für Jannes: sein Lachen, seine Bewegungen, seine Haare. In Jerusalem klopfte mein Herz schneller. Die eine Nacht spukte mir unruhig im Kopf herum: Seine Stirn gegen meine Wange gedrückt, sein Atem auf meiner Brust.
Jeden Abend in Jerusalem quälte mich meine Verklemmtheit. Ich war für Julia, Mareike und Annika eine Sackgasse gewesen und auf meiner Seite des Ufers nie über das Level betrunkenen Spaßfummelns hinausgekommen. Sören, Fabian und Dennis hätten große Lieben sein können, waren aber meine Einbahnstraßen gewesen. Weil ich es auch nie gewagt hatte, es zu versuchen. Nicht zu erwähnen, die unzähligen Schwärmereien für Promis wie Bill Kaulitz und Kim Frank (bevor er ein aufgeschwemmter Grunger wurde).
Mein Leidensgang führte mich zu Elias, einem Kioskbesitzer, der mir Bier verkaufte, aber nicht ausschloss, mich irgendwann zum Islam zu konvertieren. Dann ging ich vom Jaffator an der Altstadtmauer entlang zum Damaskustor. Dabei überschritt ich die unsichtbare Grenze zum besetzten Ostjerusalem. Dort trank ich das Bier, beobachtete Katzen, die sich wie Affen an Stromleitungen entlanghangelten und folterte mich mit Sehnsüchten nach Sex und Zärtlichkeit. Ich träumte davon, wie Jannes mich am Flughafen abholen würde und wusste, dass das nicht passieren würde. Wenn ich dann angetrunken war, schrieb ich ihm SMS, auf die er fast nie reagierte. Wenn er doch antwortete, dann oft nicht mal ein richtiges Wort wie »lol« oder »aha«. Am schlimmsten war die Abkürzung für Okay: »k«. Auf ihn musste ich völlig schizophren wirken.
Die Stadt war voller Extremisten. Ihre Grimmigkeit legte sich wie Smog auf die Dächer und Gemüter. Dazwischen wuselten UN-Mitarbeiter und Massen von Politikstudenten, für die der Konflikt wie Amphetamin wirkte.
Der Konflikt, der mich und andere anlockte, war in Jerusalem auf die Spitze getrieben worden. Die Grenze, die ich jeden Abend, ohne es weiter zur Kenntnis zu nehmen, überschritt, war für jüdische Israelis wie eine Mauer. Taxifahrer weigerten sich, darüberzufahren. Am Rathaus von Jerusalem sah man Einschusslöcher aus der Zeit vor 1967, als arabische Scharfschützen aus kurzer Distanz, direkt vom Jaffator aus, ihrer Arbeit nachgingen. Überall wachte das Militär, den Finger schon am Abzug. Aber vielen Zivilisten schien das nicht zu reichen. Die Knarre im Hosenbund eines radikalen Siedlers wurde mir bald zum gewohnten Anblick. Eltern brachten, wenn sie im Viertel der anderen wohnten, ihre Kinder mit entsicherter Waffe vom Haus ins Auto.
Natürlich verschaffte mir meine Tätigkeit bei ICHAD einen noch tieferen Einblick in den täglichen Kampf zwischen Israelis und Palästinensern. Dieser war nicht immer so augenscheinlich wie eine Intifada mit brennenden Reifen auf der Straße, aber es ging tagtäglich um jedes Staubkorn. Nichts wurde freiwillig hergegeben. Nimm, also wird dir gegeben, war das Gebot. Auf manchen T-Shirts stand »Guns n’ Moses« als Landesmotto.
Bei ICHAD war man sehr froh, dass ich tatsächlich gekommen war. Es käme ständig vor, dass Praktikanten in letzter Minute absagten, »weil irgendwo mal wieder eine Bombe explodiert« sei. Tatsächlich flogen einige Raketen aus dem Gazastreifen herüber, da dort verschiedene Extremisten um die Macht kämpften und sich profilieren wollten. Am Jaffator wurde eine Autobombe gefunden, aber rechtzeitig entschärft.
Die Einblicke, die mir ICHAD gab, ließen mich den Freiheitsgeschmack aus Tel Aviv vergessen. Als ich das erste Mal einen Checkpoint in die besetzten Gebiete überquerte, war ich fassungslos: Ein Tor von der ersten in die dritte Welt. Die Menschen lebten im Elend. Auch in Israel muss man sich an große Kakerlaken und streunenden Katzen gewöhnen, aber was ich nach dem Checkpoint sah, war brennender Müll am Straßenrand und Kinder, die dazwischen spielten. Es gab keine Gehsteige, keine Parks und kaum Beleuchtung.
Was es gab, war eine große Gastfreundschaft bei den Palästinensern. Unsere Fahrt führte uns zu einem Richtfest. ICHAD organisierte Freiwillige, die die Häuser wiederaufbauten, welche die israelische Armee wegen mangelnder Baugenehmigung (die nirgends zu bekommen war) zerstörte. Zwei Häuser waren fertiggestellt worden und das sollte gefeiert werden. Auf staubigen Plastikstühlen saßen wir zwischen unverputzten Häusern und trockener Wüste. In Sichtweite war ein israelischer Militärposten. Soldaten blickten mit Ferngläsern herüber. Auf der Bühne hielten Jeff Halper und Vertreter der Fatah ihre Reden. Jeff hatte seine Tochter auf dem Arm. Er benutzte sie als Zeichen seines Vertrauens, das er an die Stelle von Paranoia und Feindschaft gesetzt hatte. Ein palästinensischer Junge brachte mir Tee und sah, dass ich die billigsten Zigaretten rauchte. Er bot mir seine an. Ich empfand eine große Freude, dass zumindest einige wenige Menschen auf der Welt sich für das schmutzige Schicksal der Palästinenser interessierten.
Nach den Förmlichkeiten waren wir bei einer Familie zu Hause zum Essen eingeladen. Die Frauen kümmerten sich ums Essen, die Männer saßen faul herum. Ich fragte mich, was wohl passieren würde, wenn ich mit Jannes gekommen wäre. Ich wusste es. In Tel Aviv hätten wir Hand in Hand durch die Straße in dutzende Bars gehen können. In Jerusalem aber gab es keine Schwulenbar. Der Christopher Street Day war wiederholt angegriffen, Teilnehmer sogar niedergestochen worden. In Palästina hatten sich die Schwulen noch nie auf die Straße gewagt.
Diese Gedanken wurden überdeckt von den düsteren Geschichten der freiwilligen Helfer. Während des Baus kampierten sie vor Ort und mehrfach wäre es vorgekommen, dass das israelische Militär sie nachts überfallen und zusammengeschlagen hat. Bruno, ein drahtiger Finne, war in diesen Nächten zum Antisemiten geworden. Er war mit einem großen Herzen und dem Glauben an eine Welt in Harmonie und Frieden ins Land gekommen und nun schimpfte er den ganzen Abend auf »die Juden«, als wäre der Geist von Julius Streicher in ihn gefahren.
Dieser muffige und unreflektierte Hass widerte mich an, aber ich musste zugeben: Ich begann, mich vor den israelischen Sicherheitskräften mehr zu fürchten als vor den Palästinensern.
An einem anderen Tag besuchten wir eine Familie in Ostjerusalem. Kinder, Eltern, Großeltern lebten mit Matratzen unter freiem Himmel auf der Straße. In Sichtweite befand sich ihr Haus, auf dem allerdings eine Israelfahne wehte und aus dessen Fenster ein Schnellfeuergewehr auf uns zielte. Israelische Siedler hatten das Haus besetzt, da es angeblich jüdischer Besitz sei. Die Familie hatte zwar seit drei Generationen in dem Haus gelebt, aber der entsprechende Grundbucheintrag war bei den jordanischen Behörden verschlampt worden. Die Siedler waren mitten in der Nacht gekommen und hatten neben Gewehren auch die Besitzurkunde eines Rabbis von vor hundert Jahren dabei. Gerechtigkeit sieht anders aus.
In der Davidstadt südlich der Altstadtmauern hingegen hatte eine palästinensische Familie alle Besitzurkunden und lebte in einem ärmlichen Verschlag. Viele interessierte Juden boten ihnen dafür Millionenbeträge, damit sie wegzögen und so die Besiedlung wieder einen Millimeter voranschreiten konnte. Die Familie weigerte sich und lebte lieber in Armut als dieses Fleckchen Land aufzugeben. Es war klar: Wer sein Land verließ, würde es nie wieder betreten. Direkt über dem Haus war ein Aussichtspunkt. Dort genossen jüdische Reisegruppen die Aussicht auf Ostjerusalem. Das gelobte Land.
Was mir in Tel Aviv wie ein modernes, lebenslustiges Land vorgekommen war, bekam in Jerusalem den Anstrich eines rassistischen Polizeistaates. Viele Freiwillige bei ICHAD berichteten von Repressionen. Wollte man Kontrollen entgehen, sollte man eine Kippa tragen. In den palästinensischen Siedlungen gab es Bezugsscheine für Wasser, in den israelischen Siedlungen daneben spross das Rasengrün auf den Verkehrsinseln mitten in der Wüste. An den Checkpoints sah ich Araber in hüfthohen Stahlkäfigen sitzen. Vermutlich hatten sie versucht, ohne Sondererlaubnis nach Israel zu gehen. Während der Gazastreifen bombardiert wurde, war Madonna in Jerusalem zu Gast und die Leute feierten.
Desto mehr Scheiße ich sah, desto ausufernder wurden meine abendlichen Trinkgelage. Ich scherte mich nicht um Wochentage. Ich soff mich allabendlich durch die Straßen von Jerusalem.
Auch dort nur die dunklen Widersprüche. Einmal wurde mir am Tresen damit gedroht, erschossen zu werden, da ich behauptet hatte, Menschenrechte müssten auch für Palästinenser gelten: »Arabs have no human rights!« Direkt in der Nähe der Kneipe war vor zwei Jahren ein Bus »geplatzt«.
In einer anderen Kneipe erklärte mir eine aus England emigrierte Jüdin wiederum, dass die Deutschen aufhören müssten, sich wegen des Holocausts schuldig zu fühlen, um endlich Kritik an Israel zu üben. Israel bräuchte Kritik. Sie plädierte für einen demokratischen, multiethnischen Gesamtstaat. Ich erinnerte mich an die Überlebende aus Theresienstadt, die ich auf einer Klassenfahrt in Tschechien treffen durfte. Auch 60 Jahre nach den furchtbaren Ereignissen hatte sie angefangen zu weinen, als sie erzählte, wie die SS ihre Eltern erschossen hatte. Auch Yad Vashem habe ich besucht und mich gefragt, ob jemals in spontaner Raserei deutsche Besucher an diesem Ort totgeprügelt wurden und wenn nein, warum eigentlich nicht? Ich kenne mein Familienalbum. Mein Urgroßvater posierte stolz in Naziuniform. Er trug diese Uniform, weil er Karriere machen wollte. Drei Generationen später erschien es mir zunehmend falsch, mir überhaupt eine Meinung zu erlauben. Eine eigene Meinung hatten die Deutschen gar nicht verdient. Verdient hätten wir es, bis heute überall auf der Welt angespuckt zu werden.
Es gab in Jerusalem zwar keine Schwulenbar, aber in einer dunklen Nebensraße gab es eine Kneipe (»הפינה« = die Ecke), die jeden Montag eine Transvesie-Show veransaltete. Ein Funke in der erdrückend-religiösen Heteroherrschaft. Der Abend dort endete, indem ich angegriffen wurde, als ich vor die Tür trat. Fanatiker hatten im Schatten einer Mülltonne auf ein einsames Opfer gewartet. Ich konnte mich soweit wehren, dass es glimpflich ausging und ich kurz später in einer russischen Kneipe saß, die komplett mit Putinbildern ausgeschmückt war. Ich überredete den Barkeeper, dessen Arme von Narben überzogen waren, Black Metal zu spielen. So saß ich, nachdem ich für meine Homosexualität angegriffen worden war, unweit des Todesortes von Jesus und hörte satanische Musik, während alle um mich herum damit beschäftigt waren, sich das Leben zur Hölle zu machen. Das war die Spiritualität des Saufens: Ein Schrei zum Himmel und ein Absurz ins Fegefeuer. Ich meinte, den Hass spüren zu können, wie er in dicken Adern durch die Straßen pulsierte. Wie Vampire saugten die Menschen davon.
Ein paar Mal war ich mit dem Zug für Tagesausflüge in andere Städte gefahren. Und jedes Mal war der Zug fast leer gewesen, als er ab- oder einfuhr. Die Stadt scheint für die Hardcore-Extremisten zu sein und die wollen auch nicht mehr raus aus ihrer Zelle.
Meine Pro-Palästina-Haltung war auf ihrem Höhepunkt. Insbesondere nervte mich die ständige Angst. Viele Israelis waren nie in den besetzten Gebieten gewesen und wenn, dann nur als Soldaten. Sie wussten nichts über die Zustände dort. Jeff Halper hatte mir den Eindruck vermittelt, dass man einfach nur die Hand ausstrecken müsse und dann würde sie ergriffen. Also fuhr ich nach Ramallah. Die Kapitale dieser bärtigen Steinzeitmenschen, die angeblich nichts anderes im Sinn hätten, als einen zweiten Holocaust anzuzetteln.
Der erste Eindruck, den man auf der Fahrt dorthin bekommt, wird durch die Mauer vermittelt. Die Mauer war einfach nur Gewalt. Sie zerriss das Land. An ihr strandeten die Schicksale wie Plastikmüll am Strand. Der Checkpoint wirkte wie ein notdürftig mit Stacheldraht verhangenes Loch. Ich saß in einem arabischen Bus. Der einzige Weiße weit und breit.
Ramallah wirkte auf den ersten Blick wie Jerusalem. Die gleiche Bauweise, das gleiche Katzenproblem. Alles schrie, stank, wuselte kreuz und quer. Etwas überfordert ging ich in ein Lebensmittelgeschäft und bemerkte zerknirscht, dass es kein Bier zu kaufen gab. Als ich dann aber den Besitzer fragte, wie ich zu Arafats Grab käme, wurde mir wieder eine überschwängliche Gastfreundschaft zuteil. In der Folge kümmerten er, ein Taxifahrer sowie ein paar Soldaten sich mit wahnsinniger Freude darum, dass ich mein Ziel fand. Niemand versuchte mich zu betrügen oder war misstrauisch. Die Ehrengardisten am Grab waren dankbar, dass ich ein Foto von ihnen schießen wollte. Ich ging händeschüttelnd durch die Straßen. Überall grüßten mich die Leute und feierten meine Anwesenheit. Die wilde Stimmung voller Herzlichkeit riss mich mit. Obwohl Ramadan war, konnte ich problemlos ein paar Falafel bekommen und bestellte zwei Portionen, weil ich den Verkäufer sexy fand. Am Shabbat in Jerusalem wäre ich dafür geköpft worden. Auf der Straße sah man vollverschleierte Frauen und metrosexuelle Männer sowie alle Facetten dazwischen. Zwar wird es dort in den nächsten zehn Jahren keinen Gay-Pride geben, dennoch war der direkte Vergleich mit Jerusalem beschämend. Ramallah schien bunter und herzlicher als der Moloch am Ölberg.
Der Rückweg zog mich wieder runter. Erst lebensfrohe Straßen, dann die volle Härte aus Beton, Stahl und Stacheldraht am Checkpoint. Man wartete in einem kameraüberwachten Stahlkäfig, bevor man bei Israelis hinter Panzerglas vorstellig werden durfte.
Am Abend fragte ich Elias, ob er nicht wütend sei.
»Du bist hier geboren, aber ein Mensch zweiter Klasse.«
Elias kassierte einen Kunden ab, ich öffnete mein Bier und setzte mich wie gewohnt in eine Ecke des Ladens.
»Du verstehst nicht, was es heißt, hier geboren zu sein. Ich bin im Flüchtlingslager Schufat aufgewachsen. Ich wohne da noch immer, habe aber einen blauen Schein zum Passieren.«
Er wedelte mit einem blauen Papier in der Luft.
»Ich kann meine Familie versorgen. Ansonsten ist alles immer dasselbe. Stiefel, die dich treten, Zäune, durch die du seit deiner Geburt blickst.«
Ich sah mich bestätigt: »Genau, wie schaffst du es, hier einfach alle zu bedienen, als würde dir kein Leid angetan?«
»Es ist dir egal, wenn du hier lebst. Du bist wie eine Kakerlake, die sich ihren Weg sucht und – Inshallah – einen Weg findet, zu überleben.«
Nachdenklich und angetrunken ging ich später an der Grabeskirche vorbei, in der die Christen wie zugedröhnte Fixer herumsaßen. Auch sie konzentrierten sich nur auf sich und darauf, wie sie die nächste Dosis Gott bekommen konnten.
Ich wurde besessen davon, die angeblich gefährlichen Gebiete zu besuchen und beschloss, ins Flüchtlingslager Schufat zu fahren. Dass sogar die arabischen Busfahrer mich anguckten, als sei ich lebensmüde, ignorierte ich. Als ich dann kurz nach dem Checkpoint ausstieg, bereit, einmal mehr von der Wahrheit zu kosten, empfing mich allerdings eine ganz andere Stimmung. Keine Lebensfreude, sondern grimmige Wut. Hier spürte man jahrzehntelange Hoffnungslosigkeit und Erniedrigung. Die Kinder grüßten mich mit »Shalom« und ich hatte den Instinkt, so zu tun, als würde ich nicht verstehen. Ich fürchtete, sie wollten mich als Juden enttarnen, um mich dann zu massakrieren.
Ihr zweitliebstes Hobby war, gegen alle Autos auf dem Weg aus dem Flüchtlingslager zu treten. Ein müder Frust. Das Leben ist ein Glücksspiel und die meisten werden schon bei der Geburt betrogen. Die Kinder hier hatten das früh verstanden.
An die Wände waren Totenköpfe gesprüht und ich befürchtete, sie waren eine Warnung. Auch die grünen Fahnen der Islamisten waren zu sehen. Ich war froh, mich nie außerhalb des Sichtbereiches des israelischen Wachturms begeben zu haben und ging schnell dorthin zurück. Schlüpfte mit meinem deutschen Pass schnell durch die Kontrollen, während Araber in Käfigen saßen, und atmete erleichtert durch. Ich genoss das Gefühl von Sicherheit wie ein Glas Wasser in der Wüste.
Es kam der letzte Tag meines Praktikums. Jeff und die meisten anderen waren irgendwo im Wüstenstaub und taten, was sie für richtig hielten. Nur Meir war im Büro. Er saß als Ratsherr im Jerusalemer Rathaus und hatte in irgendeinem der Kriege Teile seiner rechten Hand verloren. Er reichte mir die Reste zum Abschied und fragte: »Und hast du was verändert? Sind wir dem Frieden ein bisschen näher?«
Ich sah ihn müde an und sagte: »Was soll man denn hier ändern?«
Er lächelte. Der Krieg funktioniert für alle bestens. Wut, Hoffnung, Aktion, Resignation, Legitimation – alles speiste sich aus dem Fleischwolf. Am Ende eines Tages will niemand seine Kinder zu Grabe tragen, aber alle maßgeblichen Akteure (PLO, Hamas, Israels Rechte und dutzende NGOs) lebten gut davon, wenn der Krieg kein Endkampf war, sondern ein »frozen conflict«. Was sollten sie tun, wenn das alles ein Ende fand?
Ich war glücklich, Jerusalem zu entkommen. Raus aus der moralischen Kloake. Alle im Hostel verabschiedeten mich wie jemanden, der seine Prüfung bestanden hat.
»Vergiss uns nicht.«
»Vielleicht sehen wir uns mal wieder.«
»Geh mit Gott!«
Selber mussten sie noch Nachsitzen. Ich wollte zurück nach Tel Aviv und die Freiheit genießen. Mein Gefühl war, dass ich es mir verdient hatte, wie ein Soldat, der von der Front zurückkommt. Ich mietete mich in einem schäbigen Hostel mit Mehrbettzimmern ein. Unter meinem sandigen Bett schlief ein Däne, der in der Nacht schrie, und gegenüber ein spanischer Hippie, der immer erst am späten Vormittag völlig besoffen ins Bett fiel. Endlich normale Menschen.
Ich ging auf die größten Schwulenpartys. Mehrere Stockwerke voller tanzender Männer. Die Geilheit tropfte von der Decke. Alle waren ein bisschen verunsichert, weil ein jüdischer Extremist wenige Wochen zuvor in einem Jugendclub für Homosexuelle ein Dutzend Teenager erschossen hatte, aber auf der anderen Seite heizte das die Party an.
»Du kannst schon morgen tot sein, deswegen feiern wir, solange es geht.«
Alle Hemmungen flogen wie Schweißperlen von mir. Ich soff und leckte mit Typen rum. Wir kraulten uns die Bärte, massierten die Hoden. Ich ging mit einem Typen nach Hause und randalierte nach dem Sex in seiner Wohnung, weil ich der Meinung war, ich hätte Jannes betrogen, obwohl der mir bereits per SMS klar gesagt hatte, dass ich aufhören solle, ihn zu nerven. Bereute ich es? Schämte ich mich dafür? Nein, die Sonne ging wieder auf, das war alles. Ich war hierhergekommen auf der Suche nach einem sinnstiftenden Gedanken und nun war ich völlig verkratzt. Kein Benehmen mehr.
Nach den Partys ging ich betrunken im Sonnenaufgang am Wasser entlang zum »Buzz Stop«. Ein bodenständiges Lokal, wo der Besitzer einen schon vormittags mit Guiness-Pint am Eingang grüßt und Kellnerinnen als Antwort auf den Satz »Ich habe einen Kater« Bier mit Fish & Chips servieren.
Jahre zuvor war der »Buzz Stop« von einem Anschlag erschüttert worden. Der Besitzer wischte das Blut auf und machte wenige Stunden später wieder auf. Wie der Spanier fiel ich gegen 11 Uhr ins Bett, um in der Nacht wieder bei einem Israeli in der Wohnung zu landen, wo wir gemeinsam auf Singstar von Rammstein Du Hast sangen, bis er einschlief.
Eines Abends, die vierte oder fünfte Nacht meines Partymarathons – ich war schon wieder angetrunken –, stand ich auf dem Balkon des Hostels und blickte zum Opernhaus, dem ersten Sitz der Knesset. Dort gründeten die Juden ihren eigenen Staat. Nach Jahrtausenden wieder eine Heimstätte. Ein Franzose schnorrte mich um eine Zigarette an und erzählte, er habe auch den Plan gehabt, nach Ramallah zu gehen. Da dort kein israelischer Bus hinfuhr, habe er diesen Plan aber beerdigt. Er hatte gekniffen und war nur ein Tourist. Wortlos ließ ich ihn stehen. Keine Zeit mehr mit Angst zu verschwenden.
Am Ben-Gurion-Flughafen waren die Sicherheitsschleusen extrem streng. Eine Koreanerin wurde angeschrien, weil sie in ihrem Koffer einen Koran als Souvenir aus Bethlehem hatte. Als die Israelis mit ihr fertig waren, ging ich zu ihr und tröstete sie mit heiserer Stimme: »Es ist wegen der Situation.« Man musste einfach Schläge kassieren und mit blutiger Nase ein Bier bestellen.
Im Flugzeug malte ich mir aus, wie ich in einem brennenden Feuerball zur Erde fallen würde, wenn die mit Kerosin gefüllten Tragflächen explodierten. Jede Sekunde rechnete ich schwitzend mit meinem Ende.