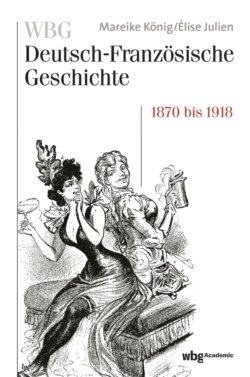Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. Ein kostspieliger Erfolg
ОглавлениеSchließlich und endlich stellte die Demobilisierung in Deutschland wie in Frankreich eine überwundene Krise dar. Dennoch war der Enderfolg kostspielig, sowohl in wirtschaftlicher als auch symbolischer Hinsicht.
Man konnte in der Tat sehen, dass es kurzfristig möglich war, die Rückkehr nach Hause zu beschleunigen, den Übergang zum Zivilleben durch die Vergütungszahlungen ein wenig zu erleichtern. Für die Jüngsten gab es an den Universitäten eine zusätzliche Maßnahme: In Deutschland öffnete man diese weiter für die Einschreibung der Veteranen-Studenten, indem man zum Beispiel Sondersemester im Frühjahr und Herbst 1919 einführte, im Fall der Mediziner bezog man die Praxisjahre an der Front in die Studien- oder Facharztausbildung mit ein.
Dennoch war der Staat, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, nicht in der Lage, eine Anstellung für alle zu garantieren, und dies umso weniger, als die wirtschaftliche Lage eine berufliche Wiedereingliederung bestimmter Kategorien von Soldaten erschwerte. Der Arbeitsmarkt gehorchte anderen Regeln, und das wirtschaftliche Chaos drohte die Rückkehr der Soldaten noch schwieriger zu gestalten.
Dennoch existierten Brücken. In beiden Ländern – vor allem in Frankreich – stammte die Mehrheit der Soldaten vom Land, und die wirtschaftliche Wiedereingliederung konnte im landwirtschaftlichen Sektor leichter vollzogen werden, vor allem für alle diejenigen, die nicht als Arbeiter von einem Arbeitgeber abhängig waren, sondern auf eigene Rechnung oder in einem Familienbetrieb arbeiteten. In diesem Sinne begünstigten die Landwirtschaft und die „Tradition“ in gewisser Weise die Demobilisierung und eine Art Rückkehr zur „Normalität“132.
Im Falle Deutschlands konnte die zeitlich versetzte Rückkehr der Kriegsgefangenen, die länger als die der besiegten Länder inhaftiert blieben – 800.000 deutsche Gefangene kehren erst Ende 1919, Anfang 1920 zurück –, paradoxerweise ebenfalls als Stoßdämpfer wirken, indem sie ihre Wiedereingliederung staffelte.
Die Städte und Industrieregionen mit einer starken Konzentration an zu demobilisierender Kriegsindustrie stellten die Räume dar, wo die Spannung aufgrund der wirtschaftlichen Wiedereingliederung der demobilisierten Soldaten potentiell am größten war. Auch die hier anstehenden Probleme bei der Umstellung der Kriegswirtschaft wurden durch eine chaotische Situation wie in Deutschland verlangsamt. Im Vergleich mit London und Paris „war der Übergang zum Frieden in der alten deutschen Hauptstadt viel schmerzhafter und verbitterter als es der Übergang zum Krieg weniger als eine Dekade vorher gewesen war“133.
In diesem Zusammenhang war die massive Rückkehr der Frauen in den Haushalt eine der vorgeschlagenen „Lösungen“ des Problems. Diese Rückkehr wurde von der traditionellen Vorstellung zur Frauenrolle begünstigt. So veröffentlichte der deutsche Kriegsminister noch vor dem Abschluss des Waffenstillstands ein Memorandum mit dem Titel „Frauenarbeit in der Übergangswirtschaft“, das empfahl:
„1. Die Frauen müssen heraus:
a) alle Frauen aus den Arbeitsplätzen, die für die heimkehrenden Männer freigemacht werden müssen.
b) alle Frauen aus schwerer und gesundheitsschädigender Arbeit, bei Knappheit der Arbeit ferner:
c) Ortsfremde Frauen aus Arbeitsplätzen, die für Ortseingesessene benötigt werden,
d) Jugendliche aus ungelernter Arbeit.
2. Die Frauen müssen herein:
a) nicht erwerbsbedürftige Frauen in die Familie,
b) erwerbsbedürftige Frauen in die früheren Berufe, die Mangel an Arbeitskräften haben (Hauswirtschaft, Landwirtschaft) und solche sonstigen Berufe, in denen sie infolge zweckmäßiger Arbeitsteilung, den Männern keine Konkurrenz machen,
c) ortsfremde Frauen müssen tunlichst in die Heimat zurückgeführt werden,
d) Jugendliche in geregelte Ausbildung“134
Diese Vorstellung wurde übrigens teilweise von den Frauen selbst geteilt, die darin die Möglichkeit einer „Rückkehr zur Normalität“ erblickten. Die Aufgabe einer Fabriktätigkeit konnte de facto ein Heiratsprojekt oder mehr noch die Planung von einem oder mehreren Kindern erleichtern, die während des Krieges bisweilen aufgeschoben wurde.
Während die Entlassungen der Frauen die langfristige Tendenz einer immer höheren Frauenerwerbsarbeitsquote nicht umkehren konnten, trugen sie „durch die Öffnung des Arbeitsmarktes für die rückkehrenden Kriegsteilnehmer erheblich dazu bei, die drohende Gefährdung des alten wirtschaftlichen Systems und der neuen politischen Ordnung abzuwenden“135.
Schließlich zielten auch sozialpolitische Maßnahmen, die sich speziell an Veteranen, Kriegsversehrte und Kriegsopfer richteten (2,7 Millionen Kriegsversehrte in Deutschland), darauf ab, den Schock einer eventuellen Arbeitslosigkeit oder einer vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit zu dämpfen136.
Wenn sie auch sozial wirksam und individuell unerlässlich waren, erwiesen sich diese Maßnahmen mittelfristig zugleich als kostspielig und vor allem überaus wenig erfolgreich in symbolischer Hinsicht137.
In Deutschland muss man den Fall der „verlorenen Soldaten“ anfügen, all jener, die die Niederlage zurückwiesen und im Innern wie an den Grenzen des Landes weiterkämpften. Sie waren natürlich weit weniger zahlreich als diejenigen, die hauptsächlich zurück nach Hause wollten, stellten jedoch eine potentielle Gefahr für die Republik und ihre neuen Führer dar138. Diese benutzte sie daher für ihre eigenen Zwecke. Jene Allianz diente in gewisser Weise als Sicherheitsventil und erlaubte es – trotz Putschversuchen und politischen Attentaten –, diese der Republik zutiefst feindlichen Kräfte zumindest bis 1920 in Schach zu halten und zu lenken. Aber der rein taktische Anschluss eines Teils der Truppen, von denen einige zu den radikalsten gehörten, war mit dem hohen Preis einer Art Selbstbeschränkung der Revolution und einer definitiven Trennung zwischen den Sozialdemokraten und der „linken Linken“ verbunden.
Hierbei ist es nötig, den weitgehend utopischen Willen der Bevölkerung nach Stabilität und Rückkehr zur Normalität zu erwähnen. Jay M. Winter hat gezeigt, dass der Erste Weltkrieg in den unterschiedlichen Kriegsgesellschaften bereits von einer Form von Nostalgie begleitet wurde, die zusammen mit der empfundenen Notwendigkeit existierte, den Krieg dennoch zu gewinnen139. Die Hoffnung auf Frieden, auf Stabilität, auf ein normales Leben konnte selbst Spannungen hervorbringen, da sie de facto nicht zu erfüllen war. Aufgrund der beschränkten Mittel und Manövrierfähigkeit der Weimarer Republik, aber auch wegen des utopischen Charakters dieser sozialen Stabilität, war diese tatsächlich „unmöglich zu erreichen und existierte nie von vornherein“ in einer Welt, „in der der Krieg der Zivilgesellschaft einen Stempel der Gewalt aufgedrückt hatte“140.
Diese Spannung zwischen dem Willen zur Normalität auf der einen Seite, für die man vom Staat erwartet, dass er die Realisierung und die strukturellen, sozialen und sogar intimen Gegebenheiten der Nachkriegszeit erlaubt oder zumindest erleichtert, zeigt sich gut an den Heiratszahlen. Diese steigen in beiden Ländern an. Doch gleichzeitig erhöht sich auch die Anzahl der Scheidungen nach dem Krieg141. Die Geburtenrate findet auch nicht zu ihrem Vorkriegsstand zurück. Obwohl sie in Deutschland im Vergleich zu den Kriegsjahren wieder ansteigt, übertrifft sie nicht jene der Jahre 1913 und 1914142. Sie zeichnet sich außerdem durch eine Steigerung der unehelichen Geburten aus. In Frankreich sinkt die Geburtenrate, die bereits bemerkenswert niedrig war, im Vergleich zum Nachbarn und zu Europa im Allgemeinen nach dem Krieg weiter.
Die Soldaten heiraten nach den Krieg oft und setzen rasch Kinder in die Welt, aber sie tun dies weniger langfristig, und ihre Ehen sind zerbrechlicher. Andere kehren in ihre vom Krieg zerstörten Häuser zurück und fügen sich in die Scheidung. Was die häusliche Sphäre betrifft, gibt es noch ein ganzes Spektrum der Geschichte familiärer, zwischengeschlechtlicher und intergenerationeller Beziehungen, die es zu erforschen gilt.
Dem muss man hinzufügen, dass bestimmte Kategorien von Menschen noch dazu mehr oder weniger verstoßen wurden und in dieser Zeit die „Vergessenen des Ersten Weltkriegs“ waren oder, genauer gesagt, der Anerkennungsmaßnahmen während der Demobilisierungsphase. Dazu zählen, vor allem im Frankreich, die zivilen Opfer des Krieges: die besetzte Bevölkerung, Flüchtlinge, zivile Deportierte etc. – und im Fall beider Länder die Kriegsgefangenen.
Diese Kategorie blieb weitgehend ausgeschlossen von den Anerkennungsmaßnahmen. Ihre gestaffelte Rückkehr, vor allem in Deutschland, wo eine größere Anzahl von ihnen zum Arbeiten in Frankreich bleiben musste, beispielsweise zum Räumen der Schlachtfelder oder als Geiseln vor der Unterzeichnung der Friedensverträge, hatte zur Folge, dass sie nicht an den Begrüßungszeremonien der heimgekehrten Soldaten teilnahmen. Aus der Berechnung der Demobilisierungskosten heraus wurden die Gefangenen in Frankreich den Mobilisierten gleichgestellt, die nicht gekämpft hatten143. Ihre Erfahrungen wurden daher an den Rand gedrängt, ihr spezifisches Leiden nicht berücksichtigt und – zu ihren Lasten – mit dem der Frontsoldaten verglichen. Sie mussten bis 1922 darauf warten, dass ihre im Lager gestorbenen Kameraden das Recht auf die Bezeichnung „gestorben für Frankreich“ erhielten144. Das was sie im Gegenzug als Missachtung erlebt haben – die Tatsache, dass sie den nichtkämpfenden Mobilisierten wegen der Berechnung der Demobilisierungszahlungen gleichgestellt worden waren –, wurde niemals wirklich thematisiert, trotz des Kampfes der Vereinigungen, die sie vertraten. Die Debatte um eine spezielle Zahlung für die Kriegsgefangenen taucht einige Male im Parlament auf, jedoch ohne Erfolg. Die Zurückweisung war bisweilen sogar brutal. Wie 1931, als ein Senator – General Hirschauer – deutlich machte: „Die Beibehaltung des Lebens ist schon etwas. Das Leben zu behalten ist es schon wert, ein wenig Hunger zu leiden. Die Gefangenen, die sich in den Konzentrationslagern ernste Krankheiten zugezogen haben, erhalten eine Pension. Die anderen, das wiederhole ich, haben nicht die Gefahren durchlebt wie diejenigen, die gekämpft haben“145. Pierre Laval, der damals Regierungschef war, widersetzte sich völlig auch nur der geringsten Zahlung an die Kriegsgefangenen, was aus ihnen de facto eine Kategorie von marginalen „Kriegsopfern“ machte. Fünf Jahre später wurde der Bürgermeister von Lille und Innenminister der Volksfrontregierung, Roger Salengro, ehemaliger Kriegsgefangener, durch eine Diffamierung der extremen Rechten in den Suizid getrieben; sie warf ihm vor, er habe sich 1915 gefangen nehmen lassen. Auch de Gaulle, der 1916 in Gefangenschaft geriet und fünf Fluchtversuche unternahm, blieben Verleumdungen nicht erspart, die letztlich aus dem größeren Verdacht herrührten, der über den Kriegsgefangenen schwebte.
In beiden Ländern konnte sich die Demobilisierung, auch wenn sie erstaunlicherweise kurzfristig eine Erfolgsgeschichte war – es ging darum, „Helden in Arbeiter zu verwandeln“146 –, mittel- und langfristig als sehr kostspielig herausstellen.
In Deutschland ging die Politik der Anerkennung der Jahre 1918 bis 1919 gegenüber der „unbesiegten Armee“ sowohl in finanzieller als auch symbolischer Hinsicht sehr weit. Sie konnte gar als Nährboden für all jene dienen, die die Niederlage verdrängten147 oder abstritten sowie für jene, die deren Ursache einem Gegner im Inneren zuschrieben: dem Bourgeois, Juden, Kommunisten oder Sozialdemokraten. Doch besaßen die Führer der Republik angesichts der ernsten Situation und ihrer damaligen Ängste einen großen Manövrierraum, wenn sie das im Entstehen begriffene Regime zu erhalten beabsichtigten? Den Rückkehrwillen der Mehrheit der Männer hatten sie sicherlich unterschätzt, doch die Anwesenheit in einem Land mitten im Chaos einer Minderheit von immerhin 400.000 Soldaten, die nicht bereit waren, die Waffen abzugeben, und die sich bei den Freikorps engagierten, konnte sie verständlicherweise Blut und Wasser schwitzen lassen. Wenn sie sich auch langfristig als unnütz herausgestellt haben mögen, so trugen die Konzessionen den Soldaten gegenüber doch unbestritten zu den Ergebnissen der Wahlen von 1919 bei, als die republikanischen Parteien gute Ergebnisse bei den Soldaten erzielten und mit großem Vorsprung gewannen. Und die Republik zu stabilisieren war das oberste Ziel ihrer Führer.
Die Geschichte der Demobilisierung in Frankreich zeigt, dass die Periode von 1918 bis 1920 noch nicht die der geistigen Demobilisierung ist. Obwohl der Wunsch nach Heimkehr stark und deutlich wahrnehmbar ist, bleibt die Feindschaft gegenüber Deutschland lebendig. Langfristig jedoch werden die durchgeführten Maßnahmen der Anerkennung, im Gegensatz zu Deutschland, durch den Kontext des Sieges begünstigt. Ihre rhetorische Wirksamkeit richtet sich nicht etwa gegen ihre Erfinder, sondern schafft vielmehr die Fundamente einer geistigen Demobilisierung, die im Pazifismus der Veteranen des „allerletzten Krieges“ (der des der) spürbar ist, der sich in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre in der gesamten Gesellschaft ausbreitet. Der geteilte Sieg erlaubt es in gewisser Weise, die symbolisch hohen Kosten abzufangen, die von der nichtkämpfenden Bevölkerung und dem Regime zugestanden wurden.
Über die interne Dynamik einer jeden Gesellschaft hinaus lastet diese Zeit auch schwer auf den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Die jüngste Geschichtsschreibung insistiert mehr und mit Recht auf der Fortsetzung des Krieges und der extremen Gewalt in den östlichen Randgebieten Deutschlands und im Osten des europäischen Kontinents148. Dennoch markieren die Jahre 1918 bis 1920 auch im deutsch-französischen Rahmen nicht nur einen Übergang zum Frieden. Wir haben diese Zeit besonders herausgestellt, weil sie uns essentiell erscheint, um die Grundzüge der fortgesetzten deutsch-französischen Feindseligkeit über den Waffenstillstand und den Versailler Vertrag hinaus zu verstehen. Eine Feindseligkeit, die im Krisenfall jederzeit wiederaufflammen kann. Diese Jahre zeigen außerdem, von welcher Grundlage, von welchem Kontext und Rahmen diejenigen ausgingen, die sich bewusst an die geistige Demobilisierung machten beziehungsweise an die Rückkehr zu friedlichen Aktivitäten, an die Annäherung an den Feind oder daran, die Idee eines friedlichen Europa voranzutreiben.
Letztere mussten eine beachtliche geistige Anstrengung unternehmen, um sich eines Gegensatzes zu entledigen, den der Kriegsausgang letztlich nur noch verstärkt hat. Nur wenige waren zu einer derartigen Bemühung langfristig in der Lage, und auch wenn die deutsch-französische Frage in beiden Ländern aus dem Vordergrund und von der Agenda der Weltpolitik verschwand, sollte die Erinnerung an den Krieg, wie sie sich von 1918 bis 1920 herauskristallisiert und verfestigt hatte, schwer wiegen und letztlich als bedrohlicher Hintergrund erhalten bleiben, oder vielmehr als ein Repertoire, aus dem die extremsten Kräfte nach Belieben schöpfen konnten.
104 Zitiert nach SCHULZE 1987 [224], S. 617.
105 In der Einleitung von WINTER/ROBERT 2007 [878].
106 BESSEL 1983 [691].
107 Auch wenn die Frage der Demobilisierung in der Kulturgeschichte eine Erneuerung erlebt (CABANES 2004 [294]), erschienen hinsichtlich sozialer und wirtschaftlicher Aspekte seit längerer Zeit Publikationen, z.B. BESSEL 1993 [191] und MOMMSEN 1983 [717] sowie die gesamten Arbeiten von Gerald Feldman (siehe die Bibliographie). Für einen vergleichenden Überblick der hier vorgetragenen Thesen: FELDMAN 1983 [707].
108 Falls nicht anders gekennzeichnet, stammen die Fakten zum französischen Fall aus CABANES 2004 [294]. Hier S. 278.
109 Ebd.
110 Nach dem Psychoanalytiker Daniel Sibony, zitiert nach CABANES 2004 [294], S. 278.
111 CABANES 2004 [294], S. 280.
112 BESSEL 1993 [191], S. 49–68.
113 ZIEMANN 1997 [420], S. 373.
114 BESSEL 1993 [191], S. 76.
115 Ebd., S. 81.
116 BARTH 2003 [270], S. 214.
117 Siehe die gegenteiligen Ansichten hinsichtlich dieses Punktes von BEHRENBECK 1999 [285], S. 317 und BARTH 2003 [270], S. 215, v.a. Fußnote 70 sowie die Untersuchung von JARDIN 2005 [340], S. 451ff.
118 Ebd., S. 440ff.
119 PROST 1983 [380].
120 Ebd., S. 178–180.
121 PROST 1983 [380], CABANES 2004 [294].
122 CABANES 2004 [294], S. 284.
123 Zitiert nach PROST 1983 [380], S. 180.
124 CABANES 2004 [294], S. 313
125 VERAY 1995 [402], VERAY 2000 [403].
126 Zitiert nach PROST 1983 [380], S. 180.
127 Ebd., S. 186.
128 Zitiert nach BEAUPRÉ 2006 [741], S. 240–241.
129 CABANES 2004 [294], S. 277. Man müsste die Empfangsriten innerhalb der Familien noch detaillierter untersuchen.
130 PROST 1977, Bd. 1 [378], S. 7, zitiert nach CABANES 2004 [294], S. 342.
131 Abgeordneter Etienne Rognon, zitiert nach CABANES 2004 [294], S. 343.
132 ZIEMANN 1997 [420], S. 392.
133 COLE 1997 [300], S. 226.
134 Zitiert nach BESSEL 1983 [691], S. 211–212.
135 BESSEL 1983 [691], S. 229. Über die Frauenarbeit während des Krieges siehe DANIEL 1989 [303].
136 GEYER 1983 [321].
137 COHEN 2001 [299], WHALEN 1984 [408], KIENITZ 2001 [343]. Zu diesem Aspekt siehe Kapitel II.2.
138 Zu den Freikorps siehe SCHULZE 1969 [391]. Siehe auch LIULEVICIUS 2002 [362], S. 278–300.
139 WINTER 2007 [877].
140 BESSEL 1993 [191], S. 284.
141 Ebd., S. 229. Siehe die kurze Ausführung zu diesem Thema in Kapitel II.8.2.
142 Ebd., S. 233.
143 CABANES 2004 [294], S. 359–424.
144 BECKER 1998 [277], S. 369.
145 Zitiert nach ABBAL 1998 [256], S. 415.
146 FELDMAN 1983 [707], S. 177.
147 HEINEMANN 1983 [203].
148 JMEH 2003 [342].