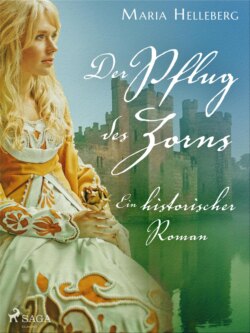Читать книгу Der Pflug des Zorns - Ein historischer Roman - Maria Helleberg - Страница 6
1
GUNNAR
Оглавление1324–28
Er nahm allen Mut zusammen und ging auf die hohe, spitze Tür der Kirche zu, wohl wissend, daß das ein unnötiges Risiko war. Der Pflegevater hatte ihm verboten, ohne Begleitung in die Stadt zu gehen. Es war nicht mehr wie damals in Norwegen, als sie vogelfrei und ohne Freunde gewesen waren. Dem Pflegevater standen Leute zu Diensten. Gunnar brauchte nicht allein und schutzlos zu gehen. Aber heute war er allein.
Unmittelbar vor der Tür blieb er stehen, fiel beinahe über seine eigenen Füße und bereute zutiefst seine Waghalsigkeit. Aber irgendwann mußte es ja geschehen. Der Kirchenraum öffnete sich ihm, viel zu weit, zu grau und unbekannt. Aus einer nicht einsehbaren Ecke des Chorraums strömte Gesang, legte sich wie ein klingendes Zeichen von Abneigung und Verstimmung mit leichtem Druck auf seine Brust.
Er benetzte die Finger mit Weihwasser und bekreuzigte sich, ein paar Tropfen fielen auf den grauen Steinfußboden, und ein kleiner, struppiger Hund stürzte sich blitzschnell darauf, sah dann wieder auf zu ihm, enttäuscht. Parasiten krabbelten in seinem Fell. Er machte einen Bogen um ihn und ging weiter, zaudernd und schwerfällig. Ein Grabstein ragte in Knöchelhöhe empor, er fiel fast darüber und dachte nicht einmal daran, daß die Toten das vielleicht als Verhöhnung auffassen könnten, hielt die eingepackte Figur dicht an seine Brust gedrückt. Stellte sich vor, was mit Cecilia hätte geschehen können, wenn er wirklich gefallen wäre: Es lief ihm kalt den Rücken hinunter, dann den Nacken hinauf, so daß er geradezu spüren konnte, wie die kleinen Haare sich voller Furcht sträubten.
Seine Augen suchten die großen Gerüste, dort mußte der Holzschnitzer zu finden sein. Ging den Stimmen nach, dem fremdartigen Klang: Die Mehrzahl der Meister waren Deutsche, hatte er gehört, aber er ahnte nicht einmal, wie deren Sprache klang. Dieses hier war zumindest weder Schwedisch noch Norwegisch, Sprachen, die ihm vertraut waren.
Einer der Gesellen bekam von einem größeren, älteren Mann eine Ohrfeige, und Gunnar blieb stehen, als habe ihn diese selbst getroffen. Auch hier gab es das also. Das hätte er nie gedacht.
Als Kind hatte er lange die sündige Hoffnung gehegt, seine Eltern würden die gewohnte Haut abstreifen und ihr eigentliches Ich entschleiern – daß sie sich verwandeln würden wie Tiere, die die Farbe der Jahreszeiten annahmen, weiß im Winter, grau im Sommer. Oder daß er eines Tages entdecken würde, daß er ein vertauschtes Kind war, wie in den Volksweisen. Daß er irgendwo andere, richtige Eltern hätte, und daß diese richtigen Eltern ihn liebten, glücklich und gerührt wären, ihn wiederzubekommen.
Aber das schien nie einzutreten, seine Eltern blieben sich ewig und unveränderlich gleich. Man konnte sich nicht auf ihre Wünsche einstellen, denn die Forderungen änderten sich von Tag zu Tag, ja, von Stunde zu Stunde, wenn man Pech hatte. Er hatte keine Ahnung, warum es Ohrfeigen nur so setzte, sobald er sich zeigte.
Alle anderen in der Familie hatte man nach verstorbenen Familienmitgliedern benannt: Wenn es richtig zugegangen wäre, hätte man ihn Bengt oder Arvid, Finn oder Oluf getauft. Aber er hieß Gunnar. Es gab auch keinen Heiligen mit diesem Namen: Der Name war schrecklich, altmodisch und heidnisch. Und er hatte sich damit abgefunden, daß seine Eltern ihn schlugen, weil er häßlich, klein, dunkelhaarig und dünn war.
Seine Pflegeeltern schlugen ihn nicht. Niemand in seinem neuen Zuhause schlug ihn. Das hatte zu Anfang sein tiefstes Mißtrauen erregt. Denn seine Pflegeeltern waren nicht krank, wie es sein Vater gewesen war, sie waren hübsch und sonderbar, und in ihren Augen mußte seine Häßlichkeit weit mehr auffallen. Es gab so viel an ihm auszusetzen. Er hörte schlecht und zog das eine Bein nach. Jeden Winter verbrachte er im Bett mit Augenentzündung und Fieber, die Schmerzen kamen wie kleine Fledermäuse aus der Lunge emporgewandert.
Er hatte das Gefühl, daß sich die Pflegeeltern sehr erschrecken würden, wenn sie entdeckten, daß er weder im Garten des Bischofshofes saß und Blumenkränze flocht noch in den Ställen nach den Pferden sah. Er hatte zum ersten Mal lügen müssen, um für dieses unaufschiebbare Vorhaben entwischen zu können. Aber es war die Lüge wert.
Er ließ den Gesellen fragen, ob der Meister einen Augenblick Zeit hätte – in dem klaren, knorrigen Gesicht war immer noch eine Spur von Demütigung zu erkennen. Gunnar wunderte sich. Der Geselle war nicht viel älter als er selbst. Mit nachlässig und unmittelbar über den Ohren geschnittenen Haaren, hohen Wangenknochen und schrägen Augen, einer speckigen, rötlichen Mütze. Er ähnelte jedem x-beliebigen Bauernjungen, aber er war der erste Deutsche, mit dem Gunnar je gesprochen hatte. Der Bescheid wurde in einer anderen Sprache weitervermittelt, die klang, als werde hoch oben unter dem Gaumen gesprochen, und der dicke Mann auf dem rohen, noch duftenden Holzgerüst ließ die Arbeit ruhen. Es sah aus, als ärgere er sich über die Unterbrechung. Gunnar wand sich und errötete unter dem bösen Blick. Aber der Meister trocknete seine roten, verschrammten Hände in der Schürze ab und legte seine Messer in einer Reihe in die Schale, bevor er schnaufend von oben herunterstieg.
Gunnar zitterte so sehr mit den Händen, daß ihm Cecilia aus dem beschützenden Stoffetzen fiel. Der Deutsche fing sie in der Luft auf und hielt sie ein Stück von sich weg, hustete zugleich kräftig und tat der Heiligen die Ehre an, das Gesicht ein wenig abzuwenden, bevor er den Rotz ausspuckte.
Cecilia war die einzige Figur, die er zu Ende gemacht hatte und vorzuzeigen wagte. Sie war so lang wie sein Unterarm, mit einer Laute in der einen Hand und scharfen Falten im Kleid, die Schleppe unter einen Ellbogen geklemmt, wie seine Pflegemutter, wenn sie ihr schönstes Zeug anhatte. So, wie er sie kaum jemals hatte sehen können, als sie in der Verbannung in Norwegen lebten.
Als er noch an der Figur arbeitete, schnitzte und die kleinen Äste mit den Nägeln abkratzte, war Cecilia der Mittelpunkt in seinem Leben gewesen, und er hatte überall ihre Formen gesehen. Jetzt jedoch sah er sie so, wie alle anderen die Figur empfinden mußten – unansehnlich und unfertig, es fehlte an Verzierung und auch an Gold. Der Deutsche drehte sie unbarmherzig herum, wie eine Magd ein gerupftes Huhn dreht, bevor dieses in den Kochtopf wandert. Dann wandte er sich an den Gesellen und fragte etwas in seiner harten Sprache. Der Geselle zwinkerte ein paarmal mit den Augen, um anzudeuten, daß dies eigentlich weit unter seiner Würde war und übersetzte schließlich mit schleppender Stimme:
– Meister Francke möchte gern wissen, bei wem du in der Lehre warst, kleiner Schwede?
Der Deutsche wirbelte herum, auf einmal behende und leicht, trotz seines schweren Körpers – kniff ein Auge zu und balancierte Cecilia auf seiner flachen Hand. In seinem Gesicht konnte man keine Veränderung erkennen, aber Gunnar wurde es warm vor Seligkeit, und die Zunge brachte die schönen Worte, mit denen er zu antworten versuchte, nicht heraus.
Der Mann glaubte, er habe dieses Fach gelernt, er, der nur gelegentlich mal geschnitzt hatte. Und nun wollte der Meister wissen, woher er kam, ob er zu einer Gilde oder Werkstatt gehörte, ob er ehelich geboren war und Auskunft über seine Familie geben konnte. Das war alles schwierig – er war unmündig, mußte seinen Pflegeeltern folgen, wie er es getan hatte, als der Pflegevater für vogelfrei erklärt worden war. Und während er versuchte, seine Herkunft zu erläutern, wurde ihm klar, daß Holzschnitzer wohl das war, was er zuallerletzt werden konnte. Er war zwar der verarmte Sohn eines verarmten jüngsten Sohnes, aber er entstammte dem Ängel-Geschlecht, und kein Mann, der diesen weiblichen Engel in seinem Wappen trug, konnte so tief sinken, daß er sich von seiner Hände Arbeit ernähren mußte.
So einfach war das. Sein Platz war bereits vor der Empfängnis festgelegt. Sein Schicksal hieß Lindö. Ein Hof irgendwo in Uppland. Er konnte sich nicht daran erinnern – er hatte den Hof verlassen, als er zehn Jahre alt war, ohne zu wissen, wieviel Zeit vergehen würde, bis er zurückkehren könnte. Jetzt war es ihm einerlei.
Niemand hielt ihn auf, als er sich an den Schreibern vorbeischlängelte, hinein in die fensterlose Kammer. Der trockene Geruch von Pergament und Staub benahm ihm den Atem. Er hatte noch nie außerhalb einer Kirche Bücher gesehen. Aber hier standen sie in Regalen, als hätten sie einander gezeugt – große und kleine, abgenutzte und neue, ein paar zerschlissene, andere fest an die Regale gekettet.
Auf Kalmarhus gab es keine anderen Angebote zur Zerstreuung. Seit er hierhergekommen war, hatte er sich gelangweilt – und er hatte seine Enttäuschung nicht einmal mit jemandem teilen können. Schon das Wort Hof hatte ihm das Herz in der Brust hüpfen lassen. Aber der Hof erfüllte nicht seine Erwartungen, die von den Erzählungen des Pflegevaters bestimmt worden waren. Hier auf Kalmarhus wohnten zwölf junge Männer, dazu ausersehen, dem König Magnus Eriksson zur Hand zu gehen, sollte es ihm eines Tages gefallen, Varberg zu verlassen, um sich sein Reich anzuschauen. Die Burschen schliefen zu zweit, um sich in den Winternächten zu wärmen, und bei Tische teilten sie Eßbretter und Becher. Aber keiner wollte mit Gunnar teilen, dem Neuankömmling. Wenn sie etwas brauchten, sahen sie durch ihn hindurch, als sei er aus klarem Glas. Und sie waren alle gleich – waren stark und muskulös, paßten zu den hübschen Pferden und Jagdhabichten und englischen Jagdhunden, mit denen sie von zu Hause versorgt worden waren.
Gunnar stand bei so vielen Dingen allein da, er war der einzige ohne Eltern, der einzige mit Pflegeeltern, die im Ausland gelebt hatten, der einzige, der lesen und schreiben konnte. Hier drinnen beim Kanzler wurde seine Fähigkeit geschätzt, wie er wußte, deshalb ging er zu einem der Schreiber und bat um die Erlaubnis, irgendein Buch an einem der leeren Pulte lesen zu dürfen.
Der Mann bedachte ihn mit einem kurzen Blick. Auf seinem Weg zu den Regalen grinste er einem anderen Schreiber zu, entblößte dabei große, gelbe Pferdezähne.
– Ich lese Schwedisch, fühlte Gunnar sich genötigt hervorzuheben – aber niemand hob den Blick.
– Sonst wäre dein Vergnügen auch nur so groß, daß es auf dem Hintern einer Fliege Platz hätte, mein Freund, sagte der Schreiber mit den gelben Zähnen und knallte ihm ein schweres Manuskript auf das Pult, so daß der Staub in Wolken um seine Nase stand und das schwache Licht mit einem Flackern erlosch.
Im Lesesaal war es still und kühl wie in einer Kapelle – er wußte, daß alle auf der Lauer lagen, nur auf einen Vorwand warteten, ihn hinauszuwerfen. Daß er anfinge, Krach zu machen, mit dem Schwert oder den Sporen zu klirren, zu rülpsen oder etwas anderes Unerhörtes, Unhöfliches zu tun. Aber er würde ihnen zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt war! Die Stille war eines der Güter, die er verloren hatte, als er nach Kalmarhus mit seinen gackernden Hühnern, wiehernden Pferden und lärmenden Menschen gekommen war.
Nun hatte er die Stille wiedergefunden, und er wußte dieses Glück zu schätzen.
Als er sich am Nachmittag zur Tür hinausschlängeln wollte, wurde er von einem ungewöhnlich großen und dünnen, gebeugten Mann angehalten. Er trug die braungraue Kutte der Grauen Brüder, hatte zerschlissene Sandalen an den gichtgekrümmten Füßen und einen Strick um den Leib. Gunnar wich unwillkürlich zur Seite, drückte sich an die Wand und ließ seinen neugierig-verschreckten Blick über ein hageres, kantiges und graues Gesicht gleiten, in dem die Haut unter den Augen ein Netzwerk von roten und blauen Äderchen bildete. Ein dünner, weißer Haarkranz umschloß eine blanke, kantige Tonsur, als sei er von fremden Händen dort angebracht.
Das war der Kanzler, fiel ihm schaudernd ein. Gern hätte er sich jetzt in irgendein Mauseloch verstecken wollen. Aber der Mann hatte ihn gesehen und packte ihn: fünf Haken aus Stahl schlugen sich in Gunnars Schulter, und ein trockenes, reibendes Lachen traf sein Gesicht – und Spritzer von Spucke.
– Das ist das erste Mal, daß ich bei einem der jungen Männer erlebe, daß er die Elchjagd und das Schwerterspiel vernachlässigt, um bei uns zu lesen! sagte der Kanzler und entblößte die gelben Pferdezähne. Schlechte Zähne schienen eine der Aufnahmebedingungen im Orden der Grauen Brüder zu sein. Gunnar schämte sich seiner ungehörigen Gedanken.
Es stimmte ja, was der Mann sagte, er war anders. Er hielt sich nun einmal lieber drinnen auf und buchstabierte sich durch Traktate hindurch, als die Zeit mit all den Dingen zu vergeuden, womit sich Gleichaltrige sonst vergnügten.
Er hatte so viele Fragen, aber keine Antworten.
Am nächsten Tag kam er wieder, am übernächsten auch, und der Kanzler nahm sich die Zeit, mit ihm zu reden. Aber als Gunnar Ulfsson ängstlich von seinen Pflegeeltern erzählte, hatte er den Eindruck, dem Mönch gehe ein Licht auf. Der Onkel seines Pflegevaters war ein heiliger Mann, Bischof in Skara. Und ein anderer seiner Onkel hatte bretonische Romane ins Norwegische übersetzt. Das klang wie die Erfüllung seiner heißesten Träume: sicher, warm und allein sitzen zu können und über Liebe, Krieg, Tod und Leidenschaften zu lesen. Ohne sein Leben aufs Spiel setzen zu müssen oder sich in die Wirklichkeit hinauszuwagen. Die fleischliche Liebe in Flores und Blanseflor oder Tristan und Isolde sagte ihm nicht viel. Die hatte er aus nächster Nähe bei den Pflegeeltern miterlebt, und die Beschreibungen waren trotz allem nur schwache Nachbildungen der brennenden, furchteinflößenden Wahrheit.
Aber einer der Schreiber war dabei, die Schriften des heiligen Franziskus zu übersetzen, und diese ließen Gunnar Mund und Nase aufsperren. Die noch feuchte Schrift machte das Lesen noch unmittelbarer: als seien die Gedanken gerade geboren. Die Vögel waren seine Geschwister, Sonne und Mond seine Familie, die Welt um ihn herum fügte sich in Vollkommenheit zusammen, alle Wesen waren von Gott geschaffen und gleichberechtigt, jedes mit seiner Rolle und dem gleichen Recht zu leben. Armut war auch die Freude der Entsagung. In allen anderen Traktaten war die Kirche nur ein Aufbewahrungsort für den Glauben – bei Franziskus wurde die ganze Welt zur Kathedrale.
Von dem ganzen gelehrten heillosen Durcheinander, wie der Kanzler seine Lektüre nannte, fand nur Franziskus Widerhall. Es sah aus, als habe er seinen rechten Platz gefunden. Mit seinen dünnen Armen, schmächtigen Schultern, seinem unterentwickelten Körper, den unzureichenden Kräften und der verringerten Seh- und Hörkraft würde er schlecht für das Schicksal gerüstet sein, das ihm zugedacht war. Aber als Mönch konnte er den ganzen Tag mit dem verbringen, was er konnte: Holzfiguren schnitzen und Bücher abschreiben. Lindö konnte er als Erbe an seine jüngere Schwester gehen lassen; auf diese Weise gab er Märta eine bessere Mitgift, sicherte ihr vielleicht sogar eine gute Ehe.
Er wollte seine Pflegeeltern fragen, sobald er zu deren Hochzeit nach Hause kam. Wenn schon nicht andere, dann müßten doch sie ihn verstehen können: daß er, wenn er schrieb, mit der Welt im Einklang war und den großen Zusammenhang bestätigte, den Franziskus entdeckt und beschrieben hatte. Gunnar Ulfsson schrieb auf Kalbsleder mit einer Schwanenfeder, die er sich selbst zugeschnitten hatte, die Tinte war ein Extrakt aus Brombeeren. Alles hatte seine Ordnung: Das Stundenglas wurde mit behutsamen Händen umgedreht, das kleine Licht auf dem Lesepult regelmäßig ausgewechselt. Selbst die runden, dicken Glasstücke, die Bruder Nikulaus aus Frankreich mitgebracht hatte (und die man Glausaugen nannte), waren wie von Franziskus vorhergesehen und gesegnet.
Ruhe, Beherrschung und Nach-innen-gewandt-Sein. Eine Welt ohne harte Stimmen.
Er las die Anmerkungen zum ›Gebet an die Sonne‹ und beachtete kaum den jungen Mann, den er überhaupt noch nie beim Kanzler gesehen hatte, der nun aber schon mehrere Stunden lang in einer Ecke des Raumes saß und offensichtlich geduldig wartete. Als Gunnar mit dem Lesen fertig war und das Buch zur Seite legte, erhob sich der Gast und begrüßte ihn. Ein paar Tage zuvor, als Gunnars Messer auf den Boden gefallen war, hatte Erik Månsson es unter einem dreckigen Schaffell gefunden. Sie hatten einander begrüßt und sich mit Namen vorgestellt, entdeckt, daß sie weitläufig verwandt waren, Eriks Mutter mit dem Vater von Gunnars Pflegevater verheiratet war, oder wie auch immer das zusammenhing. Gunnar wußte so gut wie gar nichts von seiner Familie, hatte noch nie etwas von Erik, dessen verstorbenem Vater Måns oder seiner wiederverheirateten Mutter gehört. Wunderte sich ein wenig darüber, daß zwei so betagte Menschen auf die Idee kamen, eine neue Ehe einzugehen, erfuhr aber von Erik, daß das durchaus üblich sei.
Erik war mehr als schlank; er war spindeldürr und dennoch von vorteilhaftem Aussehen. Feingliedrig und schmal an Hüften und Schultern. Sein Gesicht glich dem eines Mädchens, mit glänzendem, goldenem, dünnem Haar, das ihm bis auf die kantigen Schultern hinunterhing. Lange, weiße Wimpern, blaugeäderte Schläfen, der gespannte Bogen des Nackens, dessen leichte Rundung.
Erik stand ihm geduldig gegenüber, die rechte Hand um das linke Handgelenk geschlossen, und das ganze Gewicht auf einem Bein ruhend, den rechten Fuß etwas vorgeschoben, ein Bild höfischen Benehmens.
– Du bist etwas blaß von dem ganzen Klosterstaub, den sie über dich verteilt haben, sagte Erik und lächelte, so daß die kleinen, spitzen Mausezähne zum Vorschein kamen. – Würde es dir nicht guttun, den Staub mal aus den Haaren gepustet zu kriegen? Ein bißchen frische Luft in die Nase – heute ist Elchjagd – du kannst morgen weiterlesen, die Bücher laufen nicht so schnell wie der Elchbulle!
Er hatte das herausfordernd gesagt, aber nicht verletzend. Es interessierte ihn nicht das geringste, ob Gunnar mit auf Jagd ging oder nicht. Und Gunnar war nicht klar, was er von dem Vorschlag halten sollte. Soviel wußte er jedoch: Verließ er sein Versteck, in dem er sich zwischen den Büchern wohl und geborgen fühlte, würde es schwer sein, dahin zurückzukehren. Es hieß entweder ja, und damit Anerkennung durch die Gleichaltrigen – oder nein, gleichbedeutend mit Verachtung. Und er wußte nicht, ob diese Sache die Wahl wert war.
Er bereute schon, kaum daß er zugesagt hatte – und sah den schwachen Zug von Erleichterung und Freude, der über Eriks Gesicht glitt.
Aus der Elchjagd wurde nichts. Dafür tranken sie miteinander. Tranken heftig, verbissen, geradezu selbstzerstörerisch. Gunnar versuchte, dem dahinplätschernden Gerede seines neuen Freundes zu lauschen; beschwichtigte aufkommende Zweifel, indem er sich einredete, er statte nur einen zufälligen Besuch in einer anderen Welt ab.
Später in der Nacht, als sie wirklich betrunken waren, fingen einige Streit an; sie prügelten einander und wälzten sich auf dem Fußboden in Seen von vergossenem Bier und kleistriger Asche. Das Bier schwappte aus den Krügen, ein langer, glitzernder Schwall lauwarmer Flüssigkeit. Gunnar saß wie gelähmt da, beobachtete die anderen und sehnte sich nach Ruhe.
Als sie in den Burghof gelangten, war um sie herum kalte, pechschwarze Nacht. Gunnar hatte nicht einmal mehr sein Überzeug mitnehmen können. Erik wirkte ein wenig nüchterner, an ihn hielt er sich also – sie schleppten sich in einer Reihe vorwärts, den Arm jeweils um den Hals der anderen gelegt. Eine lärmende, wackelnde Kette, die schwankte und zerbrach, sobald jemand in die Knie ging.
Gunnar stolperte und taumelte unsicher vorwärts, Schritt für Schritt, hatte das Gefühl, einen Fuß verloren zu haben, konnte nicht sehen, ob er den Boden berührte. Die Kälte biß im Gesicht, ging durch die Kleidung hindurch. Obwohl es sein größter Wunsch war, so konnte er doch nicht diesem dumpfen, glasigen Rausch entkommen.
Eine Rettung zeigte sich in der wirklichen Welt: ein Baum, gegen den er lief und um den er die Arme schlang. Gunnar blieb stehen, horchte auf seinen rasenden Puls und ließ die klammen Hände verwundert über die fühlbar krustige Rinde der Birke wandern.
Der Geruch von Schlamm und nassem Gras drang in seine Nase. Die Magenmuskeln zogen sich zusammen, er hatte den Geschmack bitterer Galle auf der Zunge. Aber er konnte wieder sehen, und das war doch immerhin ein Fortschritt.
Die anderen saßen auf Bänken um ein offenes Feuer herum. Soweit er erkennen konnte, waren auch Mädchen dabei. Zwei von ihnen sangen, eine andere spielte unbeholfen auf einer Laute. Die anderen Mädchen saßen bei den jungen Männern auf dem Schoß, zupften sie an den Haaren oder kabbelten sich kreischend. Eines der Mädchen ließ seine schweren Brüste nackt aus dem Kleid hängen. Nicht, daß sie besonders hübsch waren – er verstand nicht, warum sie sie unbedingt zeigen wollte.
Er setzte sich so hin, daß er nicht auf die Brüste sehen mußte, und bemühte sich, wach zu bleiben. Aber er mußte sich immerzu selbst daran erinnern, warum er das wollte – es war fast zuviel, ab und zu wurde ihm vor Erschöpfung schwindelig. Irgendwo im Nebelgebräu des Moores gab es einen Namen für diese Art von Mädchen, aber er konnte sich höchstens an den Ausdruck Elfen erinnern.
Und dann torkelte er an der Seite eines dieser Mädchen durch die Nacht. Endlich gelangten sie zwischen abgestorben wirkenden, gestutzten Hecken des Gartens hinein in die warme Dunkelheit eines Hauses. Es roch abgestanden und muffig, aber es war herrlich warm. Sie wollte, daß Gunnar die Leiter hinauf auf den Boden kam; aber einer seiner Füße machte ihm einen Strich durch die Rechnung, verfehlte die Sprosse, so daß er fiel, die Leiter ebenfalls. Er zog die Frau mit sich, weil er sich an ihrem Kleid festhielt.
Sie roch ebenfalls süßlich, trocken und muffig; sie lag schwer auf seinen Beinen, deshalb schob er sie freundlich zur Seite, setzte sich auf die Knie und fummelte an seinem Gürtel herum, ohne recht zu wissen, was er tat. Gürtel, Schwert und Beine waren ineinander verwickelt. Er kicherte und ließ sich wieder auf den Rücken fallen und starrte schwindelig hinauf in den schwarzen Himmel und zu ein paar Sternen. Sie half ihm, so schien es: nahm die Lederbörse vom Gürtel und leerte sie in ihre Hand. Drehte seinen Kopf mit harten Händen und rückte sein Gesicht gegen ihren Hals, wozu das auch immer gut sein mochte. Aber sie war dünn, magerer als er selbst, magerer auch als Erik. Die Haut mit fettiger Salbe eingeschmiert – der Geruch ging nur bis zum Rande des Kinns, am Hals war sie verschwitzt und schmutzig, und ihre Haut schmeckte säuerlich und salzig.
Er richtete sich auf einem Ellbogen auf, stützte das Kinn auf die Hand und ließ einen Finger mitleidig über ihren scharfen Kehlkopf gleiten und über die Sehnen, die zu den Schultern hin liefen.
Dann wand sie sich frei, fast ungeduldig, streifte mit einer müden Bewegung das Kleid vom Oberkörper, zog den Rock hoch und spreizte weit die angezogenen Beine.
Ihm wäre es lieber gewesen, sie hätte das sein lassen: er kannte sie ja gar nicht.
Sie lachte ihn aus, ein kurzes, trockenes, zutiefst höhnisches Lachen, als sie ihre Kleidung wieder zurechtzog, sich erhob und den Rock sauberklopfte, so daß der Schmutz auf ihn niederrieselte. Dann legte er sich zum Schlafen zurecht, in sich zusammengerollt, ohne die geringste Hoffnung, die Klarheit wiederzugewinnen, die ihm verlorengegangen war und die er jetzt vermißte.
Das Erwachen war schmerzhaft. Kaltes Wasser traf sein Gesicht. Er warf sich zur Seite, schützte das Gesicht mit den Armen, spürte, wie das Leben quälend zurückkehrte und die dunkle Behaglichkeit des Schlafes vertrieb. Seine Glieder gehorchten ihm immer noch nicht – die Arme schmerzten, denn er hatte verkehrt gelegen, und der Mund war trocken, ein säuerlicher Geschmack brannte im Rachen. Unter der Kleidung, die seltsam verzogen war, war ihm naßkalt von Schweiß. Sein Körper hatte den Geruch des Häßlichen, Unerklärlichen angenommen, dessen Zeuge er geworden war.
Vor ihm stand Erik mit einem Eimer in der Hand: der baumelte genau vor seinem Gesicht, das Holz war von schmalen Eisenbändern zusammengehalten, befestigt mit kleinen, unregelmäßig eingehämmerten Eisennieten. Es kam ihm vor, als sei die ganze Wirklichkeit in diesem nützlichen Gerät eingeschlossen. Er wagte, vom Eimer zu Erik hinaufzublicken, der auch nicht den Eindruck machte, als ginge es ihm gut – sie befanden sich in der Scheune, und Waffen, Kleidung, Blumenkränze und Pferdegeschirr waren im Stroh verstreut. Erik half ihm auf die Beine, und sie bahnten sich einen Weg durch Heuhaufen und schlafende Menschen.
Ihre erste Pflicht war es, die Messe zu hören; Gunnar hatte in der ganzen Zeit, die er auf Kalmarhus gewesen war, noch keine einzige versäumt. Aber heute mußte er noch vor Ende der Messe aus der Kapelle stürzen, um sich zu übergeben. Mit der Sonne und dem Tageslicht kehrte die Erinnerung zurück, ungeordnet und abscheulich. Er hatte – wider besseres Wissen, gewählt, und sein Körper war mit der Wahl nicht einverstanden.
Erik hatte seine ersten zehn Jahre bei den Brüdern im Alvastrakloster verbracht. Niemand hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, daß das nur eine vorübergehende Unterbringung war. Sein Vater war einem Mord zum Opfer gefallen, und seine Mutter hatte sich entschlossen, eine neue Ehe einzugehen: ob es das schlechte Gewissen war oder reine Neugier, die sie nach Alvastra getrieben hatte, wußte er nicht. Er hatte seine Mutter drei-, viermal gesehen, immer nur ganz kurz – die Brüder bereiteten ihn auf die vornehme Dame vor, auf die Hofmeisterin der Königin. Aber er hatte in ihr nur eine gealterte, überarbeitete und harte Frau sehen können. Er bemühte sich, ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie hatte elf Kinder geboren, die alle gestorben waren, bevor sich Erik wie durch ein Wunder als lebenstüchtig erwies. Aber diese alte Dame – er wußte nicht, was er zu ihr sagen sollte –, sie küßte ihn auf die Wange, weil es sich so gehörte, und nahm seine Hand, hörte ihm zu, abwesend, nachsichtig.
Dann hatte er eine Zeitlang auf Åkerö gewohnt, dem großen Hof, den er von seinem Vater geerbt hatte, aber der Verwalter meinte, er sei im Wege, deshalb schickten die Mutter und der Stiefvater ihn an den königlichen Hof.
Erik sehnte sich nicht zurück nach Alvastra, das behauptete er jedenfalls: Wenn der Weg zurück versperrt war, mußte man sich mit den vorhandenen Möglichkeiten abfinden. Und er hatte gelernt, sich in dem von den Mönchen gleichermaßen mit Furcht, Respekt und Sehnsucht als Welt bezeichneten Dasein zu behaupten. Er übernahm es, Gunnar die Tischsitten beizubringen, die rechte Art, sich zu bewegen und zu benehmen, sich richtig zu kleiden und höfisch aufzutreten. Gunnar war sein Werk, eine neue, verbesserte Ausgabe seiner selbst.
Erik ähnelte einem Mädchen und benahm sich manchmal, als seien sie beide verschiedenen Geschlechts: Gewöhnlich gingen sie Hand in Hand, und wenn sie sich trafen oder trennten, küßte Erik ihn mit spitzen Lippen auf den Mund. Aber alle anderen taten das auch, Gunnar ging davon aus, daß es sich so gehörte – so wie man auch wußte, daß man die fettigen Finger im Tischtuch und nicht in den Ärmeln des Nebenmannes abzuwischen hatte.
Als sie schließlich das Bettlager teilten, entdeckte Gunnar, daß Eriks Körper Duft verströmte: Selbst sein Schweiß war süßlich und geradezu angenehm einzuatmen. Sie wärmten einander unter der dünnen Decke, erwachten mit verschlungenen Armen und Beinen. Morgens saß Gunnar immer lange da und betrachtete heimlich seinen schlafenden Freund. Erik war eigenartig und zart und hatte seidenweiche Haut, mit weißem Flaum auf den Schultern und kleinen, blonden Locken im Schritt, sonst hatte er keinerlei Haare am Körper.
Sie ähnelten einander, aber im Unterschied zu Gunnar fühlte Erik sich in seinem Körper wohl und zu Hause. Er war zartgliedrig, ärgerte sich jedoch niemals über die fehlenden Kräfte. Ihm hatte niemand gesagt, daß er es doch nicht lernen würde, mit der Armbrust zu schießen. Erik konnte alles, wußte alles und würde ihm alles beibringen, daran zweifelte Gunnar nicht. Erik war sein Zugang zur Welt, durch seine bernsteinfarbenen Augen sah er die Welt. Aber nachdem er sein Herz an Erik verloren hatte, konnte er sich nicht einmal mehr zwingen, in die Bibliothek zu gehen. Eines Tages würde er zurückkehren, wenn er Zeit hatte; aber gerade jetzt gab es so viel anderes, was er kennenlernen mußte, entschuldigte er sich selbst.
Es war nicht immer leicht, Eriks Vertrauter zu sein – gerade als er glaubte, seinen Freund in- und auswendig zu kennen, stieß Gunnar auf eine Felswand. Erik, der jeden seiner Wünsche zu spüren schien, all seine Bedürfnisse und Sehnsüchte, konnte sich mit einem Schlag in Gefühllosigkeit und Härte verschließen, und Gunnar blieb zurück, einsam und gelähmt.
Sie gelangten durch Zufall hinunter in die Stadt Kalmar, und auf dem Weg zurück zur Burg kamen sie an einem kleinen Aufzug vorbei, der dem Schinderkarren folgte. Eine junge Frau saß auf dem stinkenden Strohhaufen des Wagens. Der Anblick veranlaßte Gunnar, sein Pferd anzuhalten, aber Erik verzog keine Miene. Die Frau sollte wegen Hurerei gebrandmarkt und zur Stadt hinaus gepeitscht werden, damit die braven Bürger sich nicht mehr mit ihr herumschlagen mußten, erklärte Erik mit leerer, gleichgültiger Stimme.
– Muß die Strafe denn so hart sein? fragte Gunnar erschüttert.
– Das geschieht, damit die Priester vor allzu großen Verlockungen geschützt werden, antwortete Erik und zuckte mit den Schultern.
– Aber dann müßten sie ja eher die Priester aus der Stadt peitschen, wandte Gunnar ein.
Die Menschen drängelten sich um den Galgen: Frauen mit lachenden Kindern, Männer mit gebratenen Hähnchen am Spieß, so daß man essen konnte, während die Unterhaltung stattfand. Sogar eine kleine Gruppe von Nonnen auf Durchreise war da, blaßwangige, ältliche Frauen, und sie waren nicht gerade die leisesten.
Der Schinder zog das Mädchen vom Karren – sie schwankte, als hätte man ihr etwas Starkes zu trinken gegeben; duckte sich vor seinen großen, harten Händen, fiel aber nicht, obwohl ihre Füße nackt waren und ihre Hände auf dem Rücken zusammengebunden.
Als sie an den Pfahl gebunden werden sollte, schenkte sie dem Schinder ein breites, zahnloses Lächeln.
– Er ist bestimmt ein guter, alte Kunde, glaub mir das, flüsterte Erik.
Der Schinder schlitzte ihr Kleid am Rücken auf. Sie stand da, die Hände hoch über sich am Pfahl festgebunden, und wartete, während das Urteil verlesen wurde.
Der Henker, der in einiger Entfernung gestanden und gewartet hatte, trat einen Schritt zurück, legte die vielen eisenbeschlagenen Lederstränge in der hohlen Hand zusammen, nahm gut Maß und gab ihr den ersten Streich quer über den Rücken und die Schultern. Ein einzelner Strang fuhr über ihr Gesicht, in ihren Mund, und zog eine schmale, rote Spur über die Wange.
Es sah aus, als überraschte sie der Schlag, von dem sie schräg nach vorn gegen den Pfahl geschleudert wurde: die gebundenen Hände griffen nach oben auf der Suche nach einem festen Punkt, aber sie fanden nichts, und beim dritten Schlag sank sie mit einem kindlichen Jammern zusammen; versuchte, um den Pfahl zu fassen, blieb jedoch, den Kopf schräg nach hinten geworfen, hängen.
Gunnar konnte die Züchtigung einfach nicht mehr ansehen. Er ritt sein Pferd in die nächststehenden Zuschauer hinein, die mit offenen Mündern dastanden und gafften und wütend über die Unterbrechung waren – er schlug mit beiden Füßen, Sporen und Peitsche, um zu entkommen, rief den Leuten Schimpfwörter zu.
Erik holte ihn erst oben an der Zugbrücke ein, wo er vom Pferd gestiegen war und weinend im kniehohen Gras auf und ab ging, mit den Armen gestikulierte und gegen das Schauspiel wetterte, dessen Zeuge er gerade geworden war.
– Sie kann ja von nichts anderem leben als von dem, was sie verkauft! rief er, als Erik ihm sanft und beruhigend die Hand auf den Arm legte – Wer hat sie denn bezahlt? Sie lebte davon, aber wer bezahlte sie? Wo ist der Pfahl, an dem man die Männer festbindet und auspeitscht, die sie gezwungen haben, sich zu verkaufen?
– Dann müßten wir ja alle bestraft werden, wandte Erik bestürzt ein.
Gunnar spürte, daß er niemals ihre mageren, unsauberen Hände aus seiner Seele verbannen könnte: Er blieb zurück mit der Schuld, ohne sie benennen zu können.
Den ganzen folgenden Monat über glitt er wie ein Schatten an der Bibliothek vorbei, ohne auch nur einen Blick auf die Tür zu werfen, die immer noch zu öffnen gewesen wäre, wenn er sich nur getraut hätte. Er versuchte, sich mit ganzer Seele und all seinen Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren als auf die innere Zerrissenheit, die er nicht heilen, mit der er aber auch nicht leben konnte.
Das Pferd gähnte, scharrte mit den Hufen und drehte das Weiße in seinen Augen hervor, während sein Bauch bebte – das dünne, blanke Fell zitterte, weil ein paar Fliegen sich erdreisteten, sich auf dem Tier niederzulassen. Gunnar tat alles, um das Pferd ruhigzuhalten, aber es drückte das Hinterteil hart gegen die nächststehenden Tiere, schnaubte und schüttelte den großen Kopf, als versuche es, gleichzeitig Zaumzeug und Reiter loszuwerden.
Für Gunnar war es eine hoffnungslose Situation. All die anderen jungen Männer waren zu dem, was Erik Turnier nannte, erzogen und ausgebildet worden, zu diesem Spiel, das auf Wunsch des jungen Königs veranstaltet wurde, zum Entsetzen des Vormundschaftsrates. Er hatte sich nicht entziehen können, jetzt schon gar nicht, da er mit Erik zusammenwohnte. Aber anstatt zu versuchen, das Unmögliche wahrzumachen und sich noch die nötige Geschicklichkeit zu erwerben, hatte er sich auf Äußerlichkeiten konzentriert. Seine Ausrüstung war gut. Alle Beschläge glänzten; das Leder war gefettet, das Pferd in guter Verfassung. Auch wenn er bestimmt schon beim ersten Versuch abgeworfen wurde (vielleicht sogar schon, ehe er überhaupt die Kampfbahn erreichte), hatte er doch dieses bißchen Ehre sicher.
Am Tag zuvor hatte er zusammen mit Erik trainiert, war abgeworfen worden und hatte nach Luft gerungen. Nach dem Sturz war ihm, als seien alle seine Rippen schmerzlich verdreht und als würden sie nie mehr an ihren rechten Platz kommen. Eigentlich wäre er am liebsten liegengeblieben, bis er allein hätte aufstehen können; aber Erik eilte herbei, hob ihn in seine Arme, umarmte und küßte ihn und betastete seine Glieder, um zu sehen, ob er sich ernstlich verletzt hätte.
Welch ein Pech, dachte er, daß das Los ihm als Gegner Erik zugeführt hatte. Daran war nichts zu ändern. Er hoffte nur, daß er nach dem Kampf mit seinem Freund sein Leben wie gewohnt weiterleben konnte.
Es dauerte eine unendliche, nicht zu ertragende Ewigkeit, bis man ihn herbeiwinkte, und die Hände gehorchten ihm nicht einmal, als er den Topfhelm mit den zwei Haken am Halsstück des Lederkollers festmachen wollte. Er mußte es mehrmals versuchen, bis es schließlich gelang. Nils holte ihm den Speer: breit, mit stumpfer Spitze, so daß man seinen Gegner wirklich nur durch ein Unglück verletzen konnte. Erik nannte das Ding eine Lanze: das klang nach mehr als nach diesem Stück glatten Holzes mit Eisenbeschlägen und Handschutz.
Jetzt konnte er es nicht länger hinausschieben: Es gab keinen Ausweg.
Ohne genau zu wissen, wie, gelang es ihm, das halbwilde, schäumende Pferd zu bändigen, bevor es noch Hals über Kopf in die aufgestellten Bankreihen unter dem Zeltdach laufen konnte, wo es die frierenden Zuschauer über den Haufen geritten hätte. Der Helm war mit wattiertem Leder gefüttert, das nach Staub und Feuchtigkeit roch. Durch die beiden schmalen Sehschlitze konnte er einen kleinen, mageren Jungen erkennen, mit Flachshaaren, die ihm bis auf die Schultern reichten – in einem silbergewebten Rock und umhüllt von einem großen, pelzgefütterten Umhang. Gunnar versuchte nach besten, aber leider geringen Kräften, die Lanze zum Gruß an den König zu senken, so wie Ivan Loveridder, Tristan und Lancelot es in den Romanen taten, die er beim Kanzler gelesen hatte.
Der kleine König nickte, und sein Gesicht zeigte ein hilfloses, gehemmtes Lächeln.
Dann wagte er, das Pferd zu wenden und zur Markierung zu reiten. Vier Jungen sprangen herbei, um die aufgeregten Tiere zu halten, damit sie auf der jeweiligen Seite der Kampfbahn nicht verfrüht starteten.
Schon sprengten sie los – Gunnar kam nicht einmal dazu, zu zielen, wie Erik es ihm gezeigt hatte, denn die Lanze tanzte hoffnungslos im Takt mit den gewaltigen Bewegungen des Pferdes. Er stemmte die Waffe mit aller Kraft hoch, versuchte, den Schaft gegen den Sattelknopf zu stützen, hob seinen kleinen Schild und die Zügel in der linken Hand, brüllte dem Tier etwas zu, das allerdings weder einer Aufforderung noch Anfeuerung zu bedürfen schien und schnappte nach Luft – in Kürze würde er mit großer Wucht getroffen und zu Boden geschleudert werden.
Als genieße es das Spiel, streckte das Tier den Hals, die Kandare zwischen den gelben Zähnen. Die Lanze wippte grotesk vor Gunnar auf und ab; er schaffte es kaum, sich mit dem Schild Deckung zu geben, wenn er gleichzeitig das verrückte Tier lenken sollte. Erik näherte sich, ein grauer, glänzender, schuppiger Eisenmann.
Der Lärm pochte in ihm, fremdartig, unter Stahl und Leder. Gunnar hob die Lanze hoch, zog sie an sich und riß mit aller Kraft an den Zügeln: das Pferd sprang mit einem Satz seitwärts, Erde und Kies wurden von seinen Hufen hochgewirbelt.
Durch die Sehschlitze erkannte er, daß sie nach allen Regeln der Kunst zusammenstießen. Das Herz klopfte ihm bis zum Halse. Er spürte einen heftigen Stoß, ohne daß er sagen konnte, wo Eriks Lanze ihn getroffen hatte – er verlor einen Steigbügel, preßte die Knie zusammen und blieb sitzen, auch wenn ihm schwindelig wurde.
Das Pferd befreite sich schüttelnd von seinem Griff, verlangsamte das Tempo und blieb am anderen Ende der Kampfbahn stehen. Irgend jemand ergriff es, nahm Gunnar Schild und Lanze ab und setzte seinen rechten Eisenfuß in den Steigbügel, als sei er ein Kind, dem man gerade das Reiten beibrachte.
Er lüftete den oberen Teil des Helms und sah sich um, drehte sich im Panzer – der Wind strich zart und kühl um seine Stirn, seinen Scheitel und sein Haar, das schweißnaß war.
Er sah Erik: der Freund stand vornübergebeugt mitten auf der Bahn und bürstete den Staub, Erde, Kies und Sand vom Rock, der zerrissen war, so daß der vordere Schlitz sich schräg bis hinauf zur Brust fortsetzte.
Unendlich langsam begriff er, was geschehen sein mußte.
Hier saß er selbst unverletzt auf seinem Pferd, und dort stand Erik. Ein paar der Regeln hatte er immerhin behalten – hakte den Helm ab und warf ihn hinunter zu Nils Turesson als Zeichen dafür, daß er den Kampf nicht fortsetzen wollte.
Aber Erik kam zu ihm, das Pferd hinter sich herziehend: ging steif auf ein Knie nieder und reichte ihm die Zügel. Mit einem leuchtenden, untertänigen Ausdruck auf dem schmalen, bleichen Gesicht, in dem die Wangen glühten.
Gunnar wußte sich nicht anders zu helfen, als das Geschenk anzunehmen, und er hörte durchaus, daß die Leute angesichts der schönen Geste klatschten, aber es gefiel ihm nicht. Jetzt, wo er entgegen allen Erwartungen gewonnen hatte, hatte Erik ihm auf eine seltsame, verquere Art doch die Niederlage zugefügt, die er befürchtet hatte.
Dann nahm er die Pferde und entfernte sich, ohne mit jemandem zu sprechen. Er nahm seinem und Eriks Pferd den Sattel ab, wusch Schaum und Erde von den Tieren und begann, sie mit selbstvergessener Gründlichkeit zu striegeln, versuchte, sich selbst zur Ruhe und Vernunft zu zwingen. Natürlich wollte er Eriks Pferd nicht behalten – was sollte er mit zwei Reittieren, und wenn er mehr brauchen sollte, würde der Stiefvater ihm wohl noch eins schenken, wie er auch das erste geschenkt bekommen hatte.
Danach ging er zu ihrem gemeinsamen Bett – der Saal war leer, alle anderen waren auf der Kampfbahn beschäftigt, die Schlafplätze entlang den Wänden lagen zerwühlt und unordentlich da, mit allen möglichen Kleidungsstücken und Waffen kreuz und quer.
Eriks Armbrust lag auf dem Fußboden, die Feder war kaputt, und Gunnar hatte schon lange versprochen, daß er nachsehen sollte, ob er sie reparieren könnte. Er hatte dünne, kräftige Finger, und es machte ihm Spaß, sich mit solchen schwierigen Sachen zu beschäftigen, wie er früher auch Figuren geschnitzt und sich das Schreiben beigebracht hatte. Jetzt war es eine Art Buße, sich an die anstrengende Arbeit zu machen.
Es gab kein Holz und keine guten Messer. Sonst hätte er sich irgendwo unbemerkt eingeschlossen und angefangen zu schnitzen. In der letzten Zeit hatte er mit dem Gedanken gespielt, einmal zu versuchen, eine kleine Figur zu schnitzen, die er Heiliger Erik nennen könnte. Er würde nicht viel Holz dazu brauchen, Erik war dünn und schmal.
Wenn er in eine Kirche gehen und Erik dort stehen sehen könnte, würde er seinen Freund zugleich besitzen und von ihm befreit sein – es war ihm vorher nie bewußt gewesen, daß er Erik zwar mochte, die Freundschaft mit ihm aber auch als Fessel empfand.
Während er auf dem Bett saß, tief über die technischen Probleme gebeugt, hörte er unten Stimmen – die eine war Eriks, und die Ruhe, die er sich aufgezwungen hatte, flog aus ihm heraus und davon, wie ein Schwarm verschreckter Vögel.
Erik kletterte schnell die Leiter hoch und hob dabei den langen Rock an – ging weiter zur Schlafpritsche, ohne auf Gunnars Anwesenheit zu achten, stellte die Öllampe so, daß er besser sehen konnte, und begann mit gereizten Bewegungen und viel Lärm, seine Besitztümer in einer Decke zusammenzusuchen. Die feine Brünne, Handschuhe und Winterumhang, Stiefel und Schmuck. Dabei stieß er auf einen Gürtel, der über dem Panzerhemd hing. Der Gürtel gehörte Gunnar, also wurde er runtergerissen, zusammengerollt und seinem Eigentümer in die Arme geworfen.
Das, was seiner Meinung nach ihm gehörte, bündelte Erik zusammen, verknotete die vier Ecken der Decke und schleppte die Last zur Bodenluke. Erst als Erik sein Schwert holte und es an dem Gürtel, den er unter dem Rock trug, festspannte, wagte Gunnar, ihn anzusprechen.
– Reist du jetzt heim? fragte er mit schwacher Stimme, denn so sah es unstreitig aus; aber das war leichter gesagt als getan. Erik hatte dem Königskind Treue geschworen und mußte erst um Urlaub ersuchen, das wußte er.
– Entweder suchst du dir einen anderen Platz zum Wohnen, erwiderte Erik außer Atem, ohne sich auch nur umzuwenden, – oder ich gehe freiwillig, es gibt genug Orte unten in der Stadt, wo man eine Herberge findet.
Gunnar begriff nicht, was um ihn herum geschah. Zu irgendeinem Zeitpunkt mußte ihm etwas Entscheidendes entgangen sein, das alle anderen bemerkt hatten.
– Du darfst es nicht so schwernehmen, sagte er schließlich, so behutsam, als spiele er Ball mit einem Hühnerei, – es ist doch nur ein Spiel. Das weißt du doch selbst am besten, es war reiner Zufall – das Pferd kannst du jederzeit wiederhaben!
Erik lachte leicht in sich hinein, mit dem Rücken zu ihm; aber es klang nicht so, als belustige es ihn – dann breitete er resigniert die Arme aus und ließ die Handflächen auf die Schenkel klatschen.
– Wenn du glaubst, es ist wegen des Pferdes – dann glaub es nur weiter! sagte Erik, aber die Stimme klang nicht so scharf und sicher wie zuvor. Gunnar fühlte sich seltsam zumute, gejagt, ohne den Jäger zu erkennen, er wagte nicht, weiter einzudringen, wollte ihn nicht kränken: wenn man es genau nahm, war Erik der einzige Freund, den er je gehabt hatte.
– Wir sind Freunde, sagte er, – du bist der einzige, den ich mag. Wir können uns doch nicht so trennen!
– Freunde! wiederholte Erik, zögerte einen Augenblick, drehte sich mit einem Ruck um und starrte ihn an, mit demselben nackten, untertänigen Tierblick, den er gehabt hatte, als er sein Pferd übergab.
– Freunde, sagst du – Gott helfe uns, du weißt nicht einmal, was du da sagst! Freunde!
Gunnar begriff immer noch nicht im geringsten, was Erik meinen konnte. Etwas Böses war zwischen sie getreten, ohne daß er es bemerkt hatte; etwas Unbegreifliches und Namenloses. Er wußte sich nicht anders zu helfen, als stehenzubleiben und Eriks Blick zu erwidern – irgendwann mußte er doch eine Erklärung bekommen.
– Es gibt vieles, was du nicht weißt, sagte Erik und wandte den Blick ab, biß sich auf die Lippen, – aber so dumm kannst du doch nicht sein. Du müßtest es doch am besten wissen.
Am besten was wissen, schrie es in ihm, in banger Neugier – das Wissen, das er um jeden Preis erwerben wollte, konnte häßlich sein. Es verkrampfte sich in ihm, ein bisher unbemerktes inneres Organ zog sich in zitternder Angst zusammen und sandte Kältestrahlen durch seinen Körper, klopfte bis in die Fingerspitzen, setzte sich wie ein erstickender Kloß in der Kehle fest.
– Du weißt ja nicht mal, was du tust! sagte Erik: er klang, als wolle er sich selbst eine Lektion einprägen, die er nicht mochte. Haben sie nie mit dir gesprochen, nachdem deine Eltern gestorben waren? Du mußt doch wissen, wie schwer es ist, voranzukommen, wenn man nicht so ist wie alle anderen – du, ein Hurenkind.
Gunnar blinzelte mit den Augen, als habe jemand eine Faust an seinem Gesicht vorbeisausen lassen: der erste Hinweis, den Erik gegeben hatte, machte alles doppelt kompliziert. Hurenkind – wenn es etwas in dieser Welt gab, das er nicht war, dann mußte es ein Hurenkind sein. Seine Eltern waren mehrere Jahre verheiratet gewesen, als sie ihn bekamen; er hatte eine ältere Schwester, Gudrid, im Vårfrubergakloster. Zwar hatten seine Eltern einander verabscheut und von Herzen geschadet, aber verheiratet waren sie unstreitig gewesen. Hurenkinder – das waren Kinder, die verheiratete Männer mit andern als ihren Ehefrauen bekamen. Wie der kleine Sohn, den das Melkmädchen Jorunn letzte Woche bekommen hatte und zu dem sich der Küchenmeister bekannte.
– Was meinst du? Gunnar stammelte, mußte husten, um die Worte herauszubekommen. Eriks große, bernsteinfarbene Augen suchten die seinigen, und ein schwaches Erröten breitete sich über das schmale, bleiche Gesicht. Er strich sich mit einer Hand über Augen und Nase, und die Hand zitterte.
– Das wissen doch alle! sagte Erik kurz.
– Ich nicht. Ich nicht, antwortete Gunnar.
– Haben sie nie mit dir gesprochen? fragte Erik. Seine Stimme verriet tiefes und ehrliches Erstaunen.
– Wir haben es sogar drüben bei den Brüdern in Alvastra gehört, erklärte er und hielt Gunnars Blick stand. Während er fortfuhr, mit ruhiger Stimme und ohne drum herum zu reden, – der Mann, den du Pflegevater nennst, ist dein Vater. Deine Pflegemutter ist nicht viel besser als deine Mutter. Dein Pflegevater tötete ihren Mann, deinen Onkel – um sie heiraten zu können – und er bezahlte einen anderen dafür, daß er die Schuld auf sich nahm. Herrgott, du warst doch zwei Jahre mit ihnen in Norwegen, in der Verbannung, du mußt doch wissen, warum sie gezwungen waren, das Land zu verlassen! Dein Pflegevater wurde geächtet, weil ihm nicht erlaubt wurde, für den Mord Bußgeld zu zahlen!
Aber so war das nicht, dachte Gunnar. Es war gut möglich, daß es für Außenstehende so aussehen konnte; aber niemals für ihn. Nicht aus der Nähe. Erik konnte das nicht sagen: daß seine Eltern einander liebten und daß ein wenig von der Wärme, die zwischen ihnen strömte, ihm zum ersten Mal Leben und Mut gegeben hatte. Jofrid, seine Pflegemutter, die sich seiner angenommen hatte, als er zehn war, und als seine Mutter im Kindbett gestorben war. Sten, sein Pflegevater, der ihn immer freundlich behandelt hatte, immer so, als sei er ein Mensch.
Es stimmte auch nicht, daß er nichts wußte über ihre Vorgeschichte. Er hatte davon gehört – Bruchstücke aus Gesprächen, Gerüchte und aus dem Zusammenhang gerissene Bemerkungen. Aber er hatte sich nie gefragt, inwieweit die Vergangenheit sein Leben lenkte.
Es stimmte Gunnar nicht versöhnlicher, daß er es nun wußte. Eine Kluft tat sich zwischen ihm und Erik auf, dieses Wissen, das alle außer ihm zu haben schienen. Der Schlüssel zum Verständnis dessen, wer und was er war.
– Aber warum können wir nicht mehr zusammensein? fragte er zu Erik gewandt, der sich auf die Schlafpritsche gesetzt hatte, mit dem Rücken zu ihm, krumm und gebeugt. Aber er erhielt keine Antwort; eigentlich hatte er heute abend auch genug zu hören bekommen. Also tappte er die Leiter hinunter und hinaus in die Kälte, ohne Mantel, und ohne richtig zur Besinnung zu kommen.
Ein Schauer überlief ihn, als er spürte, wie der Wind durch die Kleidung fuhr. Nun war er wieder allein, viel einsamer als vorher – und er begriff nicht, warum.
Habe es gewußt, gewußt, gewußt, hallte es wie ein Echo in ihm. Aber vor ihm sollte es also verborgen werden. Und es mußte auch dieses Wissen sein, was ihn von Erik getrennt hatte, einen anderen Grund konnte er beim besten Willen nicht finden.
Es gab keinen Ort, an den er flüchten konnte, keinen Ort, wo er allein sein konnte, niemanden, mit dem er reden konnte. Alle anderen tanzten. Auf der grasbewachsenen Anhöhe vor der Burg war ein Feuer entzündet worden. Noch am gestrigen Abend hatte er sich auf den Tanz gefreut, Fremde würden dabei sein, all die anderen jungen Männer hatten Bräute, sogar Erik.
Der Mißmut schloß sich um ihn, wie naßkalte, dunkle Erde um einen Geist, der zum Grab zurückkehrt, nachdem er seine Geliebte besucht hat. Das war das Lied, das sie im Kreis grölten, ohne auf die Worte zu achten. Nun mußte er wohl zu den anderen hinuntergehen, sonst würden sie nach ihm suchen und Erik finden, und wer wußte schon, welche Teufeleien sich ergeben konnten?
Nils gab ihm einen großen Becher in die Hand, und er trank gehorsam von dem starken Bier. Versuchte sich dazu zu überreden, zu Erik zurückzugehen – so unheilbar konnte ihre Freundschaft nicht zerstört sein. Die Männer und Frauen hier waren betrunken und roh, tanzten und amüsierten sich. Er hatte bei ihnen nichts verloren, er würde sie nur bei ihrem Vergnügen stören, sie machten einen Bogen um ihn, als wäre er ein Aussätziger.
Der einzige Mensch, der genauso einsam wirkte, wie er sich fühlte, war ein junges Mädchen. Sie saß auf einer Bank an der Schmalseite des kleinen Steinhauses. Im Schein des Feuers fand er, daß sie Erik ähnelte. Blaß, blond und schmächtig, die weißen Hände fromm im Schoß über Kreuz gelegt. Jedesmal, wenn sich ein Mann an sie wandte, schüttelte sie abweisend den Kopf.
Er nahm allen Mut zusammen, ging zu ihr hinüber und bat sie um einen Tanz – ohne darüber nachzudenken, was ihn trieb. Als die anderen Männer sie darum gebeten hatten, da hatte sie immer verschämt auf ihre Hände niedergeblickt, mit steifem Hals, als ob man sie quälte. Nun aber richtete sie sich auf und sah zu ihm hoch, und es war die Überraschung seines Lebens. Als er Erik getroffen hatte, war es ihm vorgekommen, als sei er das merkwürdigste Geschöpf unter der Sonne. Aber dieses Mädchen war noch eigenartiger. Die Augen hatten dieselbe Farbe wie dunkler Bernstein, Haar und Haut erinnerten an frische lauwarme Milch, ganz ohne Schrammen, Fältchen und irgendwelche Fehler. Das Haar war am Ansatz dunkler, und unter den hohen schrägen Wangenknochen zeigten sich Schatten. Wie Erik schien auch sie nur ein halbwegs irdisches Wesen zu sein – der Hals war viel zu lang und gebogen, dünn und mit Flaum bedeckt. Sie wirkte frisch und unerfahren, auf jede Weise unberührt, wie Laubbäume in der ersten Woche nach dem Ausschlagen.
Während des Tanzes konnte er nicht auf das Lied achten, wagte nicht, den Blick von ihr zu wenden, aber er war immer noch einsam. Sie sang nicht mit, auf dem kleinen Gesicht ruhte unverändert der verschlossene Ernst, als denke sie über etwas nach, das weitaus interessanter war als das Lied. Es konnte nicht gesund sein, so viel zu grübeln. Aber sie ähnelten einander.
Heute hatte er seinen einzigen Freund verloren, daher war Gunnar so niedergeschlagen, daß sogar dieses schweigsame Elfenmädchen mit den Bernsteinaugen und dem milchblonden Haar neben ihm fröhlich wirkte.
Ihr Haar war aus der Stirn gekämmt und wurde von einem schmalen Seidenband gehalten. Ein kleines Schmuckstück blinkte mitten auf der hohen, schmalen Stirn: die Jungfrau Maria mit dem Kind. Er strich mit den Fingerspitzen über das Band und blickte zu ihr hinunter: Während des Tanzes war ein bißchen Farbe auf ihre Wangen und Leben in ihr Gesicht gekommen. Etwas wie ein Lächeln huschte über ihre Augen, während sie ihn betrachtete.
Sie standen allein draußen in der kühlen Luft, und er schnupperte an ihrem Haar. Er war klein von Statur, und sie noch einen ganzen Kopf kleiner – eines der kleinsten, aber vollkommensten Wesen, denen er je begegnet war. Und sie hieß Gunhild.
– Mein Vater nennt mich Gunilla, fügte sie hinzu, – das paßt besser, weil ich so klein bin. Und wie heißt du?
– Fast genauso, antwortete er mit einem Schulterzucken, erschrocken über das Gefühl der Sicherheit, das von der Jungfrau Maria und ihren Augen herrührte und ihn durchströmte, – ich heiße Gunnar. Und du bist süß.
Diese Bemerkung brachte sie zum Lachen, ein kleines, lustiges Glucksen, tief unten in ihrer Kehle. Aber ihr Mund blieb geschlossen. Das gab ihm Mut, seinen Arm um ihren Rücken zu legen, und sie gingen miteinander, in seliger Ruhe. Wenn sie es verlangte, könnte er von Kalmar bis Stockholm gehen und wieder zurück, barfuß und mit verbundenen Augen.
An der Treppe zu dem Haus, in dem sie schlief, blieb sie stehen, wandte sich ihm entschlossen zu, die Hände verschränkt vor sich. Er könne gern mitkommen, erklärte sie; auf Treu und Glauben oder auf der Decke liegen, das taten alle anderen auch, dabei konnte nichts passieren.
– Was ist, wenn dein Bräutigam kommt – ich glaube nicht, daß er entzückt wäre, mich dort oben zu finden, sagte er. Mit ihrer Zutraulichkeit hatte sie ihn über den Schrecken des Zerwürfnisses mit Erik hinweggetröstet. Er wollte den Abend nicht durch einen neuen, unvorbereiteten Streit verderben. Aber Gunilla lachte und schüttelte den Kopf, so daß ihr das Haar um das spitze Kinn flog. Diesmal konnte er ihre kleinen, weißen Mausezähne sehen.
– Er hat am liebsten nichts mit mir zu tun, sagte sie, als berührte sie das nicht im geringsten, – was das auch immer für ein Unmensch sein mußte, der nicht bereit war, alles auf der Welt dafür zu geben, um mit ihr zusammenzusein!
– Dann muß er blind und taub und lahm sein, stieß er hervor, und er meinte es – griff nach ihren Händen, erfaßte die dünnen Ellbogen und strich über den milchfarbenen Stoff der Ärmel. Sie blieb stehen, still und in sich gekehrt, bis seine Hände ihren Nacken erreichten.
In dem Augenblick sah sie zu ihm auf, und er küßte sie – bevor er überhaupt beschlossen hatte, daß es genau das war, was er wollte.
Ihr Gesicht wandte sich zu ihm empor, wie eine Blume nach dem Licht, und sie öffnete den Mund, als wolle sie schreien; aber sie hatte keine Angst.
Es war das erste Mal, daß er sich in dieser schweren Kunst versuchte, aber es war leichter, als er befürchtet hatte, fast selbstverständlich. Ihr Zunge glitt zwischen seine Zähne, warm und ein bißchen erschrocken über ihren eigenen Mut, spielte gegen seinen Gaumen und zog sich zurück, wie eine Maus in ihr sicheres Loch.
Als er sie losließ und sie sich an ihn lehnte, konnte ihn nichts Böses mehr berühren. So etwas war noch nie zuvor geschehen. Darauf hätte er schwören können.
– Tu es noch einmal! bat sie.
Als er sie das nächste Mal losließ, breitete sie die Arme aus und lachte, und einen Moment lang dachte er, sie hätte Flügel unter dem Umhang und würde in Vogelgestalt hochflattern.
Sie stiegen zusammen auf den Dachboden und legten sich aufs Bett, und Gunhild schlief ein, während sie noch miteinander flüsterten. Er brachte es nicht über sich, sie zu wecken, auch wenn er ihre Stimme vermißte. Sie schlief geräuschlos, und er lag wach, verwirrt und glücklich, und hielt sie leicht fest, ihr Gesicht in seiner Achselhöhle. Einzelne Strähnen ihres Haars waren über sein Gesicht gebreitet; er wollte sie nicht wegstreichen, auch wenn es in der Nase kitzelte.
Es gab kein größeres Vergnügen auf der Welt als dieses, davon war er überzeugt. Schon der Laut ihrer schwachen Atemzüge war unbegreiflich. Sein Herz flatterte wie ein Schmetterling in einem dunklen Haus, wenn er nur an ihre Bernsteinaugen dachte.
Früh am Morgen erwachte sie, noch vor Tagesanbruch – drehte sich mit einer heftigen Bewegung auf den Bauch und streckte sich, gähnte und prustete und rieb sich die Augen. Es war unverkennbar, daß sie gewohnt war, allein zu schlafen. Als sie ihn erblickte, setzte sie sich erschreckt auf – er hätte nicht geglaubt, daß ihr Gesicht je Farbe annehmen würde, aber sogar im schwachen Licht der Öllampe konnte er sehen, daß sie errötete, und das stand ihr ausgezeichnet.
Sie küßten sich und begannen eine Art Gespräch: Er mußte wissen, wer sie war, woher sie kam. Und sie schloß ihre kleinen Hände um die Knie und erklärte alles, als habe sie sich die ganze Nacht, auch im Schlaf, darauf vorbereitet, seine Fragen zu beantworten.
Ihr Vater hieß Torsten Ödesson, hatte einen Adlerfang in seinem Wappen, wohnte meistens in Sörmland – ihre Mutter lebte nicht mehr, und Gunhild hatte keine Geschwister, der Vater hatte sich nie wieder verheiratet.
Das klang wirklich gut, fand er: Sie war nicht die jüngste von dreizehn Töchtern, auf der Suche nach einem reichen Freier, sie war kein Hurenkind, hatte sich nie für ihre Herkunft schämen müssen. Ihr Vater mußte sie über alles auf der Welt lieben. So ein Vater würde sich nicht ihrem Wunsch widersetzen. Und der Bräutigam, der nicht einmal mit ihr tanzen wollte.
Seine Pflegeeltern würden stolz sein, wenn sie hörten, wen er erobert hatte: eine reiche Braut, die so hübsch war, daß ihm fast das Herz in der Brust schmolz, wenn er sie nur ansah.
Aber da gab es noch jemanden, den Bräutigam Gunhilds. Das mußte der Sohn eines mächtigen Mannes sein, wenn er für Torsten Ödessons einzige Tochter gut genug war. Gunnar wußte sich nicht anders zu helfen, als sie zu fragen; aber er sah, daß sie erbleichte, sich in sich selbst zurückzog, wie sie es am Vorabend beim Tanzen getan hatte. Es arbeitete in ihrem Gesicht, als würden die Worte im Mund quellen und die Lippen versuchen, sie zurückzuhalten.
Er brauchte sie nicht anzusehen, als sie den Blick auf ihn richtete, hilflos und erleichtert: Er hatte den Zusammenhang erraten. Natürlich: Solche Zufälle durfte es doch nicht geben. Jetzt hatte er Erik gerade aus seinem Gewissen verbannt, und mun begann das Ganze von vorn, und schlimmer als zuvor. Nun würde er mit Erik auch noch um eine junge Frau streiten.
Jofrid war der glücklichen Überzeugung gewesen, daß sich alle Knoten lösen würden, wenn sie nach Jahren der Verbannung und Armut in Norwegen wieder nach Schweden zurückkehren könnten. Aber so einfach war das nicht. Die Schuld war alt geworden und an den Rändern ergraut, sie fand, sie hätten genug gesühnt. Schon als sie auf dem Pachthof wohnten, war es ihr schwergefallen, sich genau vorzustellen, wie ihre Heimkehr aussehen würde – eigentlich hatte sie wohl gedacht, daß Ehre, Erbe und Name ohne Belang wären, wenn sie nur nach Hause kommen könnten und ihnen das Recht gewährt würde, in Schweden zu wohnen. Sie waren ja trotz allem nicht die ersten, die so etwas getan hatten, verteidigte sie sich: viele andere hatten sich von Mord und Gesetzesbruch freikaufen können, wohnten glücklich und frei im Lande, führten ihre Höfe gut, und niemand wagte, auf ihre undurchsichtige Vergangenheit anzuspielen.
Jofrid konnte nicht einsehen, daß ihre Schuld so viel größer als die der anderen sein sollte. Ihr eigener Onkel Ingemar, der sich ihrem Freikauf widersetzt hatte, hatte seine Pächter wie Leibeigene behandelt, und trotz seiner großen Frömmigkeit hatte er bis zu seinem Todestag mit den Nonnen der Klöster Sko und Gudhem in Fehde gelegen. Jeden Tag wurden Menschen erschlagen, ohne daß die Morde bei den Treffen des Reichsrates verhandelt wurden. Ihr Mann war unbeabsichtigt getötet worden: Sie hatte sich an diesen Begriff geklammert, hatte Sten nie gefragt, wie der Mord an Ture vor sich gegangen war. Der Mord war Sten so teuer zu stehen gekommen, weil er auf Kirchengelände und dazu an einem Meßtag geschehen war. Überdies hatte Ingemar seine eigenen Gründe, Sten den Freikauf zu verweigern. Das mußte sie glauben. Über den Rest wollte sie nicht einmal nachdenken.
Aber schon in Norwegen hatte sie begriffen: Sie konnte nicht mehr beichten, bereuen und Buße tun, wie sie es gelernt hatte. Nie mehr würde sie die befreiende Wirkung der Absolution erfahren, ohne sich heimlich einen Rest von Zweifel zu bewahren. Wenn sie beichtete, daß Sten und sie zusammengelebt hatten, während sie noch verheiratet war, würde das eine Ehe unmöglich machen. So einfach war das. Keine Instanz, weder eine weltliche noch eine kirchliche, hatte sich in ihr Zusammenleben eingemischt. Niemand mengte sich in das mehr oder weniger offenkundige Kebsenleben der Leute ein. Wenn doch, dann müßte sich die Kirche sozusagen mit jeder Großgrundbesitzerfamilie anlegen. Jofrid hätte mit Sten bis zu ihrem Tode unverheiratet zusammenleben können, und ihre Kinder hätten niemals den Namen des Vaters getragen, ihn niemals beerben können. Früher oder später würde Sten von der Kirche mit dem Bann belegt werden, weil er mit einer Frau zusammenlebte, mit der er Hurerei begangen hatte. Es war unmöglich, mit allen Seiten Frieden zu schließen. Daher war das Leben für Jofrid eine lange beschwerliche Seereise bei steifem Gegenwind und zwischen unterseeischen Riffen hindurch.
Es war undenkbar, darüber mit Sten zu sprechen. Er nahm seinen Glauben leicht: eine Formsache, etwas, das man in sein Leben einbeziehen konnte, wenn es sich ergab, und das man sonst kaum eines Gedankens würdigte. Sten hatte sich derart daran gewöhnt, seine eigenen Lebensregeln aufzustellen, daß er kaum die Meinung anderer beachtete, wenn diese von der seinigen abwich. Es waren ganz andere Begriffe als Sünde, Reue, Sühne und Reinigung, die in seiner Seele Widerhall fanden: töten, huren und stehlen, das konnte er ebenso leicht wie mit den starken, braunen Fingern schnippen – ohne zu begreifen, daß er andere verletzte. Aber wenn jemand seine Ehre, die inzwischen für alle anderen außer ihm zu einem etwas lustigen Begriff geworden war, in Frage stellte, bäumte er sich wild auf.
Jofrid hatte Schwierigkeiten, Ordnung in ihre eigenen widersprüchlichen Gefühle zu bringen. Sie hatte alle seine Fehler gesehen, und diese hatten sie verletzt – aber sie liebte ihn immer noch, möglicherweise sogar noch heftiger und unbeherrschter nach all den Leiden, die sie einander zugefügt hatten. Es war ein verbreiterter Irrtum, daß Liebe etwas Schönes sein sollte: In Wahrheit machte sie den Menschen hilflos. Bei ihrer Rückkehr nach Schweden hatte sie geradezu gehofft, daß die Priester ihnen eine strenge Buße auferlegen würden, die in ihr Schmerz und Reue hervorzwingen könnten. Eine Pilgerreise zu Fuß nach Süden, unbezahlbare Bußgelder. Aber sie trafen nur auf Schulterzucken und Kühle. Wie hoch die Geldbuße war, hatte sie nie erfahren, Sten hatte die Sache in die Hand genommen, so etwas besprach er nicht mit seiner Frau.
Nur eines hatte man von ihnen verlangt: Sie sollten vor dem Bischof in Skara einen Kniefall machen. Aber nicht im Dom, nicht öffentlich. Sie begaben sich zur Bischofsburg Läckö und fasteten einen Tag lang, bevor sie zu dem hohen Herrn geführt wurden. Eine stumme, strenge Frau half ihr in einen Kittel und zog ihr Schuhe und Strümpfe aus. Schon bei den Vorbereitungen hatte sie gespürt, daß dies ein zutiefst unwürdiges Schauspiel war. Ein erzwungenes äußeres Zeichen für ihre Bußfertigkeit.
Trotz des beginnenden Frühjahrs draußen war der Steinsaal eiskalt. Die Feuchtigkeit und der Wind vom Vänern schlugen sich als Flecken an den Wänden nieder, die gemalten Friese wurden bereits schwach in den Farben. Geruch von modrigem Regenwasser und Fäulnis stieg wie aus offenen Gräbern hervor. Die Kälte biß in die Fußsohlen, als Jofrid die ersten Schritte auf den Lehmfliesen machte. In den Privaträumen des Bischofs waren die Fußböden beheizt, aber die großen, repräsentativen Räume waren unbeheizt.
Am äußeren Ende des Saales saßen zwei Bischöfe auf ihren hochlehnigen Stühlen. Sie wagte nicht, neugierig zu ihnen hinüberzublicken, das paßte schlecht zur vorgeschriebenen Ehrfurcht. Sie waren, trotz allem, reumütige Sünder, die wieder in Gnaden aufgenommen werden sollten. Aber als sie an der Seite ihres Mannes auf die Bischöfe zuging, erregte der eine ihre Aufmerksamkeit – als sie niederknieten, blickte sie kurz auf den nächstsitzenden – und stolperte fast in der engen Kleidung, deren rauher Stoff an Brust und Schultern auf der Haut kratzte.
Er hatte die Hände über dem Bauch gefaltet, die Ellbogen auf die Armlehnen gestützt, als beobachte er etwas zutiefst Belangloses. Niemand hatte seinen Namen erwähnt. Sie hatten erfahren, daß der Bischof aus Linköping auf Besuch war. Sie hätte ihn überall wiedererkannt, in jedweder Verkleidung. Obwohl seine Figur sich verändert hatte, seit er unangemeldet in ihr Leben getreten war – vor dreizehn Jahren.
Die mit einem leichten Flaum bedeckten hohen Wangenknochen waren unter Fett und Fleisch verschwunden. Trotz aller Armutsgebote lebte man gut in der Kirche. Und die Fettschicht hatte dem Gesicht die Strenge genommen, ihm einen weicheren Eindruck verliehen. Dieser Mann war weder ein Asket noch ein Fanatiker: Er war seiner vollkommen sicher, ohne Illusionen.
Die Welt verfährt merkwürdig mit ihren Kindern, dachte sie. Sie war erleichtert, daß sie mit gebeugtem Haupt niederknien konnte, so mußte sie ihn nicht ansehen. Das hatte die Welt also aus Herrn Örjan gemacht, dem Gemeindepriester aus Grytnäs. Der sich darüber beklagt hatte, daß er auf der Schattenseite des Lebens geboren war und daher nie zu seinem Recht kommen würde. Er war in Frankreich gewesen, hatte in Paris studiert, wie er einst gehofft hatte.
Mit diesem Mann hatte sie einen Sohn. Die Kälte fuhr ihr mit einem Schauer über den schmerzenden Rücken, ein hartes Ziehen, das die Enttäuschung in ihr hervorrief. In den Jahren, in denen sie ihre Kinder hatte missen müssen, waren sie ihr als ihre eigenen in Erinnerung gewesen. Ihr Mann war ja tot, und aus Herrn Örjan war Göran Gregori geworden, Bischof in Linköping, und der hatte seinen Sohn nie gesehen.
Er sagte kein Wort, bewegte sich kaum während der Zeremonie. Aber sie spürte seinen wissenden, vergnügten Blick wie einen Schatten, den die Schmach auf sie warf.
Unleugbar war der Mann, der ihren Freikauf verhindert hatte, tot. Und doch war es unendlich schwer, sich die Freiheit zu sichern.
– Das werden schwere Zeiten für deine Pachtbauern, sagte Stens Vater zu seinem Sohn, als sie zusammen das Grundbuch durchgingen, – wenn du auch in Zukunft das eintreiben mußt, was du für dich brauchst, müssen die Pachtabgaben kräftig erhöht werden, und das sind alte gewohnheitsrechtliche Vereinbarungen. Du wirst sehen, es ist leichter, ein milder Herr zu sein, wenn man reich ist, als wenn einem die Mittel fehlen!
Sten hatte mit den Achseln gezuckt und gelächelt, wie er es immer tat, wenn er auf neue Forderungen oder Beschränkungen stieß.
– Ich hab’ es nicht gern, wenn das, was ich angehäuft habe, in alle Winde verstreut wird, hatte sein Vater Algot eingewandt, – es ist nicht gut, wenn man das Leben und das Schicksal seiner Bauern in die Hände von Fremden legen muß. Nun gehensie alle als Bußzahlung an Ingemars Sohn über – die Uppschweden sind ein richtiges Pack, samt und sonders halbe Heiden, von denen muß man sich fernhalten, das habe ich mir vorgenommen, solange noch Leben in mir ist!
– Aber Ingemar war immerhin gut genug, deine Tochter und meine Schwester zur Frau zu bekommen, warf Sten vorsichtig ein, ohne eine Antwort zu erwarten. Er erhielt auch keine.
Algot hatte den Ring nicht gemocht, den Sten für Jofrid von einem gotländischen Goldschmied hatte anfertigen lassen. Zwei kleine Menschengestalten, geformt aus gewundenem Gold, einander küssend und unter dem Baum des Lebens stehend. Die Inschrift auf der Außenseite lautete: je te desir. Algot hoffte, daß keiner, der den Ring sah, Französisch verstand. Sie hatten sich den Frieden zurückgekauft, aber es gab wohl keinen Grund, mit seinen Sünden zu prahlen!
Und dann hatten sie geheiratet. Bei ihrer ersten Hochzeit waren alle Gäste heiter und froh gewesen, sie selbst aber enttäuscht: Es war ein Fest mit allerlei Lärm und Getöse. Beim zweiten Mal war es genau umgekehrt. Auf dem langen Ritt von der Messe in die Kirche zum Fest auf Mjövik hatte Jofrid die anderen beobachtet – entweder waren sie völlig gleichgültig, oder ihnen war beklommen zumute angesichts ihrer eigenen Anwesenheit und angesichts der schamlosen Prachtentfaltung, die Sten an den Tag legte. Die Gäste empfanden die Hochzeit wohl als eine Art Formalität, die mit so wenig Aufhebens wie möglich überstanden werden mußte.
Am Morgen darauf erwachte Jofrid mit dem bitteren Gefühl, hinters Licht geführt worden zu sein. Bußgang, Reue, Ringe und Abmachungen und Schwüre – das hatte doch das Verhältnis zwischen ihnen verändern sollen. Die äußeren Zeichen, die Anerkennung der Menschen – die Vorteile erkannte sie durchaus. Aber sie fühlte sich durch die Heirat nicht in einer verbesserten Lage, wie sie es nach dem Gesetz eigentlich hätte empfinden sollen.
Sten verschwendete daran bestimmt keinen Gedanken. Er hatte die großartige Hochzeit bekommen, die er sich gewünscht hatte, das Fest und die Brautmesse und den Segen des Priesters für Ring und Brautbett, Ehrenrettung und Wiedergeburt.
Ihrer Mutter hatte er den Kopf verdreht – von dem Moment an, als sie auf den Hof kam. Er hatte die kleinwüchsige Frau vom Pferd gehoben, sie auf Hand, Mund und Wangen geküßt, bevor er sie hineingeleitete. Wenn sie es nicht besser gewußt hätte, wäre Jofrid eifersüchtig geworden: Aber so behandelte er eben Frauen. Für ihn war Gerda nicht nur eine Schwiegermutter, die er erst jetzt kennenlernte, sondern die Kebse des Königs, noch dazu die Kebse von Birger Magnusson, eine Frau, die sein Freund geliebt hatte. Hätte König Birger sie bei sich behalten, hätte Sten ihr auf dieselbe Art geholfen, zurückhaltend, mit Respekt, voller Verständnis und liebevoll.
Abends saßen sie stundenlang am Feuer und tauschten Erinnerungen an Birger Magnusson aus – Gerda hatte mit kaum einem Menschen über dieses Thema reden können, seit sie geheiratet hatte. Jofrid hatte ihre Mutter nur einmal diesen Mann erwähnen hören, vor vielen Jahre, später nie mehr, weder freiwillig noch durch Zufall. Zum ersten Mal machte sie sich eine Art Bild von ihrem Vater; nicht die Umrisse eines Gesichts, sondern das vage Bild von einem Mann mit großen Fehlern und Schwächen und vereinzelten guten Seiten.
Ihr war auch nie der Gedanke gekommen, daß ihre Mutter sich an Birger Magnusson gebunden fühlte; daß sie etwas für diesen Mann empfunden haben könnte, der unter Liebe etwas anderes verstand, als man sich gemeinhin darunter vorstellte. Daß in dieser fernen, schwer faßbaren Figur ihr Ursprung lag, daß er Fleisch, Blut und Wesen mit ihr teilte, daß sie durch ihn teilhatte an einer Welt, die ihr gleichzeitig ehrfurchtgebietend und unverständlich vorkam.
Und jetzt brach Jofrid zum Kloster von Vreta auf, um ihre Kinder zu holen. Ihre beiden Söhne waren von Stockholm, wo ihre Schwiegermutter mehrere Jahre lang gewohnt hatte, nach Vreta geschickt worden. Damals war vereinbart worden, daß der Mutter der Kinder auch erneut das Sorgerecht zugesprochen werden sollte, sobald sie und Sten wieder in den Besitz ihrer Rechte kämen, sich in Schweden niederließen und eine Ehe eingingen.
Es hatte lange gedauert, die Formalitäten zu erledigen und die Großmutter der Kinder zu überreden, die ihre Rechte nicht freiwillig aufgeben wollte. Die Äbtissin in Vreta hatte einen Streit mit dem Klarissenkloster in Stockholm auf sich nehmen müssen, um so weit zu kommen.
Es war nicht viel übrig von dem hübschen, blutjungen Mädchen, das Algot einst beherbergt hatte, als sie und Folke auf der Flucht waren, und auf das Algot seine Schwiegertochter vorbereitet hatte. Ingrid Svantepolksdotter war kräftig geworden, ja dickleibig. Man sah ihr an, daß das Leben ihr gegenüber großzügiger verfahren war als gegenüber den meisten anderen Menschen, sie hatte sich für jedes Lebensalter ein neues Schicksal wählen können. Als Kind hatte sie sich gewünscht, Nonne zu werden, dann hatte sie sich verliebt und war von ihrem Geliebten entführt worden, hatte mit ihm Kinder gezeugt und ihn verloren. Ihr bewegtes Leben wurde Gegenstand von Gedichten und Tanzweisen. Als Witwe war sie ins Kloster nach Vreta zurückgekehrt, und jetzt leitete sie das reichste Nonnenkloster des Landes.
Vreta hätte durch Armut beeindrucken müssen, wie alle Zisterzienserklöster. Aber als Jofrid kam, trug Ingrid ein schwarzes Seidengewand an Stelle der unförmigen Ordenstracht – das schwere Goldkreuz mit Rubinen und Smaragden entsprach gewiß auch nicht den Ordensregeln des Bernard von Clairvaux. Darüber hinaus hatte Ingrid sich eine eigene Wohnung eingerichtet, ein kleines hübsch ausgestattetes Haus am Rande der Klausur. Grüne gemalte Ranken wanden sich um die Fenster, die richtige Glasscheiben hatten, keine Scheiben aus Horn oder Tierhaut wie in den meisten weltlichen Wohnungen. Ingrid lebte gut, das Besteck war aus Silber und Emaille, die Schüsseln aus Limoges, das Bett voller Flecken, und auf einem kleinen Regal stand eine Reihe Bücher, eine unfaßbare Verschwendung.
Ingrid witzelte darüber, daß die Türöffnung so schmal war: die stamme noch aus der Zeit, bevor sie sich ausgeweitet habe. Ingrid war wirklich die dickste Frau, die Jofrid je gesehen hatte, und dennoch wirkte sie leichtfüßig und beweglich. Das Gesicht war konturlos, weiß und rot wie Milch und Rosenblüten, und die moorwasserfarbenen Augen glänzten und blitzten in tiefen Höhlen.
Jofrid hatte immer Mitleid mit den Frauen empfunden, die von ihren Familien in ein Kloster gesteckt wurden. Die ewig sich wiederholenden Gebete waren für das Heil der sündigen, selbstsüchtigen Menschheit notwendig, und diese wenigen Nonnen nahmen es auf sich, die Verbindung mit dem Himmel zu pflegen. Aber Jofrid selbst hatte sich in keiner Weise vom Klosterleben angezogen gefühlt, und sie begriff nicht, was ihre Mutter meinte, als diese eines Tages erzählte, daß sie als junges Mädchen daran gedacht habe, Nonne zu werden. Auf Lebenszeit eingemauert, Messen in eiskalten Kirchen absingend, niemals mehr als vier Stunden hintereinander schlafen – dann schon lieber zurück auf den Pachthof nach Norwegen!
Aber als Frau Ingrid sie herumführte, entfaltete sich vor Jofrids Augen diese besondere Frauenwelt; die friedliche Illusion einer Welt, die frei von Krieg, Hurerei, Verlockungen und Gewalt war.
Alles war wirklich von Frauenhänden und nach den Wünschen von Frauen geformt. Und besonders auf Frau Ingrid ausgerichtet. Die Äbtissin sah in Schmutz und schlechtem Körpergeruch kein Zeichen von Heiligkeit. Als neuernannte Leiterin des Klosters war ihre erste Entscheidung gewesen, den Schwestern aufzuerlegen, sich selbst und ihre Ordenstrachten sauberzuhalten, jeden Samstag zu baden, die Zähne mit ausgefaserten Wurzeln zu reinigen und das kurze Haar regelmäßig zu waschen und zu schneiden. Die Schwestern wuschen auch ihre Tischtücher und ihr Bettzeug selbst, denn nach Ingrids Auffassung tat ihnen körperliche Arbeit gut.
Ingrid war stolz darauf, daß sie in ihrer Amtszeit den Einflußbereich der Äbtissin in Vreta ausgebaut hatte. Eigentlich hätte sie sich in allen Angelegenheiten mit Männern beraten müssen; aber mit der Zeit hatte sie die Priester aus der Leitung gedrängt. Nur was die Messe und die Beichte anging, hatte sie sich beugen müssen: Keine Frau konnte zur Priesterin geweiht werden, und keine Frau durfte dem Wunder des Abendmahls vorstehen.
– Aber meinst du nicht, ich würde einen guten Bischof abgeben? fragte Ingrid, scheinbar im Ernst, – und mußte doch vor Lachen glucksen, – der alte Karl aus Linköping hielt nicht viel von mir als Äbtissin für die jungen Lämmer, solch eine alte, unverbesserliche Sünderin! Aber eine bekehrte Hure, Magdalena, war schließlich gut genug, den Wiederauferstandenen zu finden, dann konnte man wohl auch mir erlauben, den Gören in Vreta vorzustehen. Ich weiß wenigstens, wovor ich sie beschützen muß! Der neue Bischof, der niedliche Milchbart, er hat nichts gegen mich, er versuchte, die Zügel anzuziehen, und ich habe mich ihm widersetzt. Jetzt weiß er, woran er ist. So ein hübscher junger Mann! Leider kommt er nie auf die Idee, mir den Rock hochzuheben, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben!
Jofrid wußte nicht, was sie von Ingrid halten sollte – die Äbtissin war im selben Alter wie ihre Mutter. Ungestüm und doch sanft wie eine Spatzenmutter mit ihren Jungen. Ingrid nahm Jofrid mit in den Gemüsegarten, um ihr eines der Kinder zu zeigen, die Vreta zum Großziehen bekommen hatte, und von dem sie nicht wußte, was man mit ihm anfangen sollte.
Es war Gunnars kleine Schwester Märta, deren Geburt ihre Mutter das Leben gekostet hatte.
Das Mädchen konnte höchstens fünf Jahre alt sein, wirkte aber viel älter – ein verschlossenes, stilles Kind, das weder Ball spielte noch herumtollte, das hingegen artig mit kleinen Schritten auf dem geharkten Gartenweg daherkam, die Hände gefaltet, und sich vor der fremden Dame verneigte. Märta hatte Ähnlichkeit mit ihrem Bruder: die gleiche breite, gewölbte Stirn und die zusammengewachsenen Augenbrauen; aber sie war blond, nicht schwarzhaarig, und die Schwestern in Vreta hatten sie besser gefüttert als Ulf und Margareta es bei Gunnar getan hatten, deshalb war Märta rundlich, weiß und rot.
– Sie wird einmal hübsch, sagte Ingrid und strich dem Kind über das Haar, – wir begnügen uns gern damit, Gott die O-beinigen und Tauben zu geben, aber auch die hübschen, jungen Mädchen können Gott dienen, vielleicht sogar mit größerer Freude als die mißgestalteten!
Jofrid erstarrte: Sie hatte sich gefragt, was Ingrid bewogen haben könnte, das Treffen mit ihren eigenen Kindern aufzuschieben und ihr statt dessen das kleine Mädchen zu zeigen. Märta hatte wenige nahe Verwandte, und wenn Ingrid ein besiegeltes Dokument vorzeigen konnte, aus dem der Wunsch hervorging, daß das Mädchen Nonne in Vreta werden sollte, würden die anderen, die die Verantwortung für ihr weiteres Schicksal hatten, vermutlich mit den Schultern zucken und es gut sein lassen.
Auf dem Weg zurück zu Ingrids Haus wandte sie sich um und sah zu ihrer Überraschung, daß Märta einen entlaubten Stock in die Vogelkäfige steckte und nach den Tauben stach, die in den Weidenkäfigen herumflatterten, schreiend vor Angst.
Man wurde gut bewirtet in Vreta: süßer, klarer Wein aus Poitou, Lachs im Brotteig, Forellenpastete und seltene Früchte warteten auf sie, als habe sie während des Trubels der Erntearbeit nur den Hof verlassen, um verschwenderisch zu essen. Sie konnte sehen, daß es Ingrid ärgerte, daß sie so wenig aß. Ihr Magen zog sich zusammen und sandte einen dünnen, bitteren Beigeschmack von Lachs und Wein in Rachen und Mund hinauf. Nun hatte sie jahrelang diesem Augenblick entgegengefiebert, wechselweise voller Hoffnung und Mißtrauen. Sie hatte an ihre Kinder gedacht, bis sie sich völlig in der Sehnsucht verfangen hatte, und dennoch war es so einfach: zwei Kinder, die gewachsen waren. Drei, vier, fünf Jahre bedeuteten später im Leben nicht viel. Aber drei Jahre veränderten ein Kind und veränderten dessen Sicht von der Welt. Jetzt, wo sie ihnen endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, traf es sie wie ein unersetzlicher Verlust: vier Jahre des Lebens ihrer Kinder hatte sie verloren.
Lucia, die Ingrid den Haushalt führte, brachte Bengt herein. Ihn hatten sie wie einen erwachsenen Mann gekleidet, in knöchellangem Gewand, mit engen Strümpfen, kleinen Schnabelschuhen an den Füßen, einem breiten Ledergürtel um die Taille, so daß man sehen konnte, wie schlank er war. Das Haar wuchs hinten lang herunter, war aber über den scharfen Augenbrauen und an den Ohren gerade abgeschnitten, so daß das Gesicht gedrängt und schmal wirkte. Das dichte, eichhörnchenrote Haar erinnerte an seinen Vater, und er schien Görans breiten Mund und seine wachen Augen zu bekommen. In ein paar Jahren würde man unter den runden, flaumigen Wangen schon den erwachsenen Mann erahnen können.
Jofrid ging in die Hocke, teils, weil ein Schwindelgefühl sie erfaßte, teils, weil sie mit dem Jungen auf Augenhöhe sein wollte. Aber das änderte weder etwas an ihrem Unbehagen, noch trug es zur Annäherung zwischen ihnen bei. Er blieb gerade so weit von ihr entfernt stehen, daß es unmöglich war, die Hand nach ihm auszustrecken und ihn zu berühren – und er betrachtete sie mit äußerster Feindseligkeit.
Lucia knuffte Bengt in den Rücken, um ihn dazu zu bringen, ein Mindestmaß an Höflichkeit zu zeigen und zu seiner Mutter hinzugehen. Nach einer langen, peinlichen Pause tat er, was Lucia wollte: aus freiem Willen, nicht auf Befehl eines Erwachsenen.
Sie hatte geglaubt, daß sie ihn jetzt umarmen würde, den schmächtigen, unbeholfenen Körper; aber er fegte ihre Hände fort, rot vor Scham, angewidert. Räusperte sich und blickte offen und verloren zu Lucia hinüber, bevor er mit spitzer, eintöniger Stimme einen auswendig gelernten Spruch hersagte.
Seine Großmutter Cecilia, die jetzt eine der heiligen Schwestern in Stockholm war, hoffte zutiefst, daß sie endlich die Verpflichtungen einer Mutter gegenüber ihren Kindern erfüllen würde und daß sie ihre schweren Sünden und ihre Herzlosigkeit bereute.
Als er fertig war, ließ er sich auf beide Wangen küssen, biß sich aber auf die Lippen, um nicht zu weinen; stand noch lange da und atmete heftig vor Gereiztheit.
Bengt konnte sich wenigstens an sie erinnern. Arvid war nur ein paar Monate alt gewesen, als sie getrennt wurden, und der Junge hatte keine Ahnung, wer Jofrid war, wollte sich nicht von ihr anfassen lassen. Lucia warnte sie lachend: Arvid sei ein kleines Wildtier, das schlug, schrie, biß und trat. Sie hatte recht. Arvid heulte, so daß ihm die Tränen in dem kleinen, vergrämten Gesicht nur so aus den Augen rannen – und er schlug seine ihm fremde Mutter, sabberte und winselte und machte sich steif.
Abends, bei Einbruch der Dunkelheit, ging Jofrid, die keine Ruhe finden konnte, hinüber in die Kirche, um die Schwestern die Vigilie singen zu hören. Jofrid konnte kaum sehen, wohin sie ihre Füße setzte, ging aber dennoch schnell die schmalen, hohen, unebenen Stufen hinunter. Sie krümmte die Zehen um die Außenkante jeder Fliese – in den dünnen, weichen Lederschuhen spürte sie jede noch so unbedeutende Unebenheit mit der Fußsohle.
Der Chorgesang hatte begonnen, und sie war der einzige Zuhörer in der Laienbrüderkirche – als seien diese beiden Welten ernsthaft und auf ewig getrennt. Die kühle Verschlossenheit, Schutz und Flucht auf der einen Seite, unzugänglich für sie.
Lange, wogende Klangwellen füllten den Raum, ließen die Luft um sie herum schwingen und schallen, und es war, als ob ihr Körper darauf antwortete. Die klaren Frauenstimmen klangen, als stammten sie aus jungfräulichen, unwissenden Seelen.
Als sie gehen wollte, fiel ihr Blick auf eines der neuen Bilder über dem Marienaltar: das Herz von langen Schwertern durchbohrt, ein jedes symbolisierte eine Sorge, die Maria von ihrem Sohn zugefügt worden war. Noch vor kurzem wäre ihr das gekünstelt vorgekommen. Aber heute abend verstand sie die Bedeutung, und sie setzte sich auf die Treppe und weinte wie eine alte Frau.
Ein einziges Mal hatte sie mit ihrer Schwiegermutter über ihre neue Ehe gesprochen. Ingeborg hatte vierzig Jahre auf Algot gewartet. Aber Ingeborg war unglaublich beherrscht und gleichmütig, niemals verbittert. Und dann hatte sie die ältere Frau gefragt, ob sie niemals in all den Jahren, in denen sie mit Måns verheiratet gewesen war, ihr Schicksal verflucht hätte.
Nur einmal, hatte Ingeborg geantwortet; und sofort hatte sie die Frage bereut, denn eine Art Verwundbarkeit arbeitete sich durch das farblose, ausgezehrte Gesicht. Durchlebter, aber noch immer lebendiger Schmerz.
Und Ingeborg hatte erzählt: Sie war mit Måns zum Weihnachtsempfang auf einer der königlichen Residenzen gewesen. Es hatte lange und kräftig geschneit, die Nacht war frostklar und still wie der Tod. Sie war nicht zur Mitternachtsmesse in die Kapelle gegangen, stand windgeschützt bei einer der Steintreppen und genoß die Einsamkeit und die Kälte. Vier junge Männer kamen mit Fackeln in den Händen angeritten, unförmig in ihren Pelzen, sie lachten und riefen einander mit hellen Stimmen zu. Dann ritten sie in dem kleinen Innenhof umher, die Tiere schnaubten und dampften, Schaum stand um sie, und die Reiter warfen einander die brennenden Fackeln zu. Nicht ein einziges Mal fiel ihnen eine davon in den Schnee.
Einer von ihnen ritt dicht an ihr vorbei, mit zwei Fackeln in der rechten Hand, er schrie auf das Pferd ein, um es anzufeuern – sie hatte ihn von der Seite gesehen und für einen Augenblick geglaubt, die Zeit stehe still, oder der Böse habe ihr ein Trugbild gesandt, denn dieser Mann hatte ausgesehen wie ihr Algot, aber Algot war ja ein alter Mann. Erst als sie zu ihrem Bett gewankt war und lange auf vor Gicht schmerzenden Knien gebetet hatte, war ihr der Gedanke gekommen, daß es sein Sohn sein mußte.
Gunnar ging zu seinem Vater, um sich Klarheit über die Herzensangelegenheit zu verschaffen, auf die er sich eingelassen hatte. Keiner der Betroffenen war volljährig – Erik Månsson sechzehn, Gunhild vierzehn, Gunnar selbst knapp fünfzehn. Aber soweit er verstehen konnte, war sein Vater über seine Wahl entzückt. Gunilla war eine weitaus bessere Partie, als er durch Verhandlungen hätte erreichen können. Sten kannte ihren Vater, wenn auch nicht gerade von der besten Seite: Torsten Ödesson war ein versoffener Bauernschinder. Und der alte Algot holte das Västgöta-Gesetz hervor und erklärte bereitwillig die Regeln für die Auflösung einer Verlobung, die für sie gegolten hätten, wenn sie in diesem Landesteil gewohnt hätten.
Wünschte eine junge Frau sich nicht an das Wort zu halten, das andere für sie gegeben hatten, dann konnte sie sich an den Bischof des Stiftes wenden und darum bitten, daß die Abmachung durch seine Vermittlung aufgehoben wurde. Aber in diesem Fall müßten sie den Erzbischof in Uppsala aufsuchen, und der hatte, milde ausgedrückt, kein besonders gutes Verhältnis zu Stens Familie, schon gar nicht nach der Mordgeschichte und dem Verbannungsurteil. Der Bischof in Strängnäs befand sich mit Gunillas Vater in einem Güterstreit, er war also ebenfalls nicht zu gebrauchen.
Aber es zeigte sich eine Art Ausweg. Gunnars Pflegemutter kannte den neuen Bischof in Linköping – zwar hatte der Östgöta-Bischof kein formales Recht, in die Sache einzugreifen, aber er konnte einen Rat geben.
So kam es, daß sich alle Beteiligten in der großen bischöflichen Residenz in Linköping trafen: Es war das gepflegteste Haus, das Gunnar je gesehen hatte. Man war gerade dabei, die Fenster zu putzen und die weißen Fugen zwischen den roten Steinen freizukratzen, die Herbstsonne schien funkelnd, es war der schönste Tag seit Menschengedenken.
Er hatte Gunilla als klein, schwach und zart in Erinnerung, ein Schmetterling mit dünnen Flügeln; aber diesmal hinterließ sie einen anderen Eindruck auf ihn: So klein wie sie war, strahlte sie Stärke aus. Schon ihr zähes Schweigen flößte ihm Mut ein. Er hatte noch nie eine derartige verschlossene, innere Ruhe erlebt.
Sie trug dasselbe milchfarbene Seidenkleid wie zum Fest auf Kalmarhus. Als sie ihm entgegeneilte, mit so schnellen Schritten, daß sich der graue Mantel vorn teilte und sein Blick auf den hellen Stoff fiel, da hatte er gedacht, daß sie bestimmt gerade dieses Kleid angezogen hatte, um ihn an ihr einziges Treffen zu erinnern. Es stand ihr, aber es war viel zu klein, war zu kurz über den Knöcheln und spannte sich an den Hüften, und sie hatte den Saum niedergetreten und versucht, ihn mit langen, ungeschickten Stichen zu heften. In der einen Achselhöhle war der Stoff fast zerschlissen, und sie hatte versucht, die Seide mit einem andersfarbigen Faden zusammenzusticheln.
Die milchige Farbe ließ Gunhild in dem gnadenlosen Tageslicht noch farbloser und daher um so lieblicher wirken: Er hatte sich nicht geirrt, als er sich in dieses Mädchen verliebt hatte.
Die Geschäftigkeit in der großen Bischofsresidenz war fast zuviel gewesen. All die lärmenden, gehetzten Menschen, die in alle Richtungen strömten. Er wagte nicht zu glauben, daß die, die sich normalerweise damit beschäftigten, das Land zu regieren, sich seiner Bitte um Hilfe angemessen widmen würden.
Wenn er lauschte, konnte er das Domkapitel singen hören: es mußte die None sein. Der Ton der kräftigen, dunklen Männerstimmen hatte ihn schon ergriffen, als sie sich der bischöflichen Residenz näherten – er klang in ihm nach, als berühre man zufällig die Saiten einer Laute. Sein Gemüt war voller Zärtlichkeit, alles in ihm war hell, weit und von Dankbarkeit geprägt.
Sie warteten in der gewölbten Vorhalle, gegenüber von einigen langen gemalten Friesen, die die Flucht nach Ägypten darstellten und den erbärmlichen, aber frommen Tod des heiligen Erik. Die Steine des geklinkerten Fußbodens waren in Mustern verlegt und glasiert und glänzten ihm entgegen, buschige Löwen und stolze Adler, grün und golden. Die Sporen klirrten bei jedem Schritt auf dem edlen Boden. Gunnar hatte Angst, die Fliesen zu zerkratzen oder sonstwie durch Gedankenlosigkeit diesem Ort einen nicht wiedergutzumachenden Schaden zuzufügen. Die Schwertspitze schleifte leicht über den Boden, weil die Waffe für einen Mann von der Größe seines Vaters geschmiedet war: Er mußte sie ein wenig anheben. Inzwischen schwitzte er so stark, daß die feine Kleidung unter den Armen und über der Brust durchnäßt war. Das kleine Silberkreuz, das der Vater ihm gegeben hatte, mußte sich in den Brusthaaren verfangen haben, es zwickte in der feuchten Haut.
Drüben, am Schreibpult am Fenster, das einen Spaltbreit geöffnet war, kramte einer der Schreiber in einem Haufen abgegriffener Schriftstücke, öffnete einen Brief nach dem anderen und las sie mit spitzer, hängender Oberlippe. Sein nackter, glattgeschorener Scheitel glänzte, und ab und zu ließ er eine dürre Hand über die Tonsur gleiten.
Die doppelte Eichentür wurde geöffnet, und Gunnar und Gunhild wurden in den Steinsaal gerufen: Der Bischof war von seinen Pflichten in der Kirche zurückgekehrt und wollte sich nun den Bittstellern und Audienzsuchenden widmen.
Die Luft im Saal war kühl und etwas feucht, es roch nach Kalk, wie in einer frisch geweihten Kirche. Gunnar ertappte sich dabei, wie er neugierig an den Wänden nach den Weihekreuzen suchte.
An der entgegengesetzten Seite des Saales befand sich ein offener Kamin. Doch man hatte kein Feuer entzündet. Verblichene Wandteppiche bedeckten die Wände, genau wie zu Hause auf Kalmarhus.
Vier kleine, rundbogige Fenster befanden sich unregelmäßig verteilt an der Längswand mit geschlossenen Läden, so daß nur das obere Drittel Licht hereinließ. Aber die Scheiben waren aus richtigem Glas, so daß die Sonne silberhell auf den Bischof schien, schräg und stark, wie auf den Allmächtigen persönlich.
Vor seinem Stuhl lag ein gewaltiger Teppich, rot, schwarz und golden. Gunnar hatte noch nie zuvor einen Teppich auf dem Fußboden gesehen. Und dies war zudem ein heidnischer Teppich, solch einen hatte der Kanzler, das hatte er selbst gesehen, an seine Wände gehängt, dort, wo Teppiche nach Gottes Gebot hingehörten. Eine entsetzliche Verschwendungssucht – mit schmutzigen Schuhen auf einen Teppich zu treten!
Die Leute, die hier saubermachten, hatten rechts vom Eingang Wischlappen und Eimer vergessen – das sah auf dem prachtvollen Fußboden merkwürdig irdisch und nüchtern aus.
Die beiden jungen Menschen gingen Hand in Hand quer über den glatten Boden: Gunnar klammerte sich mit einer Hand an den Schwertgriff, um nicht zu stolpern. Ausgerechnet jetzt spürte er mächtigen Harndrang. Er strengte sich an, den Gedanken daran zu verdrängen. Gunhild drückte leicht seine Hand, dann knieten sie vor dem Stuhl nieder. Vor Angst, sich zu blamieren, waren seine Knie so steif, daß er sich mit gestreckten Fingern am Boden abstützen mußte.
Der Bischof hatte seine beiden großen Füße in den Blutsee des persischen Teppichs gepflanzt. Er trug weiße, dünne Handschuhe; der Handschuh an der linken Hand war kreuzförmig aufgeschlitzt, dort funkelte ein großer Ring mit blauem Stein. Als der Bischof die Hand umdrehte, sah Gunnar, daß die Handschuhe bestickt waren, die roten Rauten auf dem Handrücken sollten die Wundmale Christi darstellen.
Das ist Macht, dachte Gunnar – Macht über Leben und Tod in einem gewöhnlichen, sterblichen Menschen konzentriert. Er war immer noch dabei, die Handschuhe und deren Symbolkraft zu bewundern, als der Bischof ihm seine Hand entgegenstreckte: Er küßte den blauen Stein und sah, daß Gunhild es ihm gleich tat, wenn auch mit größerer Anmut.
Die kniende Stellung minderte den Druck der Blase ein wenig. Aber bald mußte er sich erheben – das Bein, auf das er sich stützte, war fast gefühllos. In Knie und Wade spürte er ein Ziehen. So würde es bestimmt enden, in Schande und Lächerlichkeit.
Der Schreiber, der Gunnars Stiefeltern geholfen hatte, ihre Besitzverhältnisse zu ordnen, hatte es übernommen, den Bischof mit seiner Sache vertraut zu machen. Gunnar war ihm für seinen Einsatz zutiefst dankbar, mochte es jedoch nicht, daß der Blick des Bischofs auf ihm ruhte. Im Dom, hinter dem Laiengitter, das den Chor abtrennte, war der Bischof seines Menschseins enthoben. In der steifen Kleidung, die die Linien des Körpers verhüllte, blitzend von Juwelen und Perlen, einer anderen und besseren Welt angehörend, zu Gottes Ehren singend oder den Kelch über sich erhebend, wenn Wein in Blut verwandelt wurde.
Hier aber wirkte der Bischof furchterregender. Er war keiner der ruhigen, gelehrten und hochbetagten Männer, wie man sie sonst in diesem Amt fand. Gut genährt, mit einem dicken Kranz kastanienbrauner Haare um die glänzende, perfekt geschnittene Tonsur, die die Linien eines hübschen Schädels sichtbar machte. Die Augen hellwach und durchdringend, aber munter. Er trug keine abgetragene, bescheidene Mönchskutte wie der Kanzler, sondern gute, neue Kleidung, wie Gunnar sie von seinem Stiefvater kannte. Seine Stimme war ein wenig zu laut, aber wohlklingend und selbstbewußt.
Die Beratung seiner Angelegenheit überstieg Gunnars Auffassungsvermögen. Aber er verstand doch immerhin, daß der Bischof meinte, daß nur eines die Ehe mit Gunilla verhindern könnte: Wenn Erik und sie zusammengelebt hätten, bevor es ihr klargeworden sei, daß sie das Wort, das ihr Vater in ihrem Namen gegeben hatte, nicht halten wolle.
– Aber so schlimm ist es hoffentlich nicht? fragte der Bischof mit einem breiten, schiefen Lächeln, als amüsiere er sich innerlich über die beiden Kinder, die ihn um Rat fragten. Gunilla antwortete schnell und kurzatmig, so schlimm sei es wahrhaftig nicht, kein Mann habe sie berührt.
– Zwischen Erik und mir ist nie etwas Unziemliches geschehen, fuhr sie nach einer kleinen Pause spitz fort: als halte sie es für nötig, gegenüber dem Bischof, der vielleicht nicht mit den gewöhnlichen Ausdrücken vertraut war, ihre Aussage zu erläutern – und auch zwischen Gunnar und mir ist nichts Unziemliches geschehen!
Der Bischof schlug mit gewaltigen Händen auf die Armlehnen und lachte, laut und häßlich. Gunnar hielt auch nicht sonderlich viel von dem wissenden Blick, mit dem Göran Gregori jetzt Gunilla bedachte. Es machte den Eindruck, als sei der Bischof fast zu sehr an Frauen interessiert.
– Selbst wenn etwas Unziemliches zwischen dir und deinem Freund geschehen wäre, murmelte der Bischof, wischte die Worte mit der Hand beiseite und lächelte, – hätte ich beinahe gesagt. Aber ich will mich nicht wiederholen! Das ist der einzige Weg, das Band zwischen euch so fest zu knüpfen, daß es keiner zerreißen kann.
So ist das! dachte Gunnar. Als habe der Bischof ihm quer durch den Raum einen Ball zugeworfen und erwartete, daß er ihn ergreife, solch einen Rat konnte er nicht unverschleiert geben. Aber er traute seinen eigenen Augen nicht, als er zum Bischof hinüberschielte: denn der Mann zwinkerte ihm zu, als wolle er ihn auf eine schwer zu verstehende Pointe aufmerksam machen. Gunnar errötete vor lauter Verwirrung – er hatte nicht geglaubt, daß es so leicht sein würde. Diese seltsame Welt der Erwachsenen, der er kraft seines Alters nun auch angehörte, die sich ihm bislang aber kaum öffnen wollte. Jetzt war er bald ein verheirateter, seßhafter Mann mit Ehefrau und Verpflichtungen – aber ein Teil von ihm wäre am liebsten Kind geblieben, ohne drückende Verantwortung. Andere Männer, sein Vater und der Bischof, konnten leicht mit großen Worten und einfachen Lösungen um sich werfen. Aber für ihn war das alles neu und furchteinflößend.
Er erhielt keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, wagte nicht ihr eine Nachricht zukommen zu lassen. Wußte nicht, ob sie lesen konnte, und dem Priester würde sie niemals einen Brief von ihm zeigen können. Das einzige von Bedeutung, was er von ihr erfuhr, war, daß sie mit ihrem Vater bei den Schwarzen Brüdern wohne und dort allein im Dachgeschoß des weißen Hauses schlafe. Und sie sah ihn sehr bestimmt an, als sie ihm das mitteilte, und er nickte und drückte ihre Hand. Niemand würde ihr den Vorwurf machen können, irgend etwas abgesprochen zu haben.
Er hatte nicht viel Zeit, sein Vorgehen zu überlegen. Es war seine eigene Entscheidung, niemand sollte für seinen Gesetzesbruch zur Verantwortung gezogen werden können. Das Abholen selbst klappte überraschend reibungslos: Der Pflegevater gab ihm gute Pferde zum Wechseln und Begleiter, auf die er sich verlassen konnte. Gunhild saß vollständig angezogen bereit und wartete. Sie ritten ohne Pause den Abend und die Nacht hindurch, und die Fackeln brannten herunter. Nach vielen Stunden des Vorantastens im Halbdunkeln, wo sie nur dem Lauf des Hohlweges zu folgen wagten, wurde es langsam um sie herum Tag. Gunnar hatte noch nie zuvor so den Anbruch eines Tages erlebt: Im Walde dämmerte es, der Morgennebel legte sich um die Beine der Pferde, die Sonne ging auf und ließ die Wipfel der Bäume in einem schmalen Streifen goldenen Feuers leuchten.
Sie legten sich für ein paar Stunden in das frische Heu einer Kirchenscheune, bevor sie weiterritten. Er hätte alles auf der Welt gegeben, um acht Stunden durchgehend mit ihr in einem richtigen Bett zu schlafen; aber sie wagten nicht, länger an einem Ort zu verweilen, falls sie verfolgt wurden und sie war zu müde, um ihm zu widersprechen.
Oben auf dem Pferd, hinter ihm sitzend, schob sie beide Hände unter seinen Gürtel und wärmte seinen Rücken. Die Müdigkeit staute sich in ihm wie dicht zusammengepreßte Wolle; sie legte sich nicht einmal, als er sich umdrehte und sie zu küssen versuchte.
Etwas später sah er, daß sie eingeschlafen war, die Wange gegen seine Schulter gelehnt: sie hing schlaff auf dem Pferd, mit baumelnden Füßen. Sie hatte einen Schuh verloren, aber ihre Hände umklammerten noch immer seinen Gürtel.
Es wurde schon Abend, als sie Lindö erreichten. Nur dank der Hilfe seiner Begleiter, die der Vater ihm zugeteilt hatte, konnte Gunnar überhaupt den Weg zum Hof finden. Er hatte kaum noch Erinnerungen an Lindö; denn als er den Hof verlassen hatte, im Alter von zehn Jahren, hatte er für ihn die Welt bedeutet; aber seitdem war er von Ort zu Ort verschlagen worden. Jetzt stellte er fest, daß Lindö ihm gefiel. Quer durch den schmerzenden, entkräfteten Körper zog ein kleines, murrendes Anerkennen – und Wiedererkennen. Der Himmel über ihnen war unfaßbar hoch und fahl. Das Wasser des Schärenmeeres glänzte unter der tiefstehenden Sonne wie Bronze. Der Hof erstreckte sich in braunen und grauen Streifen quer über die grüne Insel. Überall wuchsen Lindenbäume – um den Hof herum war keine Einzäunung, denn es war der einzige auf dieser Insel.
Er versuchte, die Müdigkeit zu unterdrücken, um den Anblick zu genießen. Dies hier bedeutete nichts Geringeres als den Schlußstrich unter all seinen Zukunftssorgen. Er war endlich heimgekehrt.
Gunhilds kleines, spitzes Kinn kitzelte seine Schulter: er wandte den Kopf und traf ihren verschwommenen Blick. Die Augen waren rot, müde und geschwollen; aber sie sah zumindest dasselbe wie er, gähnte und seufzte und setzte sich bequemer zurecht.
Als das Pferd von selbst stehenblieb, glitt er hinunter und stöhnte vor Schmerzen im Rücken. Streckte die Arme hoch und half ihr hinab und schwang sie herum, voller Freude, daß sie so klein und leicht war.
Sie jammerte, lachte und versuchte, die Hände vor das Gesicht zu halten, weil ihr schwindelig war, schüttelte den Kopf, so daß ihr das Haar um die Schultern flog und ihm den Blick nahm.
Sie mußten ins Haus, bevor sie zusammenbrachen, also trug er sie quer über den unebenen, grasbewachsenen Hofplatz, überzeugt, daß er sie entweder fallen lassen oder sonstwie verletzen würde, bevor sie drinnen waren.
Menschen tauchten auf zwischen den Häusern, die klein und dunkel waren, mit grassodengedeckten schweren Dächern. Die Menschen ähnelten den Häusern – freundliche Waldgeister, die aus ihren warmen Höhlen neugierig auf die Fremden blickten.
Lindö war kein großer oder reicher Hof, das hatte sein Vater ihm gründlich eingeschärft, als sie den Bischof in Linköping aufsuchten. Eigentlich verwaltete sein Vormund, Per Ingemarsson auf Rydbo, sein Erbe, und brauchte alle Einnahmen auf. Aber es würde schon gehen. Gunnar stellte keine großen Forderungen, sie waren bereit, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten.
In den folgenden Tagen führte Pers Verwalter ihn herum und nutzte die Gelegenheit, sich über seinen Herrn zu beklagen. Åke hatte einen guten Pachthof gehabt, den Per Ingemarsson ihm ohne Grund weggenommen hatte. Man hatte ihn hierhergeschickt, wo er sich rächte, indem er stahl und sich für sich selbst etwas zur Seite legte. So einer war Per, und er war nicht der einzige unter den großen Herren im Lande, die von unersättlichem Landhunger gepackt zu sein schienen, jetzt, da sie einen unmündigen König hatten und es weder Recht noch Gesetz im Lande gab. Es mußte schlecht darum bestellt sein, wenn sogar so ein unbedeutender kleiner Happen wie Lindö Per das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ.
Åke war einmal Pächter bei Gunnars Eltern gewesen, und er erinnerte sich an Gunnars Mutter, die er ›die kleine Frau‹ nannte und die er anscheinend sehr gemocht hatte. Wenn Gunnar alt genug war, sich eine Frau zu nehmen und sich niedergelassen hatte, um sein Eigentum zu bewirtschaften, dann mußte er als mündig angesehen werden, meinte Åke – die Ernte war längst vorüber, aber es gab Arbeit genug, zum Beispiel das große Schlachten vor Weihnachten. Gunnar fand, das klang verheißungsvoll. Jetzt mußten sich sein Vater, der Bischof und Torsten Ödesson um den Rest kümmern, für ihn war die Geschichte erledigt. Sie hatten ein Dach über dem Kopf, ein Heim, Essen und Arbeit, was konnte man mehr vom Leben verlangen?
Es war im Dezember, sie waren früh aufgestanden, denn der Jagdhund hatte Welpen geworfen, und Gunilla war in Sorge, ob die Kleinen den Winter überleben würden. Sie hatte für die Hündin und die Welpen einen Platz in dem Haus hergerichtet, in dem sie schliefen; ließ sie in der Nacht am Fußende des Bettes liegen. Aber die anderen, die ausgewachsenen Hunde wollten zu den Jungen hinein, und so mußte Gunhild sie hinaus auf den Hof scheuchen, indem sie mit fuchtelnden Armen hinter ihnen herlief und schrie. Die Hunde glaubten, sie wolle spielen, und sprangen kläffend und schwanzwedelnd um die junge Frau herum, schnappten knurrend nach ihren Händen und vergnügten sich.
Der Herbst und der frühe Winter waren mild gewesen, aber in diesen Tagen vor Weihnachten setzten eisigkalter, grauer Regen und Nachtfrost ein. Die Wege waren vom Wasser aufgeweicht, alles war grau oder braun, selbst die grüne Farbe der Kiefern wirkte verblichen und matt.
Draußen, im strömenden Regen schlug Gunhild die Arme kreuzweise über die Brust und wandte das Gesicht den Tropfen entgegen. Die Hunde bellten, schnappten und sprangen an ihr hoch, enttäuscht, daß sie nicht das Spiel fortsetzte, sondern die Arme unter dem kurzen Schaffellumhang versteckte.
Gunnar hatte in der niedrigen Tür zum Windfang gestanden und sie betrachtet – als sie stehenblieb, konnte er nicht anders, als zu ihr hinauszulaufen. Auf halbem Weg zwischen der Tür und Gunilla glitt er im nassen Gras aus, rutschte ein Stück auf der Ferse weiter, schlang seine Arme um ihren Leib und ließ sich bremsen.
So standen sie mitten im Regen, als einer der Knechte herbeirannte und rief, daß eine Gruppe Reiter auf dem Weg zum Hof sei. Sie hätten Schilde und Lanzen und trügen das Wappen des Erzbischofs und eine Fahne, die zu schwer vom Regen war, als daß man das Wappenzeichen erkennen konnte. Das mußten Oluf Björnssons Knechte sein, unterwegs in einer ernsten Angelegenheit, bei garstigem Wetter.
Er spürte, wie sie ihm entglitt, obwohl er beide Arme eng um ihren Körper gelegt hatte: Sie war so klein, daß er das Kinn auf ihre Stirn stützen konnte. All die kleinen Überlegungen, von denen er eben noch erfüllt war, entschwanden aus seinem Bewußtsein. Was es auch immer bedeuten mochte, daß der Erzbischof eine Nachricht für sie hatte, es würde ihr Leben verändern: soviel wußte er.
Er nahm sie fest an die Hand, und sie gingen zusammen auf den kleinen Erdhügel am Ufer, um die Reiter in Augenschein zu nehmen. Der peitschende Eisregen war in Schneeregen übergegangen, große weiße Flocken trieben durch die Luft und legten sich auf sein Gesicht.
Einer der Hunde wagte sich herbei und leckte eifrig an ihrer herabhängenden Hand, schwanzwedelnd und winselnd, und Gunhild ging in die Hocke und streichelte ihn, ohne die Reiter aus den Augen zu lassen.
Sie kamen über die Brücke geritten, zwei Reihen von schweren, kurzbeinigen und nassen Pferden. Der vorderste der Gesellen rief den anderen mit rauher Stimme etwas zu – dann glitt er vom Pferd und winkte Gunnar heran.
Seit er den Entschluß gefaßt hatte, Gunilla mit Gewalt zu holen, hatte er gefürchtet, daß ihre unbeglichenen Rechnungen mit verschiedenen Ämtern sie ins Unglück stürzen könnten. Aber ihm war nicht klargewesen, daß seine Eigenmächtigkeit strafwürdig war: Andere waren ja trotz wesentlich schwerwiegenderer Gesetzesbrüche davongekommen. Jetzt begriff er das Ausmaß seiner Kühnheit. Er begriff, daß niemand sich mit dem Erzbischof, dem mächtigsten Mann des Landes, anlegte, ohne teuer dafür büßen zu müssen.
Der Diener des Bischofs erklärte Gunnar in ruhigen Worten, daß er mit nach Uppsala kommen müsse, um seine Angelegenheit dem Erzbischof vorzutragen. Diesem waren schwerwiegende Klagen über sein eigenmächtiges Verhalten zu Ohren gekommen. Gunillas Verwandte waren zutiefst unzufrieden. Mehr wußte der Bursche nicht.
Mit gesenktem Haupt kehrten sie zusammen zum Haus zurück, um seine Kleider zu holen. Reiseumhang, Stiefel, Handschuhe, dazu Helm und Waffe. Gunhild ging mit schleppenden Schritten voran. Das Gras war welk und flachgedrückt, und ihn schauderte jedesmal vor Unbehagen, wenn er die Füße auf den wenig einladenden Boden setzte. Das Wasser lief ihm den Rücken hinunter, unter Hemd und Rock, das Haar hing in triefenden Strähnen, und seine Hände waren durchgefroren.
Sie stiegen die Treppe hinauf, auf den Boden, ohne einander anzusehen. Seine wenigen Besitztümer lagen in der einzigen schönen Truhe, die es auf dem Hof gab. Seine Mutter hatte sie aus Rydbo mitgebracht: eine lange, deutsche Truhe aus Eichenholz, mit kräftigen Eisenbeschlägen, die wie große Blumen geformt waren, und viereckigen Feldern mit gemalten Fabeltieren. Sie hatten so wenig Oberkleider, daß die Truhe nicht einmal halbvoll war.
Gunhild ließ sich in einer kleinen Wasserlache auf die Knie sinken, schloß die Truhe auf und kramte mit beiden Händen suchend darin herum. Holte den Umhang heraus und legte ihn Gunnar wie einen Säugling in die Arme. Stellte die Stiefel hin, so ruhig wie eine Schlafwandlerin, ohne ein Geräusch zu machen.
Er wußte nicht, was er sagen sollte, um ihre stumme Trauer aufzubrechen. Hier, wo es geschützt und warm war, kam wieder Leben in ihr Haar, es fiel in feinen dünnen Locken über ihre Stirn: Er konnte es einfach nicht lassen, mit dem Zeigefinger über die hohe, gewölbte Stirn zu streichen, während sie ihm in die Kleider half.
Vor weniger als sieben Stunden hatten sie sich noch geliebt. Aber er hatte ein Gefühl, als seien ihre Körper schon jetzt die unzähligen Meilen voneinander entfernt, die Lindö von Uppsala trennten und ihre Liebe von der Welt des Erzbischofs; als seien sie durch die Ankunft der Boten einander zutiefst fremd geworden.
Zum Abschied legte sie die Arme leicht um seinen Rücken und schmiegte sich verschreckt an ihn, das Gesicht gegen die Schulter gelehnt. Er aber stand steif und gefühllos wie ein Geist da und ließ ihre Zärtlichkeit über sich ergehen.
Die größten Begebenheiten in seinem Leben waren über ihn hereingestürzt, eine nach der anderen. Noch vor sieben Jahren war er allein, unverheiratet, frei und kinderlos gewesen und hatte das kaum als Mangel empfunden. Vor zwei Jahren hatte er endlich Jofrid geheiratet, und in den ersten Monaten war es ihm schwergefallen, sich an den bloßen Gedanken zu gewöhnen, daß es ihr unabänderliches Recht war, zusammenzusein. Daß er sie nicht heimlich küssen mußte, sondern es sogar vor der Kirchentür tun konnte, wenn ihm danach war.
Jetzt hatten er und Jofrid Kinder, Freunde und Anerkennung, alles was er sich gewünscht und wovon er geträumt hatte.
Allerdings hatte er auch reichlich Zeit, über ihre Schwierigkeiten nachzudenken. Er hätte nie geglaubt, daß Jofrid so beißend hart sein konnte: Sie zankten sich wie die größten Feinde über die unwesentlichsten Themen. Hinterher ärgerte er sich, begriff nicht, wie es dazu kommen konnte, daß er sich über reine Nebensächlichkeiten so unverhältnismäßig aufgeregt hatte.
Sie war jetzt schwanger, schlief schlecht und erwachte müde, beklagte sich andauernd und gab ihm die Schuld an allen möglichen Dingen.
Damals, als sie nur einander hatten, war kaum ein unsanftes Wort zwischen ihnen gefallen. Damals hatte es ihm leid getan, wenn ihr Körper während der Schwangerschaft unförmig wurde. Jetzt verfolgte er die Veränderung mit selbstquälerischem Genuß. Die Flecken im Gesicht, die geschwollenen Beine, die Kurzatmigkeit, das Gewicht des Ungeborenen, das sie plattfüßig machte.
Sie hatte sich auch nicht über die Art gefreut, wie Gunnar zu seiner Frau gekommen war. Dabei müßte sie doch die erste sein, die das Vorgehen der jungen Leute billigte. Er war stocksauer geworden, als Jofrid behauptete, sie würden Torsten Ödesson kränken, wenn sie Gunnar Pferde und Leute gaben, damit er Gunhild entführen konnte. Während des Treffens mit dem Bischof von Linköping war er sicher gewesen, daß die Sache ganz nach Plan verlief, obwohl er eigentlich die Priesterröcke kennen mußte und deren durchtriebene Einfälle! Und tatsächlich: Dieser Hurensohn Oluf Björnsson, Erzbischof von Uppsala, hatte Göran Gregori von Linköping der unzulässigen Einmischung in die Arbeit anderer Stifte und Gunnar wegen Ehrenkränkung und Verleumdung angeklagt. Nun stritten die beiden mächtigsten Kirchenfürsten des Landes miteinander, und ein verliebter vierzehnjähriger Junge und sein Mädchen waren versehentlich zwischen die Klingen geraten und bekamen herbe Schläge.
Soweit sie es Gunnars Brief entnehmen konnten, hatte man ihn auf Pilgerreise geschickt, und er sollte zugleich für Oluf Björnsson einige Briefe abliefern.
Aber es war anders gekommen. Sten hätte es gern gesehen, wenn Gunnar im Lande geblieben wäre. Per Ingemarsson auf Rydbo wollte Lindö wiederhaben. Gemeinsam mit dem Erzbischof, mit dem er verwandt war, hatte er herausgefunden, daß Gunnar erst mit sechzehn als volljährig gelten konnte. Zwischenzeitlich war – von allen Menschen auf Gottes weiter Erde – Per als Gunnars gesetzlicher Vertreter und Vormund eingesetzt worden.
Und als wäre das noch nicht genug, starb Gunillas Vater um die Weihnachtszeit, erfror auf dem Weg über den See. Pintorp und all die anderen guten Höfe gehörten nun Gunilla. Hätte sich Erzbischof Oluf Björnsson nicht eingemischt, hätten die beiden Kinder Hochzeit halten und in großem Wohlstand und Sicherheit leben können. Aber Per hatte ein Auge auf das dicke Erbe geworfen und behauptete voller Ernst, daß Torsten Ödesson gewünscht hatte, daß er Gunhild heiraten solle. Fürs erste hatten sie Gunhild unter ihren Fittichen, so weit von Rydbo entfernt wie möglich, und lieferten sie nur dem Mann aus, dem sie freiwillig folgte – und das war kaum Per Ingemarsson.
Sie hatten gegen Pers Vater, Jofrids Onkel, kämpfen müssen: Ingemar hatte sie in die Verbannung getrieben. Sten hätte nie geglaubt, daß sie nun genauso verbissen mit dem Jungen streiten mußten. Aber vor ein paar Tagen war bei Sten ein merkwürdiges Ersuchen von Per eingetroffen, nämlich die Forderung, Lindös Überschuß der letzten zwei Jahre zu entrichten. Jofrid war sowieso schon schlechtgelaunt gewesen, und so kam es, daß sie bei Tisch stritten. Schließlich warf er seinen Bierkrug gegen die Wand und fegte ein paar Tonschüsseln mit Bratfisch auf den Boden (es war Fastenzeit), um zu zeigen, wie sehr er gekränkt war. Die Dienerschaft aß ungerührt weiter, und mittendrin in ihrer Auseinandersetzung war Gunilla zusammengebrochen.
Sie war ein zähes Kind; aber er hatte schon mehrfach gesehen, wie schwer es ihr fiel, sich an den Ton zu gewöhnen, der zwischen ihren Schwiegereltern herrschte. Normalerweise floh sie, wenn sie sich zankten; aber diesmal kippte sie nur vornüber, die Arme auf dem Tisch vor sich ausgestreckt, mitten in Fischgräten und Kohlreste, und weinte herzzerreißend.
Sten ging zu seiner Schwiegertochter, zog sie hoch, legte ihr nasses, kaltes Gesicht gegen seinen Arm und strich ihr über die Stirn, während die warmen Tränen seine Hand benetzten. Es war das erste Mal seit ihrer Ankunft, daß jemand ihr so viel Kraft und Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Und sie war weich und flaumig und formlos wie ein Vogeljunges – er kannte Jofrid gut genug, um zu wissen, daß er einen gewissen Abstand halten sollte.
– Du mußt lernen, mehr Rücksicht auf unsere Schwiegertochter zu nehmen, sagte er und drückte das Kind an sich, denn sie zitterte und klapperte mit den Zähnen; er legte die Hände über ihre Ohren, um den Streit von ihr fernzuhalten, – sie ist nicht daran gewöhnt zu hören, wie Königstöchter mit ihren Ehemännern reden!
Auch sie hatte sich erhoben und war zu ihm hingegangen: graubleich im Gesicht, die Augen wie zwei Wunden. Jetzt war Jofrid erst richtig wütend. Nicht aufgebracht und überempfindlich wie sonst, sondern beherrscht in ihrer Wut, die ihn zu Boden strecken konnte.
– Glaubst du, ich hätte mich dir hingegeben, wenn ich gewußt hätte, daß du nicht einmal deine eigenen Schwiegertöchter in Frieden lassen kannst? fauchte sie.
Und sie meinte es ernst. Der Gedanke setzte sich in ihm fest, so daß er ihm nicht entkommen konnte, auch wenn er sich von Herzen frei davon wünschte. Das kleine, kindliche Wesen, das Gunnar liebte und das das Kind seines Sohnes erwartete: Es war sein erstes Enkelkind, das sie in sich trug.
Aber das schlimmste war, daß er es gedacht hatte. Bevor er wußte, daß sie schwanger war. Als sie das erste Mal zusammen im Badehaus waren, hatte er sie gründlich betrachtet, um herauszufinden, in wen Gunnar sich da verliebt hatte.
Die kleinen jungfräulichen Brüste mit rosenfarbenen Knospen, die unter seiner Zunge und seinen Lippen fest und warm werden würden. Gar nicht zu reden von der dritten kleinen, hellwachen Knospe in ihrem Schoß, die auch wachsen konnte – ihr fester Hintern, in der Wölbung seiner Hände ruhend, die kleinen Beben, die sie durchlaufen würden, der hübsche Vogelgesang, den er ihr entlocken könnte, die Muskeln in den strammen Seidenschenkeln würden sich um seine Wangen zusammenziehen, und in wildem Staunen und voller Genuß würde sich der dünne Körper spannen wie ein Bogen. Ihm war bei dem Gedanken ganz schwindelig geworden. Hinterher hatte er sich geschämt, hatte versucht, den Gedanken von sich zu schieben, hatte gebeichtet und bereut und Buße getan. Begriff nicht, was in ihn gefahren war. Ein mageres, vierzehnjähriges Wesen, die Frau seines Sohnes, die nicht viel Schönheit oder Anmut zu bieten hatte. Ihre Unschuld war das schönste an Gunhild.
Aber wie hatte Jofrid ihm seine geheimen Gefühle anmerken können, fragte er sich – er würde doch nie so weit gehen, schon der Gedanke war schlimm genug. Er war ihr treu gewesen, bis auf dieses eine verfluchte Mal, an das er sich nicht erinnern wollte und für das er keinen stichhaltigen Grund angeben konnte.
Wenn er sich ganz selten einmal, aber peinlich deutlich, daran erinnerte und Lust dabei verspürte, dann schien es, als sei er ein noch schlechterer Mensch als bislang angenommen. Diese Last für den Rest seines Lebens zu tragen, dazu war er bereit.
Er erhob sich, streckte sich und hob die Arme über den Kopf, um die schwachen, sich versteifenden Gichtschmerzen zu verjagen. Müßiggang war aller Laster Anfang, und er hatte genug zu tun.
Bengt rannte zwischen den Häusern herum und jagte ein quiekendes Ferkel – Arvid und Algot, die beiden jüngsten Kinder, saßen unter einer der Treppen und bauten aus kleinen Steinen, Matsch, toten Fröschen und anderen aufgesammelten Sachen Häuser. Der Lärm von Bengt und dem Ferkel war schon länger zu vernehmen. Sten Algotsson ging hinunter und versuchte, seine Kinder einzufangen, und mußte feststellen, daß es leichter war, Flöhe in einem Schafspelz zu erwischen. Keines der Kinder hatte Schuhe an den Füßen, obwohl es schon Spätherbst war. Sie wehrten sich unter Anwendung gemeinster Tricks, als er sie ins Haus schleppte. Bengt weigerte sich glattweg, zu essen, und er schmierte statt dessen Senf auf das weiße Brot.
Jofrid sah es am liebsten, daß die Kinder dasselbe aßen wie die Erwachsenen; aber das Essen war oft derartig schlecht, daß Sten Mühe hatte, es hinunterzubekommen. Heute abend konnten die Kleinen sich wohl einmal an Senfbrot, Honig und Waffeln satt futtern.
Anschließend schleppte er die beiden Kleinsten hinunter in den Raum, in dem sich die Feuerstelle befand, dem wärmsten Ort auf dem Hof. Zog ihnen die Kleider aus, auch wenn sie wild Widerstand leisteten, weinten und nach ihm schlugen. Sie waren schmutzig, unwillig und quengelig, und er war es nicht gewohnt, allein für sie zu sorgen. Der kleine Algot war gerade ins Bett gekommen, als er den ganzen Brei erbrach. Sten wischte das Erbrochene von der Bettdecke in den Eimer, der an der Tür stand, und kippte dann die stinkende, graubraune Masse nach draußen in den Schlamm.
Als er endlich alle drei zur Ruhe gebracht hatte, legte er sich auf das nächste Bett, um sich einen Augenblick lang auszuruhen – und erwachte mit eiskaltem Entsetzen. Eine Frau stand über ihn gebeugt und rüttelte an seiner Schulter, die vor Kälte und Gicht schmerzte. Er mußte erst zu sich kommen und die Augen an das schwache Licht gewöhnen, bevor er erkannte, wer das war. Aud, die Norwegerin, die sich normalerweise um die Kinder kümmerte – das mußte ihr Bett sein, das er mit Beschlag belegt hatte.
Er versuchte, sich zu entschuldigen, und eilte steifbeinig durch die schiefe Tür hinaus auf den Vorplatz, setzte sich auf die Treppe und sah in die Nacht hinaus, immer noch durcheinander und schwindelig, mit einem schlechten Geschmack im Mund.
Der Himmel war freudlos, leer, schwarzblau, ohne eine Andeutung von Sternen. Das dichte Dunkel ließ die Häuser verschlafen und geduckt aussehen. Rauchwölkchen stiegen senkrecht aus dem Abzugsloch in der Stube, in der Gunhild in den Wehen lag – und aus der Küche und den beiden Giebelöffnungen in der Halle.
Die Kälte machte seinen Kopf klarer, aber er fror so sehr, daß er zitterte und mit den Zähnen klapperte. Es biß und brannte in seiner Lunge, aber dennoch war es herrlich, den Körper zu zwingen, allem Unbehagen zu trotzen.
Von seinem Vater hatten sie nicht viel gesehen, seit Ingeborg gestorben war. Er wollte keine Hilfe, obwohl er sehr hinfällig geworden war, konnte nicht einmal essen, ohne das meiste zu verkleckern. In den letzten Wochen wollte er nichts davon hören, vom Altenteil in die Halle hinüberzuziehen.
Gleich nach seiner und Jofrids Hochzeit hatte er seine neue Stiefmutter zum ersten und einzigen Mal nach ihrer neuen Ehe gefragt. Ingeborg hatte die schmalen, mageren Schultern hochgezogen und gelacht: sie war nicht wieder achtzehn geworden, auch wenn Algot glaubte, daß man genau das wurde, wenn man den heiratete, den man als junger Mensch geliebt hatte.
Eines Morgens hatte sie dann gesagt, daß Måns, ihr erster Mann, auf dem Hofplatz stehe und nach ihr rufe. Der verfluchte Hurenbock, der die besten Jahre ihres Lebens verpestet hatte, war gekommen, um Ingeborg zu holen, und sie wirkte froh und erwartungsvoll! Noch bevor der Abend kam, war sie tot. Sten wunderte sich – sein Vater hatte ihren Tod leichtgenommen, aber sie hatte er ja geliebt, und auf sie hatte er vierzig Jahre gewartet. Es gab so vieles, was er nicht begriff und wonach er nicht fragen mochte, seinem Vater ging es nicht gut, er konnte sich an nichts erinnern, lebte in seiner Welt.
Es ist abstoßend und obszön, auf diese Weise alt zu werden, dachte Sten. Lieber will ich plötzlich aus dem Leben scheiden, als so ein langes und jämmerliches Leben zu führen wie mein Vater.
Ein schwaches Geräusch ließ ihn aufblicken und die Gedanken abschütteln – die Tür zur Stube, in der Gunhild lag, ging auf, und eine Frau trat heraus. Er erkannte sie wieder, schon bevor sie ganz zur Tür heraus war, und trotz der Dunkelheit und des Umhängetuchs, das sie um sich geschlungen hatte. Schon die Art, wie sie die Arme bewegte, als sie das Kopftuch über den Scheitel zog, sagte mehr als genug. Es hätte ihn freuen sollen, statt dessen erfüllte ihn ein großer, von Erschöpfung geprägter Widerwille. Dennoch erhob er sich und ging die Treppe hinunter, um sie auf halbem Wege zu treffen. Sie machte den Eindruck, als sei er der, den sie am wenigsten erwartet hatte – umarmte ihn nicht einmal, obwohl er die Arme einladend ausbreitete; ging direkt an ihm vorbei, so daß er sie an den unförmigen, wallenden Kleidern festhalten mußte, um sie zu stoppen.
– Konntest du nicht schlafen? fragte sie und wich ihm erneut aus, blieb aber stehen.
– Ich habe noch nie gern allein geschlafen, antwortete er, – ich habe dich vermißt.
– Den ganzen Tag, oben im Wald? fragte sie bissig, – du mußtest nicht den Hof verlassen. Keiner hat dich zum Tor hinausgejagt, soweit ich mich erinnere.
Darauf konnte er nichts sagen, er wartete ein wenig und hoffte, daß sie inzwischen auf bessere Gedanken käme.
Dann fragte er, hauptsächlich um das Thema zu wechseln, wie es mit Gunhild ginge – und sah, wie sich ihr Gesicht verschloß. Sie wandte sich unfreundlich von ihm ab.
– Ich weiß nicht, was mit ihr wird. Aber beim ersten Mal dauert es immer länger. Und sie ist sehr jung, und nicht stark – aber sie ist auch nicht so zart, wie man denkt, wenn man sie das erste Mal sieht, fügte sie hinzu und sah ihn vielsagend an.
Nein, er wußte, was sie meinte. Er hatte auch nicht gewußt, was für ein zähes und kriegerisches Wesen er sich ins Haus holte, als er sich in sie verliebte. Gunhild war anders und besser als das milchfarbene Engelchen, das Gunnar in Linköping vorgeführt hatte. Wenn nicht auf andere Art, so konnte er vielleicht dadurch, daß er über Gunhild sprach, die Frau in Jofrid wiedererwecken, die er kannte. Sie wurde weich, warm und gesprächig, ganz anders als die dösige, aber immer streitlustige Ehefrau, an die er sich gewöhnt hatte. Seine süße, wilde Jofrid.
Wenn er sie doch nur überreden könnte. Das Bett war gemacht, um mehr bat er nicht; aber er hatte solche Lust, sich an ihren glatten, duftenden Körper zu schmiegen, aus ihrem Mund und Schoß zu trinken, in ihren nackten Armen einzuschlafen.
– Du mußt müde sein, hörte er sich sagen, mit einem schwachen Zittern in der Stimme, das seine Absicht verraten mußte, – wir können in die Altenstube hinübergehen und uns ausruhen. Wenn sie dich brauchen, werden sie jemanden schicken – du bist schon seit dem frühen Morgengrauen auf, alle anderen sind schlafen gegangen, laß uns hinaufgehen und ein bißchen ruhen.
Er wagte kaum, sie zu berühren, wartete in atemloser Spannung auf den Augenblick, wo sie schwach wurde und nickte. Aber als er ihre Hand ergreifen wollte, die das Umhängetuch über der Brust zusammenhielt und lang, bleich und schmal erschien, übermannte ihn die Erregung, und er umarmte sie. Ihre Bewegungen und Erwartungen harmonierten nicht miteinander. Es brauchte einige Zeit, bis ihre Arme sich gefunden hatten, und ihr rund gewordener Bauch war im Wege. Aber wenn er nach ihrem Mund suchte und sie ihm ihr Gesicht zuwandte, dann konnte er sich fast einbilden, daß alles wie früher war, daß nichts Böses zwischen ihnen stand.
Es war eine armselige Freude, im Dunkel und in der Kälte zu stehen und ihren kühlen Mund zu küssen. Zuerst mußte er das dicke Tuch von ihren Schultern bekommen, aber ohne das würde sie frieren – er strich ihr über die Brüste, und das tat wohl weh, sie stöhnte erschreckt und biß ihm in die Lippe, als sie sich küßten.
Dann löste sie seinen Griff und befreite sich, behutsam, aber bestimmt.
– Ich will dich ja nicht zwingen, flüsterte er, faßte sie um die Ellbogen, um sie daran zu hindern, einmal mehr im Zorn von ihm zu gehen –, laß uns hineingehen und ausruhen, das hast du bestimmt genauso nötig wie ich.
Aber sie rührte sich nicht, und er ließ sie wieder los: alles, aber nur keinen erneuten Bruch und aufs neue Unfreundlichkeit.
– Was ist los? fragte er. Wenn sie nach ihm schlug, würde er sich nicht wehren können.
– Was los ist? fragte sie zurück, die Entrüstung steckte wie die Spitze einer Nadel in ihrer Stimme, kratzte an seinem schlechten Gewissen, – das will ich dir sagen, wenn du schon so neugierig bist! Wenn du Zeit hast, mich anzuhören, Lust hast, mich anzuhören, nichts Wichtigeres vorhast – wie sonst. Wenn ich aufwache, bin ich genauso müde wie beim Zubettgehen. Und du, du willst alles haben – ich bin deine Frau und deine Geliebte, wenn du Lust auf mich hast, ich soll deine Kinder gebären und den Hof führen und mich bei deinen Freunden vorzeigen lassen; und backen und brauen und pökeln und schlachten und weiß Gott noch was – manchmal habe ich das Gefühl, ich bin genauso gebunden wie damals, als ich mit Ture verheiratet war. Und du, dir sind deine Hunde und Pferde lieber als ich!
– Du weißt, daß das nicht stimmt! wandte er aufgewühlt ein – endlich kriegte er sie bei einer ihrer vielen Ungereimtheiten zu fassen. Aber wenn er ihr nur im geringsten recht gab, würde er sich da nie mehr herausziehen können.
Die hellen Nächte waren ja auch bald vorbei. Noch vor drei Wochen hatten sie den See in dem sanften, schläfrigen Nachtlicht erkennen können. Nun waren sie auf allen Seiten von Herbstdunkel und feuchter Kälte umgeben, die nach Verwesung roch.
– Was willst du – von mir und von dir selbst? Sag es mir, dann werde ich mein Bestes tun, sagte er, ohne größere Hoffnung, daß es etwas brachte. Es war ihr Klagen, ihr Verlust: sie sah nicht klar genug, um zu verstehen, daß er ihr genausogut vorwerfen könnte, was die Zeit ihnen antat.
Er wollte sich gern ändern, wenn es half; aber Worte allein genügten nicht – er hatte auch nichts als sein Wort, das er ihr geben konnte, und das war ohnehin armselig genug.
Sie wandte sich von ihm ab, die Hand vor dem Gesicht, nahm sie aber schnell wieder herunter. Endlich wagte er, sie an sich zu ziehen – sanft, ohne Begierde, fast tröstend. All die Male, wenn sie sich heimlich in fremden Häusern und fremden Betten getroffen hatten, hatte er von dem guten, gesetzmäßigen Leben geschwärmt, das sie führen und über das sie sich freuen würden, wenn sie erst einmal verheiratet wären. Sie lag da und betrachtete ihn, als er sich auszog. Sie rechnete nach: Es war mehr als sieben Jahre her, seit sie einander erstmals begegnet waren.
Während ihrer letzten Schwangerschaft hatte sie sich über den Verfall ihres Körpers geekelt: hatte gewußt, daß die Jugend vorbei war. Heute nacht sah sie zum ersten Mal, und das erschreckte sie weit mehr, daß auch er älter geworden war. Die vierzehn Jahre, die er älter war als sie, waren nie so sichtbar gewesen. Er hatte die Schufterei und die Entbehrungen besser verkraftet als sie. Die Spuren mußten schon lange dagewesen sein, aber sie hatte sie nicht gesehen; nur das Bild von dem Mann, den sie kannte.
Graue Haare bedeckten bereits den ganzen Kopf. Die Furchen um seinen Mund, am Hals und um die Augen waren schlaff geworden – und unter den Augen hatte er schrumpelige, hängende Falten. Die Narben zogen weiße, runzlige Striche und Muster über Körper und Glieder. Er hatte sich nie geschont, früher oder später mußte es sich rächen. Wenn er sich auszog, stieg er vorsichtig aus den Hosen und balancierte auf einem Bein – der Bauch war nicht mehr straff, und das Fleisch über der Brust und auf den Oberarmen war schwabbelig.
Die Erkenntnis schnitt ihr ins Herz, als würde ein heißer Draht in ihr verglühen, für immer: Einst war er so gewesen, wie sie ihn in Erinnerung hatte, und sie ihn immer noch mit geschlossenen Augen sah. Jung, schön, selbstbewußt, unglaublich sorglos und unverwundbar. Sie hatte ihn verwundbar gemacht, hatte die Sorglosigkeit aus seinem Gemüt geätzt, ihn die Fähigkeit zum Verrat gelehrt. Damals hatte sie nur gesehen, wozu sie selbst erniedrigt wurde. Nicht, daß sie grausam gegen ihn gewesen wäre, gegen den Menschen, in den sie sich verliebt hatte. Und mit jedem Jahr würde der Abstand zwischen damals und jetzt größer werden. Zu jenem Mann, dem sie ihr Leben in die Hände gelegt hatte, an der Tür zum Boden des Gästehauses im Klarakloster.
Es überlief sie voller Mißmut, all das, was unwiederbringlich vorbei war. Der Leichtsinn, die blinde Verliebtheit, die auf Zukunft und Vernunft pfiff: Wo man nur sich selbst sah und glaubte, die ganze Welt darin gespiegelt zu finden. Auch Gefühle konnten verschleißen und verwittern, wie alles Vergängliche, wie der Sandstein über der Männertür der Kirche in Gråbo, eingefügt von Ragnvald Jarl, die Abnahme Christi vom Kreuz, rauh und grob auf der Hand. Etwas war geblieben, das Beste und Wichtigste, das Eigentliche. Aber sie wußte nicht, wieviel es noch wert war, und wieviel es gegebenenfalls ertragen konnte.
In vielerlei lebte sie so wie in der Verbannung in Norwegen: Sten kümmerte sich um die Pferde und Hunde, ging auf die Jagd, wenn es ihm einfiel, fischte im See, vergnügte sich mit Trinken, Würfeln, Plaudereien mit Gefährten, die zu vornehm waren, ihre eigenen Pferde zu satteln. Unterdessen versuchte sie, die Dienerschaft und die vielfältige Arbeit in den Griff zu bekommen.
So war sie immer in Eile, ohne mit dem Herzen bei der Sache zu sein, und sie quälte sich mit ihrer nicht gerechtfertigten Unzufriedenheit. Denn es war ja dieses Leben, wonach sie getrachtet hatte, dafür hatten sie die mageren Jahre in Norwegen ausgehalten.
Es war ungerechtfertigt, und sie wußte es – nicht einmal für sich selbst hatte sie eine klare Vorstellung von dem, was sie sich vom Leben erhoffte. Aber die Unsicherheit und die Furcht, die unglaubliche, wilde Freude, wenn sie sich trafen – sie hatte so ungestüm gelebt, mit ihrem ganzen Körper und der seufzenden, überquellenden Seele gefühlt, kaum Schlaf oder Nahrung gebraucht. Und jetzt waren sie hier, und sie zweifelte nicht, sondern quälte sich.
Er hatte sich fertig ausgezogen, stützte sich mit einem Arm auf den Bettpfosten, gähnte und kratzte sich zwischen den Schulterblättern und streckte sich wie eine schläfrige Katze. Das schwache, gelbliche Licht tanzte über den breiten Rücken, der sich zu den Hüften hin verjüngte, bildete kleine Schatten in den Vertiefungen am Brustbein und zeichnete Striche entlang den schmalen, scharfen Sehnensträngen an Schenkeln und Armen. Der schwache Geruch von salzigem Schweiß, Leder und Rauch, Samen, Urin und Haut näherte sich, er legte sich zu ihr: Sie schloß die Augen und ließ sich in Blindheit und Schwäche hinabgleiten, die sich wie eine Decke um sie schmiegten.
Er suchte nach ihrem Mund, während seine weiche Hand auf ihrem Bauch ruhte – und sie wußte, daß er sich zu beherrschen versuchte, damit er seine Enttäuschung nicht allzu deutlich zeigen mußte, wenn sie ihn erneut abwies. Dennoch öffnete sich sein Mund mit einem erleichterten Seufzen, als sie ihm vorsichtig die Arme um die Schultern legte und ihre angezogenen Beine schlapp niedergleiten ließ. Schwereloses Wohlbehagen umgab sie, als ruhe man in angenehm warmem Wasser – breitete sich in ihr aus, und kurz darauf schlief sie ein.
Gunnar wußte nicht viel vom Krieg. In seiner Vorstellung bestand der Krieg aus bunten Seidenzelten, Trompetenfahnen, flatternden Wimpeln, edlen, schäumenden, mit gesenkten Köpfen herangaloppierenden Streithengsten und knatternden Löwenbannern, wie in den bretonischen Romanen, die er gelesen hatte. Aber so war es nicht in Wirklichkeit.
In Dänemark, wo er im Auftrage des Erzbischofs unterwegs war, traf er Knud Porse, vor dem Sten ihn gewarnt hatte. Porse war ein dänischer Großgrundbesitzersohn, der sich während des letzten schwedischen Bürgerkrieges mit der siegreichen Seite verbündet hatte. Danach hatte er die Mutter des noch jungen schwedischen Königs nach Varberg begleitet und sie verführt. Dänemark war dabei, in verpfändete Lehen zu zerfallen, und Porse sah sich nach einem passenden Landstück um, das man als Herzogtum bezeichnen konnte. Dann würde er seine Herzogin heiraten können. Bislang hatte er seine Dame hauptsächlich damit unterstützt, daß er Seeräuberei betrieb und friedliche Reisende überfiel.
All das hatte Sten ihm gesagt; aber als Gunnar dem Mann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, empfand er nur Wohlwollen. Deshalb blieb er länger als nötig in Dänemark und sah, was mit dem Land geschehen war.
Sie hatten das Reich zerrissen wie ein angeschossenes Tier, das sich noch auf die Wiese geschleppt hatte, wo Wölfe und Aasvögel von dem dampfenden Fleisch fressen. Die Großgrundbesitzer hatten den König vor die Tür gesetzt, um selbst zu regieren, zeigten aber in dieser Beziehung keinerlei größere Begabung. Nun kämpfte ein holsteinischer Graf gegen den abgesetzten König und dessen Söhne, während Porse und ein Dutzend andere im Trüben fischten.
Das Land hätte reich sein können. Der Boden war dunkel und fruchtbar und recht leicht zu bestellen – das ganze Land schien genauso flach und weich zu sein wie die weiten Ebenen zwischen Skara und Falköping.
Von zu Hause war Gunnar es gewohnt, daß viele Bauern armselig lebten. Aber auf den Anblick der Menschen in den dänischen Dörfern war er nicht vorbereitet: Unterernährte, menschenscheue Wesen, von Armut gezeichnet, denen Hunger, Unwissenheit und anhaltende bittere Not in den verhärmten Gesichtern geschrieben standen. Die Kinder waren von Dreck und Grind verunstaltet, mit aufgeblähten Bäuchen, ein zynisches Merkmal des Hungers. Porse war Däne, aber Gunnar verspürte bei ihm kein Mitleid mit dem gebeutelten Land.
Andere Gegenden waren wie unberührt von der Not, große Kirchen wurden errichtet, Ruhe herrschte. Gunnar besuchte die Frauenkirche in Kopenhagen und schlich sich verstohlen zu einem Steinmetz, um ihm dabei zuzusehen, wie er einige Skulpturen für den Chor fertigstellte – es wunderte ihn, daß er sich noch vor kurzer Zeit von dieser in sich gekehrten Lebensweise angezogen gefühlt hatte. Die Welt draußen hatte so viel mehr zu bieten: Dieses ganze unglaubliche Abenteuer, und zu Hause wartete Gunhild auf ihn, was konnte man mehr vom Leben verlangen!
Dänemark war ein schönes Land, hier könnte er leben – das Land glich einem großen bestellten Garten. Das, was die Dänen ›Hügel‹ nannten, waren leichte Anhöhen, bedeckt von wogendem Gras oder Korn. Die Küsten waren offen und einladend wie weiße, füllige Frauenarme und nahmen die Schiffe küssend auf. Die Wälder waren hoch, wehmütig und licht, streiften in jedem Herbst ihr Kleid ab und schlugen im Mai wieder mit zartgrünen Blättern aus. Hochstämmige Buchen, von den Mönchen Laubhütten genannt, ein wunderlicher Anblick.
Die Dänen sprachen viel mehr, als in Schweden üblich – vielleicht lag es daran, daß die Dänen so nah beieinander wohnten: Die Handelsstädte lagen nur eine knappe Tagesreise voneinander entfernt an den Fjorden. Die Sprache, die die Dänen nach dem Einsturz des Turms zu Babel mitgebracht hatten, war das am wenigsten Schöne am Land; aber wenn Frauen dänisch sprachen, konnte sogar Gunnar etwas Schönes an der Sprache finden – und die Dänen lachten viel, besonders die Frauen.
Man wußte immer, ob man sich auf dem Festland oder auf einer Insel befand. Die Küstenlinien waren scharf und klar. In Sörmland konnte man sich nie sicher sein, Fels und Schären wechselten sich mit fruchtbarer Erde ab. Aber der Isefjord schnitt tief ins Land hinein, und als er mit einem Brief von Porse an den Bischof weiter südwärts in den Roskilde-Fjord mußte, war er gezwungen, in ein Ruderboot umzusteigen.
Dies war ohne Zweifel der wichtigste Auftrag, der ihm erteilt worden war. Jetzt saß er im Steven und wartete darauf, daß wieder etwas Abenteuerliches geschehen würde.
Der Mann, der seine Schiffahrt arrangiert hatte, erklärte, daß sich bei Skuldelev eine alte Sperre befinde – es war auf jeden Fall am leichtesten, in einem unauffälligen Ruderboot, das keinen großen Tiefgang hatte, in die Stadt hineinzugelangen.
Ein schwacher Wind wehte, und das Boot legte sich leicht auf die Seite. Gunnar erhob sich trotzdem, er wollte die Stadt sehen – das Boot bewegte sich langsam und schwerfällig an den grünen und sandigen Küstenhängen entlang. Die Stadt lag in schwindelerregender Höhe auf einem Hügel über der Einfahrt. Er sah nicht mehr als die Andeutung von flachen, braunen Dächern, ein hohes Gebäude, das der steinerne Turm der bischöflichen Residenz sein mußte – und die Kirche.
Er hatte die Dome in Linköping und Uppsala gesehen, und die Hallvardskirche in Oslo, als er noch Kind war, und die Leute hatten zwar gesagt, daß die neue Kirche in Roskilde etwas Besonderes sei, aber das meinten die Menschen von ihren eigenen Kirchen immer, und die Dänen neigten zum Prahlen und Übertreiben. Aber in diesem Fall hatten sie recht: Ihm blieb die Luft weg, er stolperte über die Spanten und mußte sich setzen.
In der Nähe der Stelle, wo die Boote anlegen konnten, fiel sein Blick auf eine kleine, graue rauhwandige Steinkirche – aber das große, rote, neue Gebäude oben auf dem Hügelrücken stand hochmütig da, strotzend vor Selbstbewußtsein. Wie eine vornehme Dame, die ihre feinen Kleider über die Knöchel anhebt, um den Schmutz des Rinnsteins zu meiden.
Das spiegelnde Wasser des Fjords war spiegelglatt. Zum Ufer hin zeigte es eine türkise Färbung, und die klare Morgensonne glitzerte in Glas und Vergoldung, entfachte die farbige Glut, aus der tiefrote, saphirblaue, grasgrüne und goldene Flammen hervorschossen. Kaskaden von Farben, zerlegt in kurze, betörende Blicke, die vor seinen schmerzenden Augen zuckten.
Er mußte sich wieder erheben, stieß jedoch gegen eines der Ruder, und ein starker Schmerz durchfuhr sein Schienbein. Der Ruderknecht schrie ihn an, ob er denn verrückt geworden sei, ob er sich ertränken wolle – er aber wollte sehen, nicht nur mit den Augen, sondern mit dem ganzen Körper, wollte den Anblick in sich einsaugen, mit heftigen Herzschlägen, ihn ins Blut aufnehmen. Sank auf die Knie, beide Hände an der Reling, um nicht über Bord zu gehen, wütend auf sich selbst, weil er dem prachtvollen Bild, das sich ihm bot, nicht in dem erforderlichen Maße gerecht werden konnte.
In diesem Augenblick erklang der erste durchdringende Ton der Glocken. Der Klang legte sich über sie, als habe er seinen Ursprung nicht in der Kirche, sondern als komme er von dem sandigen Steilufer, den Bäumen auf dem Hang, von der gastfreundlichen Küste, als gebe alles zusammenstimmend einen Laut von sich.
Die Ruderer legten endlich die Ruder aus der Hand und beteten, und Gunnar blieb auf den Knien liegen, während die Tränen ihm über das Gesicht liefen und die Freude ihn durchströmte.
Während der letzten Monate hatte er mehr aus einem Pflichtgefühl heraus an Gunhild gedacht – nicht eigentlich an sie selbst, sondern an alles, was ihn erwartete. Das Überwältigende dieses Erlebnisses mußte sie ihm leibhaftig wieder in Erinnerung gebracht haben. Er hatte das Gefühl, vor Sehnsucht nach ihr zu vergehen. Die kurzen, mageren Arme, die kleinen Finger mit Nägeln wie Rosenblätter, ihr Lachen, die spitzen Mäusezähne und das milchfarbene Haar, das sich unter seinen Fingern kräuselte.
Nun konnte er kaum begreifen, wie es zugegangen sein mochte, daß sie ihm so aus dem Sinn gekommen war: Sein Körper wurde zu Tausenden kleiner Zungen, die nach ihr riefen. Nun wollte er nach Hause.
Aber es wurde Herbst, bevor er sich seiner Pflichten entledigen und die Heimreise antreten konnte. Und die dauerte länger und war beschwerlicher, als er erwartet hatte. Porse hatte ihm seinerzeit eine Schiffspassage nach Lödöse versprochen, statt dessen wurde er irgendwo in Halland an Land gesetzt und mußte selbst den Weg nach Västergötland und zu der abgelegenen Ortschaft finden. Er hatte nur ganz kurz auf Mjövik gewohnt, mußte aufs Geratewohl reiten und sich durchfragen – es dauerte länger als geplant, und die Ungeduld wuchs und gärte in ihm.
Es schneite, als er endlich den Weg zum Hof gefunden zu haben glaubte: Seit dem Herbst war keiner auf diesem Weg geritten, wenn der Schnee erst liegenblieb, würde jedwede Spur eines Reitpfades verschwinden. Das Pferd war ausgelaugt, Gunnar ritt im Schritt ins Tal hinunter, obwohl sein Herz vor Ungeduld pochte.
Es war kalt und dunkel, die Sonne entschwand langsam über den entferntesten Waldrücken: ein dünner, roter Streifen, der die Baumspitzen grün und matt erhellte. Der Wald schnürte sein Blickfeld ein wie ein schwarzer Gürtel, die Erde war so hart, daß es vor Frost unter den Pferdehufen dröhnte. Der See war schwarz, mit einem schmalen Eisrand am Ufer. Die Welt wurde neu geboren, wurde sichtbar, unbegreiflich in ihrer unveränderlichen Einsamkeit. Das Pferd war stehengeblieben, nur mit Mühe brachte er es zum Weitergehen, aber es bewegte sich merkwürdig stockend und unsicher. Und Gunnars Finger waren steif vor Kälte; er versuchte, die Finger in den Fäustlingen zu bewegen – obwohl er kein Gefühl darin hatte, brannte und biß es unter der Haut und in den Gelenken.
Der Wind ging durch Mark und Bein – im Hohlweg im Wald konnte der Reiter sich noch warm halten, aber als er hinaus in das offene Tal gelangte, drang die Kälte ihm bis ins Hirn.
Er hielt das Pferd auf dem öde daliegenden Hofplatz an und ließ den Blick von Haus zu Haus wandern – wenn sie ein Kind bekommen hatte, würden sie Gunhild in die Kammer bei der großen Halle legen. Nun fiel Schnee in großen, nassen Flocken. Er zog das Pferd in den Stall, rieb es mit Stroh warm und trocken und gab ihm Futter und Wasser. Es war frühmorgens, nicht einmal die Hunde waren draußen. Und etwas in ihm schreckte vor dem ersten Zusammentreffen nach so langer Trennung zurück.
Er stand vor der niedrigen, breiten Tür zur Halle, bis der Schnee sein Haar und seine Schultern wie eine nasse Decke umhüllte – ein schwacher Laut von Kinderstimmen drang nach draußen. Sie mußte das Kind bei sich haben – der Gedanke gab ihm frischen Mut, er stieß die Tür auf und trat ein, schlug die Füße gegeneinander, um den Schnee abzuschütteln, und werkelte mit den behandschuhten Händen an der Tür vor sich, der Windfang selbst war leer, dunkel und klamm. Dann stieß er die Tür zu der kleinen Schlafkammer auf, ohne zuvor anzuklopfen, konnte es nicht mehr länger hinausschieben, jetzt mußte er sie sehen.
Jofrid saß mit dem Rücken zur Tür auf der Bettkante, ein Kind auf dem Arm, während ein blutjunges Mädchen mit langem, dünnem Haar, das zu einem Zopf geflochten war, ein anderes kleines Kind, das noch gewickelt war, auf dem Arm hatte.
Sein Blick saugte sich an dem Kinderkopf fest, der ihm am nächsten war: ein kantiger Schädel, bedeckt von dunklem, langem, krausem Seidenhaar. Die Hände des Kindes hatten die Kette ergriffen, die Jofrid um den Hals trug, das Kreuz baumelte, und die Steine darin blitzten, und die kurzen, starken Kinderfinger drückten gegen die große, blaugeäderte Brust.
Das Mädchen gab Jofrid ein Zeichen, sie nahm das Kind von der Brust, bedeckte sie und wandte sich zu ihm um, mit offenen Armen und mit Worten, die er nicht verstand: Es war lange her, daß er seine Muttersprache gehört hatte. Aber er war zu Hause, stürzte vor Jofrid auf die Knie, weil die Beine versagten – er umarmte sie, so gut es sich in der unbequemen Stellung tun ließ, bekam jedoch kein Wort heraus.
Erst als er das Gesicht von ihren Knien hob und Jofrid ansah, begriff er, daß hier etwas nicht stimmte. Es war ihm nicht gelungen, die Frage mit Verstand zu stellen, aber er hörte seine eigene belegte Stimme und sah, wie die Glut in ihren Augen erlosch. Angst, Kummer, all das Neue, das er in ihrem Gesicht lesen konnte, die zwei scharfen Linien zwischen den Augenbrauen.
– Nein! sagte er atemlos und faßte sie hart an den Armen, wollte ihr eine Hand auf den Mund legen, – das kann nicht wahr sein, dann hätte ich es geahnt. Damit spaßt man nicht!
Das Mädchen mit dem Kind kam auch herbei und sah ihn düster an. In dem kleinen einfältigen Gesicht dieser Zwölfjährigen erkannte er sich selbst wieder, wie ein Gespenst, dessen Kommen man vorausgeahnt und gefürchtet hatte. Er wandte sich um und legte die Stirn gegen Jofrids Knie, damit er nichts sehen mußte. Das Mädchen machte einen Knicks, kurz und wütend, legte das Kind in die rotgestrichene Wiege und setzte sie mit dem Fuß in Bewegung. Gunnar sah nur den kleinen, geschmeidigen Fuß, in einem gefältelten roten Lederschuh, die Zehen, die sich um die Kufe krümmten.
Nichts in ihm rührte sich, nichts geschah. Die Leere in ihm wuchs und dehnte sich aus wie eine Feuerkugel, die sich ihren Weg nach draußen brennt. Er konnte nicht weinen. Alles in ihm war ausgedörrt.
Er spürte Jofrids Hände, die sich über sein Gesicht legten. Sie strich ihm über das Haar, den Nacken und den Rücken, als sei er noch ein Kind, das ein liebes Spielzeug in den Brunnen hatte fallen lassen und das seinen Schmerz bald über etwas Neuem, Lustigerem vergessen würde.
Lange Zeit blieb er auf dem Boden vor ihr sitzen, umfangen von der Wärme ihres Körpers, bis sein Vater kam und mit ihm eine Art Gespräch zu führen versuchte. Sie gingen in die Halle, und man stellte ihm einen Krug Bier hin. Er hatte Lust zu trinken, bis all das widerwärtige Wissen ertrank und nie mehr zurückkehrte. Aber wenn er den Mund mit dem perlenden, kalten Gebräu füllte, würde es ihm den Magen umdrehen, und er müßte sich erbrechen.
Das einzige, was er sah, war die Farblosigkeit – als habe der Frost des Winters die Menschen angesteckt. Sein Vater sah schlecht aus, grau, verhärmt, rauh. Die Welt hatte ihre frische Jugend verloren, so wie auch er sich alt und ausgebrannt fühlte.
Alles schoß ihm durch den Kopf. Die Sinnlosigkeit. Gunilla, das Kind, alles, was er in Dänemark gesehen und erlebt hatte. Seine Gedanken zerfielen in unverständliche Bruchstücke – als bekomme sein Verstand Risse und gehe in Auflösung.
– Wie konnte das geschehen – mit beiden? war die einzige Frage, die er stellen konnte. Er war es doch, der sich in Gefahr befunden hatte.
Wenn er versuchte, sich vorzustellen, wie sie in der dampfenden, schwarzen Erde ruhten, seine Gunhild und das Kind, das es nicht einmal aus ihrem Körper herausgeschafft hatte, bevor der Tod sie zu einem Fleisch vereinte. Er hatte viele Leichen gesehen. Steif, zusammengekrümmt in unglaublichen Stellungen. So würden die beiden zusammenliegen, bis das Fleisch zerfiel und nur die bleichen Knochen übrigblieben. Das zarte Skelett des Kindes zwischen ihren Hüftknochen. Die feinen, sanften, rundlichen Knochen, die er liebkost hatte, unter seidenweicher Haut und eingefaßt von lebendem, nachgiebigem Fleisch. Nur sein Körper begriff, daß sie aufgehört hatte zu existieren. Und er hatte es nicht einmal ahnen können: Nicht der leiseste Widerhall eines Schicksalschlages hatte sein Herz in der Fremde getroffen, nicht das schwächste Anzeichen von Mißmut.
Sein Vater räusperte sich und erzählte, voller Verlegenheit nach Worten suchend, daß Gunhild in Skänninge im Kloster der Schwarzen Brüder vor dem Hochaltar liege. Sie hatte eine große Bestattungsfeier bekommen, eine Messe und einen hübschen Grabstein, auf dem sie als Gunnar Ulfssons Ehefrau bezeichnet war. Der Zorn flammte in Gunnar auf: Sie hätten sie doch wohl auf Stroh betten können, bis er nach Hause kam, es waren seine Frau und sein Kind, das einzige, was er besaß. – Aber es war vor mehr als einem Jahr geschehen, erklärte Sten sanft.
Gunnar verstand: Sie konnten ja nicht jahrelang eine verwesende Leiche auf dem Dachboden liegenlassen und warten. Aber für ihn war es, als erwache er und entdecke, daß man ihn im Schlaf seiner Arme und Beine beraubt hat, ihn in einen gliedlosen, hilflosen Klumpen Fleisch verwandelt hat.
Der Vater rang die großen Hände, zitterte leicht, als er den Bierkrug an die Lippen führte. Er hatte etwas auf dem Herzen, was er nur unter Schwierigkeiten vorzutragen vermochte. Das große Erbe, das Gunilla und ihr Vater hinterließen, könne man festhalten, wenn sie einen Zeugen dazu bringen könnten zu beschwören, daß das Kind die Mutter überlebt hatte. Aber nun war so lange Zeit vergangen, und das Kind hatte nicht den Leib der Mutter verlassen, Herr Jon hatte trotzdem versucht, das Kind zu taufen, um ihm den Seelenfrieden zu sichern. Jetzt hatte sich die Familie von Torsten Ödesson des Erbes bemächtigt. Gunnar konnte es nicht fassen – das war unanständig.
In der Nacht konnte er nicht schlafen; lag wach und erinnerte sich an sie. An ihr Lachen, das aus der Kehle kam wie feine Töne aus einer Silberglocke, an die kleinen Zähne und das Haar, an ihre schnellen Füße, wenn sie lief, und an das Kleid, das um die Knöchel wehte. An die nackten Füße, wenn sie die Leiter zum Boden hinaufstieg, und an die kleinen, sonnenverbrannten Zehen, die sich um die Sprossen krümmten.
Er wollte sich am liebsten nicht erinnern, aber sie kam angelaufen und nahm ihren Platz ein, er konnte sie nicht fernhalten, obwohl er Angst hatte, wahnsinnig zu werden.
In dieser Nacht wog er ab, das Für und Wider. Einem Herrn, der seine Getreuen so schlecht behandelte, wollte er nicht dienen; nicht mit dem kleinsten, armseligsten Teil seiner Treue. Und wenn es das Leben kostete.
Schlimmer konnte es jedenfalls nicht mehr kommen.