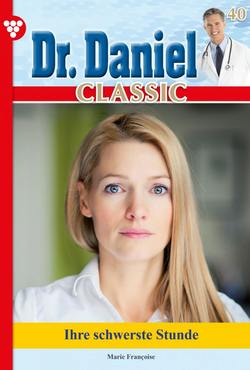Читать книгу Dr. Daniel Classic 40 – Arztroman - Marie-Francoise - Страница 3
ОглавлениеLangsam ging Frau Dr. Manon Carisi durch die Grabreihen des kleinen italienischen Friedhofes, und mit jedem Schritt wurde ihr Herz schwerer. In diesem Moment war sie nicht mehr die freundliche Allgemeinmedizinerin, die in ihrer Praxis in Steinhausen für jedes Problem ein offenes Ohr hatte – jetzt war sie nur noch eine trauernde Witwe.
Drei Jahre, mußte sie unwillkürlich denken. Heute werden es genau drei Jahre, daß Angelo gestorben ist.
Und dabei sah sie vor ihrem geistigen Auge wieder das schnittige Rennboot, sah Angelo, wie er ihr lachend zuwinkte, bevor er sich ans Steuer setzte, um seinem geliebten Hobby nachzugehen. Im nächsten Moment war dann das Boot vor Manons Augen explodiert. Man hatte von einer defekten Benzinleitung gesprochen, doch etwas Genaues war nie herausgefunden worden.
Unwillkürlich schluchzte Manon auf und bedeckte für einen Moment ihre Augen, als könne sie damit die Erinnerung verscheuchen. Es dauerte eine Weile, bis sie ihren Weg fortsetzen konnte. Im selben Moment sah sie die Frau, die an Angelos Grab kniete und mit einer zärtlichen Geste ein paar Blumen hinlegte. Manons Schritt stockte, doch dann zwang sie sich weiterzugehen.
»Buon giorno, Mamma«, grüßte sie leise.
Mit einem Ruck wandte sich die Frau um und funkelte Manon zornig an.
»Es ist alles deine Schuld!« schleuderte sie ihr auf Italienisch entgegen, dann raffte sie ihren Rock zusammen und verließ eiligst den Friedhof, als wäre die Luft durch Manons Anwesenheit plötzlich verpestet.
Traurig sah Manon ihr nach. Ihre Schwiegereltern hatten sie ja nie gemocht, aber daß sie ihr auch noch die Schuld an Angelos Tod gaben…
»Dabei vermisse ich dich doch so sehr«, flüsterte Manon unter Tränen, während sie drei rote Rosen auf das Grab legte.
Angelo Carisi, stand auf dem schmiedeeisernen Kreuz, und darunter hatte ihre Schwiegermutter ein Foto befestigt, das Angelos genauso zeigte, wie Manon ihn in Erinnerung hatte. Braungebrannt und mit fröhlich blitzenden dunklen Augen.
Das Foto verschwamm vor Manons Augen, weil die erneut aufsteigenden Tränen ihren Blick verschleierten. Vierzig Jahre war er nur alt geworden, und dabei hatten sie doch noch so viele gemeinsame Pläne gehabt!
»Geh!«
Die barsche Stimme ihres Schwiegervaters ließ Manon erschrocken hochfahren.
»Du hast ihm nur Unglück gebracht… über uns alle hast du nur Unglück gebracht!«
»Ich habe ihn geliebt«, entgegnete Manon schlicht, doch die tiefe Trauer, die sie empfand, verhinderte, daß ihre Stimme so fest klang, wie sie es sich gewünscht hätte. »Angelo war mein Leben, und er hat für mich dasselbe empfunden.«
Ein Blick voller Haß traf sie. »Über eurer Ehe lag kein Segen, und Angelos Tod war die Strafe dafür.« Voller Verachtung sah der alte Carisi die Blumen an, die Manon auf das Grab gelegt hatte. »Das hättest du dir sparen können, denn damit machst du das, was passiert ist, auch nicht ungeschehen.« Dann reckte er sich hoch.»Komm nie wieder hierher!«
Manon fühlte sich auf einmal wieder so schwach und müde, wie es ihr in den vergangenen Tagen schon öfter passiert war. Sie wollte sagen, daß sie ein Recht darauf hatte, Angelos Grab zu besuchen. Immerhin war sie ja mit ihm verheiratet gewesen, und sie hatten sich geliebt – von ganzem Herzen. Doch sie wußte, daß das vergeblich gewesen wäre. Die Carisis hatten ihre Meinung über Manon nun einmal gefaßt und würden wohl nie mehr davon abzubringen sein. Außerdem fühlte sie sich zu leer und ausgebrannt, um sich auf eine längere Diskussion mit ihrem Schwiegervater einzulassen.
Wortlos drehte sie sich um und verließ mit langsamen, schleppenden Schritten den Friedhof. Dabei wurde sie immer wieder von einem leichten Schwindel ergriffen. Plötzlich sehnte sie sich nach Hause zurück – in das idyllische Vorgebirgsdorf Steinhausen. Dort wurde sie geachtet und geliebt, und dort hatte sie einen Freund, wie sie keinen besseren und ehrlicheren finden konnte: Dr. Robert Daniel.
Kaum in der kleinen Pension angekommen, wo sie sich für ein paar Tage ein Zimmer gemietet hatte, machte sie sich auf die Suche nach dem Hausherrn.
»Signore Bertoni, kann ich bitte telefonieren?« fragte sie in so fließendem Italienisch, daß niemand auf den Gedanken gekommen wäre, sie stamme aus einem anderen Land.
»Si, si, Signora«, beeilte sich Sergio Bertoni zu versichern und begleitete Manon zu dem kleinen Zimmer im hinteren Teil des Hauses, wo das Telefon stand. Er notierte den Stand des Gebührenzählers, dann ließ er Manon allein.
Mit zitternden Händen hob sie den Hörer ab, wählte und lauschte dann voller Anspannung dem eintönigen Tuten.
»Daniel.«
Manon atmete auf, als sie die Stimme des Mannes hörte, mit dem sie nicht nur eine außergewöhnlich gute Freundschaft verband, sondern seit kurzem auch eine gemeinschaftliche Praxis.
»Robert, ich bin’s«, gab sie sich zu erkennen und hatte dabei schon wieder Mühe, die Tränen zurückzuhalten.
»Manon, was ist passiert?« fragte Dr. Daniel besorgt, weil er sogar auf diese Entfernung und durchs Telefon hörte, daß es um seine Freundin nicht sehr gut bestellt sein konnte.
»Nichts besonderes«, behauptete Manon. »Ich wollte nur deine Stimme hören.« Sie schwieg einen Moment, weil ihr plötzlich bewußt wurde, daß das Worte gewesen waren, die eigentlich nur Liebespaare zueinander sagten, dabei hatte es zwischen ihr und Dr. Daniel doch niemals eine intime Beziehung gegeben, und vielleicht würde das auch immer so bleiben. Sie mochten und vertrauten sich – mehr wollte bis jetzt noch keiner von ihnen.
»Es ist so bedrückend hier«, fügte sie leise hinzu. »Vor ein paar Minuten bin ich meinem Schwiegervater begegnet. Er war so… so kalt und herzlos.«
Dr. Daniel spürte, wie dringend Manon gerade jetzt seinen Beistand brauchte.
»Hör zu, heute ist Samstag«, meinte er. »Ich komme zu dir und hole dich ab, einverstanden?«
»Das ist doch Wahnsinn, Robert«, wandte Manon ohne rechte Überzeugung ein. Sie sehnte sich im Augenblick nämlich viel zu sehr nach der Geborgenheit, die sie in Dr. Daniels Nähe empfand. »Ich bin in der Nähe von Neapel…«
»Na und?« entgegnete Dr. Daniel. »Mit dem Flugzeug bin ich in einer Stunde unten. Mach dir keine Gedanken darüber, Manon.« Und dann hielt er sich gar nicht mehr mit langen Diskussionen auf. »Wir sehen uns dann spätestens heute nachmittag.«
*
»Ist Manon etwas passiert?« fragte Dr. Daniels Sohn Stefan, der ungewollt einen Teil des Telefongesprächs mitbekommen hatte.
Dr. Daniel seufzte. »Nein, nicht direkt. Aber weißt du, heute ist der Todestag ihres Mannes, und das nimmt sie natürlich sehr mit. Überdies hatte sie eine Begegnung mit ihrem Schwiegervater. Die Carisis haben Manon nie gemocht, und anscheinend wird er ihr das wieder einmal ganz deutlich gemacht haben.«
Prüfend sah Stefan seinen Vater an.»Was wirst du denn jetzt tun?«
»Ich fliege mit der nächsten Maschine nach Italien«, erklärte Dr. Daniel so, als würde er nur in den Nachbarort fahren.
Überrascht sah Stefan ihn an, dann grinste er. »Das muß die wahre Liebe sein.«
»Stefan, bitte!« entgegnete Dr. Daniel in ungewohnt strengem Ton. »Du weißt ganz genau, daß Manon und mich nur eine gute Freundschaft verbindet. Mehr will weder sie noch ich.« Er schwieg kurz. »Außerdem würde ich für Schorsch beispielsweise dasselbe tun, weil Freunde eben dazu da sind, einander zu helfen.«
»Ich weiß schon, Papa«, meinte Stefan versöhnlich. »Aber in meinen Augen ist deine Freundschaft zu Onkel Schorsch einfach anders als die zu Manon.«
»Weil Schorsch ein Mann ist und Manon eine Frau, aber man kann als Mann auch für eine Frau rein freundschaftlich empfinden. Um das allerdings wirklich zu verstehen, dazu bist du wohl einfach noch zu jung.«
»Möglich«, räumte Stefan ein, weil er nicht damit herausrücken wollte, was er wirklich dachte. Seiner Meinung nach würden sein Vater und Manon Carisi nämlich ganz ausgezeichnet zueinander passen, aber vermutlich war es für eine solche Verbindung einfach noch zu früh. Manon litt offensichtlich sehr unter dem Tod ihres Mannes, und Stefan wußte ganz genau, daß auch Dr. Daniel den tragischen Tod seiner Frau vor gut sechs Jahren noch nicht wirklich verwunden hatte.
Inzwischen war Dr. Daniel wieder in den Flur gegangen und buchte nun einen Platz in der nächsten Maschine nach Neapel. Entschlossen stand Stefan auf.
»Ich fahre dich zum Flughafen«, bot er spontan an.
»Das ist sehr nett von dir, mein Junge«, meinte Dr. Daniel. »Aber hast du denn keine anderen Pläne fürs Wochenende?«
Stefan schüttelte den Kopf. »Nein, aber selbst wenn ich welche hätte, würde ich sie dir und Manon zuliebe gern verschieben.«
Dr. Daniel war tief gerührt. »Danke, Stefan.«
Dann packte er rasch ein paar Sachen zusammen, ließ sich von seinem Sohn zum Flughafen bringen und wartete darauf, daß seine Maschine endlich aufgerufen würde. Wie er zu Manon schon gesagt hatte, erreichte er am frühen Nachmittag Neapel, nahm sich ein Taxi und ließ sich in den winzigen Ort bringen, den Manon ihm noch vor ihrer Abreise genannt hatte. Auch die kleine Pension fand er ohne Probleme, und hier hatte Manon schon für eine Nacht ein Zimmer für ihn bestellt, weil sie es ihm nicht zumuten wollte, gleich heute noch den Rückflug anzutreten.
Dr. Daniel erschrak, als er Manon sah. Wie hatte sie sich innerhalb dieser wenigen Tage, wo sie sich nicht gesehen hatten, nur so verändern können? Sie war schrecklich blaß, hatte dunkle Ringe unter den Augen und wirkte deprimiert und müde.
»Ich fühle mich ganz entsetzlich«, gestand sie, denn obwohl Dr. Daniel kein Wort darüber gesagt hatte, hatte sie gespürt, was in ihm vorgegangen war.
»Das sieht man dir auch an«, entgegnete er ehrlich und legte freundschaftlich einen Arm um ihre Schultern.
Vertrauensvoll lehnte sich Manon an ihn. »Ich bin froh, daß du hier bist.« Sie seufzte leise. »Ich hätte gar nicht herkommen dürfen, aber… Angelo war mein Mann, und… ich habe ihn so sehr geliebt.« Mit feuchten Augen blickte sie zu Dr. Daniel auf. »Sie geben mir die Schuld an seinem Tod.«
»Das ist doch vollkommener Unsinn«, entgegnete Dr. Daniel in seiner ruhigen, verständnisvollen Art, die nicht nur bei seinen Patientinnen Wirkung zeigte. Auch Manon entspannte sich merklich. »Angelo hatte einen sehr tragischen Unfall, und wenn überhaupt jemanden eine Schuld daran traf, dann doch wohl eher den Mechaniker, der für den einwandfreien Zustand seines Rennbootes zu sorgen hatte.«
Manon schüttelte den Kopf. »Angelo hatte keinen Mechaniker. Er hat sich immer selbst um sein Boot gekümmert. Außerdem ist die Ursache für diese schreckliche Explosion zumindest mir völlig gleichgültig, denn auch wenn ich ganz sicher wüßte, warum das Boot hochgegangen ist, würde Angelos Tod dadurch nicht weniger schmerzlich für mich werden.«
Dr. Daniel nickte. Er konnte das, was in Manon vorging, sehr gut nachvollziehen. Für ihn hatte es damals, nach Christines tragischem Tod, auch keinen Trost gegeben. Erst die Zeit hatte den Verlust seiner geliebten Frau einigermaßen erträglich gemacht.
»Vielleicht sollten wir einen kleinen Spaziergang unternehmen«, schlug Dr. Daniel vor. »Die gute Luft hier am Meer wird dir guttun.«
»Sei mir nicht böse, Robert, aber ich möchte nicht«, wehrte Manon ab. »Ich bin so furchtbar müde.«
»Dann leg dich ein bißchen hin«, riet Dr. Daniel ihr. »Ich werde bei dir bleiben, solange du schläfst.«
Dankbar lächelte Manon ihn an. »Ich bin so froh, daß es dich gibt, Robert.«
Sie ließ sich schwer auf das schmale Bett fallen und war fast schon im nächsten Moment eingeschlafen. Erst jetzt zeigte Dr. Daniel seine Besorgnis ganz offen. So kannte er Manon nicht, aber vielleicht hing ihre körperliche und geistige Erschöpfung ja wirklich nur damit zusammen, daß sich Angelos Todestag heute jährte. Außerdem wußte er auch nicht, was sich zwischen ihr und ihrem Schwiegervater genau abgespielt hatte, und Manon war nun mal ein sehr sensibler Mensch. Genau dieser Charakterzug war es ja, den Dr. Daniel – neben vielem anderen – so sehr an Manon schätzte.
»Der Schlaf wird dir guttun«, murmelte er. »Du wirst sehen, danach geht es dir gleich wieder besser. Und morgen werden wir nach Hause fliegen.«
*
In der Steinhausener Waldsee-Klinik herrschte die übliche Sonntagsruhe. Das änderte sich erst, als Sandra Abensberg völlig aufgelöst in die Eingangshalle eilte.
»Helfen Sie mir!« stieß sie hervor, als ihr ein junges Mädchen in Schwesterntracht begegnete. Es war die Krankenpflegehelferin Darinka Stöber, und die hatte jetzt natürlich nichts Eiligeres zu tun, als die diensthabende Ärztin zu informieren.
Es dauerte keine zwei Minuten, bis Frau Dr. Alena Reintaler aus der Gynäkologie in die Eingangshalle kam und sich besorgt zu der jungen Frau hinunterbeugte, die auf einer Bank an der linken Wandseite saß.
»Was ist denn passiert, Frau…« Sie ließ den Satz bedeutungsvoll offen.
»Abensberg«, stieß Sandra hervor, dann sah sie die Ärztin mit gehetztem Blick an. »Wo ist Dr. Daniel?«
»Heute ist Sonntag«, meinte Alena. »Ich nehme also an, daß er zu Hause sein wird. Worum geht’s denn, Frau Abensberg? Ich bin ebenfalls Gynäkologin. Vielleicht kann ich Ihnen auch helfen.«
»Ich bin schwanger«, brachte Sandra mühsam hervor, und erst jetzt fiel Alena die sanfte Wölbung unter dem Mantel der jungen Frau auf. Nervös nestelte sie ihren Mutterpaß aus der Tasche und reichte ihn Alena. »Fünfundzwanzig-
ste Schwangerschaftswoche. Und jetzt… seit einer Stunde… habe ich plötzlich so komische Schmerzen…« Aus weit aufgerissenen Augen starrte sie die Ärztin an. »Ich habe solche Angst, Frau Doktor.«
»Verständlicherweise«, meinte Alena in ihrer ruhigen Art. »Aber Sie sollten sich trotzdem noch keine allzu großen Sorgen machen. Vielleicht ist alles nur halb so schlimm. Jetzt werden wir erst mal in die Gynäkologie hinübergehen, und dann werde ich mir gleich ansehen, was es mit Ihren Beschwerden tatsächlich auf sich hat. Vielleicht beschreiben Sie mir inzwischen schon mal, um was für eine Art von Schmerzen es sich genau handelt.«
Ein wenig ratlos sah Sandra die junge Ärztin an. »Ich weiß nicht… es ist irgendwie seltsam. Mein Bauch wird immer wieder ganz hart, und dabei entsteht so ein unangenehmes Ziehen. Es tut eigentlich nicht wirklich weh… zumindest nicht so, daß man es nicht aushalten könnte, aber es ist schon schrecklich unangenehm, und es kommt immer wieder.«
Alena nickte. »Ich vermute, Sie leiden unter vorzeitigen Wehen.«
Sandra erschrak sichtlich. »Ist das schlimm? Ich meine… werde ich jetzt etwa mein Baby verlieren?«
Beruhigend lächelte Alena sie an. »Ich werde alles tun, um das zu verhindern, das verspreche ich Ihnen, und vorerst wissen wir ja auch noch gar nicht, ob es tatsächlich vorzeitige Wehen sind.«
Inzwischen hatten sie die Gynäkologie erreicht, und Alena bat ihre Patientin, sich auf die Untersuchungsliege zu legen.
»Keine Angst, ich tue Ihnen nicht weh«, erklärte Alena, während sie eine Art Gurt um Sandras Bauch legte. »Ich werde Sie nur an den Wehenschreiber anschließen. Die ganze Geschichte dauert etwa eine halbe Stunde, dann sehen wir weiter. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben oder Ihnen in der Rückenlage vielleicht übel wird, dann sagen Sie es mir bitte.«
Obwohl ihr die Fürsorge der jungen Ärztin guttat, konnte Sandra die Angst, die sie in sich trug, doch nicht ganz unterdrücken. Ein wenig unsicher betrachtete sie das leise summende Gerät, das irgendwelche Linien aufzeichnete.
»Sie müssen keine Angst haben«, meinte Alena beruhigend, die spürte, was in der Patientin vorging. »Selbst wenn Sie vorzeitige Wehen haben sollten, ist das nicht unbedingt ein Grund zur Sorge. In den meisten Fällen kann man das mit Bettruhe wieder in den Griff bekommen, und selbst wenn diese Methode hier versagen sollte, gibt es wehenhemmende Medikamente, die dem Baby nicht schaden.«
Sandra nickte.
»Wissen Sie, eigentlich ist es ja seltsam«, erklärte sie leise. »Ich kann mir meine Angst um das Baby selbst nicht so recht erklären.« Sie zögerte. »Ich will es doch zur Adoption freigeben… das heißt, ich muß. Ich stecke mitten in der Ausbildung und…« Sie zuckte die Schultern. »Nun ja, mein Freund hat es mit dem Heiraten leider nicht so ernst gemeint, wie er vorher sagte.«
Teilnahmsvoll sah Alena die junge Frau an.»Es muß schlimm sein, ein Kind, das man so heranwachsen fühlt, weggeben zu müssen.«
»Es ist wirklich nicht ganz einfach«, gab Sandra offen zu. »Andererseits – ich wollte ja kein Kind… jedenfalls jetzt noch nicht. Wenn Tobias zu mir gestanden hätte, dann hätten wir es sicher irgendwie geschafft, aber so… ich will nicht meine ganzen Pläne über den Haufen werfen, nur weil ich ein Baby bekomme.« Unwillkürlich streichelte sie über ihren Bauch. »Ich würde mein Kind und mich nur unglücklich machen, wenn ich es behalten würde. Da gebe ich es lieber weg – in eine Familie, wo man es zärtlich umsorgen und von ganzem Herzen lieben wird.«
»Sie werden es nie sehen«, wandte Alena unwillkürlich ein. »Glauben Sie, daß Sie damit leben können?«
Sandra dachte lange über diese Worte nach, dann nickte sie. »Ja, ich denke schon. Wissen Sie, ich habe diese Entscheidung nicht übers Knie gebrochen. Zusammen mit Dr. Daniel habe ich lange darüber nachgedacht, und er billigt meinen Entschluß. Er sagt sogar, es wäre in diesem Fall verantwortungsvoller, das Kind wegzugeben anstatt es zu behalten.« Sie seufzte. »Eigentlich hätte es ja gar nicht passieren dürfen. Ich habe immer die Pille genommen – nur ein einziges Mal habe ich sie doch vergessen.« Sie zuckte die Schultern. »Da war es auch schon passiert.« Besorgt sah sie Alena an. »Sind Sie ganz sicher, daß ich das Baby nicht verlieren werde? Wissen Sie, ich möchte, daß es lebt und glücklich wird – wenn auch nicht mit mir.«
Dieser Einstellung rang Alena etwas wie Bewunderung ab. Schließlich hätte Sandra das alles auch einfach auf sich zukommen lassen können. Eine Fehlgeburt hätte sie ja von allen Problemen befreit, doch sie sorgte sich um ihr Kind, obwohl sie es nach der Geburt weggeben und niemals mehr sehen würde.
»Wie gesagt, Frau Abensberg, Sie werden jetzt erst mal strikte Bettruhe halten«, meinte Alena. »Dann werden wir schon sehen, ob die Wehentätigkeit nachläßt. Und wenn es Sie beruhigt, kann ich rasch eine Ultraschalluntersuchung vornehmen.«
Sandra nickte eifrig. »Ja, Frau Doktor, das wäre sehr nett.«
Die Vorbereitungen waren rasch getroffen, dann verteilte Alena das spezielle Gel auf Sandras Bauch und ließ den Schallkopf darübergleiten.
»Da sehen Sie sich mal diesen Zwerg an«, meinte Alena schmunzelnd. »Tummelt sich im Fruchtwasser, lutscht am Daumen und ahnt nicht einmal, welche Sorgen es uns macht.« Sie hielt das Bild auf dem Monitor an und zeigte auf eine bestimmte Stelle. »Können Sie sehen, wie das Kleine die Hand am Mund hat?«
Angestrengt betrachtete Sandra die grauen Schatten, dann schüttelte sie den Kopf.
»Wenn ich ehrlich bin, ich sehe überhaupt nichts«, gestand sie.
Alena lächelte. »Das ist nicht ungewöhnlich, Frau Abensberg. Eine Ultraschallaufnahme ist eben leider kein Foto.« Sie ließ das Bild wieder weiterlaufen, betrachtete die Bewegungen des Ungeborenen und runzelte plötzlich besorgt die Stirn.
Sandra bemerkte es.
»Ist etwas nicht in Ordnung?« fragte sie erschrocken.
»Nein, nein, alles bestens«, antwortete Alena fast ein wenig zu rasch, während sie weiterhin das Bild betrachtete, das ihr aus San-dras Bauch gesendet wurde, dann schaltete sie den an das Gerät installierten Videorecoder an, um das, was sie sah, aufzunehmen, damit sie es später Dr. Daniel zeigen und ihn nach seiner Meinung fragen könnte.
*
Der Flug nach München und die anschließende Heimfahrt wurden für Manon Carisi trotz Dr. Daniels Anwesenheit zu einer reinen Qual. Sie fühlte sich müde und kraftlos, dazu kam so ein unangenehmes Gefühl, als hätte sie Fieber. Immer wieder verspürte sie das Bedürfnis, sich sämtliche Kleidungsstücke vom Leib zu reißen, und so sehnte sie sich förmlich nach Hause.
Erschöpft schloß Manon die Augen und versuchte, die Hitze in ihrem Körper zu vergessen. Dann hielt das Taxi endlich an.
»Komm, Manon, ich begleite dich noch nach oben«, erklärte Dr. Daniel, doch sie wehrte ab.
»Das ist nicht nötig, Robert, du hast schon so viel für mich getan«, meinte sie, verabschiedete sich und stieg mit langsamen Bewegungen aus.
Besorgt sah Dr. Daniel ihr nach, wartete, bis sie im Haus verschwunden war, und ließ sich dann zu seiner Villa fahren. Dabei ließ ihn die Sorge um Manon nicht los. Irgendwie schien es ihm, als sei nicht nur die Trauer um Angelo der Grund für ihre schlechte Verfassung.
Währenddessen hatte Manon ihre Wohnung im ersten Stockwerk erreicht, schloß mit zitternden Fingern die Tür auf, und kaum hatte sie die Wohnungstür wieder hinter sich geschlossen, da gab sie dem Verlangen in sich nach. Hastig zog sie sich aus und betrat dann ihr Schlafzimmer. Sie genoß es, die angenehme Kühle auf der Haut zu fühlen.
Müde ließ sie sich auf ihr Bett sinken und schlief sofort ein. Sie erwachte erst, als sie zu frieren begann, aber noch bevor sie aufstehen und sich etwas anziehen konnte, wurde sie von einem heftigen Schüttelfrost ergriffen. Mit Mühe hüllte sich Manon in die Bettdecke, doch das unkontrollierbare Zittern ließ nicht nach. Irgendwann schlief Manon wieder ein, und als sie am folgenden Morgen erwachte, fühlte sie sofort wieder die Hitze in ihrem Körper.
Langsam stand sie auf, schleppte sich mit Mühe ins Badezimmer und holte ihr Fieberthermometer hervor.
»38,7«, flüsterte sie bestürzt, als sie ihre Temperatur schließlich kontrollierte, dann seufzte sie tief auf. »Ich muß mir eine Erkältung eingefangen haben.«
Obwohl auch ihre Gliederschmerzen dafür sprachen, ahnte sie irgendwie, daß ihr momentaner Zustand mit einer Erkältung nichts zu tun hatte. Schließlich fühlte sie sich ja schon seit einiger Zeit so
energielos, und dann immer diese ständige Müdigkeit…
Sie überlegte einen Moment, bevor sie nach dem Telefonhörer griff und Dr. Daniels Nummer wählte.
Seine Schwester Irene, die ihm hier in Steinhausen den Haushalt führte, meldete sich.
»Manon, es tut mir leid, aber Robert ist gerade eben in die Praxis hinuntergegangen«, erklärte sie. »Warten Sie einen Moment, ich verbinde Sie nach unten.«
Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis Dr. Daniel am Apparat war.
»Manon, was ist los?« fragte er, und aus seiner Stimme konnte sie unschwer seine Besorgnis heraushören.
»Ich muß mir eine Erkältung eingefangen haben«, antwortete Manon und bemühte sich um ein wenig Munterkeit, was ihr aber kläglich mißlang. »Vielleicht bist du so lieb und sagst Fräulein Klein Bescheid, daß mein Teil der Praxis heute geschlossen bleiben muß.«
»Das ist doch selbstverständlich, Manon«, entgegnete Dr. Daniel. »Und ich werde nach der Sprechstunde zu dir hinüberkommen, das heißt… ich schicke wohl besser Wolfgang zu dir.«
»Das ist doch nicht nötig, Robert«, wehrte Manon ab. »Ich habe ein bißchen Fieber und Gliederschmerzen. Mit ausreichend Schlaf und ein paar Tassen Lindenblütentee…«
»Kommt gar nicht in Frage«, fiel Dr. Daniel ihr energisch ins Wort. »Hör mal, Manon, du bist Ärztin, also weißt du auch ganz genau, daß du dir ebensogut eine gefährliche Virusgrippe eingefangen haben kannst. Ich nehme nämlich an, daß du mit der Grippeimpfung ebenso nachlässig verfahren hast wie ich.«
Gegen ihren Willen mußte Manon lächeln. »Richtig. Meinen Patienten empfehle ich die Grippeimpfung immer, und das ist auch besser so, aber ich…« Sie seufzte. »Du weißt ja, wie das ist. Irgendwie hält man sich selbst für immun.«
»Das sind wir aber leider nicht. Also, Manon, ich rufe jetzt sofort in der Waldsee-Klinik an und sage Bescheid, daß die Frau Doktor einen Doktor braucht.«
Wieder mußte Manon lächeln. »Das hast du nett gesagt, Robert. Allerdings halte ich es nach wie vor nicht für nötig, daß Wolfgang nur wegen diesem bißchen…«
»Du wirst dich untersuchen lassen. Ende der Diskussion.« Dr. Daniel schwieg kurz. »Bitte, Manon, sei vernünftig.«
»Ist ja schon gut«, gab sie seufzend nach. »Ich sehe ein, daß du recht hast. Aber ein bißchen unangenehm darf es mir doch wohl sein, wenn ich einen Kollegen wegen solcher Lappalien belästigen muß.«
»Ich bin sicher, daß Wolfgang es nicht als Belästigung sehen wird. Und ich werde dich besuchen, sobald es meine Zeit erlaubt – wahrscheinlich am frühen Nachmittag.«
»Ich freue mich auf dich«, gestand Manon, dann seufzte sie. »Die letzten Tage waren wohl ein bißchen zu anstrengend. Die Reise nach Italien, die Begegnung mit meinen Schwiegereltern und ihre Vorwürfe…«
»Denk nicht mehr daran«, riet Dr. Daniel ihr in sanftem Ton. »Die Carisis haben ihren Sohn durch ein schreckliches Unglück verloren, das macht sie wahrscheinlich noch verbohrter, als sie es ohnehin schon waren.« Er zögerte. »Ich weiß, daß es für dich hart klingen muß, aber… vielleicht wäre es tatsächlich besser, wenn du nicht mehr hinfahren würdest.«
»Es wäre sogar ganz sicher besser«, stimmte Manon leise zu. »Aber ich fürchte, ich muß einfach immer wieder hinfahren. Ich habe Angelo so sehr geliebt, und nun soll ich nicht einmal mehr sein Grab besuchen dürfen… das ist zuviel verlangt. Ich werde es künftig allerdings vermeiden, an seinem Todestag hinzufahren, denn eine weitere Begegnung mit seinen Eltern möchte ich mir um jeden Preis ersparen.«
Bei den letzten Worten hatte ihre Stimme wieder merklich müde geklungen.
»Du solltest jetzt besser schlafen«, meinte Dr. Daniel, dann warf er einen kurzen Blick auf die Uhr. »Vor elf wird Wolfgang sicher keine Zeit haben, um zu dir zu kommen.«
Manon murmelte eine Zustimmung, verabschiedete sich von Dr. Daniel und legte schließlich auf, dann schleppte sie sich mit Mühe ins Bett und war schon kurz darauf eingeschlafen.
*
Dr. Daniel kam nicht dazu, in der Waldsee-Klinik anzurufen. Er hatte nach dem Gespräch mit Manon den Hörer noch gar nicht richtig aufgelegt, als das Telefon bereits wieder klingelte.
»Frau Dr. Reintaler ist am Apparat«, erklärte die junge Empfangsdame Gabi Meindl. »Sie sagt, es wäre dringend.«
»In Ordnung, ich übernehme«, entgegnete Dr. Daniel und drückte auf den Knopf, der das Gespräch auf seinen Apparat legte. »Alena? Was ist los?«
»Eine ganze Menge, fürchte ich«, antwortete die Gynäkologin der Waldsee-Klinik. »Ich habe seit gestern eine Patientin von Ihnen auf der Station. Sandra Abensberg. Sie kam gestern nachmittag mit vorzeitigen Wehen und machte sich große Sorgen um ihr Baby. Deshalb habe ich noch eine Ultraschallaufnahme gemacht und dabei…« Sie zögerte. »Ich möchte Ihnen das gern zeigen, Robert. Immerhin könnte es ja sein, daß ich mich irre.« Wieder schwieg sie einen Moment. »Ich hatte es gestern schon mal bei Ihnen versucht, aber Sie waren leider nicht zu Hause.«
»Ich mußte dringend nach Italien«, meinte Dr. Daniel, dann überlegte er einen Moment. »Also schön, Alena, ich komme gleich in die Klinik hinüber – auch auf die Gefahr hin, daß mich mei-
ne Sprechstundenhilfe vierteilen wird. Im Wartezimmer sitzen nämlich schon wieder drei Patientinnen.«
Die Gefahr, daß die sanfte Sarina von Gehrau ihren Chef vierteilen würde, bestand natürlich in Wirklichkeit nicht. Sie konnte einen leisen Seufzer zwar nicht unterdrücken, versicherte aber, daß sie und Gabi für eine Weile auch allein fertig werden würden.
»Ich beeile mich«, versprach Dr. Daniel noch, und Sarina nickte lächelnd, obwohl sie ihren Chef insgeheim schon für die nächsten ein bis zwei Stunden abschrieb.
Keine zehn Minuten später betrat Dr. Daniel die Waldsee-Klinik, zögerte einen Moment und wandte sich zuerst dem rechten Flügel zu, wo die Chirurgie untergebracht war. Er fand den Chefarzt Dr. Wolfgang Metzler in dessen Büro.
»Ein Direktor am frühen Morgen bringt Kummer und Sorgen«, dichtete Wolfgang grinsend, als Dr. Daniel nach kurzem Anklopfen hereintrat.
Doch dem Arzt stand heute nicht der Sinn nach Scherzen, und die hochtrabende Anrede gefiel ihm sowieso nicht. Er war nämlich viel zu bescheiden, als daß er sich auf den Posten eines Klinikdirektors irgend etwas eingebildet hätte.
»Könntest du ausnahmsweise einmal ernst bleiben, Wolfgang?« fragte er, wartete eine Antwort aber gar nicht erst ab. »Manon ist krank. Angeblich nur eine Erkältung, aber sie hat Fieber und kam mir gestern schon ein wenig seltsam vor. Erschöpft und sehr blaß.«
Dr. Metzler nickte, noch bevor Dr. Daniel weitersprechen konnte.
»Ich werde gleich nach der Visite zu ihr hinübergehen, und wenn ich es nicht schaffen sollte, schicke ich Gerrit zu ihr.«
»Genau darum wollte ich dich bitten«, meinte Dr. Daniel, dann sah er auf die Uhr. »Ich hab’s heute ziemlich eilig.«
»Heute?« Dr. Metzler schüttelte den Kopf. »Mein lieber Robert, das wird bei dir allmählich zum Dauerzustand, und ich will ehrlich sein: Dieser ständige Streß, unter dem du stehst, gefällt mir gar nicht.«
»Wer hat mir denn den Klinikdirektor damals aufs Auge gedrückt?« fragte Dr. Daniel lä-chelnd, doch diesmal blieb Dr. Metzler ernst.
»Das war ich«, gab er offen zu. »Aber der Direktorenposten ist ja auch gar nicht der Grund dafür, daß du dich Tag für Tag förmlich zerreißt. »Es ist vielmehr…«
»Ach, Wolfgang, laß es gut sein«, fiel Dr. Daniel ihm ins Wort. »Zum einen habe ich nämlich absolut keine Zeit, um mir deine Ausführungen anzuhören, und zum anderen sorgst du dich völlig grundlos um mich. Ich weiß schon sehr gut, was ich aushalten kann.«
»Hoffentlich«, murmelte Wolfgang, doch das hörte Dr. Daniel bereits nicht mehr. Nach einem flüchtigen Abschiedsgruß hatte er das Büro verlassen und eilte nun in die Gynäkologie hinüber, wo er von Frau Dr. Reintaler sehnlichst erwartet wurde.
»Also, Alena, was gibt’s?« wollte er wissen.
Statt einer Antwort legte sie die Videocassette ein und zeigte Dr. Daniel die Ultraschallaufnahme von Sandra Abensbergs ungeborenem Kind.
»Achten Sie auf das Herz, Robert«, betonte sie. »Ich hoffe, daß ich mich irre, aber ich bin der Meinung, daß da etwas nicht stimmt.«
Dr. Daniel betrachtete die Aufnahmen mehrere Male, dann nickte er mit ernstem, äußerst besorgtem Gesicht.
»Sie haben ganz recht, Alena, das Kind hat offensichtlich einen Herzfehler«, meinte er. »Und so wie ich es sehe, läßt sich das auch nicht im Mutterleib behandeln. Allerdings werde ich sie sicherheitshalber nach München in die Sommer-Klinik bringen lassen. Dr. Sommer hat einen erstklassigen Pränatal-Diagnostiker, der schon ganz überraschende Dinge vollbracht hat.«
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und erkannte, daß er eigentlich in die Praxis hätte zurückgehen sollen, doch dann entschloß er sich spontan, statt dessen noch schnell zu Sandra Abensberg hinaufzugehen.
Als Dr. Daniel nach kurzem Anklopfen eintrat, lächelte ihm die junge Frau entgegen.
»Herr Doktor, schön, daß Sie mich besuchen. Allerdings hätten Sie nicht extra während Ihrer Sprechzeit kommen müssen. Frau Dr. Reintaler hat sich ganz lieb um mich gekümmert, und sie hatte auch vollkommen recht: Seit ich im Bett liege, haben die Wehen wieder aufgehört.«
»Das ist ja schon sehr erfreulich«, stellte Dr. Daniel fest, dann setzte er sich ohne große Umstände auf die Bettkante. »Ich komme eigentlich gar nicht wegen der vorzeitigen Wehen, Frau Abensberg. Es ist…« Er stockte, weil er nicht so recht wußte, wie er das, was er vermutete, Sandra beibringen sollte. »Frau Dr. Reintaler hat gestern noch eine Ultraschallaufnahme gemacht, und dabei hat sich leider ergeben, daß Ihr Baby… nun, es ist allem Anschein nach nicht vollkommen gesund.«
Sandra erschrak zutiefst. »Ist es womöglich… behindert?« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann doch gar nicht sein! Sie selbst sagten doch schon bei der ersten Ultraschalluntersuchung, daß alles in Ordnung wäre! Sie können sich bestimmt nicht geirrt haben!«
»Nein, Frau Abensberg, es ist keine Behinderung, wie Sie es sich vorstellen, sondern… es ist das Herz. Wenn wir den letzten Ultraschalltermin nicht hätten verschieben müssen, dann hätte ich es vermutlich schon vor vier Wochen bemerkt.« Er fuhr sich mit einer Hand durch das dichte, blonde Haar. »Allerdings hätte das im Prinzip auch nicht viel geändert.« Er zögerte. »Wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich Sie gern für einen Tag nach München bringen lassen. In der Klinik meines Freundes arbeitet ein sogenannter Pränatal-Diagnostiker, der im Gegensatz zu mir beurteilen kann, ob man den Herzfehler Ihres Kindes vielleicht schon im Mutterleib behandeln kann.«
Aus weitaufgerissenen Augen starrte Sandra den Arzt an. »Wie bitte?« Fassungslos schüttelte sie den Kopf. »Ist das nicht furchtbar gefährlich?«
»Natürlich birgt ein solches Verfahren gewisse Risiken«, räumte Dr. Daniel ein. »Aber zumindest in der Sommer-Klinik hätte ich in dieser Hinsicht keinerlei Bedenken.« Wieder machte er eine kurze Pause. »Erst mal müssen wir jedoch abklären, ob eine Behandlung in diesem Fall überhaupt möglich ist.« Daß er selbst das für sehr unwahrscheinlich hielt, verschwieg er im Moment vorsichtshalber.
Aufmerksam sah Sandra den Arzt an. »Wenn mein Kind tatsächlich einen Herzfehler haben sollte… vielleicht sogar einen, der sich nicht behandeln läßt – wie groß sind dann die Chancen, daß sich ein Ehepaar finden läßt, das bereit ist, dieses Baby zu adoptieren?«
Das war genau die Frage, mit der Dr. Daniel gerechnet hatte, und das Schlimmste war, daß er für Sandra jetzt keine befriedigende Antwort parat hatte.
»Ich will ehrlich sein, Frau Abensberg, es wird sicher nicht einfach werden«, gestand er. »Allerdings gibt es immer wieder Ehepaare, die sich nicht scheuen, auch ein nicht völlig gesundes Kind zu adoptieren.«
*
Es kostete Manon Carisi große Mühe, aus dem Bett zu kommen, als es an ihrer Wohnungstür klingelte.
»Gerrit, Sie sind’s«, erklärte sie mit müder Stimme, dann ließ sie den jungen Arzt herein. »Es war sicher unnötig, daß Sie hergekommen sind, aber Robert ließ es sich einfach nicht ausreden.«
Dr. Gerrit Scheibler, der in der Waldsee-Klinik als Oberarzt tätig war, folgte Manon ins Schlafzimmer, dann sah er sie aufmerksam an.
»Mir scheint, so ganz unberechtigt sind die Sorgen, die er sich um Sie macht, nun auch wieder nicht«, entgegnete er. »Im Normalfall sagt man einer Dame ja nicht, daß sie ganz entsetzlich aussieht, aber ich glaube, als Arzt darf ich mir das einer Patientin gegenüber durchaus erlauben.«
Obwohl sie sich so elend fühlte, mußte Manon bei diesen Worten lächeln.
»Ein Kompliment war das ja wirklich nicht«, meinte sie. »Aber ich habe Ihre Bemerkung schon richtig verstanden, Gerrit, und ich kann Ihnen auch versichern, daß ich nicht nur entsetzlich aussehe, sondern mich auch so fühle. Es ist offensichtlich eine schwere Erkältung, die ich mir da eingefangen habe.« Sie seufzte, während sie sich wieder auf ihr Bett sinken ließ. »Sicher ist es nicht nur der Virus, der mich erwischt hat. Meine psychische Verfassung ist im Augenblick auch nicht gerade die beste.«
Dr. Scheibler nickte. »Wolfgang hat schon erwähnt, daß Sie momentan in einem ziemlichen Tief stecken. Er wäre übrigens persönlich hergekommen, aber ein Notfall hat ihn im OP festgehalten.« Er lächelte. »Ich hoffe, Sie nehmen in diesem Fall auch mit mir vorlieb.«
»Natürlich, Gerrit«, stimmte Manon sofort zu. »Und wie gesagt – ich halte diesen ganzen Aufwand für überflüssig. Ein paar Tage Bettruhe, dann bin ich bestimmt wieder auf dem Damm.«
»Eine Untersuchung kann ja nicht schaden«, entgegnete Dr. Scheibler. »Und zumindest in einem hat Robert recht: Es könnte sich ja tatsächlich um eine Virusgrippe handeln, und damit ist nun wirklich nicht zu scherzen. Vielleicht schildern Sie mir zuerst mal Ihre Beschwerden.«
»Seit gestern abend habe ich ein bißchen Fieber«, begann Manon, »außerdem schreckliche Gliederschmerzen. Ich fühle mich ständig müde und…« Sie stockte, als sie plötzlich bemerkte, wie ihre Nase zu bluten begann. Rasch drückte sie ein Papiertaschentuch an die Nase. »So ein Mist, das ist heute nun schon das zweite Mal.«
Alarmiert horchte Dr. Scheibler auf. Die Erinnerung an seine eigene schwere Krankheit, die noch gar nicht so lange zurücklag, drängte sich ihm unwillkürlich auf.
»Seit wann fühlen Sie sich so müde und ausgelaugt?« wollte er wissen.
Manon zuckte die Schultern. »Ich habe eigentlich nicht darauf geachtet, aber jetzt, wo Sie danach fragen… es passiert mir schon seit einigen Wochen, daß ich rasch ermüde.«
»Haben Sie an Gewicht verloren?« fragte Dr. Scheibler weiter.
»Ja, aber das war auch beabsichtigt«, antwortete Manon. »Ich hatte zugenommen und wollte wieder ein paar Kilo loswerden.« Sie runzelte die Stirn. »Warum fragen Sie das alles?«
»Weil ich einen ganz schlimmen Verdacht habe«, gab Dr. Scheibler offen zu. »Ich litt vor einiger Zeit an genau denselben Erscheinungen.« Und wäre beinahe daran gestorben, fügte er in Gedanken hinzu.
Entschlossen stand er auf. »Manon, ich nehme Sie jetzt sofort mit in die Klinik. Nur da kann ich Sie umfassend untersuchen.«
»Was heißt ›umfassend‹?« wollte Manon wissen. »Ich bin selbst Ärztin. Mir können Sie es also sagen.«
Dr. Scheibler atmete tief durch. Wenn er Manon jetzt gestand, was für eine Untersuchung er durchführen wollte, dann wußte sie mit Sicherheit, welche Krankheit er vermutete. Andererseits konnte er diese Wahrheit nicht für immer vor ihr verbergen.
»Ich muß eine Knochenmarkbiopsie vornehmen«, erklärte er.
Manon erbleichte.
»Nein«, flüsterte sie. »Bitte, Gerrit… Sie müssen sich irren. Es ist nur eine Erkältung… vielleicht eine Virusgrippe, aber nicht… nicht Leukämie.«
»Manon, ich weiß es jetzt noch nicht«, erklärte Dr. Scheibler eindringlich. »Aber so leid es mir tut – wir müssen mit der Möglichkeit dieser Diagnose rechnen.«
Manon schluchzte auf. »Ich will nicht sterben!«
Da griff Dr. Scheibler nach ihrer Hand. »Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich selbst Leukämie, und ich wurde geheilt.« Unter welchen dramatischen Umständen das geschehen war, verschwieg er allerdings lieber. »Kommen Sie, Manon, fahren wir in die Klinik, und dann sehen wir weiter. Die Untersuchung könnte ja auch etwas ganz Harmloses ergeben.« Doch daran glaubte er eigentlich selbst nicht.
*
Die letzte Patientin des Vormittags war Dr. Daniel wohlbekannt.
»Priska! Das ist aber eine Überraschung«, erklärte er und ergriff mit einem herzlichen Lächeln ihre Hand.
Unwillkürlich mußte er daran denken, wie es diese junge Frau einst nach Steinhausen verschlagen hatte – gerade achtzehn Jahre alt war sie damals gewesen, und ihre Stiefmutter hatte durch böse Raffinesse dafür gesorgt, daß Priska als Analphabetin aufgewachsen war. Erst hier in Steinhausen hatte sie dann ihr Glück gefunden. Mit Hilfe des jungen Studenten Christian Seidemann hatte sie lesen und schreiben gelernt und sich schließlich in ihn verliebt. Mittlerweile waren die beiden glücklich verheiratet, und Priska arbeitet als Sekretärin beim Steinhausener Pfarrer Klaus Wenninger.
»Nun, Priska, wie geht es Ihnen?« wollte Dr. Daniel wissen, und plötzlich fiel ihm der niedergeschlagene Gesichtsausdruck der jungen Frau auf. »Sie sind doch nicht etwa krank?«
Priska schüttelte den Kopf. »Nein, Herr Doktor, es ist keine Krankheit, die mich zu Ihnen führt, sondern… Chris und ich… wir wünschen uns sehnlichst ein Baby.«
Dr. Daniel nickte. »Ich verstehe.« Mit einem tiefen Seufzer lehnte er sich auf seinem Sessel zurück. »Wissen Sie, Priska, damals, gleich nach der Operation, konnten und wollten wir es Ihnen nicht sagen, weil…«
Priskas Blick wurde abweisend. »Soll das etwa heißen, daß Sie und Dr. Sommer mich belogen haben? Ist die Operation in Wirklichkeit überhaupt nicht geglückt?«
»Doch, Priska, das schon, aber nur teilweise.« Dr. Daniel schwieg einen Moment. »Sie wurden als Vierzehnjährige auf Betreiben Ihrer Stiefmutter sterilisiert, und unglücklicherweise wurde dieser Eingriff damals so schlampig durchgeführt, daß es Dr. Sommer nur mit großer Mühe gelungen ist, wenigstens einen Eileiter wieder funktionsfähig zu machen. Natürlich war uns von vorn herein klar, daß Sie nur schwer schwanger werden können, also haben wir Ihnen diese Tatsache verschwiegen – nicht um Sie zu täuschen, sondern um Ihnen so gut wie möglich zu helfen. Wir dachten nämlich, daß Ihre Chancen, schwanger zu werden, weit größer wären, wenn Sie unbelastet darauf zugehen würden. Die Gewißheit, daß lediglich ein Eileiter funktionsfähig ist, hätte Sie in unseren Augen nur hemmen können.«