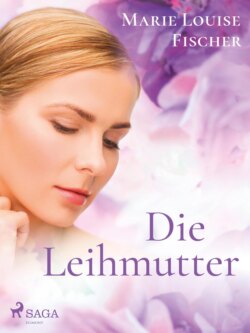Читать книгу Die Leihmutter - Marie Louise Fischer - Страница 5
II
ОглавлениеAls Beate ihre Wohnung betrat, hatte sie sofort das Gefühl, daß niemand da war. Tatsächlich waren Kinderzimmer und Küche leer. Sie klopfte an die Tür des alten Herrn, aber erhielt keine Antwort.
Sie dachte kurz nach und machte sich dann daran, das Spülbecken zu säubern und das Geschirr fortzuräumen. Danach ging sie in das Schlafzimmer und riß das Fenster zum Hof auf. Werders Wohnung lag im Erdgeschoß. Das hatte den Nachteil, daß sie recht laut war, dagegen den Vorteil, daß Beate sich mit dem Kinderwagen leichtgetan hatte und der Garten mit wenigen Schritten zu erreichen war.
Auch jetzt ging es lebhaft dort zu. Ein Baby schrie und Hunde bellten. Frauen saßen in der Sonne, ließen ihre Stricknadeln klappern und unterhielten sich. Kinder spielten, lachten, lärmten.
Florian und sein Großvater waren nicht zu sehen. Beate seufzte erleichtert auf. Wahrscheinlich, dachte sie, waren sie spazierengegangen. Sie streifte die Schuhe von den Füßen, zog den Rock aus und legte sich, die Hände unter dem Kopf verschränkt, auf ihr Bett. Sie hatte sich angewöhnt, jede Gelegenheit zu nutzen, die sich ihr zum Ausspannen bot.
Sie dachte an Frank und daran, wie sonderbar klein er gewirkt hatte, als er da in seinem rotseidenen Hausmantel allein in dem hohen Gang gestanden hatte. Dabei war er tatsächlich groß, über 1,80.
Als sie ihn kennengelernt hatte, auf einem Faschingsball im Deutchen Theater, sie erinnerte sich noch genau daran, war er ihr wegen seiner Größe unter den anderen jungen Leuten aufgefallen. Er war als Pirat erschienen, ein Tuch, das aus demselben Material hätte sein können wie sein Hausmantel, um den Kopf geschlungen. Vor dem einen Auge hatte er eine schwarze Klappe getragen, aber das andere hatte vor Unternehmungslust und Heiterkeit gefunkelt.
Wie kam es, daß er in den wenigen Jahren, die sie sich kannten, seinen Schwung so gänzlich verloren hatte? War es die Ehe, die ihm nicht bekam? Bedrückte ihn die Verantwortung der Vaterschaft? Waren es die Sorgen um sein Geschäft, die ihn erstickten? Oder war die Tatsache, daß sein Herz nicht mehr genügend durchblutet war, die Ursache seiner Veränderung?
Er war nicht mehr der Mann, den sie geheiratet hatte, aber sie fühlte, daß sie ihn, nachdem sie das Stadium blinder Verliebtheit überwunden hatte, nur um so tiefer und inniger liebte.
Nein, es war kein Fehler gewesen, ihr Leben mit dem seinen zu verbinden. Vielleicht hätte sie vorsichtiger sein sollen, die ungewollte Schwangerschaft vermeiden müssen. Aber sie war immer schlecht mit der Pille ausgekommen, hatte die Präparate immer wieder ändern müssen, weil sie sie nicht vertrug. Ihr Gynäkologe war überzeugt, daß die Nebenwirkungen, unter denen sie litt – Übelkeit, Erbrechen, Schwindelanfälle und Gewichtszunahme – einen psychologischen Grund haben müßten. Sie stemmte sich, meinte er, innerlich dagegen, sich chemisch unfruchtbar machen zu lassen. Aber diese Erklärung nutzte ihr auch nichts. Sie hatte sich Mühe gegeben, sich an das jeweilige Präparat zu gewöhnen, aber immer wieder vergeblich.
Als dann Florian unterwegs gewesen war, hatte sie nicht das Herz gehabt, die Schwangerschaft abzubrechen. Frank war auch nicht dafür gewesen. Natürlich wäre das kein Grund gewesen zu heiraten. Es war heutzutage ja gar nicht einmal mehr unüblich, daß junge Paare ohne Trauschein zusammen lebten. Aber sie hatten beide gewollt, daß alles seine Ordnung haben sollte. Da er damals gerade sein Studium der Betriebswirtschaft abgeschlossen, sie das Physikum hinter sich hatte, schien auch der Zeitpunkt durchaus günstig. Sie waren damals so voller Hoffnung gewesen.
Beates Gedanken glitten in die erste wunderbare Zeit ihrer Liebe zurück. Der Lärm hinter dem geschlossenen Fenster wurde zu einem gleichmäßigen, an- und abschwellenden Geräusch. Ohne es zu merken, versank Beate aus ihrem Traum vom Glück in einen tiefen Schlaf. –
Sie wachte erst auf, als Florian sie an den Fußsohlen kitzelte.
»Mami«, rief er, »Mami! Du hast im Schlaf gelacht!«
»Ja, wenn du mich auch kitzelst!« Sie nahm ihn liebevoll in die Arme und zog ihn zu sich auf das Bett. »Wie spät ist es?«
»Weiß nicht.«
Sie nahm ihren Wecker vom Nachttisch und hielt ihn sich vor die Augen. »Sechs Uhr vorbei!« rief sie erschrokken. »Ich muß das Abendbrot richten.«
»Mußt du nicht!« erklärte Florian strahlend. »Haben Opa und ich ganz alleine gemacht.«
»Dann verdienst du ein ganz dickes Bussi.« Sie küßte ihn auf die Wange.
»Opa auch?«
»Ja, Opa auch. Aber jetzt laß mich aufstehen.« Sie stellte ihn auf die kurzen, stämmigen Beine und schwang sich aus dem Bett. »Sag Opa, ich komme.« Mit einem kleinen Klaps auf den Allerwertesten entließ sie ihn.
Sie zog sich wieder an, ging ins Bad, wusch sich das Gesicht und Augen mit kaltem Wasser und bürstete sich ihr vom Schlaf zerzaustes rotblondes Haar.
In der Küche war der Tisch tatsächlich schon mit allem, was dazu gehört, gedeckt. Florian stand daneben, strahlend vor Selbstzufriedenheit, der Schwiegervater mit verlegenem Stolz.
»Wie lieb von euch!« rief Beate und gab dem alten Herrn den versprochenen Kuß.
»Wir dachten, du könntest eine kleine Verschnaufpause brauchen. Hast du wenigstens etwas geschlafen?«
»Und wie!« rief Florian. »Ich habe sie kaum wach gekriegt!«
»Ich bin tatsächlich eingepennt«, sagte Beate, »womit ich gar nicht gerechnet hatte. Jetzt geht es mir viel besser. Ich habe sogar Hunger.«
Sie setzten sich.
»Du siehst auch viel besser aus. Wie geht es Frank?«
»Er fühlt sich schon wieder putzmunter. Morgen wird er geröntgt.«
»Und dann?«
»Werden sie ihn wohl auf jeden Fall nach Hause schikken.«
»Wieso bist du da so sicher?«
»Er ist ja noch jung, und es war sein erster Herzanfall. Wenn er seine Gewohnheiten ändert und auf sich aufpaßt, muß es keinen zweiten geben. Für den Notfall werden sie ihm Nitrotabletten verschreiben.«
»Bist du wirklich so optimistisch?«
Sie lächelte ihren Schwiegervater an. »Ich will es sein. Ich will mich nicht verrückt machen, bevor das Untersuchungsergebnis da ist.«
»Da hast du ganz schön recht. Du warst schon immer ein vernünftiges Mädchen.« Er wechselte das Thema und begann, von Florian lebhaft unterstützt, von ihren Unternehmungen an diesem Nachmittag zu erzählen.
Nach dem Essen, als Beate die Küche mit Florians ungeschickter Hilfe aufgeräumt hatte, badete sie ihn und steckte ihn ins Bett. Sie blieb noch bei ihm und erzählte ihm eine Geschichte. Der ereignisreiche Tag hatte ihn müde gemacht, und er schlief sehr schnell ein, so daß ihr diesmal ein herzzerreißender Abschied erspart blieb.
Inzwischen war es Zeit für sie geworden, in die Klinik zu fahren. Sie mußte ihre Arbeit um acht Uhr abends antreten. Aber vorher verabschiedete sie sich noch von ihrem Schwiegervater.
»Ich wollte dir nur sagen, daß Frank dir sehr dankbar ist.«
»Cum grano salis«, erwiderte der alte Herr trocken.
»Wie meinst du das?«
»Es wird ihm wohl alles andere als angenehm sein, sich von mir helfen lassen zu müssen. Er hatte immer schon seinen dummen Stolz.«
»Von ›dumm‹ würde ich in diesem Zusammenhang nicht sprechen. Aber ich weiß schon, wie du es meinst. Also dann, bis morgen.«
»Rackere dich nicht zu sehr ab!«
Sie lächelte ihm zu. »Werd’ ich schon nicht! Gute Nacht, Vater!«
Kurz vor acht betrat Beate die »Privatklinik Dr. Scheuringer«. Sie trug schon ihre Schwesterntracht, ein blauweiß gestreiftes Kleid mit weißer Schürze, in der sie sich immer noch wie verkleidet fühlte. Ein weißer Kittel wäre ihr lieber und auch praktischer erschienen. Aber darin hätte man sie für eine Ärztin halten können, und das wollte die Krankenhausleitung verhindern. Die breiten gläsernen Vordertüren waren längst geschlossen, und sie benutzte, wie die anderen Angestellten, den Hintereingang, der von dem Nachtpförtner, einem kräftigen jungen Mann, Student der Philologie, bewacht wurde. Ohne sich von ihm aufhalten zu lassen, eilte sie weiter. Durch einen schwach beleuchteten Flur gelangte sie zum Lift und fuhr in das 4. Stockwerk hinauf, ihre Etage. In dem großen, fast quadratischen Zimmer, das den Schwestern tagsüber als Aufenthaltsraum diente, legte sie den Regenmantel ab, den sie über ihre Tracht gezogen hatte. Sie schloß ihren Spind auf, hängte den Mantel hinein und holte ihr Häubchen heraus. Vor dem Spiegel kämmte sie sich ihren weichen Pony aus der Stirn zurück und setzte ihr Häubchen auf. Sie tuschte sich die Wimpern nach und legte Lippenstift auf, nicht aus Eitelkeit, sondern weil sie wußte, daß eine blasse und müde Schwester auf die Patienten deprimierend wirkte.
Als Sybille hereinkam, schlank, sportlich, mit einem harten, fast männlichen Gesicht, war Beate gerade fertig geworden. Im Gegensatz zu Beate war Sybille gelernte Schwester, und sie hatte Beate im Lauf der Zeit einiges beigebracht.
»Gut siehst du aus!« sagte Sybille.
»Danke! Ich habe sehr schön geschlafen.«
»Freut mich für dich.« Sybille übergab Beate die Patientenliste, auf der auch die Medikamente vermerkt waren, die sie zur Nacht bekommen hatten, und berichtete ihr über die Neuzugänge. Zu einem privaten Wortwechsel kam es nicht. Sybille, die den Tag über Dienst gehabt hatte, drängte es nach Hause, und Beate mochte sie nicht aufhalten.
»Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt«, agte Sybille, »im Dritten arbeitet Otti. Auf die kannst du dich verlassen.«
»Gut zu wissen.«
Sybille hatte ihr Häubchen abgelegt und ihren Mantel angezogen. »Aber ich nehme nicht an,daß es Schwierigkeiten geben wird. Ich hab’ es dir nur auf alle Fälle gesagt.«
Beate lächelte sie an. »Danke.«
»Na, dann will ich mich mal auf die Socken machen.«
»Ich wünsche dir einen schönen Abend!«
»Hat sich was! Ich hau’ mich gleich in die Federn. Will morgen früh zum Tennis raus.«
»Wie ich dich beneide!«
»Hättest du dir keine Familie zugelegt, könntest du es dir auch leisten.«
»Wie recht du hast!«
Beate nahm die kleine Stichelei nicht übel. Sybille hatte sie gewarnt, so früh zu heiraten, und sie war immer noch überzeugt, daß sie damit recht gehabt hatte. Aber Beate war sicher, daß sie es nur gut meinte. Natürlich war ihre Ehe für Sybille auch ein echter Verlust gewesen. Obwohl sie nicht eigentlich Freundinnen waren, hatten sie früher doch hin und wieder einen Teil der Freizeit zusammen verbracht, waren zusammen ins Kino gegangen oder zum Tennisspielen. Es war nie darüber gesprochen worden, aber Beate glaubte im stillen, daß sie Sybille ihre Stellung in der Klinik verdankte oder doch zumindest mitverdankte.
Nach dem Abitur hatte Beate, wie so viele andere, nicht gleich einen Studienplatz bekommen. Deshalb hatte sie erst einmal unentgeltlich, ein Pflegepraktikum gemacht, eine Voraussetzung dafür, im Krankenhaus arbeiten zu können. Das Praktikum hatte zwei Monate gedauert. Danach hatte sie, auf ein Angebot der Klinik hin, als bezahlte Kraft weitergemacht. Als sie dann endlich studieren durfte, hatte sie sich auf die Liste der Nachtwachen setzen lassen. Man hatte ihr die halbe Personalstelle angeboten, was für sie ein großes Glück bedeutete, weil es ihr ein sicheres, wenn auch kleines Einkommen garantierte.
Normalerweise wurden Studenten, die sich für die Nachtwache aufschreiben ließen, nur bei Bedarf kurzfristig angerufen. Das war natürlich, wenn man das Geld brauchte, ein ewiges Hängen und Würgen. Außerdem hatte es den Nachteil, daß man alle Pläne umwerfen mußte, wenn dann der ersehnte, aber oft nicht erwartete Anruf der Klinik kam. Beate teilte sich ihre Planstelle mit einem Medizinstudenten namens Günther Schmidt, einem jungen Mann, den sie sehr mochte. Sie konnten untereinander ausmachen, wer wann Nachtwache halten wollte. Zusammen hatten sie vierzehn Nächte im Monat zu arbeiten, und wenn Günther einmal verreisen wollte, kam es vor, daß Beate mehr als ihre sieben Wachen übernahm. Dafür entlastete Günther sie dann im nächsten Monat. Dieser Job war für Beate die ideale Lösung, zumindest ihrer finanziellen Probleme.
Darüber hinaus liebte sie ihn aber auch noch auf andere Weise. Sie freute sich immer wieder auf den Antritt ihrer Nachtwache, den sie mit einem Rundgang durch die Krankenzimmer begann. Dabei begrüßte sie jeden Patienten einzeln, fragte nach dem Befinden und versicherte, daß sie aufbleiben und auf Klingelruf zu erreichen sein würde. Den Neuzugängen stellte sie sich erst einmal vor. Es tat ihr wohl, daß sich die Kranken durch ihr bloßes Erscheinen und die wenigen Worte, zu denen sie Zeit fand, beruhigen, ermutigen und ermuntern ließen. Das war eine Fähigkeit, die nicht jeder Mensch – auch nicht jede Schwester und jeder Arzt – besaß. Sie tat sich nichts darauf zugute, aber sie sah darin eine Bestätigung, daß es richtig war, Medizin zu studieren. Auch wenn es, bedingt durch ihre Familie, nur langsam voranging, blieb das Ziel erstrebenswert und auch erreichbar.
Nachdem sie alle Patienten besucht hatte, ging sie in das Schwesternzimmer zurück. Sie hatte sich gerade vor die Signaltafel gesetzt, als eine Kontrollampe aufleuchtete. Nummer 17. Beate wunderte sich. Nummer 17 war Ellen Klammer, eine junge Frau, die in zwei Tagen entlassen werden sollte. Es war unwahrscheinlich, daß sie einen Rückfall erlitten hatte. Dennoch eilte sie sofort in das entsprechende Zimmer.
»Gut, daß Sie kommen, Schwester!« rief Frau Klammer halblaut.
»Ja, was gibt’s denn?« Beate beugte sich über das Bett.
»Schnüffeln Sie mal!«
Beate verstand nicht sogleich, was die Patientin meinte. Flüsternd gab ihr Frau Klammer einen weiteren Hinweis. »Ich glaube, die Frau Grabowsky hat sich vollgemacht.«
»Vielleicht hat sie nur ein Buffi gelassen«, sagte Beate, mehr um sich selber, als um Frau Klammer zu beruhigen.
Aber Frau Klammer behielt recht. Das bedeutete, daß Beate die Patientin aus dem Bett heben, ihr das Nachthemd ausziehen und sie waschen mußte. Zum Glück war sie sehr leicht, eine alte Frau schon über achtzig, die kaum noch Fleisch auf den Knochen hatte. Sie wimmerte, als Beate sie behandelte.
»Haben Sie Schmerzen, Frau Grabowsky?« fragte Beate.
»Nein, nein.«
»Aber dann müssen Sie doch auch nicht weinen.«
»Ich kann nichts dafür, wirklich nicht.«
»Aber das wissen wir doch alle.«
»Es ist mir so peinlich.«
»Braucht es nicht zu sein, wirklich nicht.« Beate zog ihr ein frisches Nachthemd über. »Glauben Sie, daß Sie da einen Augenblick im Sessel sitzen können?«
»Daß ich Ihnen so viel Mühe machen muß!«
»Aber, Frau Grabowsky! Das ist mein Beruf! Wenn ich ihn nicht lieben würde, hätte ich ihn mir nicht ausgesucht.«
»Sie sind so gut, Schwester!«
»Unsinn. Ich tue ja nur meine Pflicht.«
Beate behandelte die alte Frau so vorsichtig, als wäre sie zerbrechlich, zog ihr einen Bademantel über und trug sie zu dem Korbsessel. Dann riß sie mit wenigen geschickten Griffen das Laken ab und säuberte die Gummiunterlage.
»Soll ich Ihnen helfen?« erbot sich Frau Klammer.
»Danke, nicht nötig. Das haben wir gleich.«
»Aber ich könnte doch ... ich stehe ja tagsüber schon auf ...«
»Nachts bleiben Sie ganz brav in Ihrem Bettchen! Sonst könnten wir beide Schwierigkeiten kriegen.« Sie hatte ein frisches Laken aus dem Schrank genommen und zog es über die Matratze. »Sehen Sie, da haben wir es schon.«
Beate half der alten Frau aus dem Sessel und wollte ihr den Bademantel ausziehen.
»Bitte, nicht!« wehrte sich die Patientin. »Mir ist so kalt.«
»Dann lassen wir ihn halt an. Wenn er Ihnen in der Nacht lästig wird, dann klingeln Sie einfach nach mir!« Beate bettete die alte Frau. »Ich komme gleich zurück und bringe Ihnen was für Ihr Bäuchlein!« versprach sie. »Ich werde jetzt mal ganz kurz durchlüften.«
Als sie mit dem Medikament zurückkam, schloß sie das Fenster wieder. Sie stützte Frau Grabowskys Kopf, damit sie die beiden Pillen besser schlucken konnte, und reichte ihr ein Glas Wasser.
»Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, meine Damen!« sagte sie, als sie zur Tür ging.
»Ihnen auch, Schwester Beate!« sagte Frau Klammer.
Frau Grabowsky hatte die Augen geschlossen und bewegte die Lippen in einem unhörbaren Gebet.
Zurück im Schwesternzimmer notierte Beate das Medikament, das sie der Patientin gegeben hatte und schrieb die Uhrzeit auf.
Bis Mitternacht gab es noch einige Unruhe auf der Station. Beate hatte kaum Gelegenheit, sich im Schwesternzimmer aufzuhalten. Danach hoffte sie sich ein wenig ausruhen zu dürfen. Von zwölf Uhr nachts bis drei Uhr morgens war gewöhnlich die friedlichste Zeit. Aber sie wurde noch einmal gerufen, nach Nummer 20. Es war das einzige Einzelzimmer in ihrer Station und besonders anspruchsvollen Privatpatienten vorbehalten. Im Moment war es von einer Schauspielerin belegt, die mit einer Gallenkolik eingeliefert worden war. Beate stürzte sofort los.
Trotzdem empfing Lilian Rotor sie unfreundlich: »Da sind Sie ja endlich!«
Beate wußte, daß es sinnlos gewesen wäre, sich zu verteidigen, und sich zu entschuldigen sah sie keinen Anlaß. Sie trat an das Bett und blieb abwartend stehen.
»Was starren Sie mich so an?« empörte sich die Patientin. »Ich weiß, daß ich entsetzlich aussehe.« Tatsächlich hatte sie kaum noch Ähnlichkeit mit der anziehenden Frau, die Beate vom Film und vom Fernsehen her kannte.
»Wenn Sie erst wieder gesund sind, werden Sie so schön wie immer sein, Frau Rotor!«
»Sie haben gut reden. Sie wissen ja nicht, wie mir zumute ist. Wegen dieser verdammten Kolik habe ich meine Rolle abgeben müssen.«
»Es wird andere interessante Rollen für Sie geben.«
»Sie haben keine Ahnung vom Theater!«
»Das sicher nicht«, gab Beate friedfertig zu, »aber vom Leben. Es geht immer auf und ab. Nach einem Tief kommt auch immer ein Höhepunkt.«
Die Patientin lachte auf. »Erst wird man älter, und dann wieder ein bißchen jünger! Ist es etwa das, was Sie behaupten wollen?«
»Sie wissen genau, wie ich es meine. Mit dem Älterwerden muß man sich abfinden. Aber Sie sind besser daran als die meisten Frauen. Sie können für Ihr Aussehen etwas tun. Diät, Gymnastik, Kosmetik. Damit bleibt man lange jung, und wenn alle Stricke reißen, gibt es immer noch eine Schönheitsoperation.«
»Sehr, sehr tröstlich.«
»Es ist für Ihren Gesundheitszustand bestimmt nicht günstig, wenn Sie grübeln und düstere Vorstellungen heraufbeschwören. Sie sollten den Klinikaufenthalt lieber nützen, sich zu entspannen. Sie haben es hier ja so schön wie in einem Sanatorium.«
»Nur daß ich krank bin und Schmerzen habe!«
»Sie würden sich besser fühlen, wenn Sie sich freundlicheren Gedanken hingeben würden, glauben Sie mir!«
»Ich will aber nicht denken, und schon gar nicht mitten in der Nacht! Ich will endlich schlafen.«
»Man hat Ihnen ein sehr starkes Schlafmittel gegeben.« Beate hatte sich darüber vergewissert, bevor sie zu der Patientin geeilt war.
»Das überhaupt nichts genutzt hat. Bitte, bitte, Schwester, helfen Sie mir! Bringen Sie mir noch etwas! Morphium!«
Das war eine jener Situationen, die Beate haßte. »Aber das darf ich nicht!« Es war ihr sehr unangenehm, einem Patienten eine Bitte abschlagen zu müssen.
»Ich glaube Ihnen nicht. Sie haben bestimmt Zugang zum Medikamentenschrank.«
»Ich muß mich an die Anweisungen der Ärzte halten.«
»Was sind Sie nur für ein Mensch! Sie können einfach mitansehen, wie ich hier vor Schmerzen und vor Elend verrückt werde!« Lilian Rotor wechselte den Ton. »Bitte, bitte, liebe Schwester ... wie heißen Sie doch gleich?«
»Beate.«
»Bitte, liebe Schwester Beate, Sie sollen es ja auch nicht umsonst tun! Ich gebe Ihnen Geld. Hundert Mark? Genügt das?«
»Ich brauche kein Geld.«
»Unsinn. Jeder Mensch hat Geld nötig.«
»Ich nicht! Aber ich werde sehen, was ich für Sie tun kann.« Beate ging zur Tür.
»Kommen Sie bestimmt zurück?«
»Sie können sich darauf verlassen.«
Beate lief zum Schwesternzimmer. Noch während des Gesprächs hatte sie über die Schauspielerin nachgedacht. Als Schauspielerin führte die Rotor wahrscheinlich ein sehr unregelmäßiges Leben. Es war möglich, daß sie Mißbrauch mit Aufputsch- und Beruhigungsmitteln trieb. Das konnte der Grund dafür sein, daß die wirklich sehr starke Dosis, die sie erhalten hatte, keine Wirkung zeigte. Andererseits konnte es aber auch sein, daß ihre innere Erregung die Wirkung aufhob. Es waren auch wohl nicht so sehr die Schmerzen, unter denen sie litt und sie nicht schlafen ließen, als die Angst um ihre Schönheit und damit um ihren Erfolg. Beate beschloß, es mit einem Placebo zu versuchen, einer großen rot-grünen Kapsel, die mit Puderzucker gefüllt war.
Als sie zurückkam, hatte die Patientin einen Hunderter auf den Nachttisch gelegt.
»Nein, Frau Rotor«, erklärte Beate, »ich will kein Geld. Das würde für mich die Sache noch gefährlicher machen. Falls es rauskommen sollte, daß ich etwas Verbotenes getan habe, wäre das schlimm genug für mich. Falls es sich dann noch rumspricht, daß ich mich dafür extra bezahlen lassen habe, fliege ich bestimmt.«
»Niemand wird davon erfahren.«
»Versprechen Sie mir das?«
»Ist doch ganz klar. Jetzt geben Sie mir endlich das Morphium!«
Beate zögerte. »Ich muß ganz sichergehen. Sehen Sie, Frau Rotor, es ist wahrscheinlich, daß Sie morgen eine bessere Nacht haben. Ich wünsche es Ihnen. Vielleicht können Sie aber auch morgen nicht schlafen. Dann bin ich aber nicht da. Also werden Sie meine Kollegin herbeizitieren, und sie wird sich, genau wie ich, sträuben, Ihnen etwas zu besorgen. Das macht mir angst.«
»Wieso denn?«
»Daß Sie ihr sagen werden: ›Aber Schwester Beate hat es getan !‹«
»Nie im Leben! Wer denkt denn an so etwas!«
»Ich. Jede andere an meiner Stelle würde es auch tun.«
»Ich schwöre Ihnen ...«
»Also gut. Ich werde es tun. Aber wohl ist mir nicht dabei zumute.« Beate legte der Patientin die Kapsel in die Hand.
Lilian Rotor betrachtete sie mißtrauisch. »Sieht komisch aus.«
»Ich habe es geklaut!« behauptete Beate.
»Wird man es nicht merken?«
»Doch. Die Oberschwester kontrolliert den Medikamentenschrank regelmäßig. Aber man wird es mir nicht nachweisen können. Wenn Sie den Mund halten.« Sie reichte der Patientin das Wasserglas. »Also runter damit! Oder ist es Ihnen doch zu gefährlich?«
»Quatsch!« Lilian Rotor schluckte die Kapsel. »Nehmen Sie das Geld! Ich möchte nicht in Ihrer Schuld stehen.«
»Später. Jetzt versuchen Sie sich zu entspannen. In einer halben Stunde werde ich noch einmal nach Ihnen schauen.« Sie hatte das Zimmer noch nicht ganz verlassen, als die Patientin schon das Licht löschte.
Auf der Liste trug Beate ein: »24 Uhr 20. Ein Placebo gegeben.«
Eine Stunde später schlich sie sich, ohne Licht anzuknipsen, in das Zimmer Nummer 20. Nur kurz ließ sie den Schein ihrer kleinen Taschenlampe über das Gesicht der Patientin gleiten. Lilian Rotor schlief tief und fest. Beate nahm den Geldschein an sich.
Sie notierte diese Tatsache auf der Patientenliste. Das wäre nicht nötig gewesen, aber sie wollte sich rückversichern. Sie nahm sich vor, am Morgen der Tagesschwester den Vorgang genau zu berichten.
Plötzlich fühlte sie sich erschöpft. Die Versuchung, sich eine Weile hinzulegen, war groß. Aber Beate widerstand. Aufrecht in ihrem kleinen Sessel sitzend, dämmerte sie ein wenig vor sich hin.
Doch in den nächsten Stunden geschah nichts.
Danach wurde es auf der Station lebendig. Leibschüsseln mußten gebracht, Bettlaken gewechselt, Erbrochenes weggewischt werden. Wenn auch ein guter Teil der Patienten bis zum Wecken durch die Tagesschwester schlief, oder sich doch wenigstens ruhig verhielt, fühlte Beate sich fast überfordert. In diesen frühen Morgenstunden wünschte sie sich immer eine Hilfe, denn sie konnte nicht alle Anforderungen gleichzeitig erfüllen.
Kurz vor sieben Uhr kamen die Tagesschwestern. Während zwei von ihnen gleich mit der täglichen Routine begannen – Fieber messen, Betten richten, Morgenpflege der Kranken, die zu schwach waren, aufzustehen –, erstattete Beate der Oberschwester Bericht.
Oberschwester Anna war eine streng blickende Frau, vom langjährigen Krankenhausdienst abgestumpft. »Sie haben es also mit einem Placebo geschafft. Gut so. Ich werde es der Nachtschwester weitersagen. Aber daß Sie gleich hundert Mark eingesteckt haben, war ziemlich happig, wie?«
»Die Patientin glaubt ja, daß ich ihretwegen meine Kompetenzen überschritten habe. Sie würde mich für schön blöd halten, wenn ich es ohne Entgelt getan hätte.«
Die Oberschwester musterte Beate kritisch. »Ist das der wahre Grund?«
Beate zuckte die Achseln. »Zugegeben, ich bin momentan etwas knapp bei Kasse. Ich habe mir lange überlegt, sollte ich oder nicht.«
»Und dann hat Ihre Raffgier gesiegt.«
»Man hat nicht oft Gelegenheit, sich auf die Schnelle einen Hunderter zu verdienen.«
Die Oberschwester legte Beates Aufzeichnungen aus der Hand. »Na, jedenfalls haben Sie es mir mitgeteilt. Wollen wir es dabei bewenden lassen.«
»Danke, Oberschwester!«
Beate war froh, als das unerquickliche Gespräch beendet war. Sie hatte es jetzt sehr eilig, nach Hause zu kommen. Wir nach jeder Nachtwache hoffte sie inständig, daß ihr kleiner Sohn noch nicht erwacht sein würde, bevor sie bei ihm war.
Professor Meyers Ordination war ein Eckraum, sehr hoch wie alle Zimmer und Gänge der »Internen Ambulanz«, die um die Jahrhundertwende gebaut worden war. Trotz der großen Fenster wirkte er ein wenig düster durch die schweren Vorhänge und geschnitzten Möbel. Es war ein Zimmer, ganz dazu gemacht, die Macht und Würde des Professors zu unterstreichen und die Patienten einzuschüchtern.
Der Professor selber saß hinter seinem Schreibtisch, blickte kurz auf, als Beate und Frank eintraten und wies sie mit einem Kopfrucken an, in der Sitzecke Platz zu nehmen. »Wenn Sie mich noch einen Augenblick entschuldigen wollen ...« Er beschäftigte sich weiter mit einigen Krankenbogen.
Beate, die den Umgang mit Ärzten gewohnt war, ließ sich nicht beeindrucken. Aber sie spürte, daß Frank zitterte. Sie nahm seine Hand und umschloß sie mit festem Druck.
Er mimte Galgenhumor. »Alles halb so schlimm«, behauptete er halblaut mit einem gezwungenen Grinsen.
Professor Meyser erhob sich und zog seine Weste straff. Unter dem offenen weißen Ärztemantel trug er eine tadellose graue Flanellhose mit dazu passender Weste.
Frank stand auf.
»Bleiben Sie sitzen, bleiben Sie sitzen, nur keine Umstände!« Der Professor reichte Beate eine weiche, fleischige Hand und drückte Frank mit der anderen in den Sessel zurück. »Sie sind also das Ehepaar Werder.«
»Ja«, sagte Beate, »und Sie wollten uns von dem Ergebnis der röntgenologischen Untersuchung berichten.«
Der Professor setzte sich. »Ich glaube, da sollte ich erst einmal etwas weiter ausholen und Ihnen beiden etwas über die Funktion des Herzens berichten. Es ist nicht der Sitz der Seele und hat auch nichts mit der Individualität des Menschen zu tun, sondern ist ganz einfach ein Muskel, ein Muskel, der von zwei Hauptarterien mit Blut versorgt wird. Sie entspringen aus der großen Hauptschlagader, der Aorta, und zwar unmittelbar, nachdem diese die linke Herzkammer verläßt. Zur Versorgung der verschiedenen Gebiete des Herzmuskels teilen sich die Coronararterien in einige Haupt- und sehr viele Nebenäste.« Er machte eine kleine Pause.
Beate war nahe daran, ihm ins Wort zu fallen, hielt sich aber zurück.
»Konnten Sie mir so weit folgen?« fragte Professor Meyser.
»Herr Professor, ich bin Medizinstudentin.«
»Ach ja?«, Er strich sich über den blanken Schädel. »Wie weit?«
»Zwölftes Semester.«
»Sehr schön. Dann wissen Sie also, um was es geht?«
»Ja, Herr Professor! Wie weit ist die Arteriosklerose, denn darum handelt es sich ja wohl, fortgeschritten?« fragte Beate, und zu Frank gewandt fügte sie hinzu: »Die Verhärtung der Arterien.«
»Sie sind sehr direkt, junge Frau!«
»Ich finde, es hilft nichts, um den heißen Brei herumzureden. Ein Angina-Pectoris-Anfall kommt wohl kaum von ungefähr, nicht wahr?«
»Da muß ich Ihnen recht geben. Es liegt eine relative Koronarinsuffizienz vor.«
»Das heißt, eine der Arterien ist geschädigt?«
»Ja.«
»Aber wie ist das möglich?« rief Frank, der dem Wortwechsel aufmerksam gefolgt war. »Bis auf den einen Anfall habe ich nie etwas gemerkt!«
»Auch nicht beim Sport? Beim Treppensteigen?«
»Sport habe ich aufgegeben, und wir wohnen im Parterre.«
»Nun denn, in normalem Zustand spüren Sie natürlich nichts von dieser Schädigung. Erst bei Belastung stellt sich heraus, daß die Arterie ihre Elastizität verloren hat, und dieser Elastizitätsverlust ist der im eigentlichen Sinne krankmachende Faktor. Die Arterie ist nicht mehr imstande, ihren Umfang zu vergrößern, um auf diese Weise mehr Blut zu den von ihr zu versorgenden Muskelzellen zu transportieren.«
»Wenn ich also alle körperlichen Anstrengungen und alle Aufregungen vermeide, kann mir überhaupt nichts geschehen!«
»Du redest wie ein Kind!« platzte Beate heraus.
»Na, erlaube mal!«
»Ihre Frau hat leider recht. Selbst äußerste Schonung würde ja keine Heilung bringen, im Gegenteil: die betroffenen Arterien würden mehr und mehr verhärten, bis es von der relativen zur absoluten Koronarinsuffizienz kommt, in dem sich die Arterie vollständig verschließt und so überhaupt kein Blut mehr zu den betreffenden Herzmuskelzellen kommt. Dann haben wir den mit Recht so befürchteten Herzinfarkt.«
»Herr Professor«, fragte Beate, »wie weit sind in diesem besonderen Fall die Koronararterien geschädigt?«
»So weit, daß ich dringend zu einer Bypass-Operation raten muß.«
Beate schrak zusammen, und Frank starrte den Professor ungläubig an.
»Die Röntgenuntersuchung hat gefährliche Engpässe an drei verschiedenen Stellen ergeben«, erklärte der Professor.
»Aber wie hat es dazu kommen können?« rief Frank. »Ich habe immer ganz gesund gelebt.«
»Mein lieber junger Freund, ›ganz gesund‹, wie Sie es nennen, lebt wohl niemand. Haben Sie ständig Ihren Blutdruck und Ihren Cholesterinspiegel unter Kontrolle gehabt? Nicht doch mal zu fett gegessen? Sich wenig Bewegung gemacht? Vielleicht sogar geraucht? Natürlich sündigen andere Menschen noch mehr und bleiben pumperlgesund. Es ist eben auch eine Sache der Disposition, der Veranlagung.«
»Aber deshalb braucht man doch nicht gleich zu operieren!«
»Gleich sowieso nicht. Alle Herzchirurgen haben Wartelisten. Aber Sie sollten sich jetzt schon bei Professor Reicher in der Nußbaumstraße vormerken lassen. Ich schätze, daß Sie dann in etwa drei Monaten an der Reihe sein werden. Bis dahin werde ich Sie Ihrem Hausarzt überstellen.«
»Ich soll von nun an in ständiger Behandlung bleiben? Dazu habe ich gar nicht das Geld!«
»Aber Sie werden doch versichert sein?«
»Nein.«
Schweigend klopfte sich Professor Meyser mit der fleischigen Hand gegen das Kinn.
»Wir werden selbstverständlich für den Aufenthalt hier und für Ihre Bemühungen zahlen, Herr Professor!« versicherte Beate. »Und natürlich auch die Operation.«
»Und woher nimmst du das Geld?«
»Das wird sich finden!« erklärte Beate mit Entschiedenheit. »Bitte, Herr Professor, würden Sie sich mit Professor Reicher in Verbindung setzen? Die Unterlagen rüberschicken und meinen Mann anmelden?«
»Das wird das vernünftigste sein.«
»Danke, Herr Professor!«
Frank hatte das unbehagliche Gefühl, daß über seinen Kopf entschieden wurde. »Um was geht es denn eigentlich bei dieser ...« Er hatte sich den Ausdruck nicht gemerkt. » ...dieser Operation?«
»Die Engstellen in der Gefäßbahn werden durch ein körpereigenes Transplantat ersetzt«, sagte Beate rasch, »aber das kann ich dir alles zu Hause erklären.«
Frank schauderte. »Körperliches Transplantat klingt grauenhaft.«
»Meist nimmt man ein Stück Beinvene dafür.«
»An Ihrer Stelle«, sagte Professor Meyser, »würde ich mir vorerst über die Operation keine Gedanken machen. Noch ist es ja nicht soweit.«
»Aber ich muß wissen, woran ich bin, damit ich mich entscheiden kann.«
»Du hast keine Wahl, Liebling.«
»Aber sicher ist es doch gefährlich?«
»Ein Eingriff am offenen Herzen ist nie ganz ungefährlich«, gab der Professor zu, »aber die Sterblichkeit während oder unmittelbar nach einer Bypass-Operation liegt nur knapp über einem Prozent. Bei schwerer Herzschädigung, die bei Ihnen allerdings nicht vorliegt, ist sie höher. Sie haben also eine reelle Chance.«
»Und nachher? Würde ich dann wieder ganz gesund sein? Voll leistungsfähig?«
»Ein völliges Verschwinden der Beschwerden wurde bis heute in sechzig Prozent aller Fälle beobachtet, weitere zwanzig Prozent zeigten immerhin eine wesentliche Verbesserung des Zustandes.«
»Was ist mit den übrigen zwanzig Prozent?«
»Wir wissen, daß du rechnen kannst, Liebling! Wenn es soweit ist, werde ich dir alles genau erklären.«
»Es kann natürlich zu einem Frühverschluß des Transplantates kommen«, räumte der Professor ein, »dann muß der Eingriff wiederholt werden. In anderen Fällen kommt es einige Jahre später zu einem Verschluß. Da haben Sie Ihre fehlenden zwanzig Prozent.«
»Dann besteht also gar keine Gewähr, daß ich ...«
Beate fiel ihm ins Wort. »Wir werden das alles noch gut durchsprechen, Frank; zigmal nehme ich an. Dir bleibt Zeit genug, das Für und Wider abzuwägen. Jetzt geht es nur darum, daß du einen Termin bekommst. Absagen kannst du immer noch.«
»Ihre Frau hat völlig recht, Herr Werder. Ich würde sagen, machen wir es so.« Der Professor stand auf. »Da Ihre Frau ja fast eine Kollegin ist, können wir uns den Hausarzt wohl sparen. Sie wird Sie bestimmt blendend betreuen.« Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Ich schreibe Ihnen jetzt ein Rezept auf. Nitroglyzerintabletten. Die besorgen Sie in der Apotheke. Tragen Sie sie immer bei sich, damit Sie sie zur Hand haben, falls ein neuer Anfall kommt.«
Beate und Frank waren ihm zum Schreibtisch gefolgt.
»Bitte, Herr Professor, sagen Sie meinem Mann, daß er das Rauchen aufgeben muß!« bat Beate.
Der Professor kritzelte auf seinem Rezeptblock. »Das versteht sich doch wohl von selber.«
»Es wäre mir lieb, wenn Sie es ihm ausdrücklich sagen würden!«
Der Professor lächelte. »Da haben wir also wieder mal einen Mann, der auf seine kluge kleine Frau nicht hören will.« Er reichte Frank das Rezept.« Also erkläre ich Ihnen, Herr Werder, klipp und klar: keine einzige Zigarette mehr, keine Zigarre und keine Pfeife, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist!«
»Ja, Herr Professor«, versprach Frank kleinlaut.
»Keine Aufregung, keine Anstrengung, kein schweres heben und so weiter. Sie müssen gut auf ihn aufpassen, Frau Werder!«
»Das werde ich, Herr Professor.«
Als sie die Klinik verließen, waren Beate und Frank sehr bedrückt, versuchten aber, es zu überspielen.
»Na, wenigstens haben sie mich nicht noch einen Tag festgehalten!« sagte Frank. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, daß ich da raus bin.«
»Doch, Liebling, ich kann’s dir nachfühlen.«
»Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Auf ein kleines Bierchen. Oder ist mir das auch verboten?«
»Eins pro Tag – aber wirklich nur eins – wird dir wohl nicht schaden.«
»Kehren wir irgendwo ein, ja?«
Es war ihr nicht recht, den Schwiegervater ungebührlich lange mit Florian allein zu lassen. Aber sie mochte Frank nicht darauf hinweisen. Dies war eine Situation, in der man nicht auch noch Rücksicht auf andere von ihm verlangen durfte. »Einverstanden«, sagte sie, »fahren wir zum Stachus.« –
Am Stachus, ehemals außerhalb von Alt-München gelegen, inzwischen längst zu einem zentralen Platz geworden, herrschte lebhafter Betrieb. Fontänen ergossen sich aus den Brunnen. Sie waren umlagert von sommerlich gekleideten Menschen, Touristen fotografierten, Einheimische ruhten sich auf den kleinen weißen Stühlen von einem Einkaufsbummel aus, und Stadtstreicher ließen ihre Rotweinflaschen kreisen.
Beate und Frank, aus der U-Bahn kommend, mußten sich erst an das helle Licht gewöhnen. Hand in Hand umrundeten sie die Menge und bogen durch das Karlstor in die Fußgängerzone ein. Die Lokale in der Neuhauser Straße hatten Tische und Stühle im Freien aufgestellt. Sie fanden einen Platz und bestellten.
»Am meisten«, gestand Frank, »sorge ich mich um das Geld.«
»Sorgen solltest du dich überhaupt nicht, das ist nicht gut für dein Herz, und was das Geld betrifft; die Krankenhausrechnung haben wir ja schon bezahlt, und der Professor wird es sicher gnädig machen, da er ja weiß, daß du nicht versichert bist.«
»Glaubst du?«
»Ja. Ärzte verdienen gerne gut, aber das geht nicht so weit, daß sie es über sich bringen, ihre Patienten zu ruinieren. Aus den Krankenkassen und den Privatversicherungen soviel wie möglich herauszuholen, steht auf einem anderen Blatt. Was mir sehr viel mehr zu schaffen macht, ist deine Gesundheit.«
»Ach, Beate, meinst du denn wirklich, daß ich mich operieren lassen muß?«
»Ich fürchte, daran führt kein Weg vorbei.«
Beate fiel auf, daß sie und Frank mitten zwischen den lachenden, schwatzenden, trinkenden und essenden Menschen miteinander so allein waren, als wären sie auf einer einsamen Insel. Keiner aus dem Strom der vorbeischlendernden Bummler und Kauflustigen konnte auch nur ahnen, was sie bedrückte, und keiner nahm auch nur Notiz von ihnen.
»Weißt du, Frank«, sagte sie, »wir sind da in eine schlimme Geschichte geraten. Aber eine gute Seite hat sie doch auch. Sie bringt uns wieder näher zusammen.« Zärtlich berührte sie mit dem Handrücken seine Wange. »Wir müssen das gemeinsam durchstehen.«
Er nahm ihre Hand und küßte sie. »In was für einen Schlamassel habe ich dich gebracht.«
»Du bist überhaupt nicht schuld.«
»Ich hätte eine Versicherung abschließen sollen.«
»Wenn ich dir doch immer wieder sage: Geld ist das kleinste Problem.«
»Ich hätte mich untersuchen lassen sollen, bevor wir heirateten. Vielleicht hätte sich das mit meinem Herzen dann schon rausgestellt.«
»Wahrscheinlich. Aber dann hätten wir die glücklichen, sorgenlosen Zeiten nie erlebt.«
»Sorglos!« Er lachte auf. »Waren wir denn je sorglos?«
»Am Anfang schon. Erinnere dich, wieviel du dir von deinem eigenen Geschäft versprochen hast.«
»Ich war ein Narr.«
»Im zweiten Jahr ist es doch sehr gut gelaufen.«
»Aber jetzt krebse ich nur noch dahin. Sag mir, Beate, was mache ich falsch? Ich habe mich, weiß Gott, abgerakkert.«
»Das hast du, Liebling. Wahrscheinlich ist es einfach nur Pech. Du bist ja nicht der einzige, der reingefallen ist. Denk nur mal daran, wie viele Geschäfte in der Türkenstraße, in der Amalienpassage und Umgebung eingegangen sind, seit wir dort wohnen! Wir wußten doch beide, daß es ein Risiko war. Es wäre wirklich blöd, wenn du dir Vorwürfe machen würdest.«
»Und wie soll es jetzt weitergehen? Wenn ich nicht mehr selber ausladen kann ...«
»Auf keinen Fall, Liebling!«
»Ich komme mir vor wie ein Krüppel.«
»Unsinn. Nach der Operation wirst du wieder wie neu sein.«
Die Kellnerin kam und stellte zwei Gläser Pilsener vor sie hin. Sie prosteten sich zu und nahmen beide einen tiefen Schluck. »Ah, das tut gut!« rief Frank. »Wunderbar! Solange es noch ein solches Bier gibt, kann die Welt nicht ohne Hoffnung sein.«
Lächelnd war die Kellnerin bei Ihnen stehengeblieben. »Wenn ich dann gleich kassieren darf ...«
»Ist gestattet!« Frank zahlte und gab, wie es seine Art war, ein großzügiges Trinkgeld.
Er lächelte Beate an. »Das ist genau das, was ich gebraucht habe.«
Sie erwiderte sein Lächeln. »Eine Wohltat!«
Frank lehnte sich zurück, blickte hinauf zu der Barockfassade der St. Michaels Kirche mit ihrem schönen geschwungenen Giebeln und hoch in den blauen Himmel. »Was für ein Tag! Laß uns jetzt von etwas anderem reden, ja? Wir werden noch genug Gelegenheit haben, unsere Sorgen durchzukauen.«
»Du hast ganz recht«, stimmte sie zu, aus Rücksicht auf Frank.
Aber sie wußte nur zu gut, daß nichts dadurch besser werden konnte, wenn sie versuchten, ihre Probleme totzuschweigen.