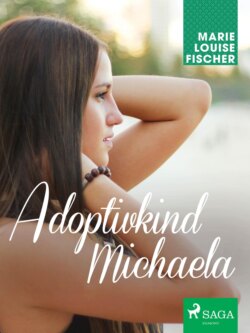Читать книгу Adoptivkind Michaela - Marie Louise Fischer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеDie Schneidersche Villa war vom Mondlicht fahlweiß, fast taghell beleuchtet, als Michaela und Gregor in die kleine Seitenstraße in Bogenhausen einbogen. Trotzdem sah Michaela sofort, daß im Wohnzimmer noch Licht brannte.
»Verflixt«, murmelte sie und kramte in ihrer Handtasche.
»Was ist? Schlüssel vergessen?« fragte Gregor.
»Ach wo. Aber«, sie machte eine Handbewegung zum Wohnzimmerfenster, »sie sind schon zu Hause.«
»Und nun?«
Sie legte ihm den Finger auf den Mund. »Pst … Ich werde mich ’reinschleichen müssen!«
Wortlos und so leise wie möglich durchschritten sie den Vorgarten und traten unter das Vordach der Haustür. Michaela steckte den Schlüssel ins Schloß, drehte ihn sachte um — die Tür gab nicht nach. »Zugeriegelt«, sagte sie verblüfft.
»Auwei!«
»Komm«, flüsterte sie und zog ihn an der Hand hinter das Haus.
»Was willst du machen?«
»Ich muß da ’rauf«, sagte sie, mit einer Kopfbewegung zum Spalier hin, und bückte sich schon, um ihre schmalen, halbhohen Pumps abzustreifen.
Er schaute unbehaglich die Hauswand hinauf. »Bist du sicher, daß ein Fenster offen ist?«
»Na klar. In meinem Zimmer immer.« Sie rollte sich mit geschickten Händen die Strümpfe herunter, stopfte sie in ihre Handtasche. »Meinst du, daß du mir das hinaufwerfen kannst …«
»Gib her, ich werde es versuchen.«
Sie küßte ihn rasch auf die Nasenspitze, dann wandte sie sich ab und begann, gewandt wie eine Katze, das Spalier hinaufzuklettern. Gregor wurde es klar, daß sie nicht zum erstenmal auf diesem Weg ins Haus gelangte. Das morsche Holz knackte ein bißchen, unwillkürlich trat er einen Schritt vor und breitete die Arme aus, um sie aufzufangen, aber es war nicht nötig.
Sie hatte sich schon zum Fenster hineingeschwungen. Jetzt öffnete sie beide Flügel weit und winkte ihm zu. Er trat einen Schritt zurück, zielte genau, dann flog die Handtasche mit Schwung durchs Fenster. Der erste Pumps folgte, der zweite war zu tief geworfen, er prallte von der Mauer ab und fiel auf den hartgefrorenen Boden. Es gab einen kleinen Lärm, beide erschraken.
Dann, als nichts geschah, löste sich ihre Aufregung in unterdrücktes Gelächter. Beim zweiten Wurf klappte es. Michaela beugte sich weit vor, sandte Gregor eine Kußhand zu, bevor sie das Fenster schloß. Er wartete, bis ein gedämpfter Lichtschein durch die zugezogenen Vorhänge fiel, dann wandte er sich ab und verschwand mit raschen Schritten.
Wenige Minuten später lag Michaela im Bett. Sie hatte ihr Kopfkissen zusammengerollt und hielt es fast zärtlich an sich gepreßt. Um ihren vollen, kindlichen Mund spielte ein Lächeln. Sie war müde und ganz wunschlos.
Plötzlich durchfuhr sie ein Gedanke. Im selben Moment war sie wieder hellwach und richtete sich steil im Bett auf. Wenn die Eltern nun gemerkt hatten, daß sie nicht zu Hause gewesen war? Wenn sie auf sie warteten?
Michaela überlegte eine Sekunde, dann kletterte sie aus dem Bett, öffnete behutsam die Zimmertür und schlich auf nackten Sohlen die schmal geschwungene Treppe hinunter.
Aus dem Wohnzimmer kam kein Laut. Michaela preßte ihr Ohr an die Tür. Es war so still, daß sie glaubte, das zarte, unablässige Ticken der kleinen antiken Uhr vernehmen zu können. Sie warf einen Blick über die Schulter. Die vertraute Diele wirkte im fahlen Mondlicht, das durch einen breiten Spalt des Vorhanges fiel, kalt und ganz fremd. Eine Treppenstufe knackte.
Michaelas Herz klopfte bis zum Hals. Am liebsten hätte sie sich umgedreht, wäre wieder hinaufgelaufen und hätte die Tür ihres Zimmers hinter sich abgeschlossen. Aber sie wußte, daß sie jetzt kein Auge zutun konnte, bevor sie nicht Gewißheit hatte.
Vorsichtig ging sie in die Knie, versuchte durch das Schlüsselloch zu spähen. Drinnen brannte Licht. Sie sah den warmen Schein der Stehlampe, sah ein Stück von der Barockkommode, sah ihr eigenes Bild als Baby von sechs Monaten in dem runden, schön geschnitzten Rahmen. Nichts rührte sich drinnen.
Dann hörte sie die Stimme ihrer Mutter, seltsam verändert, spröde, fast tonlos. »Bitte, Erhard … Ich habe keine Zigaretten mehr.«
»Ist auch besser so«, erwiderte der Vater rauh, und Michaela spürte, daß er unter der Grobheit seine eigene Erregung verbergen wollte.
»Komm, gehen wir schlafen.«
»Glaubst du, daß ich ein Auge zutun könnte?«
»Natürlich kannst du. Du brauchst bloß zu wollen. Nimm von mir aus ein Schlafmittel.«
»Ach, Erhard …!«
Wieder Stille, eine Stille, die mit Gefühlen, die keinen Ausdruck fanden, gleichsam überladen war. Michaela richtete sich wieder auf, ihre Knie zitterten. Sie mußte sich an die Wand lehnen.
»Ich begreife nicht, wie sie uns das antun konnte«, hörte sie ihren Vater sagen.
»Das arme Kind!« Die Stimme der Mutter war kraftlos vor Qual.
»Ich — mein Gott, wir — was haben wir falsch gemacht, Erhard?«
»Wir — wir — immer wir! Warum suchst du die Schuld bei uns? Warum suchst du sie nicht dort, wo sie wirklich liegt? Wir haben alles für sie getan, was in unseren Kräften steht. Sie hat, was sie braucht, und noch mehr. Wenn trotzdem solche Sachen vorkommen, dann kannst du die Schuld doch nicht bei uns suchen! Dann ist das Kind einfach zu — na, sagen war — labil!«
»Und wenn sie das ist, ist es ihre Schuld?«
Nach einer kleinen Pause sagte der Vater: »Na ja, vielleicht hast du recht, wer kann schon für seine Veranlagung … Ich hätte damals eben nicht nachgeben sollen. Es war ein zu großes Risiko, sie anzunehmen.«
»Glaubst du, bei einem eigenen Kind wäre das Risiko geringer?«
»Vielleicht nicht. Aber dann weiß man doch wenigstens …«
Er kam nicht mehr dazu, den Satz zu Ende zu sprechen. Michaela konnte es plötzlich nicht mehr ertragen. Ehe sie noch selbst wußte, was sie tat, hatte sie die Tür aufgerissen und war ins Zimmer gestürzt. Sie starrte die Eltern mit weit aufgerissenen Augen an.
»Ich — ich bin nicht euer Kind?« stammelte sie.
Isabella und Erhard Schneider starrten Michaela wortlos an. Dann löste sich Isabellas Verkrampfung.
Sie sprang auf, eilte auf das Mädchen zu und schloß es zärtlich in ihre Arme.
»Gott sei Dank, daß du wieder da bist, Liebling … Wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht«, stammelte sie.
Michaela fühlte die Tränen ihrer Mutter. Auch sie mußte plötzlich weinen. »Mutter«, flüsterte sie, »ist es wahr … Ich bin nicht euer Kind?«
Isabella zog sie noch enger an sich. Sie wiegte sie leicht in den Armen, wie sie es früher immer getan hatte, wenn die kleine Michaela mit Kummer oder Schmerzen zu ihr gekommen war.
Einen Augenblick lang schloß das Mädchen die Augen und gab sich ganz den sanften, beruhigenden Bewegungen hin. Sie hätte gern alles Trennende vergessen und sich in der mütterlichen Liebe geborgen gefühlt. Aber sie war kein Kind mehr, das man einlullen konnte. Sie mußte Klarheit haben.
Mit einer heftigen Bewegung machte sie sich frei:
»Mama, stimmt es wirklich …«
Sofort unterbrach sie Erhard Schneider: »Ich habe hier Fragen zu stellen, Michaela.«
»Bin ich nun euer Kind oder nicht?«
»Natürlich bist du unser Kind — unser kleines Mädchen«, erwiderte Isabella rasch. »Spürst du das denn nicht?«
»Aber ihr habt doch selbst gesagt …«
»Wann?« fragte Erhard Schneider.
Michaela errötete. »Eben. Bevor ich ins Zimmer kam …«
»Du hast gelauscht?«
»Ich habe es gehört.«
»Dann passe das nächste Mal besser auf, wenn du schon an den Türen horchst.«
»Aber ich habe mich nicht geirrt …«
»Unsinn. Willst du etwa behaupten, daß wir dich belügen?« Michaela schwieg verwirrt.
»Na also. Und jetzt möchte ich endlich wissen, wo du herkommst.«
Michaela sah an ihrem kurzen Nachthemd hinunter. »Aus dem Bett.«
»Willst du uns vielleicht weismachen, daß du den ganzen Abend friedlich geschlafen hast, während deine Mutter und ich vor Sorgen fast verrückt geworden sind?«
»Nein.«
»Wann bist du nach Hause gekommen?«
»Ich weiß es nicht … Ich habe nicht auf die Uhr geschaut.«
»Vielleicht kannst du uns wenigstens sagen, wie du ins Haus gekommen bist. Die Haustür ist nämlich seit Stunden verriegelt.«
»Ich bin über das Spalier in mein Zimmer geklettert.«
»Um Himmels willen, Kind — du hättest dir ja die Beine brechen können«, rief Isabella Schneider entsetzt.
»Reg dich nicht auf, Isa«, sagte ihr Mann. »Du siehst, daß ihr nichts passiert ist. Wahrscheinlich hat sie diese Kletterpartie nicht zum erstenmal gemacht, oder?«
Michaela warf trotzig ihr langes blondes Haar über die Schultern zurück. »Was hätte ich sonst tun sollen? Du sagst ja selbst, die Tür war verriegelt.«
»Klingeln — zum Beispiel.«
»Ich wollte euch nicht wecken.«
»Hast du dir wirklich eingebildet, wir wären zu Bett gegangen, während du dich bis nach Mitternacht irgendwo in der Stadt herumtreibst?«
»Ich habe mich nicht herumgetrieben.«
»Nein? Wo warst du dann?«
»Tanzen.«
Erhard und Isabella Schneider wechselten einen Blick.
»Mit wem?« fragte Isabella.
Keine Antwort.
Isabella blickte lange in das verstockte Gesicht ihrer Tochter.
»Du weißt doch, daß wir es nur gut mit dir meinen.«
Aber Michaela schwieg weiter.
»Du packst sie ganz falsch an, Isa«, sagte Erhard Schneider wütend. »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, daß du sie zu sehr verwöhnst. Jetzt hast du das Ergebnis … Ein verstocktes, verlogenes Kind, das sich nachts in Tanzlokalen herumtreibt.«
Er zog das Schreiben von Michaelas Schuldirektor aus der Tasche. »Kennst du den Brief?«
»Nein«, erwiderte Michaela leise.
»Du weißt also nicht, daß dein Direktor uns geschrieben hat? Daß deine Versetzung gefährdet ist?«
»Von dem Brief habe ich nichts gewußt. Aber der Direx hat mir natürlich schon gesagt, daß ich schlecht stehe.«
»Und wie soll das nun weitergehen mit dir?«
»Ich werde mich eben mehr anstrengen müssen.«
»Schön, daß wir uns wenigstens in diesem Punkt verstehen … Warum bist du erst nach Mitternacht nach Hause gekommen?«
»Ich wollte tanzen, Paps … Wozu habe ich es denn gelernt, wenn ich es nicht darf?«
»Du kannst ja mit uns ausgehen.«
»Wann? Und überhaupt — das ist doch nicht dasselbe.«
»Immerhin hätten wir dich pünktlich nach Hause gebracht, wie es sich gehört. Mit wem warst du tanzen?«
»Mit Greg.«
»Das ist doch kein Name.«
»Mit Gregor Hellmer. Er arbeitet in einer Bank.«
»So so. Wie alt ist dieser Knabe eigentlich?«
»Zwanzig …«
»Na hör mal, ein zwanzigjähriger Mann, der schon im Leben steht, ist kein Umgang für ein Schulmädchen. Seit wann kennst du ihn?«
»Schon ’ne ganze Weile.«
»Hat er jemals etwas von dir verlangt …«
Seine Frau unterbrach ihn. »Nicht, Erhard. Bitte nicht.«
»Wunderbar. Du weißt es wieder einmal besser.«
Erhard Schneider füllt sich ein neues Glas Kognak ein und leert es in einem Zug. »Du wirst diesen Gregor Hellmer nicht mehr Wiedersehen. Verstanden?«
»Aber — Greg kann wirklich nichts dafür, daß es so spät geworden ist. Er ist anständiger, als ihr glaubt. Er ist mein einziger Freund.«
»Das wird ja immer schöner. Mit sechzehn braucht man keinen Freund. Und schon gar keinen Zwanzigjährigen, der sicherlich schon einiges erlebt hat … Damit du nicht in Versuchung kommst, diesen Burschen wiederzutreffen, verbiete ich dir hiermit, das Haus ohne Erlaubnis zu verlassen.«
»Paps, ich …«
»Michaela«, sagt Isabella sanft. »Hab Vertrauen zu uns. Wir wollen doch nur dein Bestes. Du bist noch viel zu jung, um dies alles zu verstehen. Später wirst du uns einmal dankbar sein.« Michaela sprang auf. »Dankbar? Dafür, daß ihr mich einsperrt?«
»Kind, sei vernünftig …«
»Schluß mit dem Gerede«, befahl jetzt Erhard Schneider laut. »Michaela, du hast dich unglaublich benommen. Ich habe zumindest etwas Einsicht von dir erwartet.
Aber anscheinend habe ich mich auch darin getäuscht. Verschwinde jetzt in dein Bett. Ich hoffe, daß du morgen früh vernünftiger bist.«
Mit Tränen in den Augen sah Michaela ihre Eltern an. Dann drehte sie sich ohne Gruß um und rannte aus dem Zimmer.
Am nächsten Morgen läutete es kurz vor neun an der Schneiderschen Villa. Anna Beermann, die Haushälterin, öffnete. Eine blonde, nicht mehr ganz junge Dame im grauen Persianermantel trat ein.
»Könnte ich Frau Schneider sprechen?« fragte sie atemlos. »Es ist sehr dringend.«
»Ich fürchte, das ist unmöglich«, sagte die Haushälterin, »die Herrschaften schlafen noch.«
»Aber es ist wirklich ungeheuer wichtig … Bitte, wecken Sie Frau Schneider. Sagen Sie, Gerda Ackermann ist da.«
»Anna, was ist denn los?« ertönte plötzlich Isabellas Stimme vom Obergeschoß des Hauses, wo die Schlafgemächer lagen.
»Eine Frau Ackermann möchte Sie sprechen«, gab die Haushälterin zurück.
»Augenblick — ich komme sofort!«
Wenige Minuten später kam Isabella die geschwungene Treppe zur Diele herunter. Über ihrem Pyjama trug sie einen eleganten Morgenrock aus blauer Seide, der das Blau ihrer Augen unterstrich. Ihr braunes Haar war vom Schlaf noch verwirrt.
Sie nickte Gerda Ackermann kurz zu und ging voraus ins Wohnzimmer. »Komm herein«, sagte sie hastig zu der Besucherin.
Bereits in der Tür wandte sie sich noch einmal um. »Anna, achten Sie darauf, daß wir nicht gestört werden … Falls mein Mann — oder Michaela — herunterkommt, sagen Sie mir sofort Bescheid.«
Sie schloß die Tür und sah Gerda Ackermann an. »Was willst du? Wir hatten abgemacht, daß wir uns nur außer Haus treffen …«
»Es ist etwas Furchtbares passiert, Isa … Till Torsten, dein Bruder, ist wieder in München.«
»Ich weiß«, sagte Isabella Schneider gelassen.
»Warum hast du mich nicht gewarnt?«
»Damit mußten wir rechnen. Was regt dich daran so auf?«
»Das fragst du noch?«
»Du hast keinen Grund, dich vor Till zu fürchten. Er hat nicht die leiseste Ahnung, wie du jetzt heißt, daß du verheiratet bist, wo du wohnst … Vielleicht erkennt er dich überhaupt nicht mehr wieder — nach all den Jahren …«
»Ich jedenfalls habe ihn wiedererkannt.«
»Ja du — das ist doch kein Vergleich. In deinem Leben hat es zwei Männer gegeben, Till Torsten und Arnold Ackermann. Aber was glaubst du, wieviel Frauen in seinem Dasein eine Rolle gespielt haben?«
»Ich habe entsetzliche Angst, Isa.«
»Wovor denn? München ist eine Millionenstadt. Eine Begegnung wäre unwahrscheinlich. Und selbst wenn — was hätte es zu bedeuten? Ich kann mir kaum vorstellen, daß du noch einmal auf Till hereinfallen wirst.«
»Darum handelt es sich doch gar nicht. Es ist nur — Arnold weiß nichts von der Geschichte.«
Isabella hob die geschwungenen Augenbrauen. »Du hast ihm nichts erzählt?«
»Wie sollte ich. Ich kann doch nicht plötzlich aus heiterem Himmel …«
»Ich an deiner Stelle hätte schon längst mit meinem Mann gesprochen, Gerda. Eine Ehe muß auf gegenseitigem Vertrauen gegründet sein.«
»Arnold trägt mich auf Händen. Und da soll ich ihm sagen, daß ich ihm von Anfang an etwas verheimlicht habe?«
»Immer noch besser, als wenn er es durch Till erfährt. Das fürchtest du doch?«
»Ja.«
»Till macht nur Sachen, die ihm etwas einbringen.«
»Eben.«
In diesem Augenblick wurde leise gegen die Tür geklopft. Die beiden Frauen fuhren erschreckt zusammen.
»Was ist?« fragte Isabella.
Hinter der Tür war die Stimme der Haushälterin zu hören. »Ihr Gatte und Michaela sind zum Frühstück heruntergekommen.«
»Ich komme gleich. Sie sollen schon anfangen.«
Isabella wandte sich an die Besucherin. »Du mußt jetzt gehen, Gerda. Schnell.«
Isabella öffnete die Tür. Die beiden Frauen gingen schnell durch die Diele dem Ausgang zu.
Als die Haustür hinter Gerda Ackermann ins Schloß gefallen war, kam Erhard Schneider, die Serviette in der Hand, aus dem Frühstückszimmer.
»Was war das für ein Besuch?«
Isabella lächelte ihn an und küßte ihn rasch auf die Wange. »Nichts Wichtiges, Erhard«, sagte sie. Aber sie spürte, wie eine jähe Angst in ihr hochkroch.—
Nach dem Mittagessen, als die Eltern sich niedergelegt hatten, gelang es Michaela, das Haus ungesehen zu verlassen.
Die Schuhe in der Hand, schlich sie die Treppe hinunter und ließ die Tür so leise wie möglich ins Schloß fallen.
Erst hinter der Vorgartentür begann sie zu laufen. Sie rannte, bis sie vor dem kleinen Café in der Holbeinstraße ankam.
Das Telefon stand hinter der Kuchentheke. Noch war kein Gast da, der ihr Gespräch hätte mit anhören können. Die beiden Serviererinnen waren damit beschäftigt, sich ihre Erlebnisse vom gestrigen Abend zu erzählen.
Das Mädchen wählte Gregors Nummer. Er war selbst am Apparat. »Greg«, sagte sie atemlos, »hast du Zeit?«
»Wo brennt’s denn?« war seine erstaunte Stimme zu hören.
»Das kann ich nicht am Telefon erzählen … Bitte, komm mal, Greg, ich bin im Café Holbein. Ich warte auf dich«, sagte sie eindringlich und legte schnell den Hörer auf.
Michaela setzte sich an einen der kleinen weißlackierten Tische und bestellte eine Tasse Tee mit Zitrone. Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen. Alle zwei Minuten sah sie auf die Armbanduhr.
Plötzlich war eine Viertelstunde vorbei, und Gregor war immer noch nicht gekommen. Wenn er sie nun aber im Stich ließ?
Seine Stimme am Telefon hatte nicht besonders freundlich geklungen. Vielleicht glaubte er, daß sie ihm nachliefe. Das wäre das Allerschlimmste …
Als Gregor endlich das Café betrat, hatte Michaela schon alle Hoffnungen aufgegeben. Sie mußte ihre ganze Kraft zusammennehmen, um sich gleichgültig zu stellen. Sie beugte sich tief über ihren Tee und tat, als ob sie ihn nicht bemerkt hätte.
»Hallo, Micky«, sagte Gregor.
Michaela hob den Kopf. »Ach, du bist es.«
Der junge Mann durchschaute ihr Theater sofort. »Nun sag bloß, du hast noch ein paar andere Herren herbestellt«, lächelte er und setzte sich neben sie.
»Greg — etwas ganz Scheußliches ist passiert … Gestern abend haben mich meine Eltern erwischt.«
»Oje! — wieso denn?«
»Vielleicht war es blöd von mir — aber ich bin noch mal ’runtergegangen ins Wohnzimmer … Ich hatte das Gefühl, daß sie mein Wegbleiben bemerkt hatten.«
»Und?«
»Sie waren im Bilde.«
Die beiden jungen Leute schwiegen, während die Serviererin den Tee für Gregor brachte.
»Das schlimmste ist«, sagte Michaela, »meine Eltern sind gar nicht meine Eltern.«
»Wie kommst du denn darauf? Haben sie dir das gesagt?«
»Ich habe es ganz zufällig gehört. Bevor ich zu ihnen ins Zimmer ging.«
»Hast du sie denn gefragt, und was haben sie dir erwidert?«
»Sie tun so, als ob ich mich verhört hätte.«
Gregor zündete sich eine Zigarette an. In seinen Augen stand freundlicher Spott.
»Du glaubst mir nicht?«
»Nein, das ist doch Irrsinn. Wenn sie wirklich nicht deine Eltern wären, warum sollen sie es dir dann nicht sagen?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie zögernd.
»Aber ich weiß es. Das ganze ist Quatsch … Hast du mich etwa nur herbestellt, um mir diesen Unsinn zu erzählen?«
»Natürlich nicht — sie haben mir verboten, dich zu treffen. Sie tun so, als wäre es wegen der Schule. Aber in Wirklichkeit …« Sie stockte.
»Na?«
Michaela errötete. »Es ist deshalb, weil du schon zwanzig bist … Und kein Schüler mehr … Du weißt, was ich damit meine.«
»Aber das ist doch Unsinn, daß wir — etwas miteinander haben.«
»Red du es ihnen doch aus!«
»Das werde ich auch.«
»Sie glauben, wir treiben uns ’rum … Du darfst ihnen deshalb nicht sagen, daß wir im ›Rock ’n’ Roll‹ waren. Auch nicht, daß wir schon öfter zusammen aus waren. Ich wollte gar nicht lügen, aber sie waren so aufgeregt.«
»Schade, du hättest ihnen alles erklären sollen.«
»Zu spät. Jetzt müssen wir dabei bleiben.«
Greg drückte seine Zigarette aus. »Dann geht es nicht.«
»Wieso?«
»Du glaubst doch nicht, daß ich deine Eltern anlügen werde?«
»Warum denn nicht?«
»Micky, nimm endlich Vernunft an … Ich kann nicht zu ihnen hingehen und sagen: ›Mir könnt Ihr Eure Tochter ruhig anvertrauen, ich werde schon auf sie aufpassen‹, wenn ich im gleichen Atemzug lüge?«
»Eltern wollen es nicht anders, Greg. Glaub es mir.«
»Egal. Ich kann es nicht.«
»Greg«, sagte Michaela und legte ihre Hand auf seinen Arm. »Hast du mich eigentlich lieb?«
»Ja.«
»Dann ist ja alles gut. Wir werden uns also weiter treffen. Ich muß in Zukunft bloß vorsichtiger sein.«
»He«, erwiderte Greg, »so geht das nicht … Natürlich ist nichts dabei, wenn wir zusammen tanzen gehen. Im Grunde haben deine Eltern doch recht. Du bist noch zu jung für so was.«
»Auf einmal?«
»Gar nicht auf einmal. Ich habe mir das schon oft gedacht.«
»Aber gesagt hast du es mir bisher noch nie. Du hast jetzt einfach Angst, sie könnten uns erwischen, und mein Vater würde zu deinem Alten gehen oder zu deiner Bank, oder was weiß ich. Das ist alles.«
»Denk, was du willst«, Gregor stand auf. »Machen wir uns doch nichts vor, die Kiste ist verfahren. Das Beste wird sein, wir lassen Gras darüber wachsen. In zwei Monaten oder drei sieht die Geschichte schon ganz anders aus.«
»Drei Monate? Greg, das halte ich nicht aus.«
»Du wirst, Micky«, lächelte er. »Wenn du dich richtig hinter deine Schularbeiten kniest, wirst du nicht einmal mehr Zeit haben, an mich zu denken.«
»Du bist gemein, Gregor … Oh, bist du gemein. Wenn ich deine Freundin gewesen wäre — so richtig deine Freundin, hättest du sicherlich nicht so zu mir gesprochen.«
Michaela stand hastig auf. Sie rannte zum Ausgang
Sie verließ nicht nur das Lokal. Sie verließ Greg.
Sie war fertig mit ihm …
Als Michaela nach Hause kam, achtete sie nicht mehr darauf, ob die Haustür laut oder leise hinter ihr ins Schloß fiel. Sie war so verzweifelt, daß ihr alles gleichgültig geworden war. Sie erschrak nicht einmal, als sie in der Diele ihren Eltern, die zum Kaffeetrinken heruntergekommen waren, geradewegs in die Arme lief.
Isabellas Augen wurden dunkel vor Enttäuschung, als sie ihre Tochter sah: »Michaela, du hast uns doch versprochen …« Erhard Schneider packte seine Tochter beim Handgelenk: »Wo bist du gewesen?«
Michaela blickte an ihren Eltern vorbei, als wären sie Fremde. Nach einer kleinen Pause, in der sie sich bemühte, ihre Stimme in die Gewalt zu bekommen, sagte sie tonlos:
»Ich habe mit Gregor Schluß gemacht.«
Sofort ließ Erhard Schneider sie los.
Isabella sagte erleichtert: »Michaela … Ich habe ja gewußt, daß du ein vernünftiges Mädchen bist.«
Sie wollte ihre Tochter in die Arme schließen. Doch Michaela wich vor ihr zurück, wandte sich ab und ging schnell die Treppe hinauf. Die Eltern hörten, wie die Tür ihres Zimmers hinter ihr ins Schloß flog. Sie hörten, wie Michaela den Schlüssel zweimal umdrehte.
»Michaela«, rief ihre Mutter und wollte ihr nach. »Laß das, Isa«, sagte Erhard Schneider und legte seinen Arm um ihre Schulter. »Du siehst doch, sie ist ganz durcheinander … Wir müssen ihr jetzt Zeit lassen. Glaub mir, es wird alles gut werden.«
Noch nie in seinem Leben sollte sich Erhard Schneider so geirrt haben …
Zwar sah es in den nächsten Tagen ganz so aus, als wenn alles wieder in Ordnung gekommen wäre. Schneiders richteten es so ein, daß wenigstens Isabella jeden Abend frühzeitig nach Hause kam, damit sie sich um ihre Tochter kümmern konnte.
Michaela schien ganz verwandelt. Mit überraschender Energie stürzte sie sich in ihre Schulaufgaben. Das Benehmen den Eltern gegenüber war höflich, wenn auch etwas kühl. Sie schien Gregor vollständig vergessen zu haben.
Wenn Isabella vorsichtig versuchte, dieses Thema zu berühren, wich sie sofort aus.
»Das ist doch jetzt ganz uninteressant, Mutter.«
Sie kam jeden Tag von der Schule ohne Umweg nach Hause. Und wenn sie angerufen wurde, waren es Klassenkameradinnen, die ihre Aufgaben mit Michaela besprechen wollten.
Ihr Vater strahlte. Für ihn war die Schlacht bereits gewonnen, hatten seine Erziehungsmaßnahmen die besten Erfolge gezeitigt.
Nur Isabella betrachtete das Betragen ihrer Tochter mit Besorgnis. Sie konnte ein Gefühl des Unbehagens nicht loswerden. Michaelas Verschlossenheit erschreckte sie. Ihre Freudlosigkeit tat ihr weh.
Schließlich war sie es, die Michaela zuredete, ihre beiden Schulfreundinnen Stefanie und Heidrun ins »Luitpold-Kino« zu begleiten.
Als die drei Mädchen nach der Vorstellung ins Freie traten, gingen gerade die Straßenlaternen an.
Tauwetter hatte eingesetzt, und das Schneewasser rauschte gurgelnd in die Gullys. Sie hatten keine rechte Lust, nach Hause zu gehen.
Die dunkle Stefanie war es, die zuerst das Auto sah, das wenige Meter vor ihnen am Bordstein hielt. »Schaut mal«, rief sie, »schicke Karre, was?«
Michaela drehte sich um. Am Steuer des weißen Sportwagens saß Till Torsten.
Er hatte das Wagenfenster heruntergekurbelt und winkte ihr zu. »Ein guter Bekannter«, sagte Michaela hastig zu ihren Freundinnen. »Ich muß los. Bis morgen, ihr beiden. Tschau …«
Ohne sich noch einmal umzusehen, lief sie auf den Wagen zu. »Schöner Bekannter«, sagte Heidrun neiderfüllt hinter ihr her. »Der könnte ja zweimal ihr Vater sein.«
»Aber sein Schlitten ist toll«, erklärte Steffi. Die beiden Mädchen blieben stehen und sahen neugierig zu, wie Michaela gewandt in den Wagen stieg. »Onkel Till — du?« fragte Michaela den Mann am Steuer.
Till Torsten lächelte, langte an ihr vorbei und zog die Tür ins Schloß. »Wenn du ein nettes Mädchen bist, sagst du nie wieder Onkel zu mir.«
»Warum nicht?« fragte Michaela verständnislos. »Du bist doch mein Onkel.« Und mit plötzlichem Mißtrauen fügte sie hinzu: »Oder etwa nicht?«
»Natürlich — trotzdem mag ich es nicht von dir hören. Onkel steht mir nicht. Es macht alt.«
»Ach, deshalb«, sagte Michaela erleichtert. »Ich dachte schon …«
Sie schwieg und biß sich auf die Lippen. Fast hätte sie von ihrem Verdacht erzählt, daß sie nicht das wirkliche Kind ihrer Eltern wäre. Aber ein dunkler Instinkt hielt sie davon zurück.
Till Torsten ahnte nicht, was in dem Mädchen vorging: »Weil deine Eltern mich nicht gerne sehen, meinst du. So was kommt in den besten Familien vor. Immerhin können sie die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß ich der Bruder deiner Mutter bin.«
»Warum kommst du uns dann nie mehr besuchen?«
»Haben sie dir das nicht gesagt?« fragte Till Torsten und blickte sie forschend von der Seite an.
»Nein — sag mal, wohin fahren wir eigentlich?«
»Ich habe mir gedacht, wir gehen irgendwo eine Tasse Kaffee trinken.«
»Nein, das geht auf keinen Fall«, erwiderte Michaela sofort.
Till Torsten zeigte ihr nicht, daß er beleidigt war. »Also auch du willst nichts von mir wissen«, sagte er spöttisch. »Ich hätte es mir denken können.«
»Doch nicht deswegen, mir ist es doch ganz egal, weswegen du dich mit Paps zerstritten hast, bloß, er paßt in letzter Zeit höllisch scharf auf mich auf. Ich darf nirgends mehr hin. Nichts darf ich mehr.«
Er begriff sofort. »Was ausgefressen?«
»Ach wo. Ich bin nur einmal ein bißchen spät nach Hause gekommen. Und sie haben mich dabei erwischt. Du kannst dir das Theater nicht vorstellen.«
»O doch. Das kann ich«, sagte er ehrlich.
»Meine Eltern tun so, als wenn ich wer weiß was angestellt hätte. Nur weil ich tanzen war«, sagte sie bitter. »Wozu haben sie mich dann erst in die Tanzstunde geschickt?«
»Mach dir nichts draus, Kleines. Alles geht vorüber. Aber das ist ein schlechter Trost.«
Michaela berührte seinen Arm: »Sag nicht Kleines zu mir, du willst ja auch nicht, daß ich …«
»Schon recht. Wie soll ich dich dann nennen?«
»Micky. So wie meine Freunde.«
»Gut, Micky, abgemacht.«
Till Torsten fuhr ruhig und sicher durch das Gewühl des abendlichen Verkehrs. Er nahm den Weg über die Friedensbrücke und am Friedensengel vorbei.
»Bitte«, sagte Michaela, »setz mich nicht gerade vor unserem Hause ab. Ein paar Straßen früher, damit meine Eltern es nicht merken.«
»Geht es wirklich nicht, daß du dich noch einmal von zu Hause wegschleichen kannst?« fragte er. Als er merkte, daß sie zögerte, setzte er rasch hinzu: »Warum sollten wir beide nicht einmal zusammen bummeln gehen? Es wäre wunderbar. Ich kenne die schicksten Lokale und die besten Kapellen …«
»Du weißt genau, wie gern ich ja sagen möchte.«
»Dann tu’s doch — oder geht es wirklich nicht?«
Michaela dachte nach. »Höchstens Freitag«, sagte sie zögernd. »Da sind meine Eltern zu Geschäftsfreunden am Tegernsee eingeladen. Eine wichtige Sache, die sie nicht absagen können.«
»Na, also«, sagte Till zufrieden. »Also Freitag abend — um wieviel Uhr?«
»Aber da ist noch Frau Beermann — unsere Haushälterin?«
Er lachte. »Mit der wirst du doch spielend fertig.«
Sie hatten den Stadtteil Bogenhausen erreicht, und Till Torsten bremste hart.
»Freitag abend acht Uhr erwarte ich dich hier. Hier, an dieser Stelle.«
»Und wo kann ich dich erreichen, wenn es nicht klappt?«
»Es muß klappen … Ich bin sicher, daß du mich nicht enttäuschen wirst.«
Michaela nickte und stieg aus.
Nein, sie hatte bestimmt nicht vor, ihren charmanten Onkel zu enttäuschen. —
Der Freitag kam heran.
Michaela hatte sich immer wieder den Kopf darüber zerbrochen, wie sie am Abend das Haus verlassen sollte, ohne daß die Haushälterin, Frau Beermann, ihren Eltern davon Mitteilung machte. Natürlich hatte sie Anna in gewisser Weise in der Hand. Denn diese hatte ja auch von den früheren abendlichen Ausgängen Michaelas gewußt, ohne sie ihren Eltern zu verraten. Aber ob sie jetzt, nachdem alles herausgekommen war, noch zu ihr halten würde?
Vielleicht war es doch besser, wenn sie sich frühzeitig auf ihr Zimmer zurückzog und kurz vor acht Uhr über das Spalier entwischte. Aber das war ziemlich unbequem. Man konnte sich, wie Michaela aus Erfahrung wußte, leicht die Strümpfe dabei zerreißen.
Das Problem wurde ohne Michaelas Dazutun gelöst, Nachmittags erhielt Frau Beermann plötzlich ein Telegramm aus Rosenheim. Darin teilte ihr eine Bekannte mit, daß ihre Mutter schwer erkrankt wäre. Frau Beermann war erschrocken, sie hing sehr an ihrer Mutter. Michaela redete ihr mit Nachdruck zu, sofort zu ihr zu fahren und nach dem Rechten zu sehen.
Frau Beermann zögerte.
»Morgen früh können Sie doch schon wieder zurück sein«, lockte Michaela.
»Ja, aber — versprichst du mir, vernünftig zu sein?«
»Ich habe einen ganzen Haufen Schularbeiten. Sie dürfen Ihre Mutter nicht im Stich lassen. Sie wohnt doch ganz allein, haben Sie mir erzählt.«
»Manchmal kannst du sehr lieb und vernünftig sein, Michaela«, sagte Frau Beermann.
Sie dachte sich nichts dabei, als Michaela verlegen die Augen senkte …
Kurz nach sechs Uhr verließ Frau Beermann das Haus, um zum Münchner Hauptbahnhof zu fahren.