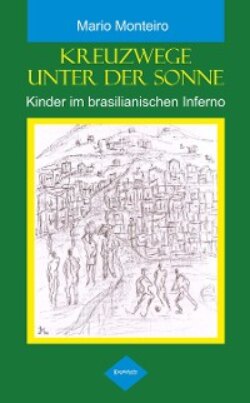Читать книгу Kreuzwege unter der Sonne - Mario Monteiro - Страница 6
HEIMKEHR NACH ARARAPURANA
ОглавлениеAgreste! Trockenes, ausgedörrtes, sterbendes Land. Stahlblauer Horizont, so weit ich sehen kann. Wolkenlos. Weder Sand noch Erde, selten eine Wurzel, verloren im Staub. Staub, nichts als Staub. Rotgelber Staub, undurchdringlich. Von überall weht er her und nirgends bleibt er. Ein einzelner Baum, der nicht recht in diese Landschaft passen will, steht neben mir. Einsam trotzt er einer Umgebung, die ihn nicht zu dulden scheint. Zweifel überfallen mich. Ist das wirklich ein Baum? Oder nur ein Rebell aus Ästen, die wie Finger eines Toten, den man schlecht beerdigt hat, aus dem Boden ragen?
Agreste! Kakteen unter der Sonne. Rotglühende Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Gleißend sticht sie durch die Haut und brennt meine Knochen lahm. Schon jetzt, am frühen Morgen, bin ich müde von gestern und von vorgestern und von allen Tagen zuvor, an die ich mich erinnern kann. Der Lappen auf meinem Kopf, vor Kurzem noch klatschnass, ist ausgetrocknet. Lustlos hängt er in meinem Nacken und über den Ohren. Halb zugekniffene Augen warnen mich vor Stacheln, die es auf mich abgesehen haben.
Ein Busch kriecht dicht am Boden, nach Wasser grabend. Um ihn herum erreicht mein Blick nur steinharte Zweige, trocken gegerbt, leblos. Hitze, die niemals nachgibt, Schweiß, der aus tausend Poren schießt und den der Boden unter meinen Füßen gierig verschluckt.
Gierig wie die Aasgeier, die frech um mich herumsitzen und warten. Warten auf was? Schafe und Ziegen sind selten geworden. Blank genagte Knochen starren durch die Ewigkeit aus Geröll und Staub. Nichts wird zu nichts.
Agreste! Der letzte Regen fiel vor einem halben Jahr. Jubel verhallt so schnell wie Wasser im Sand versickert. Irgendwo liegt ein Blatt. Ein einzelnes Blatt, das seine Farbe längst verloren hat. Leise knisternd zerbröckelt es. Bald wird es ein Teil sein von versandetem Land und Staub und Trauer, und keiner wird wissen, woher es einmal kam.
Und ich, Agreste? Wo sind die Wege geblieben, die mich in deine Arme geführt haben? Und wann war es und warum überhaupt? Ich höre nicht auf nachzudenken und weiß es dennoch genauso wenig wie das Blatt, das vor meinen Füßen im Sand verdorrt. Oder wie die einfachen Kreuze, die irgendjemand aus krummen, knorrigen Ästen zusammengebunden hat und die ohne Friedhofsmauer und ohne Grabsteine dahindämmern und ohne Namen, die an die hier Begrabenen erinnern könnten.
Agreste! Selbst die Toten sind hier bedürfnisloser als sonst irgendwo.
Ein paar Minuten vor Sonnenaufgang kommt der Bus. An den verbeulten Schüttelkasten, dessen Türen nicht mehr richtig schließen und den Staubwolken freien Einlass gewähren, habe ich mich inzwischen gewöhnt. Von dem orangefarbenen Lack ist nicht mehr viel zu sehen. Nur seltsame Flecken und bizarre silbergraue Streifen, die das Sonnenlicht widerspiegeln und in meinen Augen schmerzen, sind übriggeblieben. Wind und Sand haben gründliche Arbeit geleistet.
Auf dem Dach halten sie sich gegenseitig. Notdürftig verschnürte Pappkartons aus zweiter Hand, mit einem mageren Strick eines ans andere gebunden. Tücher, die ein paar Habseligkeiten enthalten, und Köfferchen und Beutel, die während des täglichen Dahinrumpelns wie unförmige Klumpen hin- und hertanzen, dazwischen ein zerschlissen zerrittener Sattel samt Lasso, zuletzt ein betagter Tisch, dessen Beine nach oben ragen.
Mit dem knappen Fahrgeld, das man den Passagieren für die tägliche Fahrt abnehmen kann, ist es nicht weit her. Jede kleine Kiste, jeder Sack, jede Basttasche zählt. Ein paar Gemüsekisten, die auf den nahen Markt sollen, runden die schmalen Einkünfte ab. Fast ist die ärmliche Fracht so wertvoll wie die Hoffnung. Und nur Hoffnung ist wichtiger als der nächste Regen, auf den man geduldig wartet.
Trotz des krächzenden und scheppernden Motors schaffen wir es jeden Tag, an unser Ziel zu kommen. Leidend, hoffend, betend und wartend. Wir warten, bis irgendein Wunder geschieht. Die Frau, die manchmal in meiner Nähe sitzt, lispelt unverständlich vor sich hin, wobei sie ihren Rosenkranz in krallenartigen Fingern hält und langsam weiterschiebt.
Ich versuche, mit dem Blick durch das von Staub und Sand blind gewordene Fenster zu dringen. Selten entdecke ich Neues. Irgendetwas anderes als das, was sich mir jeden Morgen bietet. Mein Blick fällt auf eine Gruppe Frauen, die randvolle Wasserkübel auf ihren Köpfen nach Hause schleppen. Zum nächsten Brunnen sind es sechs Kilometer. Vielleicht auch ein paar mehr. Ende der Woche soll der Wasserwagen kommen. Wunder sterben niemals aus. Man muss nur an sie glauben.
Agreste! Auch das gebrechliche Gefährt, dem ich mich täglich anvertraue, findet den Weg, den es in Wirklichkeit nicht gibt. Zwischen den Kreuzen und dem Baum neben mir sehe ich Reifenspuren von gestern. Nicht weit davon stehen die Hütten von Ararapurana am Wegrand. Die Straße, die dort einmal hätte vorbeiführen sollen, hat man aufgegeben. Acht Hütten sind es. Während wir an ihnen vorbeirumpeln, zähle ich sie wieder. Rotbraune Lehmwände, grob und rau, da und dort mit gelben Flecken dazwischen, so als ob man sie tarnen wollte. Fingerbreite Risse, die sich über die Mauern gelegt haben, sehen aus wie Spinnenbeine und haben sich längst in mein Gedächtnis gegraben. Ab und zu scheint man ein paar Ziegel dazwischengestopft zu haben, um das Schlimmste aufzuhalten. Noch heute könnte ich sie zeichnen, und manchmal erscheinen sie in meinen Träumen.
Ich bemerke einen Schatten, dann das ausgemergelte, lederne Gesicht. Knöchern, reglos starrt es durch den Schlitz eines verblichenen Baumwolltuches auf unseren Bus. Wie ein Schmetterling, dem die Hitze zu viel wurde, flattert der Fetzen Stoff zwischen den Rissen hin und her, vielleicht um Staub und Sand abzuhalten und dem von draußen Kommenden die Sicht zu verwehren, obwohl es nicht viel zu sehen gibt. Unser Bus fährt gleichgültig daran vorbei. In Ararapurana wartet niemand auf ihn.
Neben uns geht ein kleiner Junge im Sand. Unerschütterlich trottet er vor sich hin und scheint das Ziel der langen Strecke seinen Beinen zu überlassen. Gottergeben, wie mir scheinen will, stolz und mutig läuft er ein paar Meter neben uns her und verliert sich dann im Staub, den wir hinter uns herziehen.
Wohin es den Kleinen jeden Morgen trieb, hatte ich mich lange nicht gefragt. Viel zu lange, wie mir heute scheinen will, und manchmal, wenn es Nacht wird, schäme ich mich, weil ich nicht einschlafen kann und weil mir der Bub anfangs gar nicht aufgefallen war, ja, weil mir seine Existenz wochenlang gleichgültig gewesen war, so, wie einem in der Agreste, die Mensch und Tier und jeden Halm im Boden gnadenlos aussaugt und zu Stein werden lässt, allmählich nichts mehr wichtig ist.
Lange hatte ich mich nur in die hinterste Ecke des Busses verdrückt, um mich auf diese Weise vor hereinquellenden Staubwolken und den Puffern im Rücken auf durchgesessenen Bänken zu schützen und das ewig gleiche Gemurmel meiner Mitreisenden nicht fortwährend anhören zu müssen. Warum hatte ich so lange nichts anderes getan, als den baumwollenen Lappen über Mund und Nase zu halten, ohne auch nur die Spur eines Gedankens an den Jungen verschwendet zu haben? Da er keine Schülermappe trug und auch keines der üblichen Säckchen auf seinem Rücken baumelte, konnte ich annehmen, der Junge begebe sich nicht zum einzigen Schulhaus in dieser Gegend. Übrigens handelte es sich dabei um eine äußerst bescheidene Baracke, die man erst vor Kurzem erstanden hatte und schließlich zwischen Ararapurana und einer benachbarten Siedlung ans Ufer eines ausgetrockneten Tümpels setzte. Doch so weit lief der Junge sicher nicht. Noch weniger hätte ich ihn allerdings vor jenem primitiven Gipsofen vermutet, der sich hinter einer kaum wahrnehmbaren Anhöhe befand und zusammen mit der nahen Ziegelei von morgens bis in die Nacht grauschwarze Rauchwolken in den Himmel stieß.
Dass ich den Buben am Ende doch noch kennenlernte, hing mit einem Ochsenfuhrwerk zusammen, dem unser Bus nicht rechtzeitig ausgewichen war, was schließlich zu endlosem Palaver und zu einem längeren Aufenthalt führen musste. Und auch dabei war mir der Kleine zunächst nicht aufgefallen, da der Zwischenfall von Ararapurana die umherstehenden Bewohner derart in Aufruhr versetzte, dass mir der Tumult, der sich im Anmarsch befand, als unvermeidlich erscheinen musste.
Ganz plötzlich stand dann der Bub neben mir. Selbst der aufgeregte Atem war mir nicht entgangen, und obwohl ich den kleinen Läufer nicht sofort entdecken konnte, hatte ich doch nicht den geringsten Zweifel. Nur er konnte es sein. Jener Junge, den ich wochenlang nicht beachtet hatte. War es dann so unverständlich, dass ich plötzlich zu zittern begann?
Schließlich drückte sich der Junge an mir vorbei nach vorn, und sicher war es nur ein jäher Entschluss, um das verletzte Tier aus nächster Nähe sehen zu können. Ich sah die Muskeln seines Nackens zucken, bevor er sich ruckartig umwandte und mit unverkennbarem Vorwurf in mein Gesicht starrte. Warum richtete er seinen Blick gerade auf mich? Sah er in mir vielleicht den einzig Schuldigen für den Zwischenfall an jenem Morgen? Warum hilfst du denn nicht?, las ich in seinen Augen. Und trotzdem schwieg er. Ja, ich glaubte zu bemerken, dass er seine Lippen noch fester aufeinanderpresste.
»Es sieht schlimm aus«, sagte ich, nur um meine Verlegenheit zu verbergen.
»Kann man nichts für ihn tun?«
»Man wird einen Tierarzt holen müssen.«
Der Junge sah mich ratlos an. Sofort erkannte ich meinen Fehler. War ich noch nicht lange genug in der Agreste? Ein Tierarzt? Hier in Ararapurana, in dieser Gegend aus Leiden, Staub und Tod? Vermutlich hatte weder der Junge noch sonst jemand die geringste Ahnung, dass es so etwas wie einen Tierarzt überhaupt gab. Wenn es nicht anders ging, dann töteten sie die Tiere, um einen letzten Gewinn zu haben, und versuchten vergeblich, sich flügelschlagende Aasgeier vom Leib zu halten.
»Wie heißt du?« Die Frage kam mir belanglos vor, ja lächerlich, und doch war mir in diesem Moment nur diese eingefallen, um das karge Gespräch in Gang zu halten und von dem betrüblichen Ereignis des Morgens loszukommen.
»Jere«, antwortete der Bub nach einer kurzen Pause, in der er angestrengt nachzudenken schien. »Jere!« Ganz langsam, als ob er buchstabieren müsste, brachte er die vier Buchstaben heraus, und das in jener typischen Nuance, die für die Menschen im Nordosten kennzeichnend ist. »Alle sagen Jere. Nur mein Vater sagt Jeremias. Die anderen sagen Jere. Jeremias mag ich nicht.«
»Und weiter?«, forschte ich, um seinen ganzen Namen zu erfahren.
»Ich weiß nur Jere.«
Und sein Vater? Gewiss war der Bub verständig genug, um den vollen Namen seines Vaters zu kennen. Davon ausgehend, fing ich erneut an nachzuforschen: »Kennst du den Namen deines Vaters?«
»Zé.«
»Nur Zé?«, fragte ich und die Verzweiflung musste mir im Gesicht gestanden haben.
Jere nickte. »Nur Zé. Alle sagen Zé.«
»Und deine Mutter?«
Der Junge schüttelte den Kopf und hielt den Daumen nach unten. Ich verstand und es tat mir leid, ihn danach gefragt zu haben. Doch dann hatte ich den Eindruck, er mache sich nichts daraus. »Du hast keine Mutter … mehr?«, wagte ich mich weiter vor.
Jere zuckte mit den Schultern. »Gott hat sie genommen«, erklärte er sachlich.
Ich dachte an die Kreuze und wurde den Eindruck nicht los, er erinnere sich gar nicht mehr an seine Mutter.
»Der Ochse blutet immer noch«, unterbrach er meine Zweifel.
»Er wird durchkommen«, behauptete ich, allerdings ohne die geringste Ahnung zu haben. Und ich wunderte mich, woher die Kraft kam, die meiner Stimme so viel Gewissheit verliehen hatte. Im gleichen Moment entschied ich mich, die nächste Frage an ihn zu richten: »Gehst du nicht zur Schule?«
Eine Stahlfeder schien seinen Kopf hochschnellen zu lassen. »In die Schule?« Es sah aus, als denke er darüber nach. »Nein. Ich war niemals dort.«
»Was machst du dann, wenn du nicht zur Schule gehst?«
»Steine.«
Ich verstand nicht, was er damit meinte. Doch schien er sich mit mir keinen Spaß zu erlauben, denn sofort hielt er beide Hände so vor sich hin, als ob er einen Stein tragen müsste. Dabei sah er mich mit halb geschlossenen Lidern an, als wolle er sich vor etwas schützen. »Ich mache Steine«, erklärte er stolz.
Ich fühlte, dass es für ihn das Natürlichste der Welt war, wenn ein Neunjähriger schon genug Kraft besaß, um ihn Steine brennen zu lassen.
»Backsteine, weißt du«, versicherte er mir und sah mich dabei an, als ob ich es noch immer nicht verstanden hätte. »Schöne rotbraune Backsteine, aber ohne Glasur.« Dabei deutete er auf das Gestrüpp jenseits des engen Weges, hinter dem seit etlichen Minuten dichte Rauchschwaden in den Himmel kletterten. Von nun an war meine Neugierde nicht mehr zu bremsen. »Droben gibt’s Lehm.« Das sollte ich nun auch noch glauben. »Nicht besonders guten, aber es geht schon. Aus Lehm kann man Backsteine brennen«, wurde ich belehrt.
»Was bekommst du dafür?«, wollte ich wissen.
»Zwei Reais jeden Abend, aber nur, wenn ich 300 Steine fertigbringe.«
Ich brauchte nicht lange nachzurechnen. Knapp einen Dollar täglich bekam er also, wenn er lange genug in der Hitze stand. »Du machst 300 Steine am Tag?«, zweifelte ich.
»Nein«, widersprach er. »Nicht am Tag.« Nun war er sicher: Von Ziegeln hatte ich keinen blauen Dunst. »Nur nachmittags mache ich Steine.«
Könnte er dann nicht am Vormittag in die Schule gehen?, überlegte ich. »Was machst du jetzt?«
»Holzkohle abladen und zum Gipsofen schleppen. Morgens muss die Kohle zum Gipsofen.«
»Und dafür? Wie viel gibt’s dafür?«
»Nichts!«
Für einen Moment lehnte ich mich an den siedend heißen Kotflügel unseres Busses. Hatte ich richtig verstanden? Oder musste ich wieder mit etwas fertigwerden, das man nur in Ararapurana begreifen konnte? »Nichts?«, wiederholte ich abwesend. Vielleicht habe ich ihn damals sekundenlang angestarrt. Oder einfach auf den sandigen Weg oder in den Schattenstrich unseres Busses geblickt. Ich weiß es heute nicht mehr. Vielleicht war der kleine Jere gar nicht bei Verstand und die anderen machten mit ihm, was sie wollten. Sicher war nur eines: ›Nichts‹ hatte er gesagt. Schleppte er wirklich den ganzen Vormittag die Kohle zum Gipsofen? Ganz umsonst?
Der Kleine sah mich an wie einen, der erst heute Morgen auf die Welt gekommen sein konnte. »Weißt du, wenn ich die Kohle nicht zum Ofen bringe, lässt er Frico die Steine pressen. Der ist da doch auch hinterher. Und dann …?«
Ja, dann … Ich nickte und versuchte, ihn davon zu überzeugen, dass ich alles verstanden hatte, und insgeheim hoffte ich, dass er mein Entsetzen nicht bemerkte.
»Geschäft ist Geschäft«, sagte Jere fröhlich.
»Wenn du nicht Steine pressen müsstest, würdest du dann in die Schule gehen?«
Wieder schien er gründlich nachzudenken. »Vater sagt, Schule sei Quatsch. Ich müsse Geld verdienen.«
»Hm.« So ganz neu war mir diese Theorie nicht. »Und sonst, was würdest du …«
»Fußball spielen«, platzte er heraus. »Weißt du, ich würde gerne Fußballer werden. Fußball ist toll!«
»Kannst du spielen?«
»Ein bisschen schon. Aber nur ein bisschen.«
»Hast du einen Ball?«
»Nein«, sagte er und sah auf seine nackten Füße. »Breno hat einen, aber der ist doch geplatzt. Letzte Woche«, fügte er traurig hinzu. Aber dann sah ich ihn zum ersten Mal lachen. »Weißt du, jetzt kicken wir halt so noch n bisschen damit rum.«
Einige Wochen später brachten sie Jere zu uns. Ich brütete gerade über der Liste unerlässlicher Ausgaben. Sollten wir unsere kleine Station doch noch schließen müssen? Jere war in der Ziegelei aus drei Metern Höhe von der Leiter gestürzt. Dabei hatte er sich zwei Rippen gebrochen, nachdem er auf ein Wägelchen voll Backsteine gefallen war. »Jetzt werden sie Frico Steine machen lassen«, jammerte er, da er mich inzwischen erkannt hatte.
»So kannst du auf jeden Fall nicht arbeiten.« Der Arzt schüttelte energisch den Kopf.
Schwester Miriam stand mit dem Formular in der Hand neben mir und redete auf den Buben ein. »Hast du einen Ausweis dabei?« Wie sollte sie ihn denn in die Patientenliste eintragen?
»Hab keinen.«
»Sonst irgendetwas mit deinem Namen? Vorname, Nachname und so? Wo wohnst du denn?«
»In Ararapurana.«
Schwester Miriam sah die Zwecklosigkeit weiterer Fragen ein. »So, in Ararapurana also? Aber ohne irgendeinen …«
»Jeremias da Cunha«, flüsterte ich ihr zu, da mir dieser Name gerade in den Kopf kam. »Den Ausweis bringt er schon noch.«
Schwester Miriam spitzte die Lippen und sah mich von der Seite her an. »Na ja, wenn Sie das sagen …« Inzwischen kannte sie mich gut genug.
Wer in Ararapurana hatte schon einen Ausweis? Meistens haben die Eltern nicht einmal die paar Reais, um den Geburtsschein der Neugeborenen zu bezahlen. Es gab ein bedauerndes Kopfschütteln auf der Registratur und der kurze Dialog war beendet. Kein Geld – kein Geburtsschein. Am Ende hatte jeder seine Spesen.
Auch für den kleinen Jere aus Ararapurana hatten sie nichts übriggehabt als ein kurzes Schulterzucken. Streng genommen war er nie auf die Welt gekommen. Jere existierte einfach nicht. Und nie im Leben würde er ein Recht haben. Nicht einmal das Recht zu sterben. Es würde nur ein einfaches Kreuz aus knorrigen Ästen zusammengebunden und ohne den Namen irgendwo in der Agreste in den Boden gesteckt werden.
Zehn Tage lang hatten wir ihn auf der Station. Sobald es der Arzt verantworten konnte, half Jere in der Küche mit.
Von nun an verging kein Tag, ohne dass er mir von den Ziegeln erzählte. »Frico macht jetzt meine Steine«, jammerte er jedes Mal, sobald ich mich in der Küche zeigte, um Bestände aufzunehmen oder das Mittagessen nachzuprüfen. »Nie mehr werde ich Backsteine machen dürfen.« Und dann weinte er wieder. Backsteine, Backsteine, Backsteine! So lange, bis ich davon zu träumen begann. Nächtelang stieß ich mit einer Schar Kinder zusammen. Kinder, Kinder, Kinder, lehmverschmiert in der Gluthitze vor dem Ziegelofen schuftend.
Der Anruf, der mich nach São Paulo zurückbeorderte, kam völlig unerwartet. Abkommandiert. Was wussten die in São Paulo von Ararapurana! Kurz vor Sonnenuntergang hetzte ich auf die Registratur. Mein Entschluss stand längst fest. Der Beamte hatte ein Einsehen und stellte den Geburtsschein aus – gegen anfallende Extraspesen, wie er mir im Flüsterton begreiflich machte. Ich zwinkerte ihm vertraulich zu und danach machten wir aus Jere einen Menschen. Gewissensbisse hatte ich nicht. Der Junge war schließlich auf die Welt gekommen, ob es die anderen wahrhaben wollten oder nicht.
»Von jetzt an heißt du Jeremias da Cunha.«
»Da Cunha? Wieso da Cunha?«
»Heißt dein Vater nicht etwa da Cunha?«
Jere lachte. »Er heißt doch nicht da Cunha. Er heißt nur Zé. Und ich will Jere heißen«, protestierte er. »Jeremias gefällt mir nicht!«
»Was willst du jetzt machen?«, fragte ich und hielt die Hände auf, als trüge ich einen Ziegel.
»Wenn ich Fußball spielen könnte …«
Doktor Moreira untersuchte ihn ein letztes Mal und klopfte seinen Brustkorb ab. »Fußball … Na ja, Jere, wenn du Fußball spielen willst, dann tu es!«
Ich muss ziemlich verloren in meiner Ecke gesessen haben.
»Was hast du?«, fragte Jere, als er in das kleine Büro hereinsah.
»Nichts«, log ich. »Es ist … es ist nur ein Moment. Ich habe das häufig.« Dann griff ich nach dem Hörer und versuchte, São Paulo zu erreichen. Vielleicht konnte ich einen kleinen Aufschub erwirken … nur einen Monat.
Vierzehn Tage zuvor hatte der Junge nicht gewusst, was ein Telefon war. Als ich aufgelegt hatte, zeigte er auf den Apparat. »Teléfono«, erklärte er begeistert. Wir lachten beide. Plötzlich aber wurde er ernst. »Du hast etwas. Ich weiß das!«
Ich gab keine Antwort. Stattdessen nahm ich einen Zettel aus der Schublade und tat, als notierte ich irgendetwas Wichtiges. Ich schämte mich. Warum wollte ich es vor dem Buben verheimlichen?
»Ich muss zurück nach São Paulo«, sagte ich endlich und sah dabei zum Fenster hinaus. Als ich mich umwandte, sah ich eine einzelne Träne über Jeres Gesicht rollen.
»Warum … musst du?«
Wieder hatte ich keine Antwort, die ihn hätte überzeugen können. Was wusste er von unserer Welt?
»Ich werde wieder Steine machen!«
Es traf mich wie ein Schlag.
»Senhor Ronaldo wird mich wieder Steine machen lassen. Die Rippen sind ganz okay. Und ich mache bessere Steine als Frico! Viel bessere!« Jere straffte seinen Oberkörper und versuchte, mir etwas von seinem jugendlichen Bizeps zu zeigen. »Ich werde billiger sein als Frico!«
»Nein! Jetzt hast du einen Ausweis. Du bist Jeremias da Cunha!«
»Jere«, widersprach er und wurde ernst.
»Okay. Dann eben Jere. Auf jeden Fall wirst du mit mir nach São Paulo fahren.«
Er lehnte sich an die kahle Bretterwand und hielt den Atem an. »Nach … São … Paulo? Wo ist das? Mit einem Omnibus?« Dann lachte er laut. »Du schwindelst.«
»Nein, ich schwindle ganz und gar nicht.«
»Ich … Omnibus fahren?«
»Ja, du.«
Bis jetzt hatte Jere noch nie in einem Bus gesessen. Meine Gedanken jagten hinter mir her. Das Abenteuer, auf das ich mich durch dieses Versprechen eingelassen hatte, kam mir zu spät in den Sinn.
Zehn Tage quälte ich mich damit herum. Zehn Tage mit Leptospirose, Chagas-Leiden, Ruhrpatienten, Fieberkurven, Knochenbrüchen, Magenblutungen. Zehn Tage im Zickzack zwischen Leben und Tod.
Per Telefon bettelte ich in Rio um ein paar Pakete Verbandsmaterial, um Serum, um ein paar tausend Reais für dringende Medikamente. Der Präsident habe versprochen … Der Gesundheitsminister habe das Gesuch weitergegeben … Der Sonderbeauftragte sei zurzeit auf Europareise … Nächste Woche vielleicht … Ich legte auf.
Schwester Miriam stand in der Tür. Der kleine Vitório war vor ein paar Minuten gestorben. Seine Mutter hatte ihn zu spät auf die Station gebracht und das, was ihn hätte retten können, fehlte im Regal. »Gott nimmt sie«, sagte die Frau mit dem toten Kind im Arm. Von sieben Kindern war es das dritte, das sie verloren hatte. »Gott gibt sie, Gott nimmt sie.«
Agreste endlos. Leben von heute auf morgen. Hoffen, warten, beten und glauben. Vor allem glauben. Ich hielt die Hand über die Augen und blinzelte durch das Fenster hinaus in die gleißende Weite. Platz genug gab es hier. Platz für Kreuze aus knorrigen Ästen, mit Bast zusammengebunden.
»Mario«, sagte Schwester Miriam und umarmte mich, als wir mit Jere vor dem Überlandbus standen. »Ach, Mario!«
Jere kletterte wie im Traum in den Bus. Drei Tage und zwei Nächte dauerte die Reise. Quer durch Brasilien. Tagsüber dösten wir vor uns hin, rutschten hin und her, versuchten minutenlang, eine andere Lage ausfindig zu machen, um unsere Rücken zu vergessen, und sehnten uns nach dem nächsten Stopp. Dann und wann riss Jere die Augen auf, wenn wir auf Zentimeterdistanz an einem Lkw vorbeirutschten. Tagelöhner oft, auf schwankenden Brettern dicht gedrängt aufeinanderhockend, braune, runzelige, sonnenversengte Gesichter, Frauen mit ihren Kindern dazwischen, irgendwo Halt suchend, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Magisch vorbeigleitende Landschaften, dazwischen unsere bizarren, unsicheren, wahllos zusammengeschraubten Gedanken, plötzliche Vorstellungen, die sich nie verwirklichen ließen, wie Blitze, die im Unwetter zuckten und uns das Dunkel überließen. Brasilien endlos.
»Kann ich Steine machen in São Paulo?«
Ich musste lachen. Warum lachte ich eigentlich? Es war mitten in der Nacht. Hinter mir hustete jemand und klopfte auf meinen Rücken. »Nein«, flüsterte ich.
»Warum nicht?«
Wie sollte ich es dem Jungen erklären, der nichts gesehen hatte, außer drei, vier Hütten, einen Haufen Ziegel und den staubigen engen Weg zum Gipsofen, zu dem er jeden Morgen Holzkohle schleppte? Wie sollte ich ihm verständlich machen, wie es ist, wenn du über nie endende Asphaltbänder jagst und an hundert steil in den Himmel ragenden Betonriesen entlangirrst, mitten im Donner von Bussen und Mikrotransportern, Lastern, Bahnen, uralten Vehikeln auf abgefahrenen Reifen, aufgepeitscht vom Kreischen der Bremsen neben dir, von Trillerpfeifen, dem Gebrüll von tausend Straßenhändlern, dem nervenzerreißenden Kratzen der Zementmischer, hart auf hart aufeinanderschlagenden Stahlträgern, absinkend im Tapsen und Rennen der Dahinflüchtenden, gefangen im Taumel der Eiferer, zwischen Glück und Ausweglosigkeit, Hass und Hölle, Angst und Jubel derer, die sich selbst nicht mehr verstehen und widerstandslos in die Einsamkeit schlittern. Brasilien endlos!
Zwei Nächte lang sah ich dem Buben ins Profil, während er mit halb offenem Mund im zerrissenen, abgeschabten Polster hing. Was hatte ich verbrochen? Ich suchte nach handfesten Gründen, nach Trost, nach Halt, nach der geringsten Rechtfertigung für meinen Entschluss.
»Du wirst lesen und schreiben lernen«, erklärte ich am anderen Morgen.
Jere riss seinen Kopf herum und starrte mich an wie ein Gespenst. »Das werde ich nie lernen. Das ist unmöglich. So etwas … das kann ich nicht.«
Ich fror. Von Neuem überfiel mich ein Nebelschleier voll mit Zweifeln, Ängsten und unlösbaren Fragen, aus denen ich nicht mehr herauszufinden glaubte.
Jere schüttelte immer wieder den Kopf. »Nein«, sagte er leise und es hörte sich an, als bettelte er. »Nein. Ganz bestimmt. Das geht … ich kann das nie.«
»Jeder kann lesen und schreiben lernen«, herrschte ich ihn an. »Und rechnen natürlich auch.«
»Ich kann rechnen.« Jere zählte seine Finger ab. »Senhor Ronaldo zahlt jede Woche zehn Reais.« Jere strahlte. »Siehst du, dass ich rechnen kann?«
Jeremias da Cunha lernte rechnen, lesen und schreiben. An seinem 17. Geburtstag brachte ich ihn in der Buchhaltung einer amerikanischen Gesellschaft unter.
Samstags ging er Fußball spielen. Wenn er dann heimkam, verschwitzt und entkräftet, wurde er oft nicht mehr mit seinen Tränen fertig. »In Ararapurana haben sie keinen Fußball. Der einzige, den sie haben, ist ganz kaputt.« Darüber kam er nie hinweg. »Wenn sie wenigstens einen guten Ball hätten …«
Und sie können nicht lesen, sie können ihren Namen nicht schreiben und sie wissen nicht, wo Europa liegt. Wir verloren kein Wort darüber. Wozu auch? Es war mir klar, dass ich ihm Zeit lassen musste. Viel Zeit sogar.
Eines Morgens, als wir in der Bar an der Ecke unser Frühstück einnahmen, war es so weit. Jere knabberte unlustig an seinem Brötchen und druckste mit etwas herum. Ich war auf etwas Bombastisches gefasst, auf so etwas wie einen Donnerschlag. Hatte sich Jere vielleicht rettungslos verknallt? Oder wollte er ausziehen aus unserer Zweizimmerhöhle, um von nun an allein zu sein? Wenn man lange genug zusammenlebt, spürt man genau, wenn etwas in der Luft liegt. Ich rührte in meinem Kaffee herum. Es kam mir vor, als warte Jere auf den passenden Moment. Oder als ob er nicht wüsste, wie er es sagen sollte.
Dann, ganz plötzlich, überfiel er mich: »Mario! Ich will zurück. Verstehst du? Zurück nach Ararapurana.«
»Warum?«, fragte ich leise und wunderte mich, aus welchem Grund es mich nicht schockierte. Warum? Warum schon? Genauso gut hätte ich irgendetwas anderes, etwas furchtbar Belangloses fragen können.
»Ich werde den Ziegelofen kaufen«, erklärte Jere. »Ich habe Geld gespart.«
»Du willst die Kinder Ziegel brennen lassen?«
Meine unüberlegte Frage musste ihm einen Stich gegeben haben. »Nein!«, schrie er entsetzt, sodass der Barmann hinter der Theke zu uns herübersah. »Natürlich nicht! Ich werde bessere Ziegel machen, solche mit Glasur. Die kann ich nach São Paulo schicken, und sie werden teurer sein als die, die sie jetzt in Ararapurana machen. Dann können die Väter Backsteine brennen, und Frico und Beto und Emilio können in die Schule gehen! Ich werde eine neue Schule bauen, aus guten Ziegeln mit roter Glasur. Denk doch mal! Es wird eine schöne Schule werden, die Kinder werden sich freuen und lachen, und alle werden lesen und schreiben lernen. Alle!«
Ich starrte in meine halb leere Kaffeetasse. Draußen hatte der Nieselregen aufgehört, der Asphalt schillerte grauschwarz und dampfte. Ich weiß nicht mehr, was mich an jenem Morgen zu meinem Entschluss gebracht hatte. Ich weiß nur noch, dass ich auf das Datum meiner Uhr sah. Es war ein 17. April. Der Mann hinter dem Schanktisch erschrak, als ich meine Tasse auf den Tisch knallte. Ich blickte Jere in die Augen. Sie hatten den Glanz der Kindheit verloren.
»Nach Ararapurana …?« Ich nickte ihm zu und schluckte den Rest der Brühe hinunter. »Nach Ararapurana? Ich fahre mit!« Mehr fiel mir dazu nicht ein. Unsere Zeit in São Paulo war einfach abgelaufen.
Jere stürzte auf mich zu und umarmte mich. Ich spürte, dass er richtige Muskeln bekommen hatte.
Eine Woche brauchten wir noch, dann hatten wir aufgeräumt – unsere kleine Wohnung, unsere Jobs, uns selbst. In São Paulo hielten uns alle für verrückt. Und wenn schon! Wir fuhren los.
Drei Tage und zwei Nächte lang träumten wir vor uns hin, schmiedeten Pläne und waren entschlossen, unser Glück nie mehr aus der Hand zu geben. Nie mehr! Um keinen Preis der Welt!