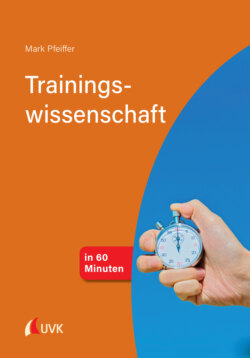Читать книгу Trainingswissenschaft in 60 Minuten - Mark Pfeiffer - Страница 5
Оглавление1 Einführung – Phänomene und Themen der Trainingswissenschaft
Zum Gegenstand „Training“
Die Trainingswissenschaft trägt den zentralen Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Bemühungen bereits im Namen: Training. Allerdings erfordert die vielfältige Verwendung des Begriffs eine inhaltliche Abgrenzung. Wie bereits die eingangs geschilderten Phänomene verdeutlichen, ist Training für die Trainingswissenschaft ausschließlich im Sportkontext von Interesse, so dass andere Verwendungszusammenhänge, beispielsweise beim Gedächtnis-, Manager- oder Anti-Gewalt-Training hier unberücksichtigt bleiben. Dabei wird der Sportbezug in erster Linie über die Ziele hergestellt, die mit Training erreicht werden sollen. Während von der Trainingslehre zunächst das Training und damit auch die Ziele ausschließlich im Leistungssport verortet wurden, wird aktuell in der Trainingswissenschaft durchgängig ein weiteres Begriffsverständnis proklamiert (Hohmann, Lames & Letzelter, 2010; Hottenrott & Neumann, 2010; Olivier, Marschall & Büsch, 2008; Schnabel, Harre & Krug, 2008; Martin, Carl & Lehnertz, 1991). Bereits Ballreich und Kuhlow (1975) führten verschiedene Lernzielkategorien ein, unterschieden zwischen verschiedenen Könnens- und Interessensstufen und begründeten damit den „offenen“ Trainingsbegriff.
„Training ist offen für alle, vom Anfänger über den Fortgeschrittenen bis zum Spitzensportler, vom Schüler über den Jugendlichen, den Aktiven bis zum Alterssportler, für den, der seine Leistung steigern, für den, der seine Fitness erhalten aber auch für den, der sie wiederherstellen will“ (Hohmann et al., 2010, S.13).
Aus Perspektive einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand „Training“ lässt sich nach Hohmann et al. (2010, S.14) für die Zielebene eine weitere Begriffsdifferenzierung vornehmen. Training kann im Kontext von Sport sowohl auf Ziele im Sport ausgerichtet sein, z.B. die Verbesserung der Wettkampfleistung, als auch auf solche Ziele, die durch Sport erreicht werden, z.B. die Reduktion des Körpergewichts. Aus der Öffnung der Trainingswissenschaft für Anwendungsfelder außerhalb des Leistungssports leitet sich gleichzeitig eine Öffnung gegenüber außersportlichen Zielen ab, wie sie beispielsweise im Integrations-, Schul- oder Abenteuersport verfolgt werden.
Die besondere trainingswissenschaftliche Perspektive besteht in einer ganzheitlichen Betrachtung des Trainings, die über die biologischen Anpassungsprozesse hinaus das menschliche Verhalten einschließlich des soziokulturellen Kontextes in den Blick nimmt. Mit diesem ganzheitlichen und umfassenden Trainingsbegriff grenzt sich die Trainingswissenschaft deutlich von anderen sportwissenschaftlichen Teildisziplinen wie der Sportmedizin oder der Sportpsychologie ab.
Aus der Erweiterung der Begriffsbedeutung von Training ergeben sich weitreichende Konsequenzen für den Zuständigkeitsbereich der Trainingswissenschaft, die jedoch nicht von allen Vertretern in dieser weitreichenden Form mitgetragen wird. Während Hottenrott und Neumann (2010) einen vergleichbar offenen Trainingsbegriff zugrunde legen, distanzieren sich andere Autoren hiervon und sehen die Ziele von Training ausschließlich in der Einwirkung auf die sportliche Leistung, die sportliche Leistungsfähigkeit, den Leistungszustand oder das sportmotorische Können (Martin et al., 1991; Schnabel et al., 2008; Olivier et al., 2008). Mit dieser Eingrenzung wird jedoch übersehen, dass dem Training als komplexem Handlungsprozess in den wenigsten Szenarien eine eindimensionale Zielperspektive zugrunde liegt. Insbesondere in den Anwendungsfeldern außerhalb des Leistungssports, z.B. dem Schulsport oder dem Breitensport, besteht zumeist ein Geflecht aus unterschiedlichen Zielen, deren Prioritäten sich unter Umständen im Trainingsverlauf auch verschieben können. Ferner lassen sich innerhalb eines Anwendungsfelds zwischen den Individuen Unterschiede in der Zielhierarchie ausmachen (Schnabel, 2008b). Im Hinblick auf die forschungsstrategische Ausrichtung und damit das Selbstverständnis der Trainingswissenschaft ist dies von richtungsweisender Bedeutung, nicht zuletzt deshalb, weil mit der Öffnung für sportexterne Ziele stärker Fragen der Prozessgestaltung in den Mittelpunkt des Interesses gerückt werden.
„Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen (Trainingsinhalte und Trainingsmethoden) zur nachhaltigen Erreichung von Zielen (Trainingszielen) im und durch Sport“ (Hohmann et al., 2010, S.14–15).
Planmäßig bezieht sich hierbei auf die Angabe von Maßnahmen zur Zielerreichung, denen längerfristige Vorüberlegungen zugrunde liegen und die wissenschaftlich begründet oder zumindest erfahrungsgestützt sind. Ferner sind Kontrollverfahren in die Planung einzubeziehen, um zu überprüfen, inwieweit bereits realisierte Maßnahmen im Hinblick auf das formulierte Ziel erfolgreich gewesen sind. Eine systematische Durchführung der Maßnahmen ist gegeben, wenn Trainingsziele aus einer detaillierten Analyse des Anwendungsfelds abgeleitet werden (Zielkataloge) und zwar in einer ganzheitlichen und umfassenden Form. Trainingsinhalte und -methoden sind Merkmale zur Gestaltung des Trainings und müssen im Hinblick auf die Ziele bzw. Teilziele spezifiziert werden. Während mit den Inhalten die Art der Tätigkeit beschrieben wird, über deren Vollzug bestimmte Trainingsziele angesteuert werden, kennzeichnen die Methoden, wie die Trainingsinhalte zielgerichtet gestaltet werden. Nach Martin et al. (1991, S.34) betreffen Inhaltsentscheidungen das „Was?“, Methodenentscheidungen das „Wie?“ von Training. Über Trainingsziele wird der Anwendungsbereich definiert. Legt man konsequent einen offenen Trainingsbegriff zugrunde, bestehen hier keinerlei Einschränkungen, lediglich die Nachhaltigkeit der Ziele muss gegeben sein, d.h., sie müssen über das durchgeführte Training hinausgehen (Hohmann et al., 2010, S.15). Trainingsziele im Sport sind auf Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit oder der Wettkampfleistung ausgerichtet und dokumentieren eine leistungssportliche Orientierung. Das Leistungsniveau spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Durch Sport verfolgte Trainingsziele sind primär aus dem jeweiligen Anwendungsfeld entlehnt. Insgesamt ist jedoch zu konstatieren, dass mit Training selten nur eine Zielstellung verfolgt wird, sondern sportinterne und -externe Ziele sich vor allem in Anwendungsfeldern außerhalb des Leistungssports gegenseitig bedingen (Schnabel, 2008b, S.17–18). Besteht beispielsweise das Ziel darin, gesundheitsfördernde Ressourcen zu stärken, das körperliche Wohlbefinden zu erhöhen oder Aggressionen abzubauen, um die soziale Integration zu befördern, erfolgt dies im Allgemeinen über eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit bzw. ist diese eine unabdingbare „Begleiterscheinung“.1
Ausgehend von der dargestellten Begriffsverortung ist das Erkenntnisinteresse der Trainingswissenschaft zum einen auf die inhaltliche und methodische Gestaltung des Trainingsprozesses ausgerichtet, was sowohl die einzelne Trainingseinheit als auch den längerfristigen Trainingsaufbau betrifft. Zum anderen werden die Zielgrößen des Trainings, beispielsweise die sportliche Leistungsfähigkeit oder die Wettkampfleistung, zum trainingswissenschaftlichen Gegenstand erhoben.