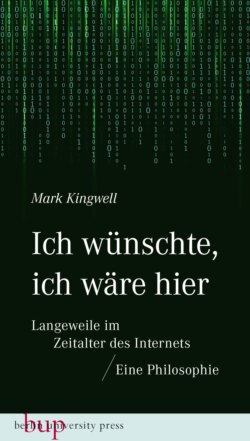Читать книгу Ich wünschte, ich wäre hier: Langeweile im Zeitalter des Internets - Mark Kingwell - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorbemerkung: Langeweile in Zeiten der Plage
ОглавлениеAnfang 2020 gewöhnten wir uns alle an die neue Normalität von Covid-19, an das Abstandhalten, an Selbstisolation und Quarantäne. Inmitten des Ausnahmezustands stellte sich bei vielen neben großen Befürchtungen ein Gefühl beharrlicher, quälender Langeweile ein. Die allgemeine Sorge zog sich über das Frühjahr bis in den Sommer, und man begann sich zu fragen, ob die staatliche Seuchenbekämpfung die Bürgerrechte noch stärker mit Füßen treten würde, aber auch, ob das Virus zurückkehren würde und ob man – inmitten zunehmender Gereiztheit und Unruhe – gar selbst bereits erkrankt war oder nur in einen Zustand der Apathie verfallen war.
Bald war man es leid, von »Abflachung der Kurve«, »Eindämmung des Virus« und von Forderungen nach Ausweitung der staatlichen Maßnahmen zu hören. In den Städten sah man vor dem Fenster leere, leblose Straßen. Gassigänger, Flaschensammler und radelnde Essenslieferanten waren die einzigen Zeichen menschlichen Lebens. Sind Sie in ihrem Zimmer auf und ab gegangen und haben sich gefragt, ob es möglich ist, sich zu Tode zu langweilen? Ja, ist es.
Der verwegene Schauspieler George Sanders, am besten bekannt als zynischer Theaterkritiker Addison DeWitt in Alles über Eva (1950), hinterließ drei Abschiedsbriefe. In einem stand: »Liebe Welt, ich verlasse Dich, weil ich mich langweile. Ich habe das Gefühl, lange genug gelebt zu haben. Ich überlasse Euch in dieser süßlichen Kloake Euren Sorgen. Viel Glück.« Auf Dreharbeiten in Spanien, beendete der 65-Jährige sein Leben mit Pentobarbital.
Das war im April 1972 – der »grausamste Monat«, wie es T. S. Eliot, ein gelangweilter Bankangestellter, in seinem Gedicht Das Ödland schrieb. Heute, im April 2020, offenbart die Viruskrise die sozio-ökonomischen Bruchkanten in unseren Gesellschaften mit voller Brutalität. Kleinselbständige, die von Mini-Aufträgen aus dem Netz leben, stehen vielerorts vor dem finanziellen Abgrund, in Ländern ohne Kurzarbeitergeld wurden viele Arbeitnehmer kurzerhand auf die Straße gesetzt oder man griff trotz Verbots zu befristeten Entlassungen. Beschäftigte im Gesundheitswesen arbeiteten bis zur Erschöpfung, während Dienstpersonal, Fluglinienangestellte und Kulturschaffende um die nackte Existenz bangten – um nur ein paar Berufe zu nennen. Wie wir nun häufig gehört haben, könnte sich die Wirtschaftskrise als weit schlimmer erweisen als die Große Depression.
Und so gerieten wir in ein Wechselbad der Gefühle, Phasen lähmender Angst und bleierner Apathie wechselten mit einer eigentümlich fiebrigen Nervosität, eine der quälendsten Erscheinungsformen der Langeweile. Manchmal kommt es einem vor wie der »lange, dunkle Fünfuhrtee der Seele«, wie der englische Science-Fiction-Kultautor Douglas Adams scherzhaft die Langeweile der Unsterblichkeit nannte. Zu anderen Zeiten ist es eine stille, innere Rage, in der alles in Gang kommt, aber nichts beginnt – eine Seele, die sich selbst zerfleischt.
Vor zweihundert Jahren bezeichnete der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer mit scharfem Blick die Langeweile als einen besonderen Zustand der modernen Welt. Er meinte damit natürlich nicht, dass sich Menschen vor dem – in Europa – relativ wohlhabenden frühen 19. Jahrhundert nie gelangweilt hätten. Was ihm auffiel, waren vielmehr neue Möglichkeitsbedingungen von Langeweile: In Zeiten sicherer Unterkünfte, ausreichender Nahrung, freier Zeit, kultureller Anregung (oder ihrem Mangel) hatten die Menschen die Muße, sich mit der eigenen Identität in einem gleichgültigen Universum auseinanderzusetzen.
Für einen großen Teil der Welt haben Konsum und die Kräfte des freien Marktes um ihn herum eine Situation der Monetarisierung dessen geschaffen, was ich im Weiteren neoliberale Langeweile nenne. Dies wurde von der Technologie und ihren verschiedenen Interfaces der profitablen Kurzzeitbefriedigung enorm unterstützt. Wann immer unmittelbare Stimulation versagt, erwacht ein neues unmittelbares Verlangen, das sich nur temporär durch neue Stimulierung lindern lässt. Scrollen, Twittern, Shoppen, Liken und Posten wirken in Kombination wie eine Versklavung des Bewusstseins. Diese Erfahrung kapitalistisch ausgebeuteter temporärer Langeweile ist eine Form der Abhängigkeit und zugleich ein Luxusgut, wie es Thorstein Veblen in seiner Analyse des demonstrativen Oberschichtkonsums in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieb. Heute betrifft der kritische, nicht mehr ganz so demonstrative Konsum Videospiele, Streaming-Dienste und die Nutzung der sozialen Netzwerke.
Langeweile offenbart eine Art psychischen Konflikt, wo, wie es der Psychotherapeut Adam Phillips ausdrückt, der »paradoxeste Wunsch sich regt, der Wunsch nach einem Begehren«. Ein abwesender Wunsch erster Ordnung (»Ich habe nichts, was ich tun möchte«) wird mit einem Wunsch zweiter Ordnung beklagt (»Ich wünschte wirklich, ich wüsste es«). Daher rührt die seltsame Unruhe und Beklemmung der Langeweile, ein Juckreiz an Stellen, wo man sich nicht kratzen kann. Jeder Wunsch erster Ordnung, so sehr er auch aus kognitivem Junkfood bestehen mag, scheint den Reiz zu beruhigen, aber nur zeitweilig – Kartoffelchips für die Seele.
So zeichnet, wie Schopenhauer schrieb, die Langeweile »zuletzt wahre Verzweiflung auf das Gesicht«. Man denke an einen Lebenslänglichen, an Soldaten, die zur Eile angetrieben werden, nur um am Bestimmungsort wieder warten zu müssen, an einen unheilbar Schlaflosen, einen Teenager auf einem erzwungenen Familienausflug oder einen durch und durch fremdbestimmten Arbeiter. Sie alle erleben wahre Langeweile. Selbst die Glücklichsten unter uns kennen in ihren Berufen sicher Phasen, in denen sie nichts als öde Langeweile erwartet.
In diesen viralen Zeiten, wo die Arbeit, wo unsere Zwecke und sogar unsere Bewegungsfreiheit umfassend überdacht werden, ist Langeweile zu einem schleichenden Feind geworden. Und doch, sie bleibt auch eine Art von Sahnehäubchen, ein Ausweis sozioökonomischer Privilegiertheit, die Klage der Gesunden und Reichen, wenngleich nicht der Weisen. Das ist das Paradox des paradoxen Verlangens nach einem Verlangen: Es ist ein Zeichen von Erregung und gleichzeitig ihrer Abwesenheit. Es kann einen anöden, gelangweilt zu sein, und so erzeugt man eine Spirale der Aufmerksamkeitsökonomie.
Wenn wir darauf reagieren, indem wir einem Gefühl der Einsamkeit oder des Ennuis, der Acedia oder des Weltschmerzes ewig davonlaufen, bereiten wir nur einem neuen psychischen Konflikt den Weg – einem neuen Markt der Möglichkeiten. Wenn die gegenwärtige Langeweile nicht zu philosophischer Reflexion, sondern stattdessen zu neuen Formen und Momenten des Konsums führt, wäre das zugleich eine verpasste Gelegenheit und eine Kapitulation vor den gegenwärtigen Verhältnissen.
Wenn Sie das Glück haben, sich gerade zu langweilen, und nicht einfach nur abstrampeln, um über die Runden zu kommen, geben Sie sich nicht der Melancholie hin oder fliehen in einen schicken neuen Stimulus. Schauen Sie aus dem Fenster, das selbst ein Fenster zur Seele ist. Nehmen Sie die Bürde, auf der Welt zu sein, an. Sie können sich selbst nicht entkommen, aber Sie können die Bedingungen Ihrer eigenen Möglichkeit untersuchen.
Um ein weiteres Genie der existenziellen Langeweile, Samuel Beckett, zu zitieren: »Ich kann nicht weitermachen, ich werde weitermachen.« Es gibt keine andere Option – nicht einmal, bei allem gebotenen Respekt für George Sanders, der Selbstmord, den Shakespeares Hamlet ins Auge fasst. Noch einmal Beckett: »Du bist auf der Erde, dagegen gibt es kein Mittel.« Langeweile ist keine Krankheit, sondern ein aufschlussreiches Symptom in Zeiten der Corona-Krise.