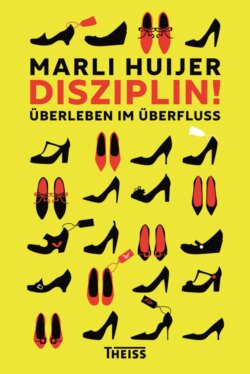Читать книгу Disziplin! - Marli Huijer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die antiautoritäre Erziehung
ОглавлениеDer zweite Schritt des Disziplinabbaus in den sechziger Jahren war die Einführung der antiautoritären Erziehung. Die philosophische Basis dafür bildete die „Kritische Theorie“ der Frankfurter Schule. Die Gruppe der neomarxistischen Soziologen und Philosophen, unter ihnen Max Horkheimer (1895–1973), Theodor W. Adorno (1903–1969), Herbert Marcuse (1898–1979) und Erich Fromm (1900–1980), stellte sich die Aufgabe, versteckte Formen der Unterdrückung ans Licht zu bringen. Die Frankfurter Schule ging aus dem 1924 gegründeten Institut für Sozialforschung (IfS) der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität hervor, zerstreute sich während des Krieges, fand jedoch nach Kriegsende wieder zusammen und veröffentlichte eine große Zahl einflussreicher Schriften.
Die Kritische Theorie verstand sich als praktische Philosophie, die ihre Aufgabe in der Emanzipation des Individuums sah. Die antiautoritäre Erziehung nahm die Kritische Theorie zur theoretischen Grundlage, um sich den traditionellen Erziehungskonzepten zu widersetzen. Man wollte zukünftig den Autoritätsverhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft Menschen mit kritischem Verstand entgegensetzen.21 „Die Freiheit von einer äußeren Autorität ist nur dann ein dauernder Gewinn, wenn unsere inneren psychologischen |31|Bedingungen derart sind, daß wir auch in der Lage sind, unsere Individualität zu behaupten“,22 erklärte Erich Fromm bereits 1941 in seinem Werk Die Furcht vor der Freiheit. Um zu verhindern, dass die Spontaneität des Babys schon bei den ersten Erziehungsmaßnahmen unterdrückt wird, sollte das eigentliche Ziel der Erziehung darin bestehen, die „innere Unabhängigkeit und Individualität des Kindes, sein Wachstum und seine Integrität“ zu fördern.23
Die antiautoritären Kindergärten wollten, dass sich die Kinder in aller Freiheit entfalten konnten, Strafen waren verpönt, die Kinder durften nackt herumlaufen, wenn sie das wollten, ihre sexuelle Neugier war nicht länger mit einem Tabu behaftet. In westdeutschen Studentenstädten wurden sogenannte „Antiautoritäre Kinderläden“ gegründet, in den Niederlanden gab es bald „nichtautoritäre“, „offene“ Kindergärten, wo den Kindern beigebracht wurde, zusammen mit den Erwachsenen den herrschenden Verhältnissen gegenüber kritisch aufzutreten und sich aktiv und kreativ an der „Humanisierung der Gemeinschaft“ zu beteiligen.24 Das Problem des aggressiven Verhaltens führte bei den Eltern zu besonders heftigen Diskussionen, denn viele hielten dieses nicht unbedingt für negativ.25
In den Niederlanden waren die antiautoritären Kindergärten von der „Kabouterbewegung“ beeinflusst. Die „Kabouter“ waren der Ansicht, dass durch die Erziehung ein Mentalitätswandel in den Niederlanden herbeigeführt werden könne. Die Eltern könnten sich am besten selbst um die Erziehung der Kinder kümmern, denn die Erfahrung lehrte, dass die traditionellen Erziehungssysteme die Kinder zu allem, nur nicht zu kritischem und autonomem Verhalten erzogen.
Einen guten Eindruck der Diskussionen, die damals geführt wurden, bietet Den lille røde bog for skoleelver (1969) der Dänen Bo Dan Andersen, Søren Hansen und Jesper Jensen. In Deutschland erschien 1970 eine nur Kleinbuchstaben verwendende Übersetzung von Peter Jacobi und Lutz Maier unter dem Titel „das kleine rote schülerbuch“. Die Schüler werden darin aufgeklärt, dass die Schule |32|nur Teil eines Gesellschaftssystems sei, in dem sich alles nur um Machtausübung drehe. Statt kritiklosem Gehorchen und mangelnder Autonomie vertraten sie ein Lernen, bei dem der Schüler selber zu entscheiden hatte, wie und was er lernt, und bei dem vor allem verhindert werden sollte, dass er sich langweilt. In dieser „demokratischen Schule“ spielt der Schüler die Hauptrolle und nicht der Lehrplan. So wie in einer Gesellschaft die Macht beim Volk liegen sollte, so sollte in der Schule die Macht bei den Schülern liegen. Es galt, die Macht der Eltern und der Lehrer zu brechen; alles darf hinterfragt werden. Der Kampf für eine demokratische Erziehung muss von unten geführt werden, und zwar gegen das kapitalistische System, das mit politischen Aktionen wie Streiks, Lehrerzimmerbesetzungen oder anderen demonstrativen Aktionen bekämpft werden muss. Darüber hinaus wollte das Büchlein die Schüler über Sex, Genussmittel und Drogen aufklären, ihnen zeigen, dass Sex etwas Angenehmes sei, egal ob homo, hetero oder bi. Werde man ungewollt schwanger, könne man ja abtreiben, und wenn in den Zeitungen etwas über sexuellen Missbrauch stehe, dann sei das meist nicht so schlimm, wie es klinge. Man riet den Schülern auch, Genussmittel und Drogen vernünftig zu konsumieren: Alkohol, Hasch und Marihuana seien harmlos, während Tabak und LSD als gefährlich einzustufen seien. Der große Erfolg des kleinen roten schülerbuchs führte dazu, dass Eltern, Lehrer und Staat sich mehr oder weniger freiwillig von ihrem autoritären Auftreten verabschiedeten. Mit der Zeit bezweifelte niemand mehr, dass man Kinder besser zu persönlicher Freiheit und autonomem Verhalten erziehen sollte als zu unreflektiertem Gehorsam. Von nun an standen das Kind und seine Eigenheit im Mittelpunkt des pädagogischen Interesses.