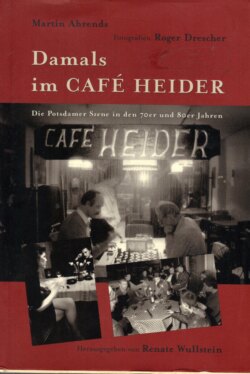Читать книгу Damals im Café Heider - Martin Ahrends - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Es geht um nichts
ОглавлениеRainer Eckert, Historiker
Ich bin Potsdamer, hab dort Abitur gemacht, 1968 an der Humboldt-Schule, ein Jahr im Staatsarchiv gearbeitet, das war in der Orangerie in Sanssouci, und zum Studium nach Berlin gegangen: Geschichte und Archivwissenschaft, drei Jahre. Im vierten Studienjahr bin ich relegiert worden. Aus politischen Gründen. Und das hat auch mit dem Heider zu tun. Es gab einen OV (operativen Vorgang bei der Staatssicherheit) „Demagoge“, das war eine Gruppe von überwiegend Potsdamern, eine Diskussionsgruppe. Einige haben Flugblätter gemacht, einige sind später in den Westen gegangen... Wir trafen uns relativ oft im Heider. Das ging in der Schulzeit los. Das geistige Erwachen oder die kritische Einstellung hatte drei Quellen: die junge Gemeinde in Potsdam, in der Heiliggeistgemeinde, die keine eigene Kirche hatte, der Turm wurde noch extra gesprengt. Wir saßen in den Gemeinderäumen in der Nähe der Reste des Neustädtischen Tores. Die zweite Quelle waren Treffen im Hause von Peter Huchel, dessen Sohn in meine Klasse ging. Wir sind als Schüler zu den Huchels nach Wilhelmshorst gefahren, nahmen an den Diskussionskreisen als Zuhörer teil, wo viele ostdeutsche Intellektuelle, auch Ausländer zu Gast waren. Eine dritte Quelle war die Familie. Mein Vater ist früh gestorben als überzeugter Kommunist, ich bin in einer eher sozialdemokratischen Ausrichtung ausgewachsen. Meine Großeltern wohnten in West-Berlin, und wir konnten sie nach dem Mauerbau nicht wiedersehen. Als das Passierscheinabkommen kam, war mein Großvater schon tot. Ich bin also in dem Zwiespalt aufgewachsen, als Potsdamer nicht zu den Großeltern nach West-Berlin zu können.
Die Zeit im Heider begann, als ich 17 war, 1967 war das, ich bin damals fast täglich im Heider gewesen. Das Heider war der einzige Ort in Potsdam, wo wir uns treffen konnten, wenn wir uns nicht privat trafen. Im Kern waren das Leute aus Babelsberg, die in irgendeiner Beziehung zur DEFA standen oder zur Filmhochschule über ihre Eltern. Eine oppositionelle Diskussionsgruppe, die sich im Heider traf. Es gab sonst wenig Möglichkeiten in Potsdam. Und wir hatten dort relative Freiheit. Wir konnten Stühle zusammenstellen und uns in großer Menge an einen Tisch setzen. Das wäre in anderen Gaststätten nicht möglich gewesen. Das enge HOG-Reglement: „Sie werden platziert“ – das gab es dort nicht. Dem Normalpublikum kamen wir schon etwas unheimlich vor, aber das hat nie dazu geführt, dass wir da Schwierigkeiten hatten. Der Heider hat das toleriert. Im Hintergrund hat die Stasi gestanden. Das war für die eher bequem, die kritischen Geister an einem Ort unter Kontrolle zu haben. Im Heider gab es die bürgerliche Kaffee-und-Kuchen-Klientel, etliche Künstler, und eben oppositionell gesinnte Studenten und Oberschüler. Es war ein Treffpunkt, um den weiteren Abend zu verabreden. Nach dem Heider ist man nicht nach Hause gegangen, sondern es schlossen sich die privaten Partys an.
Unsere Gruppe war zunächst eher locker gefügt und hat ihre Konsistenz erst durch die Staatssicherheit erhalten, als sie zusammengefasst wurde zum OV „Demagoge“. Ich war der Demagoge. 68 spielte bei uns eine große Rolle. Ich war selbst am 21. August in Prag. Das hat unser Denken erheblich beeinflusst: eine Mischung zwischen anarchistisch-linksradikalem und sozialdemokratischem Denken. Wir wollten einen demokratischen Sozialismus, ohne das theoretisch ausgeformt zu haben, jedenfalls nicht den in der DDR mit einer Politbürokratie an der Spitze.
A: Wenn ein Ostler „68“ sagt, meint er Prag, der Westler meint zumindest nicht nur Prag.
Die denken an Rudi Dutschke, Berkeley / Kalifornien und Paris. Ein zweigesichtiges Jahr. Für uns war nach diesem Jahr die letzte Reformchance des Realsozialismus vergeben.
Als Student hab ich jedes Wochenende in Potsdam verbracht und war abends im Heider. Bis Mitte der Siebziger. Ich hatte meine Treffpunkte in Berlin, das Café Burger zum Beispiel, das war etwa das Entsprechende. Eine Zeit lang das „Posthorn“ am Alexanderplatz, „Tute“ genannt. Die Potsdamer waren in Berlin zusammen, das war sozusagen landsmannschaftlich organisiert. Die Potsdamer Gruppe hat lange gehalten. Der Vorgang „Demagoge“ wurde später von der Stasi abgelegt, ein Freund war im Gefängnis gelandet, mehrere waren von den Universitäten relegiert worden, der Zusammenhang zerbrach durch diese Repressionsmaßnahmen. Es war ein tiefes Misstrauen entstanden, auch durch lancierte Verdächtigungen, das hat mich einmal getroffen, was tödlich war, man konnte das Gegenteil nicht beweisen. Das hat Zusammenhänge gestört oder zerstört. Einige waren inzwischen in den Westen gegangen, „abgehauen“. Das war in den 70ern relativ schwer, manche hatten es versucht, zum Beispiel nachts durch die Havel zu schwimmen, nackt, schwarz angemalt, waren eingesperrt worden und dann abgeschoben. Ein Freund hat versucht, in einer amerikanischen Offiziersuniform über den Checkpoint Charlie zu kommen, in der Annahme, er würde nicht kontrolliert werden...
Unser Vergehen war eigentlich dieser diskursive Zusammenhang, die Kritik am System. Am Rande gab es immer Leute, die mehr wollten, bis hin zu solchen Fantasien des bewaffneten Aufstandes. Das war aber irreal. Zwei aus unserem Kreis, die in Babelsberg in der Stubenrauchstraße nahe der Mauer wohnten, schafften es, über die Mauer zu steigen. Eine berühmte Geschichte. Sie meldeten sich drüben im Notaufnahmelager und versuchten, Kontakt zum SDS aufzunehmen. Sie fanden an diesem einen Tag dort keinen Gesprächspartner und sind wieder zurückgekommen.
A: Sie wollten einen politischen Draht knüpfen...
In ihrem Selbstverständnis als Linke oder Sozialisten wollten sie mit den entsprechenden Partnern in West-Berlin Kontakt aufnehmen. Die sind da aber abgeblitzt als Spinner, es packte sie das große Heimweh, und sie sind unerkannt zurückgekommen. Hatten die Klopfstange an die Mauer gelehnt... So erzählten sie es. Der eine ging prompt ins Heider, erzählte: gestern war ich auf dem Kudamm. Der andere kam zu mir nach Hause, erzählte die Geschichte, hatte einen behelfsmäßigen BRD-Pass dabei, seinen Notaufnahmeschein. Wir verbrannten alles im Badeofen, und ich sagte: Wenn du jetzt ruhig bleibst, und Dings nichts sagt, kann euch nichts passieren. Aber der saß derweil schon im Heider und hat erzählt, was dann parallel von mehreren IM weitergegeben wurde. Die Stasi schlug schnell zu, am nächsten Morgen sind alle verhaftet worden. Alle, die auf dieser Party waren, von der aus die beiden in den frühen Morgenstunden des Vortages in den Westen gegangen sind. Ich war die einzige Ausnahme, weil ich an diesem Morgen, am Morgen der Verhaftungen, sehr früh ins Zivilverteidigungslager aufgebrochen war. Das war in Johanngeorgenstadt. Also um sechs, als die zuschlugen, saß ich schon im Zug. Die sind allerdings nach einem Tag wieder rausgekommen, weil sich offenbar der Onkel des einen, der damals noch im Politbüro saß,[Mückenberger] eingemischt hat. In den Akten, dem OV mit dem Namen „Anarchist“ findet sich eine handschriftliche Bemerkung von Mielke, wo er schreibt: Keine Verhaftungen im OV „Demagoge“, aus politischen Gründen. Man fürchtete den Skandal, dass der Neffe eines Politbüromitgliedes mal eben zu Besuch durch die Mauer geschlüpft ist. Seine Eltern verloren allerdings ihre Arbeit. Sein Vater war damals Chef der DEFA und wurde nun Chef der Schlösser und Gärten. Seine Mutter war Kaderchefin bei der DEFA und musste den Job aufgeben. Bei dem zweiten. war der Vater Dozent an der Kleinmachnower Parteihochschule, auch der hat seinen Job verloren. Der hat dann seinen Sohn verleugnet, hat behauptet, der Junge wäre nicht von ihm, der die DDR verrät.
Eine Frau, die zu unserem Umkreis gehörte, kam eines Tages zu mir und sagte: Bei mir wohnt ein Mädchen, in deren Tasche ich Durchschläge von Berichten an die Staatssicherheit gefunden habe. Das hat sie uns gezeigt. Dieses Mädchen gehörte zu unserer Gruppe. Wir überlegten nun, ob wir ein Untergrund-Tribunal abhalten wollen. Ich war dagegen, konnte mich durchsetzen mit dem Argument, dass statt ihrer ein anderer käme. Besser für uns war es, das zu wissen und uns entsprechend zu verhalten. Die Stasi wußte sofort von unserer Entdeckung, das Mädchen verschwand aus Potsdam, ich hab sie später in Magdeburg wiedergesehen. Die uns diese Berichte gezeigt hat, stieg in unserm Vertrauen, bei Akteneinsicht stellte ich fest, dass sie ebenfalls IM war. Die Stasi hat also bewusst eine IM geopfert, um die andere in eine Vertrauensstellung zu bringen. – All das hat das Misstrauen wachsen lassen, was dazu führte, dass die Gruppe in sich zerfiel. Oder besser: auseinander fiel. Der Neffe des Politbüromitgliedes wurde vor dem eigentlichen Termin zur Armee gezogen, der andere kam in einen Baubetrieb nach Brandenburg. Ein Dritter, eine wichtige Figur der Intellektuellenszene, versuchte zu flüchten, ist geschnappt worden, saß in Haft. Wie der rüberkommen wollte, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass wir uns am Abend vorher fürchterlich betranken im Heider. Wir waren nicht mehr Herr unserer Sinne; in dieser Nacht hat er es versucht. Der hat seine Zeit im Knast abgesessen, wollte aber in der DDR bleiben und hat sich mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen. Vor zwei Jahren hat er Selbstmord begangen.
Skurrile Typen tauchten im Heider auf. Einer mit dem Spitznamen „Sülze“ kam rein, saß da, sagte den ganzen Abend nichts, trank vor sich hin, erhob sich plötzlich, zitierte Stirner, seine anarchistische Losung: „Es geht um nichts!“, und ging. Am nächsten Abend das Gleiche.
Der verleugnete Sohn war dann im Westen und wurde zum „Mauerspringer von Berlin“. Peter Schneider hat diese Erzählung daraus gemacht.
A: In der Erzählung von Stephan Heym gehen die beiden Jungs mehrmals über die Mauer.
Das stimmt eben nicht. In beiden Geschichten nicht. Die sind einmal rüber und nicht wieder. Der eine ist hier geblieben, der andere in den Westen gegangen und wurde der „Mauerspringer“. Er hat die DDR-Führung vom Westen aus erpresst: Wenn ihr meine Schwester nicht raus lasst, spring ich am 7. Oktober, dem Nationalfeiertag der DDR, über die Mauer, vor den Kameras der westlichen Welt. Die sind darauf eingegangen. Seine Schwester und dieser Anarchist, der versucht hatte, durch den Teltowkanal zu schwimmen, sind wirklich beide rausgekommen auf diesem Weg.
Nach der Wende nahm ich Akteneinsicht in den OV „Demagoge“, habe einige Klarnamen der IM’s herausbekommen. Ich hab viel zur Staatssicherheit publiziert, die Namen aber nicht preisgegeben, das hätte ich, wenn jemand versucht hätte, auf hohem Niveau wieder politisch tätig zu werden. Meine IM’s waren nicht die engsten Freunde. Klaus Behnke, der Psychologe, hat als Mitbetroffener mit den IM’s tiefschürfende Gespräche geführt, ich hab mich einmal daran beteiligt: mit derjenigen, die uns damals die Durchschriften gezeigt hat, damals Krankenschwester, dann Kulturhausmitarbeiterin. Ein unerfreuliches Gespräch, sie hat erst abgestritten, später zugegeben: ‚Ja, ich war Sozialistin’. Haben wir gesagt: ‚Wir doch auch’. Sie: ‚Aber keine richtigen, hat mir mein Führungsoffizier gesagt. Die haben mich erpresst, wegen häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs wollten sie mir das Kind wegnehmen. Und ich hatte so wenig Geld, hab im Winter gefroren, da kam der Führungsoffizier und hat mir einen Mantel geschenkt...’ So ging das, die ganze Litanei der Ausreden.
Ein IM kam im Auftrag der Stasi mit Westbüchern an, die ich weitergeben sollte, wie es üblich war, damit man was gegen mich in der Hand hatte, um juristisch gegen mich vorzugehen. Ich bin nicht rachsüchtig, spüre keinen Haß gegen die IM’s, die tun mir eher leid. Ich hab meine Akte mit hohem Interesse gelesen, ist ein Teil meiner Biographie, vieles hatte ich vergessen, die Beschreibung von Feten, von Biermann-Abenden. Hab ich da wiedergefunden, hat mich erfreut, das zu lesen. Im Lesesaal gab es Leute, die in Tränen ausbrachen und schrien: „Du Schwein, du hast mich verraten!“ – Mir ging es nicht so. Es gab eine Stelle, die mich mitgenommen hat, und zwar... Eine Zeitlang überwachten sie meine Post, 24 Stunden täglich hingen irgendwelche Stasileute auf meinen Spuren, und in dieser Zeit ist meine Großmutter in West-Berlin gestorben, unter schrecklichen Umständen. Meine Mutter durfte zu ihr, ein Funktionär, den sie kannte, hat das geregelt. Die Briefe, die meine Mutter mir vom Sterbebett meiner Großmutter schrieb, hab ich in meiner Akte gefunden. Das hat mich emotional mitgenommen. Die einzige Stelle. Ansonsten war die Aktenlektüre ein Genuss.
Ich sollte IM werden. Nachdem ich von der Uni geflogen bin, hatte ich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr in Berlin. Lebte dort illegal. War lange arbeitslos. Eines Tages bekam ich eine graue Karte, ich solle mich zur Klärung eines Sachverhalts bei der Polizei in Potsdam melden. Das war die Polizeiwache an der Puschkinallee, nahe der Russischen Kolonie. Bin da hin, als Arbeitsloser, illegal in der Hauptstadt wohnend. Es erwarteten mich zwei Männer, die gleich sagten: Wir sind nicht von der Polizei, sondern von der Staatssicherheit. Ich bin mehrere Stunden verhört worden. Immer wieder der Satz: Sie können uns nichts verschweigen, wir wissen alles über Sie. Vor allem meine intimen Beziehungen hätten sie bestens dokumentiert, ob ich wolle, dass sie das öffentlich machen. Das konnte mich nun überhaupt nicht erschüttern. Ich versuchte, niemanden zu belasten, lediglich über Leute zu reden, die schon im Westen waren. Das durchschauten die. Am Ende, als ich damit rechnete, in Handschellen nach Bautzen gefahren zu werden oder in die Lindenstraße, da haben sie gesagt: Sie sehen, Ihre Lage ist hoffnungslos, ihr Urteil steht schon fest, drei Jahre Zuchthaus wegen Spionage, oder Sie gehen den Weg der Wiedergutmachung und arbeiten für uns. Ich nahm meinen Mut zusammen und sagte nein: „Ich lehne aus moralischen Gründen ab, mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenzuarbeiten.“ – Das hab ich schriftlich niedergelegt, mit zitternder Hand geschrieben auf meinen besonderen Wunsch, was die nicht gut fanden. Und dieses Blatt ist in meinen Stasiakten drin. So kann man beweisen, dass man nein gesagt hat. Denn im Protokoll, das die geschrieben haben, stand nichts von Erpressung. Das hieß da: Kontaktgespräch zur Anbahnung weiterer Zusammenarbeit... Und das liest sich anders. Ich sagte, dass ich gläubiger Christ bin und vor solch schwerer Entscheidung mit meinem Pfarrer reden muss. Dekonspiration nennt man sowas. Sie ließen mich laufen. Sagten allerdings: Hätten Sie für uns gearbeitet, Sie wären schnell Professor geworden, Reisekader, etc. Nun werden Sie nie in der DDR Karriere machen. Und das haben sie durchgehalten, ich durfte eine Zeitlang nicht mal ins sozialistische Ausland. In den Westen schon gar nicht. - Die Vorwürfe waren zuerst ideologischer Art: Falsch denken und darüber reden. Später kam das mit der Spionage. Hatte ich nun wirklich nicht gemacht. Ich hab in Polen und Ungarn verbotene Literatur besorgt, teilweise selbst abgeschrieben, verborgt... Damit sind sie mir aber nicht gekommen. Das wäre vielleicht beweisbar gewesen. Aber Spionage... Gewiß nicht. Insofern war es mir leichter, nein zu sagen. Weil ich wusste: das können sie mir nicht nachweisen.
An der Humboldt-Uni gab es wieder eine staatsfeindliche Gruppierung, hauptsächlich bei den Bibliothekswissenschaftlern. Die sind aufgeflogen, teilweise zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt worden. In diesem Zusammenhang ist an der Sektion Geschichte groß reinegemacht worden. Es wurden alle überprüft, zu Gesprächen geladen. Und in diesem Zusammenhang kamen sie mir auf die Spur. Erst gab es ein FDJ-Verfahren mit Ausschluß aus der FDJ, ein Tribunal. Die saßen mir alle meine Kommilitonen gegenüber, und jeder hat mir irgendwelche Vorwürfe gemacht: Du bist ein Feind des Sozialismus, denn du hast gesagt... Man hatte zum Beispiel über Jahre gesammelt, was auf den Besucher-Zetteln an meiner Wohnungstür gestanden hatte. Zum Schluss erhob sich ein Professor Engel und legte los, Schaum vor dem Mund: Sie sind ein Feind... Dass ich dazu nichts gesagt hab, wurde mir strafverschärfend ausgelegt: ich hätte verbohrt geschwiegen, wo ich hätte Reue zeigen können. Das ging über mehrere Stufen weiter bis zur Verdrängung aus der Universität. Ich sollte mich in der Produktion bewähren. Bewarb mich bei zig Betrieben, und keiner hat mich genommen, obwohl sie erst gesagt hatten: Ja, wir brauchen jemanden...
A: Das kenne ich gut. Gut, wenn man nicht allein dasteht mit diesen Geschichten, die glaubt einem heute kaum jemand im Osten.
Ich hab doch noch eine Stelle gefunden. Im Heider kam ein Mädchen auf mich zu: ich hab gehört, du hast keine Arbeit, mein Vater ist Direktor eines Baukombinats, ich sprech mit dem, der stellt dich sicher ein. Und so war es. Eine Woche später war ich Mitarbeiter des Wasserstraßenbaus. Da fegte ich morgens den Hof und war dankbar, wieder einen Job zu haben und mich also in der Produktion bewähren zu können. Drei Jahre arbeitete ich dort. Bei der Akteneinsicht erfuhr ich, dass dieses Mädchen IM war, und mich die Staatssicherheit auf niedrigem Niveau re-integrieren wollte. Das war denen offenbar sicherer. Auch eine Heidergeschichte. Und ein Argument, die Akten offenzuhalten. Man muss sein Leben anders interpretieren, wenn man die ganze Wahrheit kennt.
Das Heider war für uns ein Lebensmittelpunkt. Wenn man da abends nicht hingehen konnte, hatte man Entzugserscheinungen.
A: Viele sprechen davon wie von einem Substitut, einem Ersatz für etwas anderes und also etwas süchtig machendem. Von etwas, das einen, weil es Ersatz ist, nicht wirklich sättigt, weshalb man immer wieder und mehr davon haben muss. Weil es den Hunger steigert, anstatt satt zu machen.
Hätten wir andere Möglichkeiten gehabt, hätten wir zum Beispiel reisen können, wäre das Heider wohl nicht so wichtig gewesen.
A: Einer nennt es sein Paris, mancher preist die Synergien, die dort loderten. Mein Verdacht ist, dass sie dort verpufft sind und nur dort, nicht rausgetragen wurden, es sei denn als betrunkene Geilheit und als solche ausschweifend bestattet. Von Bestattung redet man ungern, es war ja die eigene Jugend. Und es war heiter dort im Heider.
Es war toll gewesen, ich denk gern daran zurück. Es gab keine Wirkung nach außen. Ersatzfunktion ist nicht falsch, es hatte etwas Spannendes und Entspannendes. Von dort aus entwickelten sich die Partys, diese Orgien. In der DDR gab es eine eigene Feier-Subkultur. In der Literatur viel zu wenig beachtet. Um zehn machte das Heider zu. Bis halb elf musste klar gemacht werden, wo man hingeht. Das war der regelmäßige Ablauf, zumindest am Wochenende.
Ich hab mehrfach erwogen, in den Westen zu gehen, weil in den Achtzigern immer mehr meiner Freunde im Westen waren. Merkwürdiger- oder inzwischen verständlicherweise brach der Kontakt ab. Wenn jemand drüben war, hat er sich noch einmal gemeldet: Schöne Urlaubsgrüße von Mallorca! Und das war’s. Ich hab erwogen, rüberzugehen, aber nie ernsthaft. Erstens war’s mir zu gefährlich, und ich war schon der Meinung, dass das unser Land ist. Dass man nicht weggehen sollte, solange noch die geringste Chance auf Veränderung, auf Reform besteht. Ich hab lange an den ewigen Bestand der DDR geglaubt, aber einer reformierten DDR, so dachte ich zumindest in den späten Achtzigern. Das war ein Grund, hier zu bleiben. Hat sich im Nachhinein als richtig herausgestellt.
A: Das leuchtet mir sofort ein. Als ich 84 in den Westen kam wusste ich bald, dass alles, was ich in der DDR geworden oder nicht geworden war, was ich da angesammelt hatte an Wut und Erfahrung, plötzlich unsinnig, überflüssig war, es gehörte da nicht hin, sondern in den Osten. Hab versucht, meine Texte in den Osten zu rufen, was unsinnig war, weil sie da drüben nicht ankommen konnten.
Es wäre eine falsche Entscheidung gewesen, wenn es 89 nicht gegeben hätte. Da es 89 gegeben hat, war die Entscheidung richtig.
A: Das ist schön gesagt. Das macht auch meine Entscheidung zu gehen nicht falscher als sie es damals war.
Nach 89 habe ich viel machen können, politisch und publizistisch. Ohne die Revolution wäre ich wohl auf immer in irgendeiner wissenschaftlichen Hilfsfunktion beschäftigt worden. – Nach meiner Exmatrikulation hatte ich Hausverbot an der Humboldt-Uni, konnte dort aber später meine Fächer als Fernstudent abschließen. Danach durfte ich als wissenschaftliche Hilfskraft in der Bibliothek des Zentralinstituts für Geschichte an der Akademie der Wissenschaften arbeiten. Ulrike Poppe, die ich aus verschiedenen Zusammenhängen relativ gut kannte, hat mit ihrem Vater gesprochen, der war Abteilungsleiter an der Akademie der Wissenschaften und konnte etwas für mich tun. Dort bin ich bis zur Auflösung der Akademie geblieben, zuletzt als stellvertretender Institutsdirektor; weil nach der Revolution Unbelastete gesucht wurden, und viele gab’s davon nicht an diesen Instituten. So bin ich in die Direktionsebene aufgestiegen.
Heider war eine Lebenskultur. Man unterschied sich von anderen. Überhaupt war unser oppositionelles Verhalten durch eine maßlose Arroganz geprägt. Wir verachteten den Normalmenschen als Spießer.
A: Das muß man in einer bestimmten Phase wohl, um die Genese auf sich zu nehmen, die Mühen und Entbehrungen auf dem Weg zur Elite, die einem verheißen ist, aber durch nichts versprochen. Man muß die Möglichkeit einräumen, Elite zu sein, bevor man es im entferntesten ist. Um es vielleicht zu werden. Das ist arrogant, jedenfalls im Rückblick. Wir wollten Verantwortung, auf den verschiedensten Ebenen, künstlerisch, intellektuell, politisch. Ein Merkmal vieler Leute, die ich mit diesem Buchprojekt kennen lernte. Die in diesem wunderbaren Wartesaal hängen blieben.
Oder weggingen. Aber von denen hat keiner, den ich kenne, eine nennenswerte Karriere gemacht. Viele sind arg gescheitert. – Aus der Heider-Kultur ist niemand hervorgegangen, der heute einen Namen hätte.