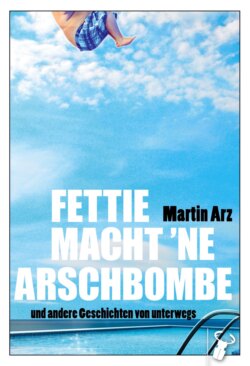Читать книгу Fettie macht 'ne Arschbombe - Martin Arz - Страница 8
ОглавлениеHeuschrecken im Knuspermantel
Thailand & Kambodscha, 2003
Wer kennt sie nicht, die kernigen Individualreisenden, die jeden mit Verachtung strafen, der irgendwas pauschal bucht. Pah, Neckermänner! All-Inclusive-Prolls!
Ganz ehrlich? Ich hatte spätestens 2003 die Schnauze voll vom Individuellen. Die Zeiten, als ich in öffentlichen Linienbussen die Türkei durchquerte (damals noch ein touristisches Abenteuerland), interrailend Marokko bereiste, bei Nevercomeback-Airlines um ein Stand-by bettelte, bereitwillig auf versifften Zugklos (oh ja, ich erinnere mich noch heute an die Strecke Madrid-Lissabon!) oder im Cockroach Inn nächtigte, und mich mit einem Joghurt plus einem halben Baguette pro Tag zufriedengab, sind einfach vorbei. Ich wills bequem! Und nicht umsonst habe ich bei Deutschlands erfolgreichster Quizshow »Wer wird Millionär?« im Herbst 2002 einen gehörigen Batzen Geld gewonnen. Also wird forsch ein Reisebüro geentert und eine Pauschalreise gebucht. Megaspießig, ich weiß, oder in anderen Worten: Einfach ideal, praktisch, billiger und überhaupt.
Wenigstens ist mein Ziel auch bei Zeitgeldnervenverschwendern akzeptiert. Obwohl man mir natürlich eher Bhutan, die hintere Mongolei oder Kuba (»Wer weiß, wie lange es Fidel noch gibt …«) ans Herz legt, finden auch und gerade Individualreisende Thailand ganz okay:
»Klar, voll krasse Full Moon Raves auf Koh Phangan und so …«
»Nö, wir sind auf Koh Samui.«
»Ey, auch cool. Chaweng Beach und so … Voll die Party.«
»Nö, Maenam Beach.«
»Maenam? Nie gehört, da ist doch bestimmt gar nix los.«
»Ja, eben!«
Gut, ursprünglich hatten wir Bali im Auge. Da war ich schon mal und wollte gerne wieder hin. Bis dann im Herbst 2002 gehirnfreie Religionsfaschisten das Paradies mit ihren Bomben in eine Hölle verwandelten1. Wir sind ja flexibel und buchen schnell um: Kenia. Klasse Hotel bei Mombasa. Safari und so wollen wir dann spontan unten organisieren. Eben erwähnte primitive Lebensformen, die einem von den skrupellosen USA zum skrupellosen Terroristen ausgebildeten Milliardär namens Osama bin Laden hörig ergeben sind, handeln wieder gemäß ihrer perversen Logik. Ein Selbstmordkommando mit vielen Toten später fällt auch Kenia flach2. Es ist weniger die Angst vor weiteren Anschlägen – im Gegenteil, ich halte Bali und Kenia nach den Anschlägen für die sichersten Plätze –, es ist mehr das ungute Gefühl, dort einen auf Urlaub zu machen, wo just Urlauber sinnlos abgeschlachtet wurden. Vor allem muss ich nicht in ein Land reisen, in dem mal eben mit Boden-Luft-Raketen auf einen startenden Passagierjet geschossen werden kann, ohne dass es irgendwer merkt.
Also gehts wieder ins Reisebüro. Die Angestellte ist zunächst endgenervt, zickt herum, dass »es« uns ebenso in Berlin, Paris oder Kleinunterstüchtelheim passieren könnte. Gebucht ist gebucht. Umbuchen kostet! Schleichts eich. Gut, wenn sie uns so kommt. Zickig können wir auch. Wir bösen Buben buchen nun kreuz und quer durch den Katalog, was das Zeug hält. Okay, total pauschal ist das nicht gerade, aber so hardcore sind wir doch noch nicht. Geschlagene zwei Stunden später haben wir alles unter Dach und Fach, die Buchungsfachkraft ist ein japsendes Nervenbündel, und wir sind das erste Mal im Leben so etwas wie Pauschalreisende.
Bangkok
So brechen wir Ende Januar 2003 gen Thailand auf. Immerhin haben wir uns für ein neiderregendes Schmankerl entschieden, mit dem wir alle Lästerer mundtot machen: Drei Tage Kambodscha – Angkor checken. Ebenfalls pauschal in Deutschland gebucht. Nein, das bekommt man vor Ort kaum billiger. Bin ja nicht ganz blöd und habe mich im weltweiten Netz erkundigt. Flüge von Bangkok nach Siem Reap kosten ab 300 Dollar, dazu dann Hotel und Eintritt in Angkor (Mehrtagespass ab 40 Dollar) und Transfers und ein Guide und und und. Da ist das Pauschpaket, das mein Veranstalter bietet, preislich konkurrenzlos attraktiv.
Es gibt so ein paar Städte, die man sich mindestens einmal im Jahr geben sollte, um sich lebendig zu fühlen. Jeder hat so seine Handvoll Traumstädte. Meine sind Amsterdam, Paris, New York (tja, sorry Wien und Rom, vielleicht das nächste Mal …) und immer wieder Bangkok. Bangkok, weil es einfach die real gewordene Version des Mega-Molochs aus dem Sci-Fi-Klassiker »Blade Runner« ist, weil es unerträglich laut ist und wie die Pest stinkt, weil man aus dem klimatisierten Hotel tritt und die Luft sich anfühlt, als würde man ein glutheißes, patschnasses Saunahandtuch um die Ohren geschlagen bekommen, weil man nirgendwo so schön »Shop till you drop« spielen kann und weil man sich von früh bis spät den Bauch mit den leckersten Köstlichkeiten für quasi umme vollschlagen kann.
Wenn man mir eine Wette anbieten würde, bei der man internationale Flughäfen am Geruch erkennen soll, würde ich sofort Bangkok herausschnuppern. Ich hatte diesen charakteristischen Mief aus süßlich Vermoderndem, gemixt mit schweren Blüten und Desinfektionsmitteln, schon völlig vergessen. Umso härter drängt Eau de Bangkok nach der Landung in meine Nase. Olfaktorisch noch außer Gefecht gesetzt, gehts schon los mit dem Pauschprogramm: Wir werden abgeholt. Irgendwie kommen wir uns blöd vor, als wir mit lauter Ehepaaren mittleren Alters magnetisch auf die freundlichen Thais zudackeln, die ihre Empfangsschilder hochhalten. Nun gehören wir also dazu. Den verächtlichen Blicken der vorbeiziehenden Backpacker halten wir trotzig und arrogant stand. Denn wer je versucht hat, vom Bangkoker Flughafen per Taxi in die Stadt zu kommen, ohne mehrere Tobsuchtsanfälle wegen impertinenter Chauffeure zu erleiden, weiß den Service des Hoteltransfers sehr wohl zu schätzen. Das nennt man pampern. Wir gewöhnen uns schnell dran.
Nach kurzem Nickerchen im Hotel, dem Crowne Plaza, einstmals Holiday Inn, praktischerweise in der Silom Road gelegen, damit man alle wichtigen Punkte bequem zu Fuß erreichen kann (Oriental Pier für die Bootsfahrten auf dem mächtigen Mae Nam Chao Phraya in die Altstadt, Oriental Terrace für den Sundowner, Silom Village und Patpong zum Powershoppen, Ban Chiang zum Schlemmen), gehts los. Bangkok verzeiht es einem nicht, wenn man irgendwas verschläft. Jetlag hin oder her: Mit dem Linienboot zu Wat Po. Zum x-ten Mal sehen und immer noch fasziniert sein. Und zum x-ten Mal sich über meinen Reiseführer aus den frühen 90ern des letzten Jahrhunderts des vergangenen Jahrtausends amüsieren; putzigerweise beschreibt der die Hauptattraktion der Tempelanlage Wat Po so: »Der Tempel des ruhenden Buddha (50 cm lang, 15 cm hoch) wurde 1987 zum Geburtstag von König Bhumibol neu vergoldet.« (Merian live: Thailand, Gräfe und Unzer Verlag, München, 1994, S. 57). Boah, denkt man sich. Da haben die Thais für ihren König ganz schön was springen lassen. Ganze 50 Zentimeter lang! Dann steht man vor dem in Wirklichkeit natürlich 50 Meter langen Riesenbuddha und wundert sich ein bisschen, dass sich solch entscheidende Details durch zig Korrekturstufen schmuggeln können, die ein Reiseführer aus dem Hause Merian durchlaufen sollte.
Wir haben keine Zeit für eine erholsame Thaimassage in der berühmten Massageschule von Wat Po, sondern hetzen sofort weiter zu den Märkten, die in Reiseführern gerne als verschiedene Märkte (Pahurat Market, Old Siam Plaza, Diebesmarkt, Pak Khlong Talat) beschrieben werden, die aber letztlich ein einziger, gigantischer, unzählige Straßenzüge umspannender Markt sind. Wir haben nur noch wenig Zeit, bis die Sonne untergeht und die Stände schließen. Schnell in das Gewusel einreihen und sich ständig dem Kreislaufkollaps nahe durch die dichten Menschenmassen quetschen oder sich mal willenlos ein paar Straßenzüge lang mitreißen lassen. Und immer darauf hoffen, dass keine Stampede ausbricht. Glücklich, überlebt und eine spottbillige Ray-Ban (garantiert so was von echt) erstanden zu haben, bummelt man dann durch die etwas ruhigeren Gassen von Chinatown, reiht sich an abgesperrten Straßen in fähnchenschwingende Schulkinder ein, die einer hinter dem dunklen Panzerglas einer vorbeirauschenden Luxuslimousine verborgenen königlichen Hoheit zujubeln, und erreicht endlich die Terrasse des Oriental, seines Zeichens regelmäßig zum besten Hotel der Welt gekürt, wo man bei einem Cocktail den Sonnenuntergang am Flussufer genießt. Okay, zugegeben, seit auf der anderen Flussseite das Peninsula an den Wolken kratzt, ist es mit dem Sonnenuntergang im Oriental vorbei, aber trotzdem. Tradition ist Tradition. Und qualmende Füße fordern ihren Tribut.
Auch wenn die zahlreichen Garküchen mit noch so leckeren Düften locken, zum Glück weiß der erfahrene Bangkok-Urlauber, wo er die besten Lukullitäten zu vernünftigen Preisen in schönster Atmosphäre genießen kann. Das Ban Chiang, ein kleines, altes, liebevoll hergerichtetes Holzhaus im Kolonialstil, und das Harmonique, ebenfalls ein altes Häuschen mit romantischem Innenhof, liegen beide nur einen Steinwurf weit vom Hotel entfernt. Wobei ich mich im Zweifelsfall immer wieder fürs Ban Chiang, das in einer sehr dunklen Gasse hinter dem Crowne Plaza liegt, entscheiden würde …
Angkor, Siem Reap
Pauschalreisen haben einen entscheidenden Nachteil: Als Herdentier wird man ständig gehetzt. Wir müssen am nächsten Tag schon um kurz nach Mitternacht aufstehen, weil der Shuttle uns um 5 Uhr abholt, damit wir auch sicher den Flieger um 8 Uhr nach Siem Reap, Kambodscha, erreichen. Dass man dann zweieinhalb Stunden am Flughafen chillt, was solls. Dafür begrüßt einen der winzige Flughafen in Kambodscha, ein für Länder mit diktatorischer Vergangenheit typischer, hingeklatschter Betonklotz, mit einem charmanten Fußbodenmuster aus lauter zerquetschten Kakerlaken.
Eine weitere zweifelhafte Charmeoffensive erwartet uns an der Passkontrolle. Die sich nur alle paar Stunden um einige Millimeter weiterbewegenden drei Warteschlangen und die grimmig blickenden Uniformierten hinter dem Tresen erinnern verdächtig an Zeiten, als es noch ein Abenteuer war, die Sowjetische Besatzungszone (heute: Neue Bundesländer) zu besuchen. Wer ins Land will, muss ein Passfoto vorlegen und 20 Dollar in bar berappen. Wenn man kein Passfoto hat, wie das amerikanische Ehepaar vor uns, tuns zur Not auch 5 Dollar, die man zusätzlich über den Tresen schiebt. Hat man die 20-Dollar-und-im-Notfall-Bestechungsgeld-Schlange überwunden, stellt man sich brav an der Visum-Aushändigungs-Schlange an. Spätestens hier beginnt ein munteres Zeittotschlagen, indem man mit seinen Vorder- oder Hinterleuten Bruderschaft trinkt und lebenslange Freundschaften schließt. Glücklich, wer einen prall gefüllten Picknickkorb, Astronautennahrung oder ein Klappbett dabeihat. Das amerikanische Ehepaar von eben plauscht mit uns. Er erinnert mit seinem markant zerknitterten Gesicht an einen deutschen Schauspieler, der immer in den Winnetou-Filmen oder bei »Lederstrumpf« mitgespielt hat, und dessen Name mir nicht einfällt. Ich glaube, der Schauspieler hieß Hellmut Lange. Lederstrumpf ist natürlich sofort begeistert, als er erfährt, dass wir Deutsche sind. »Meine Großvater war eine Schwabe«, radebrecht er stolz. »Isn’t that gorgeous?!«
Schon ein halbes Menschenleben später haben wir unser Visum und können endlich zur Passkontrolle-Schlange vorrücken. Die Lebensgeschichte von Lederstrumpf und Gattin beherrschen wir bereits auswendig, und ich schaffe es gerade noch, den Amis die detaillierte Biografie meiner Urgroßmutter väterlicherseits reinzudrücken, als es auch schon Abschied nehmen heißt. Wir sind durch! Dass wir das noch erleben durften! Wir treten ins gleißende Sonnenlicht Kambodschas.
Unser Reiseführer strahlt über beide Ohren, als er uns in Empfang nimmt. Man möge ihn bitte Ry nennen, denn seinen kompletten Namen könnten wir uns eh nicht merken. Uns zuliebe spricht er seinen Namen dann doch aus. Wir können ihm nur zustimmen und bleiben bei Ry.
Ry karrt unsere Reisegruppe ins Angkor Hotel. Gepäck abliefern. Einchecken können wir erst später, weil die Zimmer nicht fertig sind. Unsere Gruppe besteht außer uns aus einem ältlichen schweizerischen und einem niederbayrischen Ehepaar, einem jungen Pärchen aus München (Gott sei Dank sind wir nicht die Jüngsten!), einem schwergewichtigen Ehepaar aus Berlin und einem alleinreisenden, putzmunteren Greis aus dem Schwäbischen, der die 80 schon weit hinter sich hat. Im Hotel heißt uns eine freundliche Dame mit der entzückenden Geste des Schalumlegens willkommen. Einer buddhistischen Tradition folgend, bekommt jeder einen dünnen Schal um den Hals gehängt. Vor einigen Jahren gab es einmal eine außenministeriale Notlösung namens Klaus Kinkel, die ganz undiplomatisch für einen Skandal sorgte, als sie dem Dalai Lama just diese Geste verwehrte. Ein Kinkel Klaus ließ sich nichts um den Hals wickeln, lieber beleidigte er das geistliche und weltliche Oberhaupt von zig Millionen Buddhisten tödlich. Doch Seine Heiligkeit, die Diplomatie in Person, lächelte und tat, als ob nichts wäre. Wir hingegen lassen uns gerne Schals umlegen. Alle bedanken sich artig, doch schnell wandern neidische Blicke durch die Runde. Der hat einen blauen, den will ich! Sauerei, die fette Kuh bekommt den orangenen und ich den hässlichen schlammfarbenen. Ein munteres Schaltauschen beginnt. Die Hoteldame lächelt und tut, als ob nichts wäre.
Die Begrüßungsschals, eben noch hart ertauscht, verschwinden lieblos zusammengeknüllt in den Reisetaschen, die erste Besichtigungstour beginnt. Wir bekommen unsere Mehrtagespässe, die wir ständig sichtbar tragen müssen, denn obwohl Angkor sich über etliche Quadratkilometer erstreckt und aus zahllosen, teilweise völlig einsam liegenden Gebäudekomplexen besteht, gibt es überall Kontrollen, damit sich niemand die Schönheiten Kambodschas umsonst erschleichen kann. Was jedoch noch wichtiger ist: Der Pass berechtigt zum kostenlosen Aufsuchen der Angkor-Toiletten, die nicht nur nach den Maßstäben eines Fünfteweltlandes sauberst, modernst und empfehlenswertestens sind. Allein die putzigen Piktogramme, die ungeübte Klobesucher darauf hinweisen, dass man auf der Klobrille sitzt und nicht steht oder hockt, sind den Besuch wert.
Die Besichtigung der ersten Attraktionen wird durch einen kleinen Makel erschwert: Unser Reiseleiter Ry ist eine Seele von Mensch, lieb und bemüht – aber er redet auch wie ein Wasserfall und versucht uns die Unmengen an Wissen zur faszinierenden Khmer-Geschichte, über die er zweifellos verfügt, geballt reinzudrücken. Leider kann sich der Mitteleuropäer als solcher komplizierte asiatische Herrschernamen und den reichhaltigen Kosmos hinduistischer Gottheiten sowie die Terminologie buddhistischer Erleuchtungsstadien nur schwer auf Anhieb merken. Bedauerlicherweise bedient sich Ry, der angeblich zu DDR-Zeiten in Rostock Medizin studiert hat, einer Sprache, die man beim konzentrierten Hinhören nur mit viel Wohlwollen als Deutsch identifizieren kann. Und er pflegt seine Ausführungen pädagogisch wertvoll aufzubereiten, indem er stets ein rhetorisches »Und warum?« einfügt, um noch detaillierter das eben Gesagte zu wiederholen.
So erfahren wir beispielsweise angesichts der erschlagend beeindruckenden Ruine des Bayon Tempels: »Dann sinn Hinduis unn Shivais geweseh weg unn König Jayavarman die Siebeh, die iss König von elfehundeheinunnachezih bis zwolefehundehneunezeh, wolleh deh Mach von König neu stutzeh auf die Mahayana-Buddhis, sag man doch, stutzeh, eh? Unn warum? Weil die Buddhis is von Jayavarman die Religion, die haben.« Und schon begehen wir einen Frevel, den Pauschalisten scheuen wie der Teufel das Weihwasser: Wir setzen uns einfach ganz individuell ab, erkunden die umwerfende, letztlich nicht beschreibbare Anlage mit den 37 milde lächelnden, meterhohen Buddhaköpfen auf eigene Faust. Einzig das Berliner Ehepaar, sie kugelrund und ständig die Videokamera im Anschlag, er geschmackssicher in schreienden Hawaiihemden, traut sich, ebenfalls aus der Herde auszubrechen. Hier, wie in allen anderen Tempelruinen, wurden einige der heiligen Stätten reaktiviert. In verfallenden Türmen sind Buddhastatuen mit orangenen Schärpen postiert, meist halten kahlgeschorene, greise Nonnen Wache und bitten um Almosen.
Allein der Bayon Tempel und die Straße der Riesen mit den gigantischen Dämonenstatuen auf der rechten und den monumentalen Buddhastatuen auf der linken Seite haben uns völlig betäubt. Man muss sich ständig ins Bewusstsein rufen, dass das alles keine Kulissen für einen »Indiana Jones«-Film sind, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Der Ta Prohm Tempel wird sogar fälschlicherweise »Indiana Jones Tempel« genannt. Nein, Indiana Jones war nie hier. Dafür Angenlina Jolie in »Lara Croft: Tomb Raider«. Alles ist echt, wir erleben die spektakulären Ruinen einer einstigen Millionenstadt, die zur selben Zeit aufblühte wie das Reich Karls des Großen, ihren Höhepunkt unter den Gottkönigen im 12. Jahrhundert erlebte und sich durch ihre eigene, unstillbare Prunksucht dann selbst das Grab schaufelte. Nach zahlreichen Kriegen, Eroberungen und Plünderungen durch die Siamesen wurde Angkor verlassen und ab dem 15. Jahrhundert vom Urwald zurückerobert. Seit knapp eineinhalb Jahrhunderten wird die Stätte der Superlative wieder peu à peu dem Dschungel entrissen. Angkor darf man sich nicht als wilde Ansammlung von Ruinen vorstellen. Schon von der Straße der Riesen zum Bayon Tempel fährt man mehrere Kilometer. Teilweise ist man je nach Fortbewegungsmittel (und unsere Individual-Freunde wählen hierzu Mopeds oder Fahrräder, zwei bis drei völlig Durchgeknallte sind mit hochroten Köpfen sogar per pedes unterwegs und sehen so aus, als würden sie nicht mehr lebend nach Siem Reap zurückkehren) mehrere Stunden von Tempel zu Tempel unterwegs, durchquert Dörfer, Felder und wilden Urwald.
Bevor wir uns Angkor Thom und Angkor Wat widmen dürfen, heißt es erst: zurück ins Hotel, Zimmer beziehen. In der Sekunde, in der wir unsere Zimmertüre aufschließen, ertönt innen ein kurzes Quieken und die Badezimmertür wird zugeschlagen. Im Bruchteil einer Sekunde erhaschen wir noch einen Blick auf die Ursache: Ein Zimmermädchen hockt mit runtergelassenem Höschen auf unserem Klo und kackt sich aus. Es dauert, bis sie endlich fertig ist. Sie kommt heraus, lächelt verlegen und sagt »Sorry«, während sie sich mit der rechten Hand vielsagend den Bauch hält.
Die meisten aus unserer Gruppe nutzen die freie Stunde zum Schlafen, ich erkunde lieber den Hotelpool. Außer mir kommt noch die junge Münchnerin an den Pool. Sie heißt Clara und fühlt sich vom stundenlang durch die Tempel tigern noch nicht richtig ausgelastet. Ein paar Kilometer schwimmen soll Abhilfe verschaffen. Der Pool ist ansonsten fest in japanischer Hand – wie übrigens fast alles in Kambodscha. Vielleicht finden die reichen Zeitgenossen aus dem Land des Lächelns ja auch die Attraktion toll, die hinter dem Pool zur Gästebelustigung bereitgehalten wird: Zwei völlig verstörte Schwarzbären kauern in einem winzigen Käfig, der so gut wie keinen Sonnenschutz bietet.
Nur bleibt kaum Zeit, Bärenschicksale zu bedauern, denn wir müssen an diesem Nachmittag noch einiges abarbeiten. Angkor Thom mit dem Königspalast, der gigantischen Elefantenterrasse und der Terrasse des Lepra-Königs sind vergleichsweise schnell abgehakt, wobei die drängende Frage, ob denn der König nun wirklich Lepra hatte oder nicht, von unserem Reiseleiter Ry nicht erschöpfend beantwortet werden kann. Das heißt, uns erschöpft die Antwort sehr wohl, denn Ry holt erst einmal zu einer kompletten Genealogie der Khmer-Könige aus, um dann die Frage nach der Lepra wortreich in einer uns größtenteils unbekannten Sprache zu umschiffen: »Die Leute denken die Lepra mit die König. Unn warum? Weil die König habe die Fingah unn die Leute nich habe gewusst – man sag doch gewusst? –, dass die Lepra nich die Ursach, wenn die König habe das. Aber die König so habe immer unn denke die Leute mit die Lepra. Aber habe die Fingah! Sie verstehe? Also, ich wiederhole noch mah …«
Immer noch rätselnd, was denn nun an der Leprageschichte dran war, turnen wir bald darauf auf den Steiltreppen des Phimeanakas, einer Tempelpyramide aus dem 10./11. Jahrhundert, herum. Wie sich im Nachhinein zeigen sollte, noch die harmloseste. Buddhistische Tempelpyramiden in Angkor neigen dazu, nur über halsbrecherische, beinahe senkrechte Steintreppen mit ausgelatschten, extrem schmalen Tritten erklimmbar zu sein. Nichtsdestotrotz klaxelt Clara, die den dringenden Hinweis des Reiseveranstalters auf festes Schuhwerk einfach ignoriert hat, mit hochhackigen, offenen Sandaletten hinauf und erstaunlicherweise auch lebend wieder hinunter. Gute Übung für die Kletterherausforderung, die nun auf uns wartet: Angkor Wat. Die pompöse, trotz der Jahrhunderte Dornröschenschlaf im dichten Dschungel sehr gut erhaltene Tempelanlage ist der erste und einzige Ort hier, den man tatsächlich als touristisch überlaufen bezeichnen könnte: Man sieht nämlich ab und an mal ein paar andere Menschen. Natürlich haben wir zwei schwarze Schafe uns wieder von Rys Erklärungsmarathon zum größten sakralen Bauwerk der Welt befreit, überqueren die Brücke über dem Wassergraben, der Angkor Wat umgibt, und lustwandeln auf der Prachtallee gen Zentraltempel. Ab und an rollt die dicke Berlinerin, die ebenfalls endgültig zu den Dissidenten gehört, in Sichtweite herum und filmt, was die Videokamerabatterien hergeben. Bei jeder Begegnung zwinkern wir uns verschwörerisch zu. »Det isn Ding hier, wa?«, ruft sie uns fröhlich zu. »Aba det is noch jar nüscht jejen Burma! Det müssta ma machen!« Machma. Näxtes Jahr, wa.
»Hey, howya doin?«, plärrt es da von der Seite, und schon treffen wir unsere Bekannten aus dem Einreise-Schlangen-Abenteuer, Lederstrumpf und Gattin.
»What a small world, hm?«
»It is!«
»Isn’t that ter-ri-fic?!«
»Sen-sa-tio-nal!«
»A-ma-zing!«
»It’s just like, you know, so impressing!«
»Yeah, see ya!«
»See ya!«
(Amnerkung von 2020: Damals war noch nicht alles »awesome«.)
Im Herzen Angkor Wats befindet sich die ultimative Traniningsanlage für Freeclimbing-Freaks. Die »Treppe« der Tempelpyramide ist nichts weiter als eine endlos hohe Wand mit einem winzigen Stüfchen alle fünf Meter. Carsten, fitnessgestählt, macht die Vorgabe und turnt leichtfüßig, einer Bergziege gleich, die Senkrechte hoch. Ich, schokoladengeschwächt, erklimme zitternd auf allen vieren und mit dem Adrenalinausstoß eines Bungeespringers die Wand. Bloß nicht nach unten schauen, bloß nicht hinterfragen, was ich da eigentlich mache. Und da ich oben auch tatterige Greisinnen herumspazieren sehe, bin ich leidlich zuversichtlich, dass es irgendwo einen einfachen Weg geben muss. Einen einfachen Weg hinunter. Den gibt es tatsächlich, doch die Warteschlange downstairs ist schier endlos. Schon senkt sich die Sonne im Westen ihrem Untergang zu. Von hier oben aus hat man einen Traumblick auf die dämmernde Landschaft. Bekanntermaßen geht in den Tropen die Sonne meist ziemlich ploppartig unter, das bedeutet im Zweifelsfall: Abstieg vom Tempel im Dunkeln. Es gelingt mir, mich gnadenlos durch geschicktes Vortäuschen akuter Darmprobleme in der Warteschlange vorzudrängen. Nun ist eine junge Frau mit Kleinkind auf dem Arm vor mir. Wie die es mit dem Balg hier hochgeschafft hat, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Jedenfalls sollte man ihr sofort das Sorgerecht entziehen. Der einfache Abstieg entpuppt sich als ebenso senkrechte Wand mit alle fünf Metern einem schmalen Stüfchen, nur wird er von einem hauchdünnen Metalldrähtchen, an das sich alle verzweifelt krallen, »abgesichert«. Tattergreisinnen, Mütter mit Säuglingen und nicht völlig schwindelfreie Autoren benötigen natürlich eine gewisse Zeit, um sich diesen Weg hinabzuhangeln. Froh, noch unter den Lebenden zu weilen, bummeln wir zurück zum Eingangstor von Angkor Wat, in der Hoffnung, dort unsere Gruppe wiederzufinden.
»Hey, my god, did anybody ever tell ya, that you are tall?!«, quäkt es da plötzlich von links hinten in jenem breiten Gerülpse, das in weiten Teilen der USA als Sprache anerkannt ist. Wir drehen uns um, eine kleine, dicke Amerikanerin asiatischer Herkunft grinst breit.
»Tall? Me? You’re sure?!«, antworte ich geistesgegenwärtig. Nun bin ich nicht gerade der Kleinste und falle besonders in asiatischen Ländern auf, weil ich mit meinen 2,03 Metern mühelos jeden überrage. Doch so plump hat es bisher noch niemand gebracht. Die pummelige Amerikanerin tut fortan so, als hätte sie mit uns die Wartezeit an den drei Einreiseschlangen am Flughafen verbracht, textet uns gnadenlos mit Blabla à l’americaine zu (»So fascinating, isn’t it? Überfascinating.«). Wir spielen mit, wohl wissend, dass der trendige Ami momentan die deutsche Vorsilbe »über« favorisiert (»It’s just like, you know, so unique. Überunique.«), bis die Frau dann abrupt stehen bleibt und sich mit einem: »Allright, I’ll just catch a photo right here. See you, boys.« verabschiedet. Weg ist sie.
Es ist zwar schon schwärzeste Nacht, doch noch früh am Abend, als wir endlich wieder unsere Pauschalfreunde treffen. Ry grollt nicht, weil wir den Nachmittag ohne seine Erläuterungen verbracht haben. Er bleibt die radebrechende Freundlichkeit in Person. Doch er ist verzweifelt, weil er den Programmpunkt »Sonnenuntergang von Phnom Bakheng« nicht mehr untergebracht hat. Dafür will er uns am nächsten Morgen mit einem Sonnenaufgang locken. Irgendwie sind wir alle nicht begeistert von der Vorstellung, schon wieder um 5 Uhr früh aufstehen zu müssen, und lehnen das Angebot ab. Nun schmollt Ry doch ein wenig und scheucht uns zur Strafe in einen der zahlreichen supermarktgroßen Souvenirshops, wo man nach allen Regeln der Kunst ausgenommen werden soll. Hostessen mit der Penetranz von Filzläusen und Preise jenseits der Schamgrenze verhindern jegliche Kaufgelüste. Zumal man die identischen industriegeschnitzten Buddhas, den billigen Silberschmuck und die Stoffe in Bangkok erheblich preiswerter kaufen kann. Da wir den Konsum verweigern, kann Ry vom Ladenbesitzer auch keine Provision einstreichen. Er wird uns daher am nächsten Tag noch zwei- bis dreimal hartnäckig an Souvenirsupermärkten ausladen und beschwört uns, am Abend zumindest in die Lokale zu gehen, die er uns empfiehlt.
Hier haben die anderen Gruppenmitglieder ein Herz, doch wir zwei seilen uns gewohnheitsmäßig ab und entdecken prompt, angelockt von blinkenden Leuchtketten, in einer düsteren Seitenstraße einen spottbilligen Gourmettempel. Das Geblinke ist nur von kurzer Dauer, denn kaum haben wir bestellt, gehen die Lichter aus. Totaler Stromausfall. Nun hocken wir bei Kerzenlicht. Richtig romantisch. Das finden auch die vier sehr praktisch gekleideten, kräftig gebauten Damen mit Kurzhaarfrisuren und markant maskuliner Appearance am Nebentisch, die sich nun noch verliebter gegenseitig in die Augen schauen. Sie rufen uns im derbsten Boarisch ein freundliches »Grad griabig da herin, gell. Pfiads eich, Buam!« nach, als wir, vollgewamst bis zum Anschlag, höchst zufrieden das Lokal verlassen. Auf unser »Pfiads eich aa, Madln, äh, Buam!« strahlen sie wie Honigkuchenpferdinnen.
Wir wollen ein wenig Siem Reap erkunden, doch wir finden nicht viel Erkundenswertes. Zwei kleine Schmuddelläden mit einigen interessanten asiatischen Pseudoantiquitäten ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich, doch kambodschanische Ladenbesitzer haben im Gegensatz zu ihren thailändischen Kollegen sehr viel fixere und vor allem viel überzogenere Preisvorstellungen. Sie knallen uns einen obszönen Dollarpreis hin und lassen sich nicht mal annähernd in die für uns interessante Preiszone handeln. Pech gehabt, dann eben nicht.
Apropos Dollar: Kambodscha gilt als eines der ärmsten Länder der Welt, was man nirgends nachlesen muss, weil man es sofort am Straßenleben sieht. Alle Hoffnungen ruhen auf dem Tourismus, weshalb an der Straße nach Angkor ein Hotel neben dem anderen hingeklotzt wird. Von den rund 600 000 Besuchern im Jahre 2002 will sich Kambodscha auf 2,8 Millionen bis 2006 steigern. Da der kambodschanische Riel völlig unter Schwindsucht leidet, sind US-Dollar und Thai-Baht die offiziellen Zahlungsmittel. Und auf einen Dollar oder mindestens 20 Baht (ca. 50 Euro-Cent) hoffen alle Kinder und Bettler. Klar soll man nichts geben, weil man sonst die Kinder zum Betteln erzieht. Dies haben aber schon zahllose Touristen vor uns gemacht, und so hat man an jedem Tempel in Angkor und an jeder Straßenecke in Siem Reap eine Horde »One dollah«-kreischender Bälger um sich. Manche versuchen, dir für den Dollar (oder zwei oder drei) zumindest ein T-Shirt, Filme, Postkarten oder ihre Schwester anzudrehen, doch die dreisteren bieten nichts außer Hartnäckigkeit. Kaum hat man zum Beispiel die herrliche Aussicht vom Gipfel des Ta Keo genossen und küsst noch ganz trunken vor Freude den Boden, dass man wieder eine halsbrecherische Steiltreppe überlebt hat, schon klebt Miss Impertinent an dir und schreit: »Give me one dollah!«
Du ignorierst es zunächst.
Sie zerrt an dir und deinen Nerven. Moderne Künstler könnten aus dem Rhythmus der nun folgenden Endlosschleife »One dollah!« »No!« »One dollah!« »No!« »One dollah!« »No!« eine interessante Klanginstallation machen. Endlich ist der Bus erreicht, mit einem triumphierenden Lächeln schmetterst du dem Mädchen ein letztes »No!« entgegen, und willst das Gefährt besteigen, da spielt die Kleine voll auf, schleudert dir ein völlig absurdes »Okay, Sir, so you give me two dollah!« hinterher und damit hat sie dich dann.
Ähnlich gepolt ist auch der kleine Junge, dem ich vor dem sprachlos machenden Meisterwerk mittelalterlich-hinduistischer Steinmetzkunst, dem über und über mit Ornamenten verzierten Tempel Banteay Srei, in die Arme laufe. Da ich eben bei einer Kollegin die sensationell gut gemachte Bronzereplik eines stehenden Ganescha aus dem 7. Jahrhundert auf 12 Dollar heruntergehandelt habe, reagiere ich nicht auf T-Shirts, Filme, Postkarten, Drogen, Waffen und Flugzeugträger. Schließlich versucht er es mit dem plumpen »Mistah, buy something! One dollah!« und fügt ein verzweifeltes »What do you want?« hinzu.
Ich antworte: »Nothing!«
Darauf er: »Nothing? Nothing is two dollah!«
Am Nachmittag dieses zweiten denkwürdigen Tages im Pauschalhetz-Sightseeing-Marathon (okay, wir haben auch noch den Tempel Ta Som und das riesige Schwimmbecken Srah Srang besichtigt, aber unter uns: Man kann einfach nicht jedes Mal erneut in orgiastische Entzückensschreie ausbrechen, und irgendwann gehen einem einfach die Superlative aus) läuft uns in Ta Prohm wieder Lederstrumpf mit Gattin über den Weg.
»Isn’t that amazing?«
»Indeed. So überinteresting!«
»Phan-tas-tic!«
»Mar-ve-lous!«
»It’s just like, you know, gorgeous!«
»Oh my gosh! You’re damn right!«
(Wie gesagt, so war es in den Vor-»awesome«-Zeiten!)
Mittlerweile sind wir alte Profis in amerikanischem Smalltalk, wir beherrschen nicht nur die Worte, auch die Tonlage: Ein hysterisches Fiepsen im Ultraschallbereich, kurz vorm Orgasmus. So muss es sich anhören, wenn man gorgeous sagt; so kann man den immer noch urwaldüberwucherten, romantisch verwitterten Ta Prohm, sicher einer der absoluten Höhepunkte der Angkor-Tour, in einem Wort zusammenfassen. Praktisch, diese Amis. Unsereiner hätte mühsam nach Worten gerungen, um das meterhohe Wurzelwerk von Urwaldriesen zu beschreiben, das krakenartig die Ruinen des Tempels aus dem 12. Jahrhundert umschlingt oder elegant wie das Wachs einer Riesenkerze über Mauern fließt, und hinter jeder Biegung heißlaufende Fotoapparate evoziert. Doch dank Lederstrumpf wissen wir nun, dass ein einfaches gorgeous wirklich alles sagt. Keine Frage, dass uns fortan irgendwelche Akropolen, Colosseen oder ägyptische Pyramiden nur noch ein müdes Gähnen entlocken werden.
Uns begegnen geballt weitere Formen der Armut und Bettelei. Kriegsveteranen und Landminenopfer mit fehlenden Beinen, Armen und Augen. Erschütternde Zeugnisse der Terrorjahre, die hinter Kambodscha liegen. Pol Pot und die Roten Khmer sind so noch immer gegenwärtig. Das Schweizer Ehepaar ist zu Recht stolz auf seinen Landsmann Dr. Beat Richner, der mit Spendengeldern in Siem Reap das bisher einzige funktionierende Krankenhaus Kambodschas aufgezogen hat. Unsere Schweizer, die sich bisher hauptsächlich durch strohtrockene Sauertöpfigkeit hervorgetan haben, geben den Bettlern mal hier mal da 20 Baht oder einen Dollar. Ähnlich die Münchnerin Clara, die ihre Lernfähigkeit unter Beweis stellt, indem sie heute geschlossene Pumps mit Turboabsätzen statt hochhackiger Kamikazesandaletten trägt und munter weiterhin einer Gämse gleich jede Tempelsteilwand hinauf- und hinabturnt, während ihr Freund Thomas mit schreckensbleichem Gesicht und »Ich kann gar nicht hinsehen«-murmelnd an einem schattigen Plätzchen auf sie wartet. Sie hat schon am Vorabend ihre Finanzreserven in Eindollarscheine umgetauscht und gibt und gibt und gibt, unsere Einwände fegt sie beiseite. Tausende Arme und Stummel greifen nach ihr. Die Situation wird letztlich pervers, als sie, mit einem Dollarschein wedelnd, von bettelnden Kindern umringt dasteht und uns zuruft: »Wem soll ich denn nun den letzten Schein geben?« Wir verzichten auf politisch korrekte Ökotourismus-Pädagogik, spielen Schicksal und deuten willkürlich auf ein Mädchen.
Während Carsten zunächst noch eher bereit war, Geld zu geben, nun zusehends abstumpft und garstigerweise den kreischenden Bettlern auf ihr »One Dollah!« ein freches, ihrem Pidgin-Englisch angeglichenes »No have!« antwortet, verläuft bei mir der Prozess anders herum. Ich entstumpfe langsam, weiß, dass ich es nicht tun sollte. Vernünftiger wäre es, von den Erwachsenen T-Shirts oder Postkarten, die fast nichts kosten, in Massen zu kaufen. Das fördert – im Gegensatz zu Almosen. Trotzdem gebe ich zaghaft mal 20 Baht, mal nur zehn. Doch wo anfangen und wo aufhören? Gewiss gar nicht anfangen bei dem Angebot, das uns gleich mehrere Polizisten zukommen lassen: Sie wollen uns ihre Dienstmarken andrehen. »Nice souvenir!« Für nur fünf Dollar das Stück. Und man versichert uns, dass der Verlust der Marke für den Polizisten kein Problem sei. »I have quinze à la maison.« Nun sehen diese Marken wirklich hübsch und dank der Schrift auch exotisch aus, doch weniger hübsch und exotisch stellen wir uns vor, was passiert, wenn wir an der Grenze gefilzt werden und die Dinger im Gepäck haben. Garantiert wurde irgendwann in den letzten Wochen ein kambodschanischer Bulle ermordet und ohne Dienstmarke aufgefunden. Da sitzt man schneller in der Todeszelle, als einem lieb ist. Ry klärt uns auf, dass die Polizei seit zig Monaten keine Gehälter mehr ausgezahlt bekommen hat. Immerhin sind wir dankbar, dass die Bullen uns nur ihre Dienstmarken verscherbeln wollen, und uns nicht, wie der Reiseführer eindringlich warnt, einfach mit vorgehaltener Dienstwaffe ausrauben.
Für Ry muss der Tag bisher die Hölle gewesen sein. Angestachelt von uns schwarzen Schafen und der individuell herumkugelnden Berlinerin, haben plötzlich alle (ausgenommen die immer sauertöpfischer dreinblickenden Schweizer) mit zahllosen Sonderwünschen, äußerst flexibler Zeiteinteilung und Extrastopps an nicht vorgesehenen Sehenswürdigkeiten den Plan völlig auf den Kopf gestellt. Doch nun, wo Ry uns schon mal so schön zusammen hat, bugsiert er uns kurzerhand in den Bus. Heute Abend entkommen wir dem Sonnenuntergang nicht. Ry karrt uns zum Phnom (»Das Phnom bei uns in Kambodschah isse Berg!«) Bakheng. Schon finden wir uns mitten in einem Gewusel von Bussen, Taxen und Mopeds, die einen endlosen Strom an (hauptsächlich japanischen) Touristen am Fuße des Phnom abladen. Für Gutbetuchte stehen für 15 Dollar pro Person Elefanten bereit, auf deren Rücken der Aufstieg bequem zu bewältigen ist. Die dicke Berlinerin verweigert erstmals komplett die Gefolgschaft und verzieht sich samt Videokamera zu den Getränkebuden am Parkplatz. Ry erbarmt sich unseres greisen Alleinreisenden und führt ihn auf dem Elefantentrampelpfad zum Gipfel. Der alte Mann trotzt tapfer der Hitze und den Strapazen und macht entgegen anders lautender Wetten keine Sekunde schlapp. Schweißgebadet, kurzatmig und der Optik nach kurz vorm Herzstillstand zwar, aber er hält durch. Völlig schweißgebadet sind auch wir Fußvolk, die wir den »kurzen« Weg nach oben wählen und eine beinahe senkrechte Steilwand aus losem Geröll hochklettern müssen. Mitten im Geröll haben sich erschwerend bettelnde Minenopfer mit bloßen Bein- und Armstümpfen postiert. Heilfroh, endlich oben zu sein und den Sonnenuntergang genießen zu können, eröffnet sich dem Kletterer eine weitere Hürde: Auf dem Berggipfel befindet sich eine Tempelpyramide, die es noch zu erklimmen gilt, um den ultimativen Blick zu haben. Ich sage nur: »Steiltreppe, alle fünf Meter ein Stüfchen.« Oben tobt das Leben. Sundown auf Phnom Bakheng scheint der angesagte Event zu sein. Wir wähnen uns in einem polaren Land oder dem Epizentum einer ansteckenden Pandemie. Japaner über Japaner in den abenteuerlichsten Verhüllungen, damit kein Sonnenstrahl die empfindliche Haut berührt, dazu Mund-, Augen- und Sonstwas-Schutz. Vor allem die Damen tragen die wildesten Aufbauten rings um den Kopf, die sie wie futuristische Stahlschweißerinnen aussehen lassen, um sich vor der Sonne zu schützen. Wir finden letztlich noch ein japanerfreies Steinchen und warten freudig erregt auf das Naturschauspiel.
Das Münchner Pärchen gesellt sich zu uns. Clara hat unten am Berg bei einer Bude zwei Getränke erworben. Eine Dose einheimisches, durchaus leckeres Angkor-Bier und eine Dose, die eine uns unbekannte, nicht sehr vertrauenserweckende Frucht ziert. Die Gute wollte mal was anderes ausprobieren. Der hohe Bogen, in dem sie dann den ersten Schluck wieder ausspuckt, lässt keine Zweifel zu: Die Geschmacksrichtung »Unbekannte, nicht sehr vertrauenserweckende Frucht« ist nicht der Bringer. Noch sind 20 Minuten vor Sonnenuntergang.
»Ich brauche was zu trinken«, beschließt Clara. »Will noch jemand was?«
»Wie? Woher willst du denn jetzt was anderes herbekommen?«, frage ich verwundert.
»Na, ich geh schnell wieder runter und kauf was Neues«, antwortet sie mit einer Seelenruhe, als sei es auch nur ansatzweise realistisch, in einer Viertelstunde die Tempelsteiltreppe plus senkrechte Geröllwand lebend runter- und vor allem wieder raufzukommen. Noch dazu in offenen Pumps.
»Soll ich dir ’ne Cola mitbringen?«, fragt sie, dann stöckelt sie auch schon los, und ihr Freund Thomas wird wieder kreidebleich, murmelt Verzweifeltes. Noch während wir ihm tröstend die Schulter tätscheln und gut gemeinte Phrasen wie »Wir helfen dir schon mit dem Papierkram, den so eine Leichenüberführung mit sich bringt« von uns geben, tanzt eine Coladose vor meiner Nase.
»Hier, ist noch gut kalt.« Die Gute benötigte nicht einmal zehn Minuten für die Getränkeaktion, inklusive Dollarnotenverteilen an die Bettler. »Ach, manchmal brauche ich einfach ein bisschen Bewegung«, sagt sie und transpiriert nicht einmal.
Die Sonne senkt sich beeindruckend über ebensolche Landschaft, schnell ein Foto geknipst, dann heißt es auch schon Aufbruch. Denn alle wollen noch bei Licht den Abstieg machen, und wir müssen ihn daher vor allen anderen schaffen. Wir gehören zu den Ersten, der staufreie Rückweg gelingt. Abgekämpft wie wir sind, hält Ry uns für willenlos genug und karrt uns wieder zu einem Souvenirsupermarkt. Da er wirklich eine Seele von Mensch ist, geradezu masochistisch alle Programmänderungen akzeptiert hat und immer noch ein überzeugend ehrliches Dauerlächeln aufgesetzt hat, spielen wir ausnahmsweise mit und heucheln Interesse. Die Schweizer kaufen eine Kleinigkeit, damit Ry seine Provision kassieren kann, doch dann schlagen sie gnadenlos zu.
»Was sind denn das für Elefanten gewesen?«, fragt der Schweizer. »Afrikanische oder indische?« Eine ebenso überflüssige wie dumme Frage mitten in Südostasien.
Ry versteht zunächst auch nicht, doch schließlich antwortet er: »Elefanten sinn kambodschanis. Unn warum?! Sinn aus Kambodschah.«
»Ja, das schon«, vertieft der Schweizer sinnloserweise die Diskussion. »Mir ist klar, dass die hier leben. Aber sind es nun von der Rasse her afrikanische oder indische?«
»Kambodschanise«, beharrt Ry mit verzweifeltem Lächeln.
»Es gibt keine kambodschanischen Elefanten!«, doziert der Schweizer rechthaberisch und deutlich angesäuert. Er führt die verschiedenen Merkmale der beiden Elefantenrassen an. Als Ry dann zugibt, dass die kambodschanischen Elefanten auch kleine Ohren haben, gibt der Schweizer ein zufriedenes »Aha, also doch indische!« von sich.
»Nein, nich indis!« Ry verzweifelt langsam angesichts eidgenössischer Ignoranz. »Kambodschanis!«
Aus lauter schlechtem Gewissen, weil wir in der Elefantendiskussion nicht viel eher zugunsten von Ry eingeschritten sind, folgen wir am Abend dann doch Rys Restaurantempfehlung, was wir schneller bereuen, als uns lieb ist. Der wittert Morgenluft und unternimmt einen erneuten Anlauf, uns am nächsten Morgen den bislang verschmähten Programmpunkt »Sonnenaufgang um 5 Uhr früh« unterzujubeln. Vergebens. Wir ziehen »Ausschlafen bis 8 Uhr« vor, um für das angeblich unbedingt sehenswerte schwimmende Dorf auf dem Tonle Sap See fit zu sein.
Ach, was waren wir naiv! Carsten hatte noch am Vorabend beschlossen, auf den Bootstrip zu verzichten, weil er lieber den Alten Markt in Siem Reap erkunden wollte. Dummerweise überredete ich ihn, doch mitzukommen. Malte romantische See-Idyllen mit glücklichen Fischern in bunten Booten aus, bis Carsten ganz heiß auf Bötchenfahren war. Immerhin können wir schon bei der Abfahrt Ry dahingehend weichklopfen, dass wir auf dem See nur die Schnelltour machen, und dann endlich außerplanmäßig den Markt in Siem Reap besuchen, bevor es mittags zum Flieger nach Bangkok geht.
Doch weshalb der See Eingang in die Programmplanung von Reiseveranstaltern gefunden hat, wird eines der großen Rätsel der Menschheit bleiben. Es kann nur daran liegen, dass es eine Internationale Verschwörung Supersadistischer Reiseroutenplaner (IVSR) gibt. Die haben böse kichernd in ihren Kämmerlein beschlossen, dass man jedem Kambodscha-Touri gehörig den Rest geben muss, indem man Tonle Sap als Attraktion anpreist. Flugs haben sie noch den Verband Lügender Reisebuchautoren (VLR) auf ihre Seite gezogen. Eine andere Erklärung kann es nicht geben. Über eine Buckelpiste nähert man sich dem Gewässer. Der Bus schlingert wie ein Schiff in Seenot auf der unbefestigten Straße, die sich beim näheren Hinsehen als festgebackene Müllkippe entpuppt. Links und rechts ziehen verwahrloste Hundehütten vorbei. Nur dass darin keine Hunde, sondern Menschen hausen. Selbst die kleinen Geisterhäuschen, die wie überall in Südostasien vor den Häusern stehen, sind hier aus alten Blechdosen selbst gebastelt. Wir werden durch den slumigsten Slum, den man sich vorstellen kann, gefahren.
Als Fernsehjunkie glaubt man, alles schon mal gesehen zu haben. Man kennt das Leben. Elendsviertel in Südamerika schocken natürlich, doch was da am Busfenster vorbeizieht, hat selbst ein Fernsehjunkie wie ich noch nie gesehen. Erbärmlichere Armut ist kaum vorstellbar. Ein kleines Mädchen im schmuddeligen blauen Kleid rennt fast die ganze Zeit neben dem Bus her, winkt verzweifelt und hebt ständig ihren rechten Zeigefinger. Ihr Zeichen für »one dollah«.
Mitten im tiefsten Slum hält der Bus. Ein brackiges schwarzes Gewässer dümpelt neben der völlig zugemüllten Straße. Wir steigen geschockt aus und wollen sofort zurück in den Bus. Die Luft, die uns empfängt, ist zum Schneiden dick. Es stinkt nach Müllkippe, gemixt mit Kläranlage und Fischfabrik. Auf der Kloake schwimmen zwischen kleinen braunen Klumpen auch bunte Ausflugsboote. Der Weg dorthin gestaltet sich schwierig, weil wir nicht wissen, ob wir da überhaupt hinwollen.
Clara herrscht ihren Freund an: »Gib mir gefälligst alle Dollar, die du noch hast!«, und betätigt sich wieder als Geldverteilstation. Ein Fass ohne Boden.
Der Horror steht allen ins Gesicht geschrieben, als unser Ausflugsboot ablegt. Einzig Ry strahlt wie immer fröhlich vor sich hin. Nur wenn er sich unbeobachtet fühlt, hält er sich die Hand vor die Nase. Wir gleiten durch das Brack an heruntergekommenen Hausbooten vorbei. Erst als der Fluss etwas breiter wird, sehen die Boote einen winzigen Hauch gepflegter aus. Ein paar sind sogar bunt bemalt. Doch der Eindruck bleibt, dass wir hier die Perversion von Tourismus erleben. Derartige Armut zu fotografieren, verbietet sich von selbst. Bisher habe ich es nie getan, doch diesmal knipse ich drei oder vier Fotos zur Dokumentation, bis mich Carsten erzürnt anschnauzt: »Hör sofort auf! Hier zu fotografieren ist ja wohl das Allerallerletzte!«
Die Hausbootbewohner verrichten ihre alltäglichen Arbeiten, waschen Wäsche und Geschirr in der Kloake oder trocknen Fisch auf großen Plattformen am Ufer. Wenn wir diese Plattformen passieren, löst selbst Luftanhalten Brechreiz aus. Diejenigen unter uns, die am Vorabend der grottigen Essensempfehlung von Ry gefolgt waren, leiden besonders. Bei einer der Spezialitäten khmerscher Küche handelte es sich nämlich um Mangosalat mit getrocknetem Fisch. Eine Kombination, die man beim besten Willen nur mit viel Angkor-Bier herunterwürgen konnte. Nun riecht es so, wie es gestern schmeckte.
Endlich erreichen wir den Tonle Sap See. Die Luft wird frischer, die paar Boote am Ufer sehen relativ gepflegt aus. Es ist auch die Anlegestelle für die Schnellboote von und nach Phnom Penh. Ry hält uns Vorträge über irgendwelche Seeschlachten, die hier stattgefunden haben. Wir hören kaum zu. Erst Wochen später erfahre ich, dass die Attraktion des Tonle Sap Sees angeblich vom Aussterben bedrohte Süßwasserdelfine sind (vom Aussterben bedroht, weil der Kambodschaner gerne mit Dynamit fischt). Wir sehen jedenfalls keine. Das Boot fährt langsam zurück, auf eines der großen, bunt bemalten Hausboote zu, auf denen »Fishing Center« steht. Wir sehen Souvenirramsch blinken und verweigern Ry die Gefolgschaft. Verstört weist er unseren Bootsführer an, zurückzufahren. Auf halber Strecke, mitten im erschütterndsten Kloakensumpf, schlägt Ry dann vor, doch schon mal hier anzulegen, wir könnten ja gemütlich per pedes zum Bus bummeln. Wenn wir wollten. Er meint es ernst. Wir auch. Das Boot legt nicht an.
Auf der Busfahrt zurück nach Siem Reap halten wir noch mal kurz, um dem Mädchen, das seit einer Ewigkeit flehend neben dem Bus herrennt, ein paar Baht zuzustecken. Und wir formulieren in Gedanken schon mal den Brief an unseren Veranstalter: »Sehr geehrter Herr Meier, Sie sollten Ihre Weltreisen aus den Klauen des IVSR reißen und Ihre Prospekttexte nicht vom VLR schreiben lassen. Richten Sie lieber sinn- und wirkungsvolle Hilfsfonds ein, für die wir gerne spenden. Um uns reichen, verwöhnten, selbstmitleidigen Deutschen mal gehörig die Jammer-Perspektive zurechtzurücken, reicht schon das ganz normale Straßenleben in Siem Reap …«
Bevor uns das ganz normale Straßenleben in Siem Reap wieder hat, treibt uns Ry gnadenlos in das Handicraft-Center. Erneut vergebens. Keiner kauft was, obwohl das Center durchaus unterstützenswerte, unesco-geförderte Arbeit leistet, indem es junge Kambodschaner zu Kunsthandwerkern ausbildet. Die angebotenen Schnitzereien und Steinmetzarbeiten sind tatsächlich auf hohem Niveau, die Preise allerdings auch. Gerade überlege ich, ob ich einen der khmer-typischen, milde lächelnden Buddhaköpfe aus Holz erstehen soll. Doch noch bevor ich mich entscheiden kann, scheucht uns Ry schon wieder in den Bus. Schnell unseren Wunsch abhaken und den alten Markt Psah Chas besuchen.
Endlich. Hier finden wir letztlich alles, was unser Herz bisher vergeblich suchte und begehrte: Atmo, Kontakt zur Bevölkerung und jede Menge Asia-Ramsch. Wir scheißen auf die halbe Stunde Zeit und verzichten auf die gemeinsame Busfahrt zum Hotel. Ein Tuktuk wird uns rechtzeitig zurückbringen. Tuktuks, jene legendären zweisitzigen Rikschas, die ihren lautmalerischen Namen den röhrenden Mopedmotoren verdanken, mit denen sie durch die Straßen jagen, sind in Kambodscha die gängigste Form des öffentlichen Personennahverkehrs.
»Aber der Shuttle zum Flughafen geht pünktlich um zwölf«, kreischt die Schweizerin panisch und sieht sich schon wegen uns den Flieger verpassen.
»Ja und? Es ist noch nicht mal elf!« Wir verlassen unsere Pauschalfreunde und hetzen zum Shoppen, stinksauer darüber, dass man uns diesen Markt fast vorenthalten hätte. Mittlerweile ohne einen Dollar oder Baht in der Tasche. Angeblich, so wurde uns eingebläut, kann man nirgends mit Euro zahlen. Angeblich! Carsten ersteht endlich seine heiß ersehnte, riesengroße Vishnufigur aus Bronze, ich kralle mir einen Buddhakopf aus blaugeädertem Marmor. Natürlich nehmen die Händler mit Kusshand Euro. Okay, ich weiß mittlerweile, dass es eigentlich kein Buddhakopf ist, sondern das meditativ-entrückte Antlitz König Jayavarmans VII. (ca. 1125 bis 1219), das einem in Kambodscha wie eine Pop-Ikone überall friedfertig entgegenlächelt. Allein die Auffahrt zu unserem Hotel wird von vier überdimensionalen Jayavarmännern aus Beton geschmückt.
Selig schleppen wir unsere tonnenschweren Souvenirs zum nächsten Tuktuk. Ich begehe unterwegs den Fehler, mein letztes Kleingeld einer Bettlerin zu geben, schon sind wir von verzweifelten Dollah-Kreischern umgeben – zerfetzte Gliedmaßen, handlose Arme recken sich bittend nach vorne, augenlose Gesichter flennen. Uns bleibt nur, dem Tuktuk-Fahrer »Go! Go! Go!« zuzubrüllen.
Bangkok
Kaum aus Siem Reap in Bangkok gelandet, löst sich unsere kleine Gruppe auf. Einige fliegen gleich nach Deutschland weiter, andere machen einen Badeurlaub. Clara und Thomas werden ein wenig Laos erkunden. Und wir zwei bleiben noch zwei Tage in Bangkok, bevor wir nach Koh Samui fliegen. So viel also dazu, dass Pauschalreisen Herdenreisen sei.
Die Ausreise aus Siem Reap gestaltete sich im Gegensatz zur Einreise übrigens durchaus angenehm. Lächelnde Zöllner und freundliche Grenzbeamte machten den Abschied schwer. Große, blonde Männer wie Carsten schienen dabei einen besonderen Stein im Brett kambodschanischer Grenzer zu haben. Jeder buhlte darum, seinen tonnenschweren Vishnu zu schleppen. Ein Beamter versank gar öffentlich in Carstens blauen Augen und meinte mit verzücktem Lächeln: »Sir, you are an actor, right? Because you look so handsome!« (Worauf Carsten zum kichernden Teenie mutierte.)
Wann hört man so was am deutschen Zoll?
Da verkraftete ich es gerne, dass ein gewissenhafter Grenzer meine klitzekleine, zusammenklappbare Schere, die ich weiland in einem kleinen Chinesenladen in San Francisco erstanden hatte und seit Menschengedenken in meinem Filofax bei mir führe, als gefährliche Waffe einstufte und kurzerhand konfiszierend in seine Hosentasche steckte.
Alle Reiseführer warnen in fetten Blockbuchstaben: Aus Thailand dürfen keinerlei Buddhafiguren oder -teile ausgeführt werden. Verboten, verboten, verboten. Selbst am Bangkoker Flughafen weisen unübersehbare Tafeln darauf hin. Nun ist der Zöllner als solcher in den seltensten Fällen kunsthistorisch so firm, dass er einen kambodschanischen Vishnu von einem Buddha unterscheiden kann. Erfahrene Weltenbummler wissen, dass ein industriegeschnitztes Massenprodukt an der Grenze schnell zum identitätsstiftenden Heiligtum ganzer Nationen mit Ausfuhrverbot mutieren kann, wenn der diensthabende Zöllner dringend einen Kredit abzahlen muss. Also beschließt Carsten, Schmiergelder schon im Vorfeld zu umgehen und seinen Vishnu bei der Einreise in Bangkok anzugeben, damit wir bei der Heimreise nach Deutschland keine Schwierigkeiten bekommen. Die Zolldame in schmucker Uniform versteht sein Anliegen nicht und fragt ihren Kollegen. Ja, die Figur ist aus Bronze und auf antik getrimmt. Nein, kein Buddha, ein Vishnu. Wir packen sie auf Wunsch gerne aus. Der Zöllner winkt gelangweilt ab. Selbst wenn es ein aus einem Bangkoker Museum gestohlener Buddha sei, so sollten wir ihn ganz einfach im Gepäck verstecken. So bekämen wir auf gar keinen Fall Schwierigkeiten. Ich beherzige den Rat des Zöllners, nachdem ich mir am Abend in einem kleinen Laden an der Silom Road einen antiken Alabaster-Buddha aus Burma zu einem Schnäppchenpreis erhandelt habe. Das tonnenschwere Prachtstück kommt zwischen die Schmutzwäsche in den Koffer. Zwar klärt uns eine Antiquitätenhändlerin im Gegensatz zu den Reiseführern dann definitiv auf: Ausschließlich antike Buddhas im Thaistil dürfen nicht oder nur mit ministerieller Genehmigung ausgeführt werden; burmesische oder laotische Buddhas, die sich stilistisch erheblich von den thailändischen unterscheiden und momentan den Markt ebenso überschwemmen wie billige Repliken, können hingegen en masse in alle Welt mitgeschleppt werden. Doch sicher ist sicher, mein Buddha bleibt im Koffer.
Ganz nebenbei erfahren wir, dass wir das Glück hatten, mit dem letzten Flieger aus Kambodscha rausgekommen zu sein, bevor wegen gewalttätiger Unruhen die Grenzen für mehrere Tage dichtgemacht wurden. Eine thailändische Schauspielerin hatte angeblich gesagt, dass Angkor eigentlich zu Thailand gehören würde und von den Khmer geraubt worden sei. Wie diese Äußerung zeigt, haben Soap-Stars in aller Welt offenbar den gleichen IQ, das hinderte die armen Khmer aber nicht daran, völlig auszuflippen. Man fackelte kurzerhand die Thai-Botschaft in Phnom Penh ab, plünderte schnell noch einige Hotels, die Thais gehören, und zerstörte Tankstellen der Thai-Benzin-Kette PTT.
Die Unruhen beherrschen tagelang die Medien. Eine Sondersendung jagt die andere. Offenbar nur in Thailand. Denn noch bevor wir überlegen, ob wir Stern oder Focus die Exklusivrechte für unsere Story verkloppen sollen, rufen wir schnell per Kreditkartentelefon zu Hause an, um Entwarnung zu geben (»Ja, wir haben es eben noch irgendwie geschafft! Puh, fragt nicht! Hölle! Jaja, wir leben, macht euch keine Sorgen! Gott, irgendwie muss es ja weitergehen, gell?!«), und stoßen auf absolute Informationsdefizite (»Wieso Sorgen? War was? Nö, hamma nix von gehört.«).
Die zwei Tage in Bangkok nutzen wir zum Powershoppen kombiniert mit Extrem-Sightseeing. Der kluge Weltreisende achtet von jeher besonders in tropischen Ländern auf gepflegte Kleidung (ich habe z. B. noch nie so viele gut und bis in die Haarspitzen korrekt gekleidete Menschen auf einem Haufen gesehen – Damen im eleganten Kostüm, Herren mit Anzug, Weste und Schlips – wie in den Geschäftsstraßen von Nairobi). Kurze Hosen trägt der Mann von Welt, wenn überhaupt, ausschließlich zu Hause auf dem Balkon oder am Strand. Sandalen kommen nur dann an den Herrenfuß, wenn selbiger sockenlos und perfekt pedikürt ist (und wenn das Schuhwerk nicht aus dem Hause Birkenstock kommt). Buntschreiende Unterhemden verbieten sich generell von selbst. Über nackte Oberkörper in der Öffentlichkeit braucht man gar nicht erst reden. Denkt man zumindest.
Heilfroh, in einem Land zu sein, in dem Menschen in Shorts und Tanktops einfach der Zutritt zu allen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Hotels verwehrt wird, schlendern wir triumphierend an halb nackten, stachelbeinigen Kiddies und Fetties vorbei, die sich Hosen und Tücher leihen müssen, um in den Königspalast zu gelangen. Wat Phra Kaeo und der Große Palast erschlagen einen jedes Mal wieder mit ihrer Pracht und Herrlichkeit in Ewigkeit. Doch jetzt erst können wir das im Palastgelände en miniature nachgebaute Angkor Wat wirklich schätzen.
Und da wir schon mal in der Gegend sind, bummeln wir noch ein wenig durch eine riesige, öde Karstfläche – den Sanam Luang, einen der raren Stadtparks in Bangkok, der von leidenden Bäumen gesäumt ist, auf denen düstere Taubenschwärme à la Hitchcock lauern. Wir sind auf dem Weg zu einer Sehenswürdigkeit der anderen Art, dem Mekka der Individualreisenden: Khaosan Road. Hier treffen sich Backpacker und Billigreisende aus aller Welt, um sich gegenseitig ganz individuell mit Piercings und Tattoos zu übertrumpfen. Ein Guesthouse reiht sich ans andere, keines sieht auch nur annähernd vertrauenserweckend aus. Aus den unzähligen Kneipen brüllt Musik jeglicher Stilrichtungen, damit man sich garantiert nicht unterhalten muss, über den Bars hängen Riesenmonitore, auf denen irgendwelche Hollywoodergüsse laufen, damit man sich nicht anschauen muss. Hier erleben wir auch, wen wunderts, das allererste Mal in all den Jahren Thailand die einzige wirklich pampige Kellnerin. Hier kann man auch für einen Appel und ein Ei einen Ausflug nach Angkor buchen – per Linienbus. Dafür dauert die Fahrt über unwegsame Schlammpisten circa einhundert Stunden, und wenn man sehr viel Glück hat, wird man auch nicht überfallen. Die Khaosan ist wie Patpong oder Teile der Sukhumvit gesäumt von T-Shirt-, CD-, Uhren- und Staubfänger-Buden. Die in allen Reiseführern beschriebenen falschen Lacoste-Hemden sucht man allerdings meist vergebens. La… was? Die Marke ist ja sowas von total 1990er. Die Fälscher sind am Puls der Zeit, die Trends werden hier auf der Straße gemacht. Die Saison 2003 gehört alleine Diesel – ob Tasche, Hose, Brille, Schuhe, Uhr oder Hemdchen, Hauptsache es steht fett und breit der Name der italienischen Jeansmarke drauf.
Hier tummeln sie sich also in Rudeln, die Individualreisenden. Hier suchen sie Kontakt zur Bevölkerung (»Okay, und was kosten zwei Gramm?«). Hier drücken sie kollektiv ihre Individualität aus, indem sie alle irgendwie echt total relaxed und peacig drauf sind, sich in dem Land mit einer der besten Küchen der Welt doch lieber mainstreamig Junkfood amerikanischer Ketten reinziehen, gefakte Diesel- oder echte Chang-Bier-Shirts tragen, sich Dreadlocks flechten lassen, schlechte Drogen zu schlechter Musik reinpfeifen, importiertes Heineken statt einheimisches Singha trinken und dabei über Neckermänner ablästern. Irgendwie drängen sich Ballermann-6-Bilder auf. Jeder Generation von Spießern ihr Getto. Bloß nicht ausbrechen aus dieser Individualität.
Bangkok hat sich verändert, seit ich das erste Mal vor etwa zehn Jahren (also Anfang der 1990er) da war. War ja zu erwarten.
Damals gab es zum Beispiel an der Silom noch ein paar herrlich alte Holzhäuser im traditionellen Thaistil. Heute findet sich an der Straße kein Haus, das nicht mindestens 20 Glas-Marmor-Chrom-vertäfelte Stockwerke hat.
Damals gab es jede Menge zerbeulte Rostlauben, wilde Tuktuk-Herden und eine unübersehbare Armada von Mopeds, die für permanentes Verkehrschaos sorgten. Heute gibt es nur noch vergleichsweise wenige Mopeds, und die Autos, meist Japaner oder Koreaner, aber auch erstaunlich viele deutsche Luxusmarken, sind ausnahmslos die neuesten Modelle. Tuktuks, die ein Fahrgefühl zwischen Achterbahn und Wilder Maus vermitteln (mein Tipp: Mal bei heftigem Tropengewitter ausprobieren – das fetzt!), scheinen langsam sogar vom Aussterben bedroht zu sein. Das Verkehrschaos hat sich hingegen nicht geändert. Trotz mehrstöckiger Straßen und dem spacigen Skytrain, der nagelneuen Schnellbahn, die hoch über all den Straßenstockwerken fährt. Hier noch ein kleiner Tipp für unerfahrene Skytrain-Benutzer: Wintermantel mitnehmen! Die Klimaanlage ist auf Pinguin-Wohlfühl-Temperatur eingestellt.
Damals gab es auch penetrante Schlepper, die einen an der Straße ansprachen und sich als Fernsehstars, Doktoren oder Hotelangestellte ausgaben. Sie erzählten dir erst was vom Wetter, dann was vom Wolf, und schließlich, dass genau dieser Tag ein Feiertag sei, Jubel Trubel, der einzige Feiertag im Jahr, an dem man keine Mehrwertsteuer zahlen müsse, weil der König das so beschlossen habe! Und dass man deshalb: a) den Boden küssen möge vor Glück, dass man sie getroffen hat und b) sofort Schmuck und Stoffe en gros kaufen müsse. Natürlich in dem weit außerhalb der Stadt gelegenem »Lapidary« ohne Fluchtmöglichkeit, zu dem sie uns per Tuktuk verschleppten. Andere arbeiteten mit der »Closed«-Methode. Sie lauerten vor Wat Pho oder dem Königspalast und behaupteten, die Sehenswürdigkeit sei geschlossen, da bliebe nur Klunkerkaufen. Nun, diese Schlepper gibt es immer noch. Heute macht es aber Spaß, sie erst auf Hochtouren kommen und dann eiskalt abblitzen zu lassen.
Damals nervte die Reisescheckumtauschkiste. Heute reicht eine Kreditkarte, und wenn man Bargeld braucht, findet man an fast jeder Straßenecke einen internationalen Geldautomaten. Schnell die EC-Karte rein und noch ein paar Hundert Baht abgehoben, weil auf Patpong die tollen Fakes gekauft werden müssen. Taschen, Uhren und vor allem T-Shirts. Ja, ich gebe zu: Auch wir kaufen falsche Diesel- und echte Chang-Bier-Shirts. Gelobt seien die Fortschritte des internationalen Bankwesens.
Damals gab es an fast jeder Straßenecke mobile Verkaufseinheiten, die ganz besondere Spezialitäten der asiatischen Küche feilboten: Kakerlaken, Maden, Käfer, Grillen, Skorpione, Heuschrecken und komplette Jungvögel – alles frisch frittiert. Vor ein paar Jahren hatte ich mir geschworen, dass ich, wenn ich jemals wieder nach Bangkok kommen sollte, mir irgendwas davon reinziehen werde. Heute ist es ein schier aussichtsloses Unterfangen, diese Spezialitätenhändler noch zu finden. Aber wir haben letztlich Glück. Schräg gegenüber dem Hotel bietet nächtens eine Dame alles oben Erwähnte an. Wir wählen knusprige Heuschrecken frites to go an leichtem Sojadressing. Ja, es kostet Überwindung. Nein, sie schmecken nicht eklig. Einfach salzig und knusprig. Man muss nur den Kopf ausschalten und eine Flasche Wasser bereitstehen haben, schon flutschts. Apropos Kopf: Den Schreckenkopf haben wir vor Verzehr abgetrennt, das hatte uns die Verkäuferin empfohlen.
Damals tat auch ein verwöhnter, milliardenschwerer saudischer Ex-Playboy namens Osama bin Laden die ersten Schritte in seinem neuen Metier. Stopp. Einschub. Hierzu eine kleine Geschichte am Rande: Die saudische Form des Islam nennt sich Wahhabismus. Im Jahr 2002 brannte eine Mädchenschule in Mekka, Saudi-Arabien. An sich schon eine Sensation, denn für strenge Wahhabiten sind Schulen für Mädchen ein Frevel. Fünfzehn Schülerinnen starben aus dem einzigen Grund, weil sie in der Panik verständlicherweise ihre Schleier nicht fanden. Die Religionspolizei hatte den Mädchen die Flucht verweigert, sie durften unverschleiert nicht auf die Straße. Nach wahhabitischer Denkungsart werden Frauen, so sie keinen Schleier tragen, sofort vergewaltigt. Letztlich natürlich ein erschütterndes Armutszeugnis für die Männer. Philosophisch-moralisch derart gerüstet und zudem von den USA in jeder denkbaren Tötungsdisziplin ausgebildet, rutscht ein labiler Geist leicht ab. Deshalb hat nun das Auswärtige Amt allen Grund, vor Thailand-Reisen wegen akuter Terrorgefahr zu warnen. Thailand gilt als »weiches« Ziel. Nun vergällt Osama bin Laden selbst das Shoppen, weil nicht wenige Händler Fanartikel für Hirnamputierte im Angebot haben: T-Shirts mit seinem Konterfei. Gelegentlich finden sich Hemdchen mit Osama und dem US-Präsidenten George Dabbeljuh – »Twin Terrorists« steht berechtigterweise darunter. (Ach, Schorsch-Dabbeljuh, denkt man sich Jahre später. Das waren noch Zeiten. Wer hätte damals gedacht, dass nach dem grenzdebilen »fascist groove thang« Ronald Reagan und dem bodenlos dummen Schorsch-Dabbeljuh noch unsäglichere Personen wie z. B. Donald »the orange clown« Trump das Amt des US-Präsidenten bekleiden werden.)
Damals stolperte man an jeder Straßenecke über sabbernde, käsige Quallen kurz vor der Verwesung, die wie ekelerregender Aussatz an blutjungen Thaimädchen oder -jungs klebten. Hier hat sich leider immer noch nichts geändert. Sextouristen gibt es besonders auf Patpong wie Sand am Meer. Das riesige Amüsierareal Patpong im Herzen Bangkoks besteht aus ein paar Gassen, die von der Silom Road abgehen, in denen sich Kneipen mit Peep-, Strip- und Fickshows aneinanderreihen. Anreißer versuchen jeden Mann in ihr Lokal zu zerren und halten jedem Zettel unter die Nase, die die Besonderheiten der Show ankündigen. Die Nummer mit der genitalen Pingpong-Ball-Jonglage hat jede Sexshowmaus im Programm. Da bei den meisten Läden die Tür weit offen steht, kann man die Damen begutachten, wie sie lustlos und mit ausdruckslosen, stark geschminkten Gesichtern an den Stangen auf dem Tresen tanzen. Wie man(n) angesichts der Erbärmlichkeit da noch einen hoch kriegen kann, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Fängt eine Thekenkraft den Blick des Flaneurs, beginnt sofort das klassische »Hello, hello, Mister!«-Rufen. Jenes Rufen, das jedem Mann, der nicht in Begleitung einer Frau an einer der offenen Bars vorbeigeht, überall in Thailand hinterherschallt, egal, ob in Patpong, auf Phuket oder Koh Samui. Männer, echt jetzt, macht euch das geil?
Viele Kneipen haben ein paar Tische draußen an der Straße stehen, da kann man gepflegt ein kühles Bier zischen und das bunte Treiben in der Gassenmitte beobachten: Dort tobt Thailands bekanntester Nachtmarkt, der sich am Wochenende krakenartig sogar die ganze Silom Road hinunter ausbreitet. Touristen drängen sich dicht an dicht, grabschen hier nach einem T-Shirt und zerren dort ein anderes hervor. Eifrig beobachtet von den Verkäuferinnen, die jede Bewegung des potenziellen Kunden mit ihrem schwer verständlichen Englisch-Singsang kommentieren. Egal, wie groß der Kunde ist, es ist immer »Won saih! Won saih!« (»One size«). Von überall tönt der längst zum Klassiker gewordene Ausruf: »Same same! But different.« Mittlerweile gibt es T-Shirts mit dem Spruch. Übrigens können sich auch Frauen problem- und gefahrlos in der Sündenmeile Patpong bewegen. Sie stürzen sich mit Verve auf alles, was nachgemacht ist – von der Handtasche bis zum Polohemd. Dabei sollten sie ihre Männer nicht aus den Augen lassen, die verstohlen in die Sex-Läden schielen und auf ein noch billigeres Amüsement als ihre Gattinnen aus sind.
Um mitreden zu können, habe ich einmal vor Jahren eine Live-Sex-Show in Bangkok besucht. Damals mit dem Lufthanseaten Carlo. Eine Stewardess hatte uns einen Club empfohlen, in dem es angeblich eine gute Gay-Show gäbe. Sie selbst hätte schon mehrere gesehen, und diese sei die beste gewesen. Stewardessen scheinen ein ausgesprochenes Faible für schwule Sex-Shows zu haben, denn als wir in dem Laden ankamen, trafen wir auf einen gackernden Haufen Saftschubsen beiderlei Geschlechts. Eine halbe Lufthansacrew lümmelte in den schmuddeligen Sitzen. Der Laden lag im ersten Stock eines unscheinbaren Hauses in einer Seitengasse der Silom, schräg gegenüber einer angesagten Disco, vor der aufgetakelte Nachtfalken jederlei Geschlechts in der Schlange warteten, Einlass zu finden. Carlo und ich bestellten Bier und dann ging schon die Show los. Fünfzehn magere Thaiboys tummelten sich in weißer Feinripp-Unterwäsche mit Eingriff auf der Bühne. Sie wiegten sich ein wenig zu dröhnenden Discoklängen und zogen die Unterhemden aus. Dann spielten sie ein wenig an sich herum und entledigten sich der Unterhosen. Die Stehfreudigeren mussten in den vorderen Reihen herumhopsen. In den hinteren Reihen kämpfte manch einer sichtbar damit, eine anständige Erektion hinzubekommen. Wir durften die nächsten Minuten den Burschen beim Onanieren zusehen. Einer kam sogar. Dann wurde es dunkel, die Wichser schlichen von dannen. Licht an: Ein muskulöser, erstaunlich männlicher Thai und ein magerer Bursche strippten und schraubten aneinander herum. Als beide endlich einen vorzeigbaren Ständer hatten, zog der Bursche dem Kerl einen Pariser drüber (immerhin!) und ließ sich in Folge in jeder erdenklichen Position nageln. Eine nicht sehr stimulierende, aber augenscheinlich kraftraubende Rammelei zog sich vom einen Bühnenende zum anderen hin. Akrobatik pur, der Kerl balancierte den Burschen in Positionen, die Equilibristen vor Neid erblassen lassen würden. Mit Höschen hätte man die Nummer beim Zirkusfestival in Monte Carlo laufen lassen können. Längst hatte der Kerl keinen Ständer mehr, wie wir aus unserem Blickwinkel bemerkten, doch er pumpte professionell weiter und der Bursche fakte schließlich einen Top-Orgasmus. Nun stürmten wieder die fünfzehn Burschen die Bühne. Diesmal trugen sie Unterhosen, an denen ein Zettel mit einer Zahl befestigt war. Sie tanzten eine Weile, und wir hätten uns unsere Wunschzahl aussuchen können, diese bei der Bedienung bestellen und dann ins Separée folgen können. Wir verzichteten dankend. Animierend ist etwas anderes als Elend ausbeuten.
Koh Samui
Doch auch auf unserer nächsten Station Koh Samui stolpern wir über sie, die hemmungslosen Sex-Touris, obwohl die Insel als Paradies der letzten Hippies und Aussteiger und als Musterbeispiel für sanften Tourismus gilt. Aber selbst Hippies wollen poppen.
r Kassiererin im Supermarkt Beifall zu spenden, wenn sie nach erfolgreichem Hacken auf der Kassentastatur »Macht dann zwölfachtundsechzig« plärrt. Oder der Jeansverkäuferin fürs »Ne, die hamma net in deiner Größe! Brauch ich gar net erst nachschauen!«-Sagen. Oder dem Piloten fürs katastrophenfreie Landen. Doch schließlich applaudieren meine pauschalreisenden Landsleute ja mit Begeisterung geistigen Tieffliegern, die die kulturelle Latte wöchentlich tiefer legen, indem sie absolut talentfrei mit akustischer Luftverpestung die Charts stürmen und dann auch noch bar jeder Sprachbegabung mit ihren als bedrucktes Klopapier in Buchform gebrachten »Lebenserinnerungen« die Bestsellerlisten anführen. Dafür muss man einen neuen Begriff einführen: Bohlen, als Steigerung von peinlich, schlimmer gehts nimmer. Und dann wird mir klar: Damals, Anfang der 1980er-Jahre, wurde die schlimmste aller denkbaren Langzeitbomben gezündet, die sich auf Englisch »Modernes Geschwätz« nannte. So kann man Kultur ebenfalls schlachten, vernichten, ausradieren. Stehen am Ende gar die Taliban dahinter? Werden sie also doch auf die weiche Art siegen, oder …
Als kleines Zeichen des kulturellen Werteerhalts setze ich mich demonstrativ auf meine Hände, als wir uns im Landeanflug auf München befinden. Wollen wir doch mal sehen! Die Maschine setzt auf, butterweich, der Flieger bleibt still. Draußen hat es minus 4 Grad, der Himmel ist bleiern grau, ein Hauch Schnee bedeckt die Landschaft. Die Motoren drosseln ihre Leistung, das Flugzeug rollt langsam aus, kein Applaus. Wo sind wir denn?! Ich habe mich so darauf gefreut, kopfschüttelnd die Augen zu verdrehen und meine klatschenden Nachbarn mit vernichtendem Blicken zum Verstummen zu bringen. Vielleicht sollte ich mich ein wenig als Agent Provocateur betätigen, und die Vorgabe machen? Da – der Flieger steht fast, endlich führen zwei oder drei Pauschalisten frenetisch patschend ihre Handflächen zusammen. Niemand steigt darauf ein. Nun fällt mir auch ein, dass bereits auf dem Hinflug bei der Landung in Bangkok kein Mensch geklatscht hatte. Die Klatscher verstummen, noch bevor sie richtig losgelegt haben. Schade, wo ich so gerne vernichtend um mich blicke. Pauschalreisen sind halt einfach nicht mehr das, was sie einmal waren …
PS, ein paar Monate später: Wie man eine uralte Kultur nachhaltig plättet und ausbluten lässt, haben kurz nach unserem Urlaub unsere amerikanischen Freunde demonstriert, als sie den Irak überfielen und neben vielen anderen berichtenswerten Aktionen auch Panzer dafür abstellten, Bagdads Museen mit jahrtausendealten Artefakten zu bewachen – zu bewachen, damit Plünderer (nicht selten GIs) ungehindert kostbare Kunstwerke aus der Frühzeit jeglicher menschlicher Kultur aus den Museen rauben und in Amerika verhökern konnten. So funktioniert das.
PS, beim Überarbeiten 2019: Damals, 2003, war Kambodscha noch touristisches Entwicklungsland. Wir hatten das Glück, Angkor noch verhältnismäßig leer zu erleben. Wir konnten in den verwunschenen Tempeln noch Fotos nur von uns machen. Heute, so heißt es, gehört Angkor zu den vom Übertourismus bedrohten Zielen, die man sich getrost sparen kann. Spart es euch auf gar keinen Fall, wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt. Es ist über-gorgeos bzw. über-awesome. Meine Heimatstadt München zählt ja ebenfalls zu den vom Übertourismus schwerst gebeutelten Orten – und ist trotzdem weiterhin eine sensationell tolle Stadt, die jeden Besuch wert ist.
2 Beim Terroranschlag am 28. November 2002 auf ein Hotel in Mombasa wurden 16 Menschen getötet und 80 verletzt. Gleichzeitig wurde versucht, ein israelisches Passagierflugzeug mit Strela-2-Raketen abzuschießen.
1 Beim Anschlag vom 12. Oktober 2002 wurden in der Stadt Kuta durch muslimische Extremisten 202 Menschen getötet und 209 verletzt.