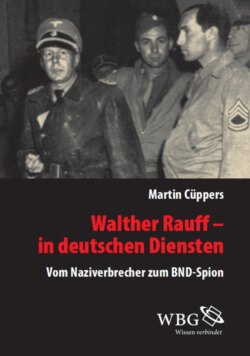Читать книгу Walther Rauff – In deutschen Diensten - Martin Cüppers - Страница 12
2. Die Karriere auf See Offizier in der Reichsmarine
ОглавлениеZusammen mit annähernd 100 jungen Männern betrat der Magdeburger Abiturient am Vormittag des 26. März 1924 die Marineschule in Kiel, um sich dort den Aufnahmeprüfungen zum Seekadettenanwärter der Reichsmarine zu stellen. Finster dreinblickende Unteroffiziere empfingen den zusammengewürfelten Haufen, den der gemeinsame Wille einte, eine Perspektive in der noch jungen Marine der Republik zu suchen. Ab jenem Mittwochmorgen war die restliche Woche für Rauff und die übrigen Bewerber mit verschiedensten ärztlichen Untersuchungen und Eignungstests ausgefüllt. Es folgten sportliche Prüfungen, die sich mit schriftlichen Arbeiten sowie dem Ausfüllen von Fragebögen und Formularen abwechselten.1 Abgesehen von dem Prüfungs- und Ausleseverfahren wurden den jungen Männern immerhin auch Ausflüge in den Marinehafen und die Besichtigung mehrerer Schiffe geboten. So bekamen die angehenden Kadetten in einer für sie zweifellos beeindruckenden Weise bereits einen Vorgeschmack auf das spätere Leben auf See vermittelt.2
Als Rauff in jenen Tagen an der Kieler Förde mit Blick auf die Kriegsschiffe Seeluft schnupperte, wird er bei allen neuen Eindrücken auch eine intensive Verbindung zu seiner Familie empfunden haben. Wahrscheinlich dachte er auch daran, wie der Vater, der ja selbst seinerzeit gerne eine Karriere bei der Kaiserlichen Marine angestrebt hätte, ihn ermutigt hatte, den Berufswunsch zu realisieren. Auch dem älteren Bruder Ernst-August muss Rauff sich irgendwie verbunden gefühlt haben. Immerhin war der vor acht Jahren zur Marineinfanterie gegangen, hatte im Krieg gekämpft und musste jetzt noch zu Hause unter den Spätfolgen seiner schweren Verwundung leiden. Einen großen Ausschlag für seine letztliche Entscheidung, zur Marine zu gehen, hatte aber nicht zuletzt auch die Schwester Ilse gegeben.
Erst durch sie war er in Kontakt mit Personen gekommen, die sein Bild von der Marine maßgeblich prägen sollten und die ihm persönlich so imponierten, dass der Entschluss, einen entsprechenden Lebensweg einzuschlagen, immer konkretere Konturen angenommen hatte. Ilse Rauff hatte in den frühen 1920er Jahren einen Mann kennengelernt, dessen ganze Familie eng mit der früheren kaiserlichen Kriegsmarine verbunden war und von der einzelne Offiziere auch jetzt noch in der Reichsmarine der Republik dienten. Dr. Wullf Hugo Emsmann, den Ilse im März 1924 kurz vor Rauffs Bewerbungsreise nach Kiel geheiratet hatte, war als aktiver Offizier in der Reichsmarine tätig und hatte schon am Weltkrieg als Freiwilliger dieser Waffengattung teilgenommen.3 Dessen Bruder Hans-Joachim, Oberleutnant zur See, führte während des Krieges als Kommandant verschiedener Unterseeboote zahlreiche Einsätze an. Nachdem er dabei insgesamt 26 feindliche Schiffe versenkt hatte, lief er noch in den letzten Kriegstagen mit dem Unterseeboot „SM U 116“ den britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow an, um dort vor Anker liegende Kriegsschiffe zu torpedieren. Der Angriff scheiterte, „U 116“ wurde von wachsamen Einheiten der „Grand Fleet“ entdeckt und am 28. Oktober versenkt, wobei die gesamte Crew mit Oberleutnant Emsmann starb. Diese Versenkung stellte zugleich den letzten Verlust eines deutschen U-Bootes im Ersten Weltkrieg dar. Zur heroisierenden Erinnerung an das sinnlose Opfer gab es auf Helgoland zwischen 1938 und 1947 eigens eine Emsmannstraße.4
Gerta, die Schwester der beiden Marineoffiziere, hatte den Oberleutnant zur See Robert Ramm geheiratet. Er starb als Kommandant des kaiserlichen U-Bootes „SM U 123“ neun Tage vor seinem Schwager am 19. Oktober 1918 mit seiner gesamten Crew in der Nordsee, nachdem das Tauchboot vermutlich auf eine Mine gelaufen war.5 In zweiter Ehe heiratete Gerta Emsmann wieder einen Marineoffizier, Erich Förste. Der Oberleutnant zur See war im Weltkrieg Kommandant der Unterseeboote „U 34“ und „U 99“ gewesen, hatte diese Kommandos überlebt und sich 1919 dem auch als 3. Marine-Brigade bezeichneten Freikorps unter Wilfried von Loewenfeld angeschlossen. Nach der Übernahme in die Reichswehr war Förste in den Jahren 1922 bis 1925 das Kommando über verschiedene Torpedoboote übertragen worden.6
Dass Wulff Hugo und Hans-Joachim Emsmann jeweils für sich eine Laufbahn bei der Kriegsmarine wählten und die Schwester Gerta nacheinander mit zwei Offizieren dieser Waffengattung verheiratet war, belegt seinerseits wiederum den prägenden Einfluss des Vaters. Hugo Emsmann war selbst ein prominenter Seeoffizier der Kaiserlichen Marine gewesen. Er hatte das Kommando über verschiedene Schiffe innegehabt, war in den Jahren 1906 bis 1909 Kommandant auf Helgoland gewesen, im Laufe seiner Marinekarriere bis zum Konteradmiral aufgestiegen und hatte es schließlich bis zum Abgeordneten im Reichstag gebracht.7 Sein wohl bekanntestes Kommando führte ihn als Ersten Offizier auf das Kanonenboot „Eber“ und ab November 1887 mit dem Kriegsschiff in die Südsee. Nachdem der Kapitän im folgenden Sommer im Hafen von Apia auf Samoa das Kommando über „Eber“ krankheitsbedingt an den Leutnant zur See Emsmann abgegeben hatte, führte der das Schiff in der Folge auf einer monatelangen Fahrt durch den Pazifik. Dabei ließ Emsmann am 2. Oktober 1888 die deutsche Kriegsflagge auf der Insel Nauru im Westpazifik hissen und nahm im Rahmen dieser Zeremonie das Eiland offiziell in Besitz des deutschen Kaiserreichs. Gleichzeitig wurden, Exempel für das koloniale Gebahren des Deutschen Reiches, Führer der Einheimischen als Geiseln genommen und im Gebäude eines deutschen Händlers festgehalten, um die Inselbewohner zu entwaffnen. Widerstand gegen die neue Kolonialmacht sollte so weitgehend unterbunden werden. Nachdem innerhalb von drei Tagen etwa 700 Gewehre abgeliefert worden waren, wurden die Würdenträger schließlich freigelassen und „Eber“ verließ Nauru. Nach Samoa zurückgekehrt, übergab Emsmann das Kommando des Kanonenbootes an einen neu eingetroffenen Kapitän, während der Leutnant zum Navigationsoffizier auf der kaiserlichen Kreuzerkorvette „Olga“ bestimmt wurde. Für den jungen Offizier sollte sich das noch als Glücksfall erweisen. Kaum vier Monate später sank „Eber“ während eines Taifuns im Hafen von Apia, ein Großteil der Besatzung kam dabei ums Leben. Dagegen überstand „Olga“ den Tropensturm ohne größere Schäden und brachte Emsmann einige Zeit später sicher wieder nach Deutschland zurück.8
Angesichts all dieser beeindruckenden Beispiele gelebter Marinetradition, die Walther Rauff alle bewusst gewesen sein dürften, kann es kaum verwundern, dass der noch nicht einmal 18-jährige die Familie des Schwagers zum Vorbild nahm und darin Orientierung und eine Lebensperspektive für sich selbst suchte. Zwar ist an keiner Stelle seiner späteren Marinelaufbahn nachweisbar, dass er von seiner Verbindung zur Familie Emsmann beruflich profitierte, von Nachteil wird die Verwandtschaft jedoch sicherlich nicht gewesen sein. Von der Erziehung im konservativen Elternhaus geprägt und wie viele andere Jungen schon früh fasziniert von der Welt der Seefahrt, suchte Rauff damit Anschluss an eine Institution, die wohl am weitestgehenden die Tradition des untergegangenen Kaiserreiches konservierte und allein qua Präsenz von alter imperialer Größe zeugte. Dass Rauff seine Berufswahl gerade auf diese Institution gründete, wirft ein zusätzliches Schlaglicht auf den Umstand, wie stark die Bestürzung über die Kriegsniederlage in der Familie noch immer nachwirkte und wie wenig die neue politische Ordnung der jungen Weimarer Demokratie es in den vergangenen fünf Jahren vermocht hatte, bei dem Heranwachsenden eine republikanische, weniger rückwärtsgewandte Orientierung zu schaffen. Von der starken Bindung an Elternhaus und Verwandtschaft geprägt, zeigte sich der junge Mann nicht fähig, für sich eine autonome Perspektive zu entwickeln. Vielmehr orientierte er sich am vorgelebten Wertekanon und suchte nach Autoritäten, die Sicherheit und eine gewisse Kontinuität zu seinem bisherigen Erlebnishorizont versprachen. Für Rauff schien die deutsche Marine trotz aller jüngsten Verwerfungen fähig, ein solches Versprechen einzulösen.
Sechs Jahre nach dem Ende des Weltkriegs hatte sich die demokratische Ordnung in Deutschland wenig gefestigt. Verbreitet wurden noch immer sowohl die Verantwortung am Ausbruch des Krieges als auch die Schuld an der Niederlage mit allerlei Mythen abgewehrt. Die in direkter Konsequenz entstandene Republik provozierte seitens nationalistischer und rechtsradikaler Kräften vehemente Ablehnung und wurde ebenso erbittert auch von links bekämpft. Das erklärte Credo großer Teile der erwachsen werdenden, so genannten Kriegsjugendgeneration war es, die Republik abzulehnen, still oder offen zu rebellieren und sich entweder neuen, radikalen Ideen zu verschreiben oder nach Inseln der alten, untergegangenen Ordnung zu suchen, die noch eine traditionelle Wertevermittlung versprachen.9 Dem jungen Rauff wird zwar wie vielen seiner Altersgenossen eine rechtsextreme Orientierung nicht unbedingt ferngelegen haben, bei ihm fehlen jedoch jegliche Hinweise auf eine frühe politische Organisierung. Im Gegensatz zu zahlreichen Gleichaltrigen verschrieb er sich keiner extremistischen Grupperung und richtete seinen weiteren Werdegang nicht dementsprechend aus. Vielmehr bot ihm die in der eigenen Familie gelebte Marinetradition Verheißung genug für eine perspektivreiche Orientierung. Die Tradition sowie die personelle Führung der Marine versprachen doch immerhin, maßgebliche Wertvorstellungen der alten, untergegangenen Ordnung zu tradieren und sich so ebenfalls gegen die neue, demokratische Ordnung zu positionieren. Damit fällt die Berufswahl Rauffs zwar deutlich anders aus, als die vieler Gleichaltriger seiner Generation, die einen radikaleren Weg wählten. Politisch kann dessen Entscheidung dennoch gedeutet werden, denn sie orientiert sich am Ideal der untergegangenen Ordnung und fällt deswegen trotz der Entscheidung für die Laufbahn bei einer Institution der Republik tendenziell antirepublikanisch aus.
Ganz verbreitet galten die Seestreitkräfte als Hort der Werte des untergegangenen Reiches. Früher Beleg dafür war nicht zuletzt der Versuch der Marineleitung, mit dem Befehl zum Auslaufen der Flotte im Herbst 1918 die unabänderliche Niederlage nicht wahrhaben zu wollen und stattdessen mit einer selbstmörderischen Verzweiflungstat den ehrenvollen Ruf der Marine für die Zukunft zu bewahren. Dass eben dieser Befehl zum sinnlosen Tod dann ausgerechnet Auslöser der Revolution in Deutschland wurde, legte einen Makel auf das Ansehen der Marine, der in den Augen Nationalgesinnter einen Neustart erheblich belasten musste.10 Doch das Fanal der revolutionären Matrosen auf den Großkampfschiffen in Wilhelmshaven und Kiel wurde bald schon von einem neuen Mythos abgelöst, der die Marine wieder in das Fahrwasser nationaler Symbolik zurückbrachte. Nachdem das Gros der Kriegsschiffe 1919 im britischen Flottenstützpunkt in der Bucht von Scapa Flow interniert worden war, gab dort der Flottenchef Konteradmiral Ludwig von Reuter nach entsprechender Ermutigung durch den deutschen Marinechef, Vizeadmiral von Trotha, am 21. Juni den Befehl zur Selbstversenkung. Durch Öffnen der Seeventile sanken in den folgenden Stunden 59 Schiffe der Hochseeflotte auf den Grund der Bucht, darunter fünf Schlachtkreuzer und neun Linienschiffe.11
Nach dem Übergang zur republikanischen Ordnung lagen die größten Probleme der Reichsmarine zweifellos darin begründet, dass sich weite Teile des Offizierskorps eben nicht mit den Bestimmungen von Versailles oder mit der nunmehr demokratischen Identität des eigenen Truppenteils abfinden wollten. Dieses gefährliche Spannungsverhältnis offenbarte sich im März 1920 während des so genannten Kapp-Lüttwitz-Putsches, als auch hohe Marineoffiziere den letztlich gescheiterten Staatsstreich unterstützten.12 Im Zuge der „Lohmann-Affäre“ wurde Jahre später ein geheimes Aufrüstungsprogramm publik, dessen Aufdeckung erneut bewies, wie sich innerhalb der Reichsmarine eine zutiefst antidemokratische Struktur konserviert hatte, deren Anhänger die Republik radikal ablehnten. Eben diese radikalen Kräfte waren aber auch entscheidend dafür verantwortlich, dass die Reichsmarine herbe Ansehensverluste in der Gesellschaft hinnehmen musste.13
Dem jungen Rauff war zweifellos bewusst, dass die Marine der Weimarer Republik sich entscheidend von ihrem glanzvollen Vorläufer im Kaiserreich unterschied, in dem der Großonkel noch als Admiral gedient hatte und für den einer von dessen Söhnen in den letzten Kriegstagen sein Leben gegeben hatte. Als der angehende Seemann im Frühjahr 1924 zum Eignungstest in Kiel antrat, war die Marine noch immer ein Truppenteil im Umbruch. Rauff hatte während der vergangenen Jahre genau verfolgen können, welche Entwicklung die einstige kaiserliche Flotte nahm. Seit nunmehr drei Jahren trugen die Seestreitkräfte die offizielle Bezeichnung „Reichsmarine“. Ende 1921 war auch die kaiserliche Kriegsflagge von der neuen, schwarz-weiß-roten Kriegsflagge mit Eisernem Kreuz in der Mitte und den Farben der Republik in der linken oberen Ecke abgelöst worden.14 Mit diesem rein äußerlichen Wandel gingen umfassende strukturelle und qualitative Umbrüche einher. Gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages blieben Deutschland lediglich sechs veraltete Linienschiffe, weitere sechs Kleine Kreuzer, zwölf Zerstörer sowie zwölf Torpedoboote. Sowohl sämtliche Unterseeboote als auch Kriegsflugzeuge waren untersagt und jegliche Schiffsneubauten für die nächsten 20 Jahre streng limitiert. Der Personalbestand der Marine schrumpfte aufgrund der Vertragsbestimmungen von etwa 80.000 Mann im Kaiserreich auf lediglich 15.000 Marineangehörige in der Weimarer Republik.15
Trotz dieser tiefgreifenden Beschränkungen hatten die Siegermächte ein Interesse an einer funktionierenden deutschen Marine. Als regionale Seemacht sollte die Republik vor allem in der Ostsee fähig sein, dem Expansionsdrang der nach den Revolutionswirren aufstrebenden Sowjetunion Paroli zu bieten und sich gegen eine mögliche Ausweitung des polnisch-russischen Krieges auf deutsches Territorium erwehren zu können. Darüber hinaus erforderte auch die durch die Schaffung des polnischen Korridors isolierte Lage Ostpreußens den Einsatz von Marineverbänden und ließ damit den Ostseeraum als vorrangiges Operationsgebiet der Reichsmarine erscheinen.16 Das frühere elitäre Selbstverständnis lebte in weiten Teilen des Offizierskorps nach allen Umbrüchen noch immer fort. Auf Druck der Berliner Politik hatte die Reichswehrführung eine Öffnung der Offizierslaufbahn für qualifizierte Unteroffiziere einführen müssen. Von ihren privilegierten und mit Standesdünkel behafteten Kameraden wurden diesen aus dem Mannschaftsstand hervorgegangen Offiziersanwärtern jedoch erst einmal massive Vorbehalte entgegengebracht. Nur zwei Jahre vor dem Eintritt Rauffs in die Marine brachte der Kommandeur der Marineschule Mürwik das kursierende Verständnis mit dem knappen Satz treffend auf den Punkt: „Der Offizier wird schließlich doch nicht erzogen, sondern geboren.“17
Das angedeutete Konfliktpotential sowie das innerhalb der Reichsmarine vorherrschende Selbstverständnis eines republikfeindlichen „Staates im Staate“ müssen auch den jungen Rauff geprägt haben. Die mehrtägige Aufnahmeprüfung hatte er zusammen mit 79 anderen Bewerbern bestanden. Damit wurde Rauff zum 31. März 1924 „mit der Aussicht auf eine Übernahme in die Offizierslaufbahnen“ für eine Dienstzeit von zwölf Jahren in die Reichsmarine übernommen.18 Das zum Dienstjubiläum 1969 veröffentlichte Crewbuch von Rauffs Marinejahrgang 1924 präsentiert knappe biographische Angaben zu einem Großteil der Männer, die damals die Seeoffiziersausbildung begannen. In dem Sample von 69 Personen sind die Geburtsjahrgänge 1903 bis 1905 mit Abstand am häufigsten vertreten. Rauff gehörte in der Ausbildung zu den Jüngsten. Alle Männer hatten ihr Abitur abgelegt, Voraussetzung für die Seekadettenausbildung in der Reichsmarine. Mit seiner sozialen Herkunft war Rauff in der Alterskohorte alles andere als eine Ausnahmeerscheinung. Fast alle Anwärter entstammten der mittleren und oberen Mittelschicht. Deren Väter waren selbst noch als Offiziere tätig, übten aber auch nicht-militärische Berufe als Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, höhere Beamte, Akademiker oder Unternehmer aus. Dagegen finden sich unter den Väterberufen lediglich ein Handwerker, ein Postamtmann, aber immerhin drei Gutsbesitzer.19 Das Sample lässt auf eine hohe generationelle Kohärenz schließen. Geboren in einer privilegierten sozialen Schicht hatten die Männer das Gymnasium absolviert und waren in der Zeit nur von Zuhause Zeugen des Ersten Weltkriegs geworden. Ähnlich wie Rauff entschieden sie sich jedoch nicht für den politischen Radikalismus, sondern für eine Laufbahn in der republikanischen Marine. Vor allem diese Alterskohorte seiner 79 Crewkameraden muss auch für Rauff eine wichtige generationelle Orientierung dargestellt haben.
Nach den ersten Prüfungstagen und der offiziellen Aufnahme Ende März trennten sich erst einmal die Wege der angehenden Seekadetten. Die eine Hälfte kam zur weiteren Ausbildung nach Wilhelmshaven und damit an die Nordsee, während Rauff mit den übrigen Männern auf den Dänholm vor Stralsund versetzt wurde, um dort den Ausbildungslehrgang an der Marinestation der Ostsee zu beginnen. Die Einrichtung wurde zu der Zeit vom ehemaligen Freikorpskommandanten Wilhelm von Loewenfeld geleitet. Unter ihm gehörte Rauff nun offiziell der 8. Kompanie, 2. Abteilung der Schiffsstammdivision Ostsee an und stand am Anfang einer Ausbildung, die er zusammen mit den übrigen Anwärtern erst nach viereinhalb Jahren als Offizier der Reichsmarine abschließen sollte. Gemäß den frühen Ausbildungsrichtlinien der Reichsmarine absolvierten die Offiziersanwärter ihre Grundausbildung generell zusammen mit den Matrosen. Entsprechend rau dürfte daher allgemein der Umgangston gewesen sein. Abgesehen davon bewirkten die Zeitumstände des Jahres 1924, dass das Training der angehenden Seekadetten wenig mit dem zu tun hatte, was heute unter einer regulären Marineoffiziersausbildung verstanden werden würde.20 Wie sich einer aus dem Jahrgang 1924 erinnerte, begann die „Ausbildung an den Feldkanonen der Küstenwehrabteilung […] und im Straßenkampf mit Handgranaten als erster scharfer Waffe. Es war eine wilde Zeit“.21
Anfang Oktober wurde der gesamte Stralsunder Lehrgang nach Wilhelmshaven auf das Linienschiff „Elsass“ versetzt. Damit ging es nach halbjähriger Ausbildung auch erstmals auf See. Im Zusammenwirken mit der regulären Crew lernten die jungen Männer den Bordalltag kennen. Teils im Hafen, teils auf Ausbildungsfahrten wurden die Kadetten in die maßgeblichen Bereiche des betagten Kriegsschiffs eingeführt. Manövrieren, Taktik, Signalkunde, der Antrieb, Schiffsartillerie und Torpedoschießen waren nur einige der Themen, die auf der „Elsass“ zur Grundausbildung gehörten und theoretisch wie praktisch vermittelt wurden.22 Zum Abschluss dieser ersten, mit zahlreichen Fahrten in Nord- und Ostsee begleiteten Phase stand Ende März 1925 die Offiziersanwärter-Prüfung an. Rauff bestand, war damit zum Gefreiten befördert und durfte sich fortan offiziell Offiziersanwärter nennen. Anschließend teilte sich der Jahrgang erneut auf. Diejenigen, die eine Laufbahn als technische Offiziere oder Ingenieure anstrebten, wurden zur weiteren Ausbildung an die Marineschule Mürwik bei Flensburg versetzt. Rauff dagegen wollte Seeoffizier werden, damit kam er mit den anderen auf das Segelschulschiff „Niobe“, auf dem das weitere Training der angehenden Seeleute intensiviert werden sollte. Mit „Niobe“ ging Rauff bald erneut auf Ausbildungsfahrt, diesmal sogar ins Ausland. Über die Ostsee segelte er mit dem Schulschiff im Frühjahr 1925 nach Schweden und lief dort als ersten Auslandshafen das südschwedische Kalmar an.23 Nach Deutschland zurückgekehrt, wurden die Männer am 19. Juni und damit an Rauffs 20. Geburtstag zu Seekadetten ernannt.24
Für den 19-jährigen hatten die vergangenen 15 Monate gezeigt, dass er die richtige Berufswahl getroffen hatte. Rauff identifizierte sich in hohem Maße mit der Marine und ging in diesem Selbstverständnis auf. Die Ausbildung scheint dem jungen Mann zugesagt zu haben; er war begierig, sich zu bewähren und im Rahmen der begonnenen militärischen Karriere weitere Stationen zu durchlaufen. Mit der Unterordnung unter das militärische Befehlssystem hatte er offensichtlich keine Probleme; letztlich waren der militärische Umgang und die Unterordnung unter Vorgesetzte das, was ihm auch Sicherheit bot.25 Im Kameradenkreis war Rauff beliebt. Er zeigte sich keineswegs eigenbrötlerisch, sondern genoss die Gesellschaft der anderen. Auch war er kein Kind von Traurigkeit, zeigte sich jederzeit für einen Scherz bereit, der die Gemeinschaft unterhielt. Bald hatte er den Ruf weg, unter den Jahrgangskameraden die „Betriebsnudel“ zu sein, – einer derjenigen, der Akzeptanz und Anerkennung auch daraus zog, die Gemeinschaft mit Humor und Späßen zu unterhalten.26
Schon damals zeigte sich zudem eine Neigung, die Rauff in geselliger Runde zusätzlich sozial kompatibel machte und die ihn durch sein ganzes weiteres Leben begleiten sollte. Er trank gerne Alkohol, konsumierte auch größere Mengen und ließ kaum einmal eine Gelegenheit für ein vergnügtes Gelage verstreichen. Auf Urlaub besuchte der Seekadett zusammen mit einem Kameraden einmal die ältere Schwester in Berlin. Ilse Emsmann war für einen Aufenthalt in der Hauptstadt 1925 vorübergehend in der Wohnung des Schwiegervaters und ehemaligen Konteradmirals untergekommen. Auf Bitten der Schwester sagte Rauff zusammen mit dem Kameraden zu, den neugeborenen Sohn der Schwester zu hüten. Mit dem Kind dann in der Wohnung alleine gelassen, machten sich beide Männer bald über die dortigen Schnapsvorräte her. Als dann aber Hugo Emsmann anrief und zusammen mit Vizeadmiral Erich Raeder sein baldiges Kommen ankündigte, entschieden beide, schnell das Weite zu suchen, um nicht betrunken von den hohen Marineautoritäten zur Rede gestellt zu werden und am Ende noch den Alkoholkonsum eingestehen zu müssen. Über den Dienstboteneingang verließen die Seeleute die Wohnung und ließen das ihnen anvertraute Kind der Schwester kurzerhand alleine zurück. An derartige Erlebnisse pflegte Rauff sich immer gerne zu erinnern.27
Im Sommer kam der lebensfrohe und bei seinen Kameraden beliebte Gefreite nach mehr als einjähriger Ausbildung erneut mit dem gesamten Jahrgang der Offiziersanwärter zusammen. Alle verbliebenen 80 Männer wurden Anfang Juli auf den Kreuzer „Berlin“ versetzt, der neben dem Segelschiff „Niobe“ ebenfalls als Schulschiff der Reichsmarine diente.28 Der 1902 auf Kiel gelegte und im Folgejahr vom Stapel gelaufene leichte Kreuzer der kaiserlichen Marine hatte es Anfang des Jahrhunderts zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Das Schiff löste nämlich seit dem 4. Juli 1911 das wesentlich kleinere Kanonenboot SMS „Panther“ vor der marokkanischen Hafenstadt Agadir ab und sollte damit dem Machtanspruch des Deutschen Reiches Nachdruck verleihen. Hintergrund der auch als „Panther-Sprung nach Agadir“ bezeichneten Zweiten Marokkokrise war der deutsche Versuch, durch die Präsenz der eigenen Kriegsmarine Frankreich zu Gebietsabtretungen in Afrika zu bewegen. Im Ausgleich für die deutsche Anerkennung des französischen Machtanspruchs auf Marokko sollte die französische Kolonialmacht ihrerseits afrikanische Kolonialgebiete an das Kaiserreich abgeben.29 Derartige deutsche Hoffnungen auf eine Erweiterung des kolonialen Einflusses erfüllten sich jedoch auch durch die Präsenz der „Berlin“ vor der marokkanischen Küste nicht. Nach dem Kanonenboot „Panther“ kehrte auch der kleine Kreuzer unverrichteter Dinge wieder nach Kiel zurück. Auf dem erhalten gebliebenen und vielfach in Schulbüchern oder anderen Publikationen veröffentlichten Foto zur Marokkokrise ist vor Agadir ankernd eben nicht, wie mitunter fälschlicherweise angegeben, das Kanonenboot „Panther“ zu sehen, sondern unverkennbar der kleine Kreuzer „Berlin“ mit seinen drei Schornsteinen.30
Vierzehn Jahre später stand Rauff am 9. September 1925 im Marinehafen von Kiel an der Reling von „Berlin“, als das Kommando „Leinen los“ erschallte und sich das Schiff auf eine siebenmonatige Fahrt über die Weltmeere begab. Der Kreuzer war eines der ersten Kriegsschiffe, das im Auftrag der Berliner Republik in die Welt aufbrach, um Deutschland im Ausland zu repräsentieren und Freundschaftsbesuche in einer Vielzahl von fremden Häfen abzustatten. Rauff und die anderen Anwärter gehörten nicht mehr zur Ausbildungsgruppe, sondern waren Teil der regulären Besatzung und erlebten damit ganz real den Alltag an Bord eines Kriegsschiffes.31 Bald hatte „Berlin“ die Ostsee, dann die Nordsee im Kielwasser gelassen und den Atlantik erreicht. Auf den Azoren wurde nochmals Zwischenstation gemacht, dann hieß es Kurs Amerika. Der Kreuzer war bald darauf das erste deutsche Kriegsschiff, das den Panamakanal befuhr. Im Pazifischen Ozean angekommen, ging es weiter südwärts. Vor der Küste Ecuadors erlebte Rauff seine Äquatortaufe, bei der die Neulinge traditionell einige derbe Streiche von altgedienten Mannschaftsangehörigen zu erdulden haben. Weiter ging es zu einem Besuch der ecuadorianischen Küstenstadt Guayaquil, anschließend mit Kurs Süd zu einer Visite von Callao an der Küste Perus und von dort nach Chile.32
Rauff und die übrigen Mannschaftskameraden lernten nun, dass sie auf ihrer Reise neben der Repräsentation für Deutschland im Ausland auch eine nicht zu unterschätzende Mittlerrolle für Auslandsdeutsche in Südamerika erfüllten. Seit langem hatten Vertreter deutscher Gemeinden Berlin darum gebeten, bei einer Auslandsvisite eines Kriegsschiffs ebenfalls berücksichtigt zu werden. Die deutsche Handelskammer im chilenischen Valparaíso argumentierte beispielsweise, ein derartiger Besuch wäre geeignet, „die Deutschen Südamerikas mit ihrer alten Heimat erneut zu verbinden und das Selbstbewusstsein derselben zu stärken“.33 Im Sommer 1925 konnte das Auswärtige Amt den diplomatischen Vertretungen in Chile dann die freudige Mitteilung machen, dass Ende des Jahres der Kreuzer „Berlin“ die Häfen Valparaíso, Corral und Punta Arenas anlaufen würde.34 Daraufhin begann man sich in den genannten Städten eifrig auf den bevorstehenden Besuch vorzubereiten, während deutsche Gemeinden wie die in Iquique, Concepción oder Puerto Montt darum baten, bloß nicht vergessen zu werden.35
Abb. 3. Kleiner Kreuzer „Berlin“.
Die vierwöchige Fahrt des kleinen Kreuzers entlang der chilenischen Küste kam dann einem regelrechten Triumphzug gleich. Als ersten Hafen erreichte „Berlin“ am 27. November Valparaíso, wo das Schiff von Deutschen wie Chilenen begeistert empfangen wurde. Nach ersten Begegnungen richtete die deutsche Gemeinde für die gesamte Besatzung zwei Tage später ein großes Fest aus, an dem auch über 800 Auslandsdeutsche teilnahmen. Tags darauf war die Mannschaft des Kreuzers in der chilenischen Marineschule eingeladen. Die Besatzung revanchierte sich am Nachmittag des 1. Dezember mit einem Fest, zu dem mehrere hundert Besucher an Bord kamen. Weitere Essen, Bierabende und ein Konzert der Bordkapelle auf dem Hauptplatz der Stadt folgten.36 Die allgemeine Freude über den Besuch des deutschen Kriegsschiffs fand auch in der Presse ihren Niederschlag. Die großen Tageszeitungen des Landes berichteten über Tage ausführlich und mit sehr positiver Tendenz über das Ereignis.37 Als das Schiff am 4. Dezember Valparaíso wieder verließ, konnte ein uneingeschränkt erfreuliches Fazit gezogen werden. „Der Kreuzerbesuch hat ganz sicher zur Stärkung des hiesigen Deutschtums beigetragen. Auch mit der chilenischen Gesellschaft haben vielfach freundschaftliche Berührungen stattgefundenden“, resümierte der Deutsche Generalkonsul.38
Im Anschluss an die Tage in Valparaíso legte „Berlin“ am 5. Dezember in Talcahuano an. Nachdem der Empfang durch die Deutschen ebenfalls äußerst herzlich ausgefallen war, wurde für die Crew am folgenden Tag ein Ausflug auf eine nahe Insel organisiert. Weitere Feiern folgten.39 Feste, die verschiedensten Aufführungen und Darbietungen, gemeinsame Ausflüge und Einladungen erlebten Rauff und die gesamte Mannschaft der „Berlin“ noch in anderen chilenischen Häfen. Zusätzlich wurden Delegationen der Kreuzerbesatzung in andere Städte entsandt, um möglichst keine deutschen Gemeinden zu enttäuschen und die Gesamtwirkung des Besuchs zu verstärken. Abordnungen der Besatzung besuchten sowohl die Hauptstadt Santiago als auch Städte wie Puerto Montt, Frutillar, Osorno oder La Unión, und überall wurden die Seeleute freudig empfangen.40 Bei allen Tanzvergnügen, Feiern und Festessen müssen Kapitän Junkermann im Hafen von Corral Bedenken hinsichtlich der Disziplin seiner Besatzung gekommen sein. „Aus Corral wurde am 15.XII. früh, zwei Tage früher als nach Reiseplan, ausgelaufen. Nach den vielen Festen der letzten Wochen musste der militärische Dienst wieder mehr in den Vordergrund treten“, begründete der Kommandant die zeitige Abreise.41
Nachdem in Corral noch mehrere Weihnachtsbäume an Bord genommen worden waren, traf „Berlin“ am 22. Dezember im an der Magellanstraße gelegenen Punta Arenas ein. Nach der Begrüßung folgte auch im Süden Chiles das obligatorische Bankett für die gesamte Besatzung, das in einem rauschenden Fest mit Tanz und reichlich Bowle ausklang. Ein Stadtrundgang, ein abendlicher Kegelabend beim Deutschen Verein sowie die festliche Parade eines dort stationierten chilenischen Infanterieregiments mit anschließendem Sektempfang rundeten das Besuchsprogramm ab.42 Vor Punta Arenas verbrachte Rauff auf dem Schulschiff bei sonnigem Wetter, aber dennoch reichlich kühlen Temperaturen, auch die Weihnachtsfeiertage. Die langen Sommerabende auf der Südhalbkugel müssen für alle Besatzungsmitglieder ein ungewohntes Erlebnis gewesen sein. Unter gänzlich veränderten persönlichen Bedingungen sollte Punta Arenas etliche Jahre später für Rauff noch einmal eine besondere Bedeutung bekommen.43
Im Beisein der Besatzung wurde am 25. Dezember von der deutschen Gemeinde noch ein Denkmal für die Opfer des Kreuzergeschwaders unter Vizeadmiral Maximilian von Spee eingeweiht. In einem Seegefecht mit britischen Schiffen waren vor den Falklandinseln am 14. November 1914 mehr als 2200 deutsche Seeleute umgekommen und vier Kreuzer versenkt worden. Im Gedenken steuerte die Crew der „Berlin“ zu der feierlichen Einweihung vier Granaten für die weitere Dekoration des Denkmals bei.44 Nach den Weihnachtsfeiertagen trat Rauff mit dem Schulschiff zum Jahresende vom südlichen Patagonien aus dann die lange Rückreise in die Heimat an. Diesmal ging es durch die Magellanstraße zurück in den Atlantik. Als „Berlin“ bereits die chilenischen Gewässer verlassen hatte, sorgte das Schiff noch für positive Momente im deutsch-chilenischen Verhältnis. Der deutsche Gesandte in Santiago dankte dem Außenminister des Landes in einer Note „für die zahlreichen Aufmerksamkeiten und Beweise herzlicher Freundschaft […], die dem Kommando und der Besatzung des Kreuzers bei ihrem Aufenthalt in chilenischen Gewässern und Häfen von den chilenischen Behörden und der chilenischen Bevölkerung zuteil geworden sind“.45 Derweil wurde von dem Kreuzer auftragsgemäß das mitgeführte Kurzwellen-Funkgerät an einem vereinbarten Treffpunkt an das Vermessungsschiff „Meteor“ übergeben. Bei den Falklandinseln gedachte die Mannschaft am Neujahrstag mit einem mit Eisernem Kreuz drapierten Kranz ein weiteres Mal des Schicksals des Kreuzergeschwaders unter Vizeadmiral Graf Spee. Anschließend angelaufene Zwischenstationen an der Ostküste Südamerikas waren so bedeutende Hafenstätte wie Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, das brasilianische Bahia sowie die Insel St. Vincent in der Karibik. In jedem der Häfen und bei den Landgängen müssen Rauff und die übrigen Crewmitglieder neue Erlebnisse gesammelt haben.46
Leicht kann bei einer derartigen Reiseschilderung der Eindruck aufkommen, die Männer auf dem Schulschiff hätten sich auf einer entspannten Kreuzfahrt befunden. Doch der Alltag an Bord sah deutlich anders aus. Als reguläre Besatzungsmitglieder waren alle Angehörigen der Crew in den täglichen, monotonen Dienst auf dem Kriegsschiff eingebunden. Das bedeutete Dienstzeiten, die einen Großteil des Tages einnahmen und nur von kurzen Ruhezeiten in den äußerst beengten Mannschaftsunterkünften unterbrochen wurden. Darüber hinaus musste auch der alltägliche Drill an Bord ertragen werden, der sich faktisch nur wenig von dem harten Regiment der kaiserlichen Marine unterschied. Nicht zuletzt gilt es bei der Beurteilung einer solchen Reise auch die menschlichen Konflikte zu berücksichtigen, die beim Bordleben auf engem Raum zwangsläufig aufgetreten sein und die Atmosphäre auf dem Schiff mitbestimmt haben müssen.
Rauffs Mannschaftskamerad Günther Wachsmuth schrieb dazu: „Zeitweise waren die Spannungen an Bord nicht schön, oft erfuhren wir, wie man es nicht machen sollte!“47 Zur Rückfahrt über den Atlantik notierte er außerdem: „Viele Ausfälle durch Hitze und auch mancherlei Schikane. […] Ganz üble Stimmung an Bord: Schiff gegen Kadetten, Erster Offizier gegen Behr [der Kadettenoffizier], Kadettenoffizier und Korporäle gegen uns.“48 Der persönlichen Erinnerung entsprach eine kurze Begegnung auf See. In der Nähe der Kanarischen Inseln traf „Berlin“ im Februar 1926 auf den kleinen Kreuzer „Hamburg“. Das ebenfalls als Schulschiff der Reichsmarine genutzte Schwesterschiff mit dem Folgejahrgang von Offiziersanwärtern an Bord war gerade zu einer Weltreise aufgebrochen, bei der die Crew erst nach 13 Monaten die Heimat wiedersehen sollte. In der Ahnung, was die jüngeren Kameraden während der folgenden Wochen und Monate noch erwarten würde, sendeten die Kadetten um Rauff einen Signalspruch an das Schwesterschiff. „Segelt Ihr mal ruhig weiter, ganz zum Schluss, da wird man heiter“, lautete der an „Hamburg“ übermittelte vielsagende Gruß.49 Nach der erneuten Atlantiküberquerung machte „Berlin“ noch einmal im nordspanischen Vigo fest. Dort hatten die angehenden Offiziere an Bord ihre schriftliche Fähnrichsprüfung zu absolvieren, die Rauff problemlos bestand. Dann ging es für alle auf die letzte Etappe der langen Reise. Nach einer störungsfreien Passage entlang der französischen Atlantikküste fuhr das Schulschiff in den Ärmelkanal ein, rundete Skagen und machte nach einer Reisedauer von insgesamt 190 Tagen am 22. März 1926 wieder in Kiel fest.50
Mit der Ankunft im Heimathafen kehrte für die Offiziersanwärter nach der nicht immer angenehmen, aber doch ungemein erlebnisreichen Reise ein stärker theoretisch orientierter Ausbildungsalltag ein. Rauff wie allen anderen Anwärter blieb kaum Zeit, sich über die Rückkehr zu freuen, vielmehr hatte der gesamte Jahrgang umgehend in der Marineschule in Flensburg-Mürwik zu erscheinen, wo noch die mündliche Fähnrichsprüfung absolviert werden musste. Mit bestandener Prüfung wurde Rauff am 1. April zum Fähnrich befördert. Damit hatte er einen Unteroffiziersdienstgrad inne und war erstmals nominell zur Führung Untergebener berechtigt. Sämtliche frischgebackenen Fähnriche erwartete anschließend ein Ausbildungsjahr an der Marineschule in Mürwik, in dem den Männern die zentralen Kompetenzen vermittelt werden sollten, die sie zukünftig als Offiziere der Reichsmarine auszeichnen sollten.51
Die im Stil norddeutscher Backsteingotik am Südufer der Flensburger Förde errichtete weitläufige Anlage war im November 1910 von Kaiser Wilhelm II. als zentrale Ausbildungsstätte für die Offiziere seiner Marine eingeweiht worden. Acht Jahre später war die Ausbildung infolge der Kriegsniederlage ausgesetzt worden. Erst ab September 1920 zog dann der erste Lehrgang von Offiziersanwärtern der neuen, republikanischen Marine in Mürwik ein. Deren demokratischer Geist ließ noch sehr zu wünschen übrig. Viele der von den paramilitärischen Marinebrigaden der Revolutionszeit geprägten Offiziersanwärter machten weniger durch ihre persönliche Befähigung als durch rechtsradikale Gesinnung auf sich aufmerksam. Das veranlasste im Februar 1923 sogar einen Reichstagsausschuss zu der kritischen Frage, „ob die innere Verfassung der Marineschule so sei, dass sie der dem Parlament verantwortliche Minister auch vertreten könne“.52
Die Anwärter des Folgejahres, in dem Rauff seine Marinelaufbahn begann, schienen personell etwas günstiger zusammengesetzt und politisch unauffälliger gewesen zu sein. Andere Probleme im Ausbildungsbetrieb der Schule blieben bestehen. Vor allem der verbreitete Alkoholmissbrauch und daraus resultierendes Fehlverhalten schufen Probleme. So musste der Schulkommandeur in Mürwik 1924 eigens darauf verweisen, „dass in den letzten Jahren geradezu erschütternd viele Fähnriche und junge Offiziere wegen grober dienstlicher Versager oder Disziplinarvergehen entlassen werden mussten, deren Anlass fast in allen Fällen ein Zuviel an Alkohol war“.53 Insgesamt schieden in den drei Jahren zwischen Mai 1924 und Mai 1927 von 348 Seeoffiziersanwärtern 38 aufgrund diverser Verfehlungen oder mangelnder Befähigung aus der Reichsmarine aus. Das entsprach einem Anteil von immerhin 10,9 Prozent.54
Generell sollten während des Ausbildungsjahres an der Marineschule die grundlegenden Kompetenzen vermittelt werden, auf die Offiziere der Reichsmarine bei den verschiedensten Anforderungen an Bord später angewiesen sein würden. Dazu war, anders als etwa bei der US-Marine, entschieden worden, die technischen Ausbildungslehrgänge zu Ingenieuren nicht von dem davon völlig verschiedenen Anforderungsprofil der Ausbildung der reinen Seeoffiziere zu trennen. Die Fähnriche hatten in Mürwik damit einen deutlich überladenen Lehrbetrieb zu absolvieren. Die Auswahl der Fächer und ein Großteil der Ausbildungsstruktur beruhten noch auf den Richtlinien der Kaiserlichen Marine. Im Kern wurden allein 16 verschiedene Fächer vermittelt, die in den Abschlussprüfungen unterschiedlich gewertet wurden. Zu den sieben wichtigsten Fächern erster Ordnung zählten die Bereiche Navigation, Seemannschaft, Schiffskunde, Artillerie, Hydraulik, Maschinenkunde und Dienstkenntnis. Neu hinzugekommen waren in der Reichsmarine außerdem Seetaktik und Seekriegsgeschichte. Zu den geringer benoteten Fächern zweiter Ordnung gehörten Schiffbau, Mathematik, Naturlehre, Elektrotechnik, Englisch, Französisch, Minenwesen, Landtaktik und Befestigungslehre. Darüber hinaus gab es noch einige nachgeordnete Fächer dritter Ordnung wie Zeichnen oder Stenographie.55
Angesichts einer solchen Breite waren dem Inspekteur des Bildungswesens, Konteradmiral Hosemann, im Frühjahr 1925 Bedenken hinsichtlich der Effizienz des Ausbildungswesens gekommen, die er in einem Schreiben an die Marineleitung zur Sprache brachte: „Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, als ob der Lehrplan durch eine zu große Vielseitigkeit und Zersplitterung der genügenden Grundlage entbehrt. Die Marineschule vermittelt den Fähnrichen zwar ein vielseitiges, aber nur lose zusammenhängendes Wissen. Die theoretischen Fächer, wie Mathematik, Naturwissenschaften und Elektrizitätslehre dürfen nur als Hilfswissenschaften für die militärischen Fächer betrieben werden, das Reinwissenschaftliche muss zurücktreten. Halbwissen muss vermieden werden.“56 Admiral Zenker, der Marinechef, befürwortete die inhaltliche Kritik, doch Rauff sollte nicht mehr in den Genuss der sich andeutenden Reform des Ausbildungswesens kommen. Erst im Februar 1930 wurde die Dienstvorschrift der Marineschule entsprechend geändert, womit die Ausbildung fortan etwas praxisorientierter organisiert wurde.57
Ein weiterer schwerwiegender Mangel lag zudem in der völlig unzureichenden politischen Bildung. Einmal mehr ist an dieser wichtigen Frage die Distanz des Marineoffizierskorps zum demokratischen Weimarer System festzustellen. In den Unterrichtsleitfäden waren bis ins Jahr 1930 Themen schlicht nicht vorgesehen, die den jungen Männern die Vorzüge einer republikanischen Staatsform oder das Wesen einer parlamentarischen Demokratie vermittelt hätten. Während noch 1914 der Dienstkenntnisleitfaden der Marineschule auf 21 Seiten den staatlichen Aufbau des Kaiserreichs ausführlich vermittelt hatte, blieb das Weimarer Staatswesen in den ab 1920 erschienenen Leitfäden der Reichsmarine vollkommen unerwähnt. In dem seit 1926 auch für Mürwik gültigen „Leitfaden für den Dienstunterricht in der Reichsmarine“ fehlte ein positiver Bezug auf das demokratische System ebenfalls fast völlig. Hervorgehoben wurde stattdessen die Rolle der Reichswehr als fester „Grund- und Eckstein“ für „jede staatliche Ordnung und jedes staatliche Leben“.58 Rauff bekam damit eben nicht die staatsbürgerlichen Inhalte vermittelt, die ein ernstzunehmendes Gegengewicht zu seiner antirepublikanischen Orientierung hätte bilden können.
Dadurch, dass die Marineleitung und die Mehrzahl der ausbildenden Führungskräfte die demokratische Ausrichtung der Republik nicht akzeptierten und sich diese staatsfeindliche Orientierung auch in den Ausbildungsinhalten niederschlug, bestand die unmittelbare Gefahr, die neuen Mannschaften und Offiziersanwärter schnell an das antidemokratische Lager zu verlieren. Weil ein entsprechendes Staatsverständnis im Rahmen der Marineausbildung der Weimarer Republik über lange Zeit überhaupt nicht vermittelt wurde, ergab sich überhaupt nicht die eigentlich dringend erforderliche Möglichkeit, junge Männer in der Reichsmarine zu loyalen republikanischen Staatsbürgern auszubilden. Damit lag es nahe, dass bei inneren Krisen gerade diejenigen, die qua Funktion eigentlich den Staat verteidigen müssten, selbst Protagonisten bei dessen Auflösung sein würden. Durch die dominierende Präsenz antirepublikanisch eingestellter Militärs zeigte sich die Weimarer Republik zu keiner Zeit dazu in der Lage, solche schwerwiegenden Widersprüche aufzulösen.
Für Rauff und seine Kameraden existierte in der Marineschule nicht nur der vielschichtige theoretische Ausbildungsbetrieb. Als Abwechslung zur Vermittlung der Lerninhalte wurden zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten angeboten. Insbesondere der Sport nahm in Mürwik als ein Teilaspekt der Ausbildung eine gewichtige Rolle ein. Im Angebot gab es unter anderem Schwimmen, Turnen, Handball, Hockey oder Boxen.59 Dem noch immer elitären Selbstverständnis des Marineoffizierskorps entsprechend, war es außerdem obligatorisch, dass die angehenden Seeoffiziere sich dem Segel- sowie dem Reitsport zu widmen hatten.60 Rauff nahm solche Angebote offenbar gerne an und erlernte auch das Reiten. Wie er selbst einmal witzelnd anmerkte, missachtete er damit allerdings den nicht ganz ernstgemeinten Marinespruch, der lautete: „Das Pferd ist ein Tier, das an Steuerbord und Backbord steil abfällt, vorn und achtern zu kurz ist und dem Seemann nach dem Leben trachtet.“61 Daneben hatte der angehende Seeoffizier in Mürwik Gelegenheit, sich intensiv mit dem Segelsport zu befassen. Den Anwärtern standen verschiedene Bootsklassen zur Verfügung, mit denen das sportliche Segeln erlernt und mit der Zeit dann auch Regatten ausgetragen werden konnten. Rauff schien sich bald auf eine allein zu bedienende kleinere Jollenklasse spezialisiert zu haben, in der er noch Jahre später an Wettfahrten teilnehmen sollte.62 Ironisch kommentierte er seine Hinwendung zum sportlichen Segeln später einmal in der Richtung, dass es das gleiche gewesen sei, wie „wenn ein Landbriefträger am Sonntag spazieren geht“.63
Abgesehen von den sportlichen Aktivitäten kam der Jahrgang zu Lehrfahrten an Bord verschiedenster Schiffe. Abends standen zudem öfters gesellige Zusammenkünfte auf dem Programm. So kamen die Fähnriche wiederholt in den Genuss von Weinproben, bei anderer Gelegenheit wurden so genannte Herrenabende zelebriert. Das waren ungezwungene Runden, zu denen mitunter interessante Gäste eingeladen wurden, um mit den Offiziersanwärtern zu debattieren. Zu einem solchen Anlass saßen die Männer abends einmal mit Prinz Heinrich, dem noch immer populären jüngeren Bruder des letzten deutschen Kaisers und ehemaligen Großadmiral der deutschen Flotte, zusammen. Auch wegen solcher Ereignisse blieb den angehenden Seeoffizieren das gesamte Ausbildungsjahr in positiver Erinnerung. Wie es einer von Rauffs Jahrgangskameraden ausdrückte, empfanden sich die jungen Männer in dieser Zeit als Herren ihrer „kleinen Welt, der weitläufigen Anlagen in Mürwik, wie der Flensburger Gesellschaft“.64
Zum Abschluss des Jahres an der Marineschule stand für Rauff und die übrigen Anwärter des Jahrgangs im März 1927 die Offiziershauptprüfung an. Auch diese Hürde meisterte der junge Fähnrich zusammen mit dem Großteil des Lehrgangs. Mit der erfolgreichen Prüfung wurden die Absolventen zu Obermaaten befördert; im Anschluss begann die jeweilige Spezialausbildung. Diejenigen, die eine technische Laufbahn einschlagen wollten oder sich für den Verwaltungsweg berufen fühlten, hatten in Stralsund einen Zugführerlehrgang zu absolvieren und wurden dann an der Marineschule in Kiel-Wik auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Rauff strebte jedoch keine Spezialisierung in dieser Richtung an, sondern wollte weiterhin echter Seeoffizier werden. Damit wurde er mit anderen Anwärtern zuerst zu Waffenschulen versetzt, dann absolvierten die Männer eine Infanterieschulung in Stralsund und wurden schließlich in Zivilkleidung noch zu einem Sonderlehrgang nach Kiel-Holtenau abgestellt, um dort die Grundlagen des Seefliegerwesen vermittelt zu bekommen. Diese Ausbildungsphase dauerte bis zum Jahresende 1927. In der Folge ging es für Rauff und die Anderen erneut an Bord. Auf verschiedenen Schiffen der Reichsmarine mussten sich die Anwärter noch einmal bewähren.65
Während zahlreiche seiner Jahrgangskameraden dabei ab Anfang 1928 nochmals für mehrere Monate auf das Linienschiff „Elsass“ kamen, wurde Rauff nach Kiel versetzt, um dort seine Marinekarriere im Minensuchdienst fortzusetzen.66 Zum 1. Mai des Jahres wurde der angehende Offizier zeitgleich mit den übrigen Jahrgangsteilnehmern zum Oberfähnrich befördert und hatte somit den höchsten Unteroffiziersdienstgrad erreicht. Fünf Monate später war dann die viereinhalb-jährige Ausbildung für den Jahrgang 1924 offiziell abgeschlossen. Alle Anwärter wurden am 1. Oktober des Jahres zu Leutnants befördert und erreichten damit ihren ersten Offiziersdienstgrad.67 Stolz konnte Rauff für sich bilanzieren, dass es ihm gelungen war, sein Berufsziel zu verwirklichen. Vom frisch gebackenen Abiturienten des Jahres 1924 hatte er sich zu einem Leutnant der Reichsmarine entwickelt. Den einstigen Berufswunsch des Vaters hatte er für sich realisiert und nicht zuletzt auch die Familientradition des angeheirateten Hauses Emsmann für die Rauff-Linie fortgeführt.
Schon vor dem eigentlichen Abschluss der Offiziersausbildung und seiner Beförderung zum Leutnant zur See setzte er seine Dienstzeit bei der in Kiel stationierten 1. Minensuch-Halbflotille fort. Dass er zu diesem speziellen Zweig der Reichsmarine kommandiert wurde, muss zum guten Teil auf eigener Entscheidung beruht haben. Rauff bekam wie seine Kameraden die Gelegenheit, sich gemäß eigener Begabungen und Interessen für den weiteren Dienst festzulegen. Offenbar hatte er während vergangener Lehrgänge eine besondere Befähigung bei der Minenabwehr gezeigt und sich daher letztlich für diesen hochspezialisierten Bereich entschieden.68
Seeminen stellten als Waffe gegen gegnerische Schiffe Ende der 1920er Jahre ein noch relativ neues Kampfmittel dar. Zwar wurden erste, unter der Wasseroberfläche gezündete Sprengladungen bereits im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg eingesetzt, dennoch spielten Minen im Seekrieg bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine untergeordnete Rolle.69 Im Verlauf des Ersten Weltkriegs wurden dann vor allem von Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Russland und dem Deutschen Reich allein in Nord- und Ostsee fast 200.000 Minen gelegt. Sie schränkten den Operationsraum des Gegners ein und verlegten ganz konkret auch die Zufahrten zu feindlichen Häfen. Besonders die britische Royal Navy konnte im Einsatz der Minenwaffe Erfolge verbuchen. Ihr gelang ab 1917 die Verminung weiter Teile der Deutschen Bucht und im Jahr darauf die Abriegelung des Ärmelkanals für deutsche Schiffe. Allgemein wurden unterschiedliche Minentypen gegen Kriegsschiffe, U-Boote sowie die feindliche Handelsschifffahrt eingesetzt. Mit dem Einsatz dieser gefährlichen und vergleichsweise preiswerten Waffe stieg zwangsläufig die Notwendigkeit, feindliche Seeminen aufzuspüren, möglichst zu zerstören und damit die Seewege für eigene Schiffe wieder passierbar zu machen. So waren bis Kriegsende auch zahlreiche Minensuch- und Räumboote der kaiserlichen Marine im Einsatz.70 In Artikel 193 des Versailler Vertrages war Deutschland dann auferlegt worden, weite Bereiche der Gewässer in Nord- und Ostsee von Minen zu räumen. Dazu wurden aus Schiffen der einstigen Kriegsmarine mehrere Suchflotillen gebildet, die mit Freiwilligen als Personal ab Anfang 1919 mit den Räumarbeiten begannen. Im Oktober 1922 waren diese umfangreichen Operationen beendet und Nord- wie Ostsee konnten als minenfreie Gewässer wieder für die allgemeine Schifffahrt freigegeben werden.71
Nach dem Abschluss des mehrjährigen Räumeinsatzes wurden die Minensuchverbände aufgelöst. Die Reichsmarine wäre nominell zwar zum Einsatz einiger Minensuchboote berechtigt gewesen, jedoch entschied die Führung, die ausgebildeten und im Einsatz erprobten Besatzungen lieber an anderer, dringender benötigter Stelle einzusetzen. Erst im Oktober 1924 wurde auf Befehl des neuen Chefs der Marineleitung, Admiral Zenker, mit der „1. Minensuch-Halbflotille“ ein Minensuchverband der Weimarer Republik aufgebaut. Korvettenkapitän Hugo Schmidt war der erste Chef des Verbandes, der anfangs aus lediglich vier Booten bestand: Das als Führerboot fungierende „M 113“, außerdem „M 122“, „M 136“ sowie „M 145“. Rauff als frischgebackenem Leutnant zur See wurde die Funktion des 1. Wachoffiziers auf dem Minensucher „M 136“ übertragen.72
Derartige hochseetüchtige Boote waren noch während des Krieges ab dem Jahr 1916 gebaut worden und firmierten daher allgemein unter der Bezeichnung „Typ 16“. Bei einer Gesamtlänge von 59 Metern hatten sie einen Aktionsradius von 2000 Seemeilen und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten. Eine eigene Bewaffnung wiesen diese ersten Minensuchboote der Reichsmarine nicht auf, da Schiffskanonen wegen der strikten Begrenzungen des Versailler Vertrages für andere Klassen von Kriegsschiffen aufgespart wurden. Die Besatzung der Minensuchboote bestand aus 45 Seeleuten. Neben dem Kommandanten, dem 1. und einem 2. Wachoffizier bildete die so genannte technische Division der Maschinisten und Heizer sowie die seemännische Division der eigentlichen Decksmannschaft mit Matrosen, Funkern, dem Koch und den jeweils befehlsgebenden Unteroffizieren zu etwa gleichen Teilen die eigentliche Besatzung.73
Kommandant auf „M 136“ war Kapitänleutnant Friedrich Ruge. Für Rauffs Marinelaufbahn sollte der Vorgesetzte in den kommenden Jahren ein wichtiger Förderer und Mentor werden. Ruge, Jahrgang 1894, stammte aus bildungsbürgerlichem Elternhaus, sein Vater war Rektor eines Gymnasiums in Bautzen. Sohn Friedrich meldete sich wohl beeindruckt von einem Verwandten, der als Marinearzt tätig war, im Frühjahr 1914 zur Kaiserlichen Marine und absolvierte die Anfänge seiner Seeoffiziersausbildung wie Rauff Jahre später an den Marineschulen in Kiel-Wik und Flensburg-Mürwik. Nach einer entsprechenden Spezialisierung wurde er als Wachoffizier auf ein Torpedoboot kommandiert, auf dem er bis Kriegsende Dienst tat. Noch 1919 wurde Ruge selbst das Kommando über ein eigenes Torpedoboot übertragen, das er im Verband mit der Kaiserlichen Flotte in die Internierung nach Scapa Flow führte und dort im Juni ebenfalls versenkte. Aus britischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, wurde Ruge anschließend in die Reichsmarine übernommen, wo sich der Offizier in den folgenden Jahren zunehmend im Bereich der Sperrwaffe spezialisierte und dafür eigens auch ein Studium an der Berliner Technischen Hochschule absolvierte. Jahrzehnte später sollte Ruge es schließlich noch zum ersten Chef der Bundesmarine bringen.74
Im Jahr 1928 hatte das Minensuchboot „M 136“ unter Ruges Führung und mit dem neuen 1. Wachoffizier Rauff an Bord genauso wie die übrigen Schiffe der Halbflotille ein intensives Ausbildungspensum zu absolvieren. Einerseits musste auf den einzelnen Booten das Zusammenspiel der Crew und der Umgang mit dem komplizierten Minensuchgeschirr geübt werden. Mindestens ebenso anspruchsvoll erwies sich außerdem das koordinierte Operieren der einzelnen Einheiten im Suchverband, das erst ein verlässliches Freiräumen von Seegebieten erlaubte.75 Neben dem eigentlichen Minensuchdienst gehörte bei der Flotille außerdem die U-Boot-Jagd zum Aufgabengebiet. Übungen gerade auf dem Feld waren nicht nur auf Rauffs Schiff beliebt. Da die späteren Unterwasser-Ortungsgeräte noch gar nicht existierten und der Reichsmarine vor allem der Besitz von Unterseebooten strikt verboten war, fiel das Training recht locker aus. Es wurden lediglich verschiedene Angriffsformationen geübt und abgesehen davon jeweils ein paar Wasserbomben geworfen. Dabei gingen die Minensucher jeweils sehr umsichtig vor, denn je nachdem, wie fischreich die Gewässer des Übungsgebiets waren, schwammen nach der Explosion einer Wasserbombe zahlreiche Fische an der Oberfläche, die von den hungrigen Minensuchern als willkommene Ergänzung der nächsten Mahlzeiten sofort emsig eingesammelt wurden.76
Abb. 4. Minensuchboot der Reichsmarine auf See.
Die Aufgaben als 1. Wachoffizier auf „M 136“ absolvierte Rauff in den Augen seiner Vorgesetzten offenbar so überzeugend, dass er ab Herbst 1930 von seinem Dienst auf dem Minensuchboot als Lehrer für die Offiziersausbildung an die für das Minenwesen zuständige Sperrschule in Kiel wechselte. Selbst gerade einmal 24 Jahre alt und erst im Juli zum Oberleutnant zur See befördert, bildete der junge Offizier fortan den Führungsnachwuchs der Reichsmarine auf dem komplizierten Feld des Minensuchens aus.77 Dass Rauff in Kiel mit einer solchen Ausbildungstätigkeit für seine Kompetenz faktisch ausgezeichnet wurde, hatte offenbar einen wichtigen Fürsprecher – seinen bisherigen Kapitän Friedrich Ruge. Der Spezialist für die Sperrwaffe war zwei Jahre vorher von seinem Kommando auf „M 136“ als Mineneferent ins Sperrversuchskommando nach Kiel gewechselt. Dort wurde ihm wohl die Notwendigkeit einer raschen und effizienten Offiziersausbildung im Minenräumwesen bewusst. So empfahl Ruge als Mitarbeiter derjenigen Einrichtung, aus dem bald die spätere Sperrschule hervorging, seinen früheren 1. Wachoffizier als Lehrer.78
Innerhalb einer neu gebildeten Ausbildungsstruktur gehörte Rauff damit zur ersten Generation von speziellen Instrukteuren für den Minenräumdienst. Zum 1. Oktober 1930 war in Kiel unter Fregattenkapitän Ralf von der Marwitz die so genannte Sperrabteilung gegründet worden. Aufgabe der Einrichtung war es, die Ausbildung in der Sperrwaffe nach modernen Standards zu vereinheitlichen und effektiver zu gestalten. Dazu wurde die bereits seit 1922 bestehende Sperrschule unter der Leitung der neugeschaffenen Abteilung reorganisiert und mit einer als Sperrverband bezeichneten Einheit verschiedener Übungsschiffe für die praktische Ausbildung ergänzt.79 Auf jenen Ausbildungsschiffen der Kieler Sperrabteilung wurde Rauff zum ersten Mal auch als Kommandant eingesetzt. 1932 wurde ihm die Führung des Minentenders „MT 2“ übertragen. Ein derartiges Versorgungs- und Mutterschiff für die kleineren Minensuchboote war nicht gerade der Inbegriff eines furchteinflößenden Kriegsschiffs, doch immerhin hatte Rauff vier Jahre nach Vollendung seiner Ausbildung mit dem Kommando auf „MT 2“ erstmals überhaupt die Verantwortung für ein Marineschiff und dessen Besatzung inne.80
Zu Recht konnte sich der Oberleutnant zur See sagen, dass dies einen wirklich vielversprechenden Auftakt seiner noch jungen Offizierskarriere darstellte. Der neue Kapitän des Übungsschiffes und Ausbilder in Kiel konnte dementsprechend gegen Ende des Jahres 1932 ganz optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn er sich weiter in der bisherigen Form bewährte, konnten in der Zukunft bald noch weit bedeutendere Aufgaben auf den Seeoffizier warten. Aussichtsreich für seine Karriere erschien Rauff neben dem Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten auch die Protektion durch seinen früheren Kapitän Ruge, der ihn nicht aus den Augen verloren hatte und sich zukünftig womöglich erneut als hilfreich erweisen würde. Nicht nur die weitere Entwicklung in der Reichsmarine, sondern die allgemeine politische Entwicklung in Deutschland sollten dann aber ganz entscheidend veränderte Rahmenbedingungen schaffen, die auch das Leben des Oberleutnants maßgeblich mitbestimmten.