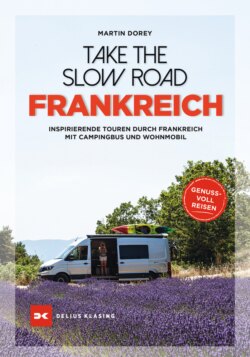Читать книгу Take the Slow Road - Martin Dorey - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAn einem frühen Morgen im Oktober gehen wir in Roscoff von Bord. Es dauert nicht lange, da nur eine Handvoll von Reisenden auf dieser Route unterwegs sind. Zu Hause in England gelten Covid-Beschränkungen. Das heißt, dass wir uns nach unserer Rückkehr für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Das ist okay für uns. Nach einem arbeitsreichen Sommer in Cornwall sind wir froh, mal rauszukommen.
Wir reisen nach Osten in Richtung Morlaix. Es ist ein schöner Tag, und die Sonne strahlt bedrohlich, während wir die D786 entlangrollen. Wir biegen in Lanmeur ab und fahren in Richtung Locquirec, das wir als Startpunkt dieser Tour festgelegt haben. Wir waren schon einmal hier und erinnern uns an einen fantastischen Campingplatz, Camping du Fond de la Baie, der direkt am Strand liegt. Ein super Start.
Als wir einen der Strände des Ortes erreichen, führen wir eine Diskussion über das Wetter; es soll sich bald ändern, und nun ist die Frage, ob wir jetzt ins Meer gehen, während es noch schön ist, oder das gute Licht für Fotos nutzen sollten. Die Wellen sind gut, sie brechen sich sauber am Sandstrand, und ein paar Einheimische sind im Wasser. Ich bin dafür, es bei den Fotos drauf ankommen zu lassen und lieber ins Meer zu gehen, und ich bin leicht verstimmt, weil meine Entscheidung, die Surfboards zu Hause zu lassen, sich rächen könnte. Wenigstens haben wir Bodyboards im Schrank des Wohnmobils (die nehmen nur wenig Platz weg), also besteht doch noch Hoffnung auf einen Ritt.
Wir verlassen Locquirec auf der Corniche de l’Armorique, die uns auf eine Halbinsel führt, vorbei an Stränden und Sommerhäusern, Kiefern und Dünen. Wir fahren auf den Parkplatz an der Plage des Curés und schauen zum flachen, unberührten Sandstrand hinunter.
Am Ufer bricht sich eine kleine Welle, und es ist niemand sonst am Strand, nur ein paar Wohnmobile stehen auf dem Parkplatz. Wir halten, springen fast in unsere Neoprenanzüge und rennen den steilen Pfad zum Ufer hinunter. Das Wasser ist warm, und die Wellen sind kraftvoll und sauber, der Wind ist ablandig und sorgt dafür, dass sie gut laufen.
Vier Frauen in kurzen Neoprenanzügen folgen uns zum Strand hinunter. Sie waten parallel zum Strand durchs Wasser, das ihnen bis an die Knie reicht, machen Fotos und albern herum. Als sie zum zweiten Mal an uns vorbeigehen, erwischt Lizzy gerade eine Welle, ganz bis zum Strand, bis zu ihnen. Sie fragen, woraus das Board bestehe. So eins hätten sie noch nie gesehen. Lizzy erklärt, dass es altmodische Boards aus Cornwall sind, die man in den 1960er- und 1970er-Jahren benutzt habe, bevor Polystyrol als nicht recycelbare Alternative zu Bootsbau-Sperrholz die Oberhand gewonnen habe. Die Frauen lächeln und gehen weiter. Jedes Mal, wenn sie wieder an uns vorbeikommen, beobachten sie, wie wir die Wellen reiten. Wir überlegen, sie zu fragen, ob sie es mal ausprobieren wollen, aber dann verschwinden sie selbst in der Brandung und schwimmen in die offene See hinaus. Dann kommen sie wieder aus dem Wasser heraus und trocknen sich ab.
Wie vorhergesagt, kommt der Regen, als wir den Strand gerade verlassen wollen. Er schlägt aufs Dach, während wir Lannion erreichen, um auf der Corniche Bretonne weiterzufahren, der Straße, die über 48 Kilometer, bis nach Perros-Guirec, der Rosa Granitküste folgt. Der Regen lässt nach, als wir in Ploumanac’h haltmachen, dem selbst ernannten »französischen Dorf des Jahres 2015« – ein absolutes Muss an dieser Küste. Auf der Suche nach einem Parkplatz kurven wir ein paarmal durchs Dorf und stellen uns vor, wie voll es hier im August sein muss. Wie in vielen anderen sehr beliebten Orten auch, befindet sich der Parkplatz für camping cars etwas außerhalb, deshalb setzen wir uns auf unsere Fahrräder und fahren ins Dorf, wir halten uns in Richtung des Leuchtturms, der aus rosa Granit besteht. Als wir die Küste erreichen, schließen wir die Räder ab und gehen über den Sentier des Douaniers (einen Küstenwanderweg) zum Strand. Hier wird uns klar, warum der Ort so beliebt ist: Der rosa Granit ist einfach fantastisch.
Riesige Felsblöcke haben sich durch die Witterung in glatte Gebilde verwandelt, die aussehen wie Skulpturen von Henry Moore. Dort, wo Wasser und Wind in Tausenden von Jahren Furchen, Mulden und Rinnen in den Fels gegraben haben, sind Formationen entstanden. In einer solchen Umgebung bin ich noch nie gewesen. An einigen Stellen sehe ich Gesichter im Fels, an anderen aufgeschichtete Felstürme, die anscheinend auf nur einem oder zwei kleinen Punkten balancieren. Sie sehen aus, als ob man sie ganz leicht mit einer Hand umstoßen könnte, und doch wirken sie gleichzeitig so massiv und unbeweglich. Die Farbe des Felses, ein rötliches Rosa mit Partikeln von funkelndem weißem Quartz und dunklen Klecksen, teilweise mit einer graugrünen Flechte überzogen, kontrastiert mit dem milchig-grünen Meer und Flecken von torfig-violetter Heide sowie gelbem, mit Ginster überzogenem Untergrund. An wieder anderen Stellen sieht der Fels aus wie von Disney entworfen, so perfekt ist er.
Als der Regen zurückkehrt – diesmal schüttet es –, suchen wir Schutz unter einem riesigen vorspringenden Felsblock, der aussieht, als würde er jeden Moment umkippen. Das Wasser strömt vom Felsen vor uns herunter, sodass wir uns vorkommen wie hinter einem Wasserfall. Wir beobachten, wie die Leute zurück zu ihren Autos rennen, sich, wie wir, unter Felsen verstecken oder den Guss unter riesigen wasserdichten Capes und Schirmen grinsend über sich ergehen lassen. Als der Regen nachlässt, sodass wir wieder herauskönnen, funkeln die Felsen wie teure Granitarbeitsplatten, so als hätte Henry Moore Küchen entworfen.
Wir verbringen diese Nacht am Meer; unser Wohnmobil schaukelt auf einem verlassenen Kai in Tréguier im Wind. Wenn wir aus dem Seitenfenster schauen, können wir nur Wasser sehen und wie der Wind die sprühende Gischt aufpeitscht. Als wir aufwachen, erscheint es uns unmöglich, dass die Bretagne so grau ist, wenn man bedenkt, wie wir sie am Tag zuvor erlebt haben.
Der Granit wird dunkler und trüber, als wir uns in Richtung Osten aufmachen und über Seitenstraßen zum Leuchtturm und zu den versteckten Stränden von Cap Fréhel, durch Dinard und dann weiter nach Saint-Malo fahren. Die Küste ist gebrochen und verschachtelt, und wir haben das Gefühl, als könnten wir hinter jeder Ecke etwas Neues entdecken. Es ist eine Küstenlinie scheinbar endloser Möglichkeiten. Während an einem Strand eine tosende Brandung herrscht, kann es am nächsten ganz ruhig sein.
Wir halten in Saint-Malo, dessen Mauern aus dunklem Granit gebaut sind, genauso wie das von Vauban entworfene Fort, das auf einer kleinen Insel hinter einem gelben Sandstrand steht. Wir fahren mit den Rädern über geometrisch angelegte Plätze, durch kleine Gassen mit Kopfsteinpflaster und an schicken Läden mit gestreiften Hemden und Strohhüten vorbei, bis wir die Mauern erreichen. Von hier aus können wir den Küstenverlauf sehen: Er ist mit schwarzen Granitbrocken gesprenkelt, zwischen denen grüne Fahrrinnen für die Schiffe verlaufen, die hier im Hafen anlegen wollen. Diese Küste unterscheidet sich stark von der Rosa Granitküste und ist ihr doch so ähnlich. Es ist ein Wechsel von Stimmung und Farben, der dennoch aufregend und lebendig ist.
Vor Saint-Malo fahren wir wieder auf die Route de la Baie und folgen der Küste am Damm entlang, der am Rand der Bucht von Mont-Saint-Michel die Salzmarschen vom urbar gemachten Ackerland trennt. In der Ferne wird unser Ziel zu einem Wegweiser, den wir nicht ignorieren können – auch wenn er sich in 20 Kilometern Entfernung mitten in der Bucht befindet. Le Mont-Saint-Michel ist immer noch so beeindruckend wie damals, als ich ihn als kleines Kind zum ersten Mal gesehen habe. Er erhebt sich in den Himmel wie ein Schiff, das in einem leuchtenden Watt voll hellgrünem Meerfenchel gestrandet ist, wobei seine vergoldete Turmspitze die Wolken durchstößt. Er ist atemberaubend, und trotz der Touristenbusse und der maskentragenden Menschenmassen bin ich einfach überwältigt. Der Kontrast zwischen der Turmspitze sowie den gezackten Umrissen der Gebäude, mit denen der Felsen bebaut ist, und den sanften, natürlichen Linien der Flüsse, der Flecken von Weideland und der kleinen Inseln im Mündungsgebiet drum herum könnte nicht größer sein. Es ist kein Wunder, dass man den Mont-Saint-Michel einst als Darstellung des Himmels auf Erden betrachtet hat, als etwas, das dem Himmel am nächsten kam, ohne dass man selbst dort gewesen sein musste. Wie Pilger nehmen wir die navette (den Shuttlebus) vom Parkplatz aus, wandern durch die Straßen und stehen mit offenem Mund vor dieser Architektur, beeindruckt von der Leistung und der Hingabe, die darin ihren Ausdruck finden.