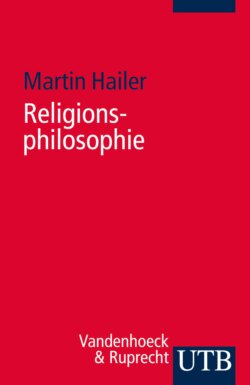Читать книгу Religionsphilosophie - Martin Hailer - Страница 11
Оглавление2. Den entzogenen Grund denken
I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Werke Bd. IV, Darmstadt 1983, 103–302; ders. Kritik der reinen Vernunft, Werke Bd. II, Darmstadt 1985; Platon, Phaidros, in: Werke Bd. 5, bearb. von D. Kurz, Darmstadt Neudruck 2001, 1–193; ders., Politeia (Der Staat), Werke Bd. 4, bearb. von D. Kurz, Darmstadt Neudruck 2001; J. Rawls, Geschichte der Moralphilosophie. Hume – Leibniz – Kant – Hegel, Frankfurt/M. 2002. L. Wittgenstein, Tractatus, Logico-Philosophicus, in: Werkausgabe Bd. 1, Frankfurt/M. 51989, 7–85; ders., Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und religiösen Glauben, Frankfurt/M. 22001.
In diesem Kapitel kommen große Vertreter der rationalen Theologie zu Wort. Sie werden daraufhin befragt, wie sie mit der Grundschwierigkeit umgehen, einen ›Gegenstand‹ denken zu wollen, der ein Gegenstand doch nicht sein kann. Es gehört zu den hermeneutischen Selbstverständlichkeiten, anzunehmen, dass ein Autor von Rang etwas, was man als Problem empfindet, selbst eher und deutlicher sah. Der amerikanische Ethiker John Rawls nannte das den Grundsatz, »daß die Autoren, die wir studierten, viel gescheiter gewesen waren als ich selbst. Wären sie es nicht gewesen, warum hätte ich dann meine eigene Zeit (…) mit ihrer Lektüre vergeuden sollen?« (Rawls 17f) Wissend, dass die Lektüre dieser Originale gewiss keinerlei Zeitvergeudung ist, folgt hier der Blick auf drei charakteristisch unterschiedliche Weisen, mit der Grundschwierigkeit der rationalen Theologie umzugehen.
a) Platon: Das blendende Licht und die Macht der Bilder
Eines der bekanntesten Stücke aus dem Werk Platons (428–348 v.Chr.) ist das sogenannte Höhlengleichnis. Es ist neben dem Seelenmythos (Phaidros 246a–247e) der Textausschnitt aus Platons Werk, in dem die Grundschwierigkeit der rationalen Theologie in besonders dichter und für ihn besonders typischer Weise behandelt wird. Der Kontext der Argumentation ist in etwa folgender: Sokrates und seine Gesprächspartner beraten in umfangreichen Erörterungen, wie ein ideales Gemeinwesen aussehen könnte. Eine Kernfrage dabei ist, ob der ideale Staat eine Verpflichtung zur Wahrheit hat. Staaten, so könnte man ja durchaus meinen, haben dies nicht: In ihnen gilt das, was das Gemeinwesen leidlich funktionieren lässt und worauf die Bürgerinnen und Bürger sich einigen. In Demokratien etwa geht es nicht um ›Wahrheit‹, sondern um politisches Funktionieren und den guten Kompromiss innerhalb bestimmter grundrechtlicher Grenzen. Das freilich, so Sokrates und seine Freunde, soll im idealen Staat nicht so sein (entsprechend kritisch sieht er die Demokratie: Politeia 555b–562a). Die Gesetze und Ideale sollen vielmehr von denjenigen Menschen festgelegt werden, die sich nicht nach der jeweiligen kurzlebigen Mode mal so und mal so verhalten, sondern die »das, was immer/ewig sich gleich bleibt, erfassen können«. (Pol 484b) Diese Menschengruppe aber sind die Philosophen. Das muss gegen einen gewissen modephilosophischen Trend derjenigen gesagt werden, die Philosophie mit gut ankommender Rhetorik verwechseln (nichts übrigens, was es nur zur Zeit Platons gegeben hätte!), auch ist das Erkenntnisstreben eines Philosophen durchaus gefährdet. (Pol 490d–495b) Ist das aber geklärt, so kann man sagen: Ein von Philosophen eingerichteter Staat wird nicht nach bloßer Tradition oder nach gerade vorhandenen Machtkonstellationen leben. Die Philosophen werden vielmehr daran gehen, ihn nach Maßgabe des »natürlicherweise Gerechten, Guten und Besonnenen« einzurichten. (Pol 501b) Wer einen philosophisch geführten Staat möchte, muss also akzeptieren, dass er nur von denen geleitet wird, die in besonderer Weise befähigt sind. Er/sie bekommt dafür aber die Garantie, dass dieser Staat auf den Wahrheiten der Gerechtigkeit, des Guten und der klugen Abwägung aufruht.
Der nächste große Gedankenschritt fragt, worin diese Wahrheiten denn nun bestünden. Eine verzweigte und auch auf andere Dialoge Platons ausgedehnte Argumentation bringt an den Tag, dass das Konzept des ›Guten‹ der wichtigste Wahrheitsbesitz ist, den jemand haben kann. Die einfachste Begründung dafür geht so: Man muss sich nur vorstellen, von einem Gegenstand alle Exemplare zu besitzen, die es überhaupt gibt, gleich ob es sich um eine Süßigkeit handelt, eine CD oder einen Tisch. Wüsste der Besitzer all dieser Dinge nicht, welches oder welche davon gut sind, dann hätte er nur einen unübersehbaren Berg an Dingen, aber er hätte im Wortsinne nichts, was zu besitzen sich lohnt. Aus diesem Grund ist die Fähigkeit, aus dem unüberblickbaren Heer von Gütern diejenigen herausfinden zu können, die ›gut‹ genannt zu werden verdienen, die herausragendste aller Eigenschaften. (Pol 505a–b)
Was das Gute nun näherhin ist und wie man zu ihm gelangt, muss offenbar der Kern der Erörterung sein. Hier nimmt das in der Politeia berichtete Gespräch eine eigentümliche Wendung. Die diskursive und traditionskritische Erörterung der langen Abschnitte zuvor wandelt sich zu einer Reihe von drei Gleichnissen, dem Sonnengleichnis, dem Liniengleichnis und eben dem wohlbekannten Höhlengleichnis. Die ersten beiden (Pol 506b–511e) gehören in die Erörterung dessen, was das Gute an sich ausmacht, das Höhlengleichnis baut hierauf auf, fokussiert aber auf diejenigen, die sich die Erkenntnis des Guten zur Lebensaufgabe machen, also auf die Philosophen. Es erzählt folgendes:
Ganz normale Menschen meinen, dass sie es in ihrem ganz normalen Leben mit realen Dingen und Weltzuständen zu tun haben. Das ist jedoch ein Irrtum, denn sie sehen nur flüchtige Schatten. Die Menschen sind, entgegen ihrer Annahme, nämlich wie gefesselte Gefangene in einer Höhle. Was sie für die realen Gegenstände halten, sind Schatten, die an eine Wand in der Höhle projiziert werden, indem jemand außerhalb der Höhle Gegenstände vorbeiträgt und ein ebenfalls außerhalb brennendes Feuer jene Schatten erzeugt. Da niemand diese Höhle verlässt, ist die Einigkeit über die Realität dessen, was doch nur Schatten sind, komplett. Nun könnte es aber sein, dass jemandem die Fesseln abgenommen würden und er gezwungen würde, sich der Lichtquelle zuzuwenden. Das ist für diesen Menschen freilich keine Erleichterung oder Befreiung, sondern zunächst eine große Irritation, weil die Selbstverständlichkeit dessen, was für real gehalten werden darf, damit durchbrochen wird. Dieser Einzelne wird nun mit Gewalt aus seiner gewohnten Umgebung gerissen und aus der Höhle geführt. Er muss einen unwegsamen und steilen Aufgang nehmen, bis er ganz ans Licht der Sonne kommt. Erst allmählich gewöhnen sich seine Augen an dieses Licht. Er sieht die Schatten, die die anderen Menschen für Realität halten, die anderen Dinge, schließlich sogar das, was am Himmel ist und den Himmel selbst. Es ist ihm sogar vergönnt, die Sonne zu sehen und »er wird es schon schaffen, herauszufinden dass sie Zeiten und Jahre hervorbringt und allem im sichtbaren Raum die Ordnung gibt und auch von dem, was dort sichtbar ist, die Ursache ist.« (Pol 516b–c) Da er dies erkannt hat, bemerkt er, wie vollständig die anderen Menschen irren, die darum wetteifern, das am besten zu erkennen und für real zu halten, was doch nur Schatten sind. Kehrt derjenige, dem es vergönnt war, die Sonne zu sehen, wieder in die Höhle zurück, so wird ihm dort vorgehalten werden, dass er sich die Augen verdorben habe und dass es nicht lohnt, diesen beschwerlichen und irritierenden Aufstieg zu unternehmen. Mehr noch: Jeden, der einem diese irritierenden Erkenntnisse antun will, muss man fangen und umbringen. (Pol 514a–517a)
Dieses Gleichnis gibt vielfach Auskunft, selbst dann, wenn wir uns nur auf die Aspekte konzentrieren, die es zur Grundschwierigkeit der rationalen Theologie beisteuert, das Undenkbare denken zu wollen. Folgendes ist hier mindestens zu nennen: (1) Es ist radikal unwahrscheinlich, den höchsten aller Gegenstände überhaupt zu Gesicht zu bekommen, weil man sich dafür von tief eingewurzelten Vorstellungen über das, was wirklich ist, befreien muss. Genauer: Man muss davon befreit werden – das Gleichnis spricht ausdrücklich davon, dass der Einzelne, der die Höhle verlässt, dies nicht aus eigenem Antrieb, sondern gezwungenermaßen tut. Auch wird er bei Rückkehr auf die geballte Feindschaft seiner Mitmenschen treffen. (2) Die Erkenntnis der höchsten Wahrheit ist mühsam, schmerzhaft und ein langer Prozess, der wortwörtlich als ein zurückzulegender Weg beschrieben wird. (3) Die Erkenntnis der höchsten Wahrheit geschieht nicht isoliert, sondern ist eingebettet in die Schau der Weltgegenstände und des Himmels. Sie ist also der Abschlusspunkt einer Gesamtorientierung, welche die Täuschungen des ganz normalen Lebens hinter sich lässt. (4) Die Erkenntnis der höchsten Wahrheit selbst ist keine Erkenntnis im begrifflichen Sinn: Der Philosoph sieht für einen Augenblick in die Sonne. Er hat also einen kurzzeitigen optischen Eindruck, eine Vision. Dass sie es ist, die alles ordnet und allem seinen Platz gibt, wird im zitierten Satz aus dem Höhlengleichnis ausdrücklich als ein nachgelagerter Schluss bezeichnet, und überdies als einer, der keine notwendige Folge anzeigt, sondern von dem man annehmen muss, dass es klappen wird. Eine Vision und eine gar nicht sicher stattfindende, nachgelagerte Schlussfolgerung machen also den Kern der Sache aus. (5) Die Erkenntnis des Philosophen macht einsam: Die Erkenntniswettbewerbe seiner Mitmenschen findet der Philosoph ab jetzt albern, auch wird er seiner Aussagen wegen von ihnen für verrückt erklärt und mit dem Tode bedroht. (6) Über den höchsten aller Gegenstände selbst wird nur gesagt, dass er die Sonne ist; eine Theorie seiner Eigenart liegt nicht vor, wohl aber Schlussfolgerungen, die seine Tätigkeiten und Effekte betreffen. Das wird (7) noch dadurch unterstrichen, dass das Höhlengleichnis insgesamt den Werdegang des Philosophen beschreibt. Es ist also mindestens eine Mischform aus rationaler Theologie und Philosophie der Religion, weil es deutlich macht, dass die rationale Theologie nur über den Weg der Religion des Philosophen erschwinglich ist.
Diese Elemente können durchweg als Ausdruck dessen gelesen werden, wie radikal unwahrscheinlich, schwierig und letztlich gar nicht begrifflich die ›Erkenntnis‹ der letzten und höchsten Wahrheit ist. Dazu kommt noch (8) die Beobachtung zur Darstellungsweise: Der platonische Sokrates entwickelt nicht eine Theorie, sondern wechselt am Gipfelpunkt seiner Argumentation ins Medium der Erzählung und des Gleichnisses. Das geschieht an entscheidenden Argumentationsstellen im Werk Platons öfter und ist also kein Zufall. Vielmehr scheint hier zu gelten: Erkenntnisse höchster Rangordnung sind nicht begrifflicher Natur. Der Weg zu ihnen ist nur im Bild beschreibbar.
b) Kant: Gott ist kein Gegenstand, aber denknotwendig
In einem ganz anders gelagerten intellektuellen Klima bearbeitet Immanuel Kant (1724–1804) genau dasselbe Problem wie Platon, weshalb es reizvoll ist, die Position der beiden Denker unmittelbar nebeneinander zu stellen.
Kant gilt gewöhnlich – gleich, ob das lobend oder kritisch gemeint ist – als der Philosoph der Aufklärung. Freilich ist er es in einem besonderen Sinn. Die große kritische Gedankenkraft, mit der die Aufklärung an Traditionen, Religion, Regierungsformen usw. herangegangen war, findet Kants Beifall. Er geht aber einen entscheidenden Schritt weiter: Diese Fähigkeit zum kritischen Denken darf sich nicht nur nach außen – eben an Tradition, Religion, Politik usw. – wenden, ihr erster Adressat ist der Denkende selbst. Erst als Selbstkritik ist Kritik wirklich in ihr Reifestadium gekommen. Damit traf Kant einen wunden Punkt der Aufklärungszeit. Es war unbestritten viel nützliche Kritikarbeit geleistet worden. Das Kritikinstrument dabei aber war so gut wie nicht selbst zum Gegenstand gemacht worden. Genau das ist das Programm, das Kant sich für seine kritische Philosophie gibt: Die Vernunft selbst muss analysiert werden, ihre spezifische Leistungsfähigkeit und damit aber auch die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit müssen analysiert werden. Diese Arbeitsaufgabe spiegelt sich im Titel der drei Bücher wieder, die für das Programm stehen: Die ›Kritik der reinen Vernunft‹ (KrV) analysiert die reine = theoretische Vernunft, also das Vermögen zur Beobachtung und zum Ziehen von Schlüssen, die ›Kritik der praktischen Vernunft‹ (KpV) fragt nach dem Praktischwerden der Vernunft, also nach moralischen Entscheidungen, die ›Kritik der Urteilskraft‹ (KU) analysiert Wert- und Geschmacksurteile. In Sachen Gottesbegriff fallen die wichtigsten Grundentscheidungen in der KrV und spielen dann zu einer Grundentscheidung der KpV hinüber.
Die Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft ist eine separate Lektüre wert, weil sie in der relativen Kürze von 21 Seiten eine programmatische Kurzerklärung des kritischen Programms enthält. Mit Blick auf die ziemlich bewegte Aufnahme der 1. Auflage umreißt Kant hier die wesentlichen Elemente seines über siebenhundert Seiten langen Werks. In dieser Vorrede nun steht der oft zitierte Satz: »Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen«. (KrV B XXX) Ein unerhörter Satz, der – wie zu sehen sein wird – bis heute Aufmerksamkeit erhält und nicht unwidersprochen bleibt. Für Kant steht er in folgendem Zusammenhang: Könnte ich von Gott etwas wissen, könnte ich Gottes Existenz belegen, könnte ich seine Eigenschaften beschreiben usw., dann könnte Gott nicht Gott sein. Warum? Menschliche Erkenntnis, so Kant, geht auf Gegenstände der Erfahrung und auf mögliche Gegenstände der Erfahrung. Sie bezieht sich also auf Dinge und Weltzustände, die man sehen, messen, wiegen oder sonstwie zur Erfahrung bringen kann oder von denen man doch mit guten Gründen vermuten darf, dass sie Gegenstand von Erfahrung werden könnten (so ist es z.B. wenn die theoretische Physik die Existenz eines Materieteilchens postuliert und der Nachweis seiner Existenz wegen des enormen apparativen Aufwands erst später erfolgt; dergleichen ist recht häufig vorgekommen). Was ich erkenne, erkenne ich aber anhand von Gesetzmäßigkeiten, eben indem ich es messe, wiege oder sonstwie zur Erfahrung bringe. In Sachen Gotteserkenntnis stellen sich dann gleich zwei Schwierigkeiten: Erstens, kann er überhaupt unter die Gegenstände tatsächlicher oder möglicher Erfahrung gerechnet werden? Und zweitens, wäre Gott noch Gott, wenn wir ihn so beobachten, wie wir beobachten können, nämlich anhand von Gesetzmäßigkeiten? Beide Fragen muss man im Sinne Kants verneinen. Um mit der zweiten zu beginnen: Was ich anhand von Gesetzmäßigkeiten beobachte, kann nicht frei sein. Ich sehe ja Regelmäßigkeiten und Anwendungsfälle von Naturgesetzen, ich sehe also das, was Kant an vielen Stellen den ›Naturmechanism‹ nennt. Gott als Anwendungsfall von Gesetzen und dem ›Naturmechanism‹ unterliegend? Mit der Idee, dass Gott frei, allmächtig usw. ist, geht das offenbar nicht zusammen. Zur ersten Schwierigkeit ist zu sagen: Wäre Gott ein Gegenstand möglicher oder tatsächlicher Erfahrung, dann wäre er Teil der Welt. Das aber ist ein direkter Widerspruch zur Basisannahme über Gott, gleich ob sie aus griechisch-philosophischer oder aus biblischer Richtung kommt: Gott steht der Welt gegenüber, er ist kein Teil von ihr.
So bleibt nur der Schluss: Ist Gott, so ist er kein Teil der Welt. Deshalb kann es auch keine Kenntnis über ihn geben. Die philosophischen Gotteslehren, die viel über ihn zu wissen meinten, sind dann aber gänzlich falsch. Sie geben vor, in einem Bereich Kenntnisse zu haben, in dem man aus den eben kurz genannten Gründen keine Kenntnis haben kann. Diese Vorspiegelung von Kenntnis nennt Kant Dogmatismus. Das eben gegebene Zitat heißt im Ganzen und aus diesen Erläuterungen in eckigen Klammern ergänzten Satz so:
»Ich mußte also das [falsche, nur vorgespiegelte] Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen [denn etwas, was ich erkenne, wäre nicht Gegenstand meines Glaubens], und der Dogmatismus der Metaphysik, d.i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft [ohne die beschriebene Selbstkritik] fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist [und damit Wissen behauptet, wo es nichts zu wissen gibt].« (KrV B XXX)
Dieses Ergebnis war (und ist) ein harter Schlag: Selbstkritische Vernunft erkennt, dass es in Sachen Gott nichts zu wissen gibt. Kant baut dieses Argument aus, indem er – im Gestus schon fast genüsslich und nicht ohne Humor – einen Gottesbeweis nach dem anderen (vgl. unten Kap. 4) zerpflückt und für untauglich erklärt. (KrV B 611–671) Ist also das das Ergebnis: Rationale Theologie ist aus und vorbei, weil sie etwas zum weltlichen Gegenstand machen muss, was nun mal kein weltlicher Gegenstand ist? Kant ist so gelesen worden und (nicht nur) das hat ihm das Epitheton ›Alleszermalmer‹ eingebracht. Und doch stimmt es nicht. Es gehört zur Größe – oder, wenn man unter die Kritiker seines Werks zählt, die es selbstverständlich bis heute gibt – zur Inkonsequenz seines Werks, dass er zwischen der Idee Gottes und einer ihn beschreibenden Theorie unterscheidet. Letztere kann es nicht geben, die erstere ist sehr wohl nötig. Zu dieser auf den ersten Blick überraschenden Wendung führen zwei Gedankenspuren:
(1) Die theoretische – bei Kant: die reine – Vernunft braucht die Idee Gottes. Denn sie muss annehmen, dass ihre Erkenntnis sich irgendwie erfolgreich auf Wirklichkeit bezieht. Das kann sie nicht selbst kontrollieren und deswegen muss sie setzen, dass es eine Größe gibt, die sowohl die Vernunft als auch die gesamte Welt und ihren Inhalt kennt. Das kann kein Teil der Welt sein und muss also Gott sein. – Notabene: Die Vernunft weiß nicht, ob es diesen Gott gibt. Sie muss es um ihrer selbst willen als gültig behaupten und also setzen. Kant nennt dies Gott als ›regulative Idee‹ und achtet sorgfältig darauf, aus dieser Idee Gottes keine Theorie über ihn werden zu lassen. (KrV B 672 u.ö.)
(2) In einem Gedankengang, der so in der Kritik der reinen Vernunft nicht angelegt ist, kommt Kant im Rahmen der Kritik der praktischen Vernunft auf Gott zu sprechen. Er führt dort aus, dass die einzig akzeptable Ethik eine ist, die aus Vernunft agiert. Ich soll nur und ausschließlich das tun, was die Vernunft mir gebietet. Kant nennt das: Pflicht. Und nun wird, wer ausschließlich pflichtmäßig lebt, die Erfahrung machen, dass nicht er, sondern die Schufte in der Welt den Erfolg und den Lebensgenuss davon tragen. Soll er also aufhören, pflichtgemäß zu leben und wie die anderen mittels kleinerer und größerer Gaunereien dem Glück hinterherjagen? Kant lehnt das ab und sagt: Wenn es vernunftnotwendig ist, nach der Pflicht zu leben, dann ist es auch vernunftnotwendig anzunehmen, dass eine Welt entsteht, die dem Leben aus der Pflicht entspricht. Da die – gewiss nicht allzu vielen – Pflichtmenschen diese Welt aber nicht hervorbringen können, ist es vernunftnotwendig anzunehmen, dass es eine Instanz gibt, die diese Welt hervorbringt. Das muss Gott sein. (KpV A 226) – Wiederum ist das nur eine Idee, eine Setzung der Vernunft und kein Beweis.
In beiden Fällen kommt es für Kant also darauf hinaus: Eine beschreibende Theorie Gottes kann es nicht geben – hier muss die Vernunft von einer lange gepflegten Tradition Abschied nehmen und so weit ist die Rede vom ›Alleszermalmer‹ gewiss schon richtig. Aber es bleibt nicht beim schneidenden Nein, vielmehr sieht die Vernunft ein, dass sie um ihrer selbst willen, in theoretischer wie in praktischer Hinsicht die Idee Gottes braucht.
Wo stehen wir? Zwei Antworten auf dieselbe Grundfrage sind in aller Kürze vorgestellt worden: Wie kann ich vom letzten Grund, vom höchsten Wesen sprechen, wenn es doch zum letzten Grund oder höchsten Wesen gehört, über mein Begreifenkönnen hinaus zu sein? Platon antwortete darauf, indem er keine Gottestheorie entwarf, sondern von einer Vision sprach, die zu erlangen sehr mühsam ist und die überdies nur als Moment im Lebensweg eines Philosophen verstehbar wird und also isoliert überhaupt keinen Sinn machen würde: Diese rationale Theologie ist nur in Verschränkung mit der Philosophie der Religion des Philosophen verstehbar – und umgekehrt. Bei Kant liegen die Dinge anders, und doch gibt es eine überraschende Ähnlichkeit: Aus Gründen der Erkenntnistheorie räumte er mit einer rationalen Theologie als Theorie über Gott radikal auf; den Gedanken einer Vision Gottes würde er wohl als Geisterseherei abgetan haben. Und doch ist, wie eben zu sehen war, die Idee Gottes für die selbstkritische Vernunft ganz unverzichtbar. In ihrer zweiten Variante, also mit Blick auf die Kritik der praktischen Vernunft, steckt die relative Nähe zu Platon: Ein pflichtgemäß Handelnder lebt mit der – unbeweisbaren – Annahme, dass Gott existiert. Seine Ethik und damit sein alltäglicher Weltumgang ruhen auf dieser Annahme auf. Es ist keine Gewaltsamkeit zu sagen, dass es sich dabei um so etwas wie die Religion des Philosophen kantischer Prägung handelt.
Beide Male haben wir es mit einer rationalen Theologie zu tun, die deren Grundanliegen – wir sollen mit philosophischen Argumenten von Gott reden – teilt, die das in der Durchführung aber auf eigentümliche Weise durchstreicht und verändert: im nur im Bild auszusagenden Verweis auf den beschwerlichen Lebensweg des Philosophen und in der Selbstkritik, die alle Gottesrede auf ein Postulat, er existiere, zusammendrängt. Das mag als ein erstes Arbeitsergebnis in Sachen rationaler Theologie durchgehen. Die Bandbreite der klassischen Lösungen zu diesem Thema ist freilich noch um einiges größer. Zum Schluss dieses Kapitels soll deshalb noch eine Position zu Wort kommen, die im 20. Jahrhundert zu einiger Prominenz gelangte und auch in den gegenwärtigen Diskussionen um eine Erneuerung der rationalen Theologie (vgl. Kap. 9) diskutiert wird – wenn auch vornehmlich kritisch.
c) Wittgenstein: Vom wirklich Wichtigen lässt sich nichts sagen
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) gehört zu den ganz wenigen Denkern, die gleich zwei namhafte Richtungen des Philosophierens angestoßen oder doch mit wesentlichen Impulsen versehen haben. Sein Frühwerk ›Tractatus Logico-Philosophicus‹ (1921/1922) ist ein Schlüsselbuch für diejenige Philosophie, die sich der formalen Logik und einem engen Bezug zur Empirie verschrieben hat und für die die klassischen Themen der Metaphysik und auch der rationalen Theologie fern und absurd klingen. Nach gedanklichen Umbruchphasen arbeitete Wittgenstein bis zwei Jahre vor seinem Tod an den ›Philosophischen Untersuchungen‹ (erschienen postum 1952). Dieses Werk hat eine ganz andere Richtung der Philosophie inauguriert, die Philosophie der normalen Sprache. Die Philosophischen Untersuchungen haben in der Theologie – vor allem im evangelischen Bereich – teilweise interessierte Aufnahme gefunden. Das ist durchaus erstaunlich, weil religiöse Themen in ihnen so gut wie keine Rolle spielen. Durchaus anders ist das im Tractatus. Für die Frage nach der Darstellbarkeit des Nicht-Darstellbaren ist ein Blick darauf lohnend, weil Wittgenstein die bei Kant erkennbare Tendenz durchaus noch einmal verstärkt, dabei aber eigene Akzente setzt.
›Der Tractatus‹, wie das Buch, das sein Autor selbst als ›Logisch-Philosophische-Abhandlung‹ betitelte, stets genannt wird, ist ein genauso schmales wie außerordentlich streng komponiertes Buch. Auf unter 80 Seiten legt Wittgenstein unter anderem eine Ontologie, eine Satztheorie, eine Wahrheitstheorie und anderes vor. Die argumentative Struktur ist dabei völlig in die hierarchische Bezifferung der einzelnen Sätze integriert, so dass Satz 1 von Satz 1.1 erläutert wird usw. Das Buch hat sieben Hauptsätze und eine fein gegliederte Hierarchie von mehreren hundert Unter-Sätzen. Bereits hier zeigt sich die strenge Richtung der analytischen Philosophie, die auf logische Nachvollziehbarkeit der Gedankenführung großen Wert legt.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass der Tractatus an Themen der Religion keinerlei Interesse haben dürfte. Denn in ihm wird die Anschauung des logischen Atomismus vermittelt: Die Welt ist ein großes gegliedertes Ganzes. Die einzelnen Teile der Welt kann man Dinge oder Gegenstände nennen. Sie treten in sehr vielen verschiedenen Gruppierungen auf, die Wittgenstein Sachverhalte nennt. Die Gesamtheit aller Sachverhalte macht die Welt aus. Einzelne Sachverhalte sind voneinander unabhängig und man kann nicht von einem Sachverhalt auf den nächsten schließen. (2.061 und 2.062) – Das ist bereits die Grundintuition des logischen Atomismus, nach dem wir uns die Welt als Ensemble relativ unverbundener Dinge und Zustände denke sollen, eben als riesiges Aggregat von selbständigen Atomen.
Dieser Welt korrespondiert die menschliche Fähigkeit zur Erkenntnis. Freilich kann als Erkenntnis nur das gelten, was die Struktur der Gegenstände, Dinge und Sachverhalte abbildet. Wahre Sätze sind also Abbilder der Wirklichkeit. Die einfachsten dieser Sätze werden – im Tractatus nicht dem Begriff, aber der Sache nach – oft als Protokollsätze bezeichnet, weil es ihre Aufgabe ist, ein kleines Stück Wirklichkeit getreu abzubilden. (2.18) Neben diesen Protokollsätzen sind nur noch solche Sätze wahrheitsfähig, die als logische strenge Ableitungen aus ihnen hervorgehen. Das damit verbundene Ziel ist: Eine Sprache, die mit Protokollsätzen beginnt und nur logische Ableitungen aus ihnen zulässt, ist wahres Reden über den Zustand und Inhalt der Welt. Alles andere Sprechen – das es ja in größter Zahl und Variationsbreite gibt – ist demgegenüber pure Phantasie und nicht wirklichkeitshaltig.
Diese philosophische Stoßrichtung war vor allem gegen die spekulativen und metaphysischen Richtungen der europäischen Philosophie gerichtet, die Ideen für das eigentlich Wirkliche hielten und den Kontakt zur empirisch fassbaren Wirklichkeit entsprechend gering schätzten. Ihnen sollte gezeigt werden, dass es sich um nicht mehr als Phantasie und Geisterseherei handelte. Ein von der gesamten Richtung des logischen Atomismus durchaus gewünschter Nebeneffekt war, dass die Rede von Gott und Religion in der Philosophie keinerlei Rolle mehr spielen sollte, weil ihre Sätze ja evidenterweise nicht als Protokollsätze von einfachsten Dingen, Gegenständen und Sachverhalten beginnen und daraus logische Ableitungen vornehmen. Es gehört – auch und zumal für die ersten Rezipienten des Tractatus in den 1920er Jahren – zum Überraschenden des Werks, dass in ihm sehr wohl von Ethik, Gott, Religion und sogar von Mystik die Rede ist.
Möglich oder sogar zwingend wird das für Wittgenstein, weil es die Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen gibt. Sinnvollerweise sagen kann man nur Sätze, die die Wirklichkeit protokollieren, sowie Ableitungen von diesen Sätzen. Es gibt aber noch mehr in der Welt, was Menschen durchaus brauchen und worauf sie rekurrieren. So muss zum Beispiel, wer Protokollsätze anfertigt, davon ausgehen, dass die Form seiner Sätze und die Form derjenigen Wirklichkeit, die von ihnen abgebildet wird, identisch sind. Dass das so ist, darüber kann kein sinnvoller Protokollsatz gebildet werden, es muss sich vielmehr zeigen. So ist bereits die Formulierung eines Protokollsatzes darauf angewiesen, dass es die Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen gibt. Die Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen ist aber noch für ganz andere Bereiche wichtig, so zum Beispiel für die Ethik: Dass es Ethik gibt, ist irgendwie klar, denn Menschen müssen sich verhalten und sie müssen sich dabei – nicht immer, aber oft genug – entscheiden. In den logisch bildbaren Sätzen kann die Ethik aber nicht enthalten sein, weil diese ein Abbild der Gegenstände der Welt darstellen und weiter nichts. Folgerung: »Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken.« (6.42) Ich kann in sinnvollen Sätzen nicht über Ethik sprechen. Gibt es sie also nicht? Im nächsten erläuternden Satz sagt Wittgenstein: »Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen läßt.« (6.421) Die Schlussfolgerung heißt also: Nur weil sich etwas nicht sagen lässt, heißt es noch lange nicht, dass dies ›etwas‹ nicht existiert. Es gehört allerdings dem Bereich des Zeigbaren, nicht dem des Sagbaren an.
Diese Bestimmung wendet Wittgenstein auch auf den Bereich dessen an, was er im Tractatus Mystik nennt und was mit Religion in etwa deckungsgleich ist. Mystik bzw. das Mystische ist geradezu das Paradebeispiel für die Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen: »Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.« (6.522)
Und was ist dann das Mystische? Wittgensteins erste Antwort ist knapp und vielleicht enttäuschend: »Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen.« (6.5) Das ist, hält man sich die Satztheorie des Tractatus vor Augen, konsequent. Freilich geht Wittgenstein in einigen Andeutungen doch weiter. Wie kann sich etwas zeigen, das außerhalb der sinnvollerweise bildbaren Sätze liegt? Es kann sich nicht auf Teilbereiche der Welt beziehen, weil diese ja in Protokollsätzen beschreibbar wären. Also muss es mit dem Ganzen der Welt zu tun haben. Wittgenstein rekurriert auf die Erfahrung, dass zwei Menschen genau dasselbe sehen und dabei doch ganz andere Empfindungen haben können: »Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die Welt des Unglücklichen.« (6.43) Es geht also um eine Einstellung zur Welt überhaupt. Sie kann sich, so viel sollte klar sein, nur zeigen. In logisch sinnvollen Sätzen kann sie nicht debattiert werden. Und doch ist unabweisbar, dass es solche Einstellungen gibt und dass jeder Mensch so oder so dem Ganzen der Welt gegenüber eingestellt ist. Wer sich in einer Einstellung vorfindet, die das Ganze der Welt dankbar und staunend hinnehmen kann, dürfte den Satz mitsprechen können: »Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern daß sie ist.« (6.44) Und was, so suggeriert er damit, wäre wichtiger als dies?
Mehr inhaltliche Auskunft gibt der Tractatus zum Mystischen kaum. Wittgenstein deutet noch an, dass sein Mystikverständnis etwas mit Gott zu tun hat, (6.432) und er beendet sein Buch mit dem Hinweis, dass er, um sinnvolle Sätze möglich zu machen, lauter sinnlose sagen musste. (6.54)
Der Beitrag des frühen Ludwig Wittgenstein zum in diesem Kapitel verhandelten Grundproblem lässt sich anhand von zwei Beobachtungen einordnen: (1) Wittgenstein verschärft den bei Immanuel Kant anzutreffenden Zug noch einmal: Eine Lehre über Gott kann es wirklich nicht geben. Das geht für ihn sogar so weit, dass auch eine regulative Idee namens ›Gott‹, die es bei Kant ja gibt, sinnlos ist. Die erkenntnistheoretischen Annahmen – also die Frage, wie und worüber sinnvolle Sätze gebildet werden können – sind bei Kant und Wittgenstein unterschiedlich, die Grundtendenz in Sachen Unaussagbarkeit Gottes aber ähnlich und bei Wittgenstein noch weiter getrieben. (2) Wittgenstein identifiziert, wie eben gesehen, ›das Mystische‹ und die grundlegende Haltung zur Welt: Bei identischem Inhalt der Welt ist die Welt des Glücklichen eine andere als die des Unglücklichen. Gott/Mystik und die Haltung zur Welt sind also eng miteinander verbunden. Dieses Motiv gibt es bei Kant nur recht indirekt: Für ihn ist die Annahme, Gott existiere, eine notwendige Implikation der Ethik. Man soll aber nicht auf Gott schauen und sich Belohnungen erhoffen, sondern nur und ausschließlich pflichtgemäß handeln. Wittgenstein bringt also den Bezug auf Gott/Mystik und das, was man mit einem ungeschickten Wort das Lebensgefühl nennen könnte, näher zusammen als Kant. Damit erreicht er eine Wiederannäherung an die Konstellation, mit der dies Kapitel begann: Für Platon ist der Bezug zum Höchsten ja nur aussagbar, indem der Lebensweg und damit auch die vielfältigen Erfahrungen des Philosophen in den Blick genommen werden.
Irgendwie, so scheint es, gehören beide zusammen: Die Unnennbarkeit Gottes auf der einen Seite und der Umstand, dass genau damit Erfahrungen verbunden sind, die etwas mit Orientierung, Ausrichtung des Lebens und mit der Wirklichkeit als ganzer zu tun haben. Dieser Konnex – Unnennbarkeit Gottes auf der einen Seite und damit verbundene Orientierung auf der anderen – ist damit erst anfänglich benannt und absichtlich vage umschrieben. Er wird sich für den religionsphilosophischen Gedanken als zentral erweisen, der im nächsten Kapitel vorgestellt wird.