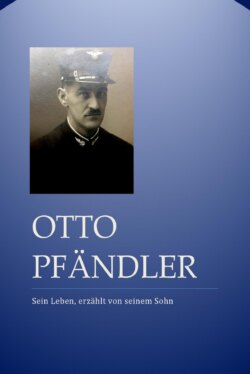Читать книгу Otto Pfändler 1889-1966 - Martin Renold - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1912 – 1913
ОглавлениеMARTIN RENOLD – OTTO PFÄNDLER
Martin Renold
OTTO PFÄNDLER
1889 – 1966
Sein Leben
erzählt von seinem Sohn
Zweite, verbesserte Ausgabe
© 2017
by Marcel Pfändler
Ullmannstraße 11, CH-9014 St. Gallen
Es ist ein warmer Frühlingstag, der erste Samstag im Mai 1912, als am Nachmittag zwei Männer von Othmarsingen her durch den Staatswald nach Birr wandern. Der kleinere, Albert, ist achtundzwanzig Jahre alt, Otto, der jüngere gerade mal dreiundzwanzig. Beide arbeiten in der 1903 gegründeten Biskuitfabrik Jakob Disch-Schatzmann in Othmarsingen. Albert, oder Berti, wie er von seinen Kollegen genannt wird, arbeitet seit dem Gründungsjahr als gelernter Konditor bei Disch. Otto ist gelernter Confiseur und Schokolatier. Er hat die Stelle bei Disch erst am letzten Montag angetreten.
Da Albert gedacht hat, dass sich Otto in der Gegend noch nicht auskennt, hat er ihm am Vormittag gesagt, im „Bären“ in Birr, das hinter dem Kestenberg liegt, sei am Abend Tanz. Sie könnten doch am Nachmittag hingehen. Beide sind Junggesellen. Otto hat ihm sofort zugesagt.
Sie sind nun erst kurz unterwegs. Sie haben das Gleis der Dampfeisenbahn, die von Baden-Oberstadt nach Lenzburg führt, überschritten und sind den kurzen Anstieg zum Staatswald hinaufgegangen und wandern nun auf der ungeteerten Straße durch den Wald, in dem auf der linken Seite mehrheitlich Fichten stehen, während rechts das Sonnenlicht in das junge Laub der Buchen fällt.
Berti ist auf dem elterlichen Bauernhof auf dem Bözberg aufgewachsen und kennt die Gaststätten in den umliegenden Dörfern, wo immer etwas Musik und Tanz ist.
Die beiden haben sich erst ein paar Mal nach der Arbeit mit zwei, drei Kollegen bei einem Bier getroffen. Da Berti in der Backstube arbeitet und Otto in der Schokoladenabteilung, wissen sie noch nicht viel voneinander. Beim Bier an den ersten Abenden, wo Otto dabei war, wurde vor allem über die Arbeit gesprochen, nur ab und zu wurde Otto, der zuerst einmal zuhören wollte, ins Gespräch gezogen. Nun fragt ihn Berti: „Wo hast du zuletzt gearbeitet?“
„Ich war fast zwei Jahre lang in Deutschland“, antwortet Otto. „Ich habe in Flawil bei Munz die Lehre gemacht und habe mich in Halle an der Saale…“
„Was ist denn das für ein komischer Name?“, unterbricht ihn Berti. „Den habe ich noch nie gehört. Wo liegt denn das?“
„Das ist eine Stadt in Sachsen, nahe bei Leipzig“, erklärt Otto. „Die Saale ist ein Fluss. Bei der Schokoladenfabrik Friedrich David und Söhne habe ich mich noch zum Schokolatier ausbilden lassen.“
„Aha“, macht Berti und sagt: „Darum arbeitest du also bei uns in der Schokoladenabteilung.“
Nach einer Weile fragt Berti: „Hast du in Deutschland tanzen gelernt? Ich habe dich gar nicht gefragt, ob du es kannst. Ich hab nur gedacht … du siehst so aus, als ob du es könntest.“
„Ich hab’s nicht gelernt“, antwortet Otto. Aber ich hab schon in Flawil ab und zu mal getanzt, wenn eine Appenzeller oder Toggenburger Musik in der Nähe war. Gewohnt habe ich damals noch bei meinen Eltern auf der Flawiler Egg. Da bin ich oft mit ein paar Kollegen nach Herisau oder Magdenau hinunter gegangen, um mit den jungen Mädchen das Tanzbein zu schwingen. Am Anfang hat die eine oder andere noch Ledige, die unter die Haube kommen wollte, mir gezeigt, wie es geht. Aber dann hab ich’s schnell begriffen und meistens nur noch mit den Jüngeren getanzt.“
„Hast du da eine Freundin gefunden?“, fragt Berti, und als Otto zögert, „oder gar in Deutschland, in dieser Halle?“
„Halle an der Saale“, korrigiert ihn Otto. „Das ist eine große Stadt. Ich glaube, sie hat über hunderttausend Einwohner. Sie hat auch eine elektrische Straßenbahn, weißt du, nicht mehr so eine, die mit Pferden gezogen wird.“
„Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du brauchst nicht rot zu werden“, sagt nun Berti, bleibt stehen und schaut ihm ins Gesicht.
„Was ist das dort oben?“, fragt Otto, der nur auf den Hügel hinauf geschaut hat, der sich, als sie aus dem Wald heraustraten, vor ihnen erhob und auf dem ein, wie es scheint, altes Gebäude sichtbar wird.
„Das ist das Schloss Brunegg“, antwortet Berti. Und die zwei Giebel, die du siehst, gehören zum Pächterhaus.“
„Und ist das der Kestenberg?“, fragt Otto. „Gehen wir da hinauf?“
„Nein, siehst du, da auf der rechten Seite fällt der Berg steil ab. Wir gehen auf der Straße um ihn herum“, erklärt Berti. „Aber du weichst mir aus. Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.“
„Lass uns weitergehen“, bittet Otto, der nicht will, dass sein Kollege ihm ins Gesicht schaut, während er noch überlegt, ob er auf seine Frage antworten soll.
Langsam schreiten sie weiter. Die ersten Häuser
des Dorfes werden sichtbar.
„Ja, ich hab ein Mädchen kennen gelernt in Saale, entschuldige, in Halle an der Saale. Jetzt hast du mich tatsächlich noch drausgebracht. Sie war groß und schlank und überaus schön, und ich hab mich in sie verliebt. Wir haben uns beim Tanzen kennen gelernt. Zuerst dachte ich, sie möge mich auch. Aber dann hab ich gemerkt, dass sie nur mit mir tanzen wollte. Ich sei der beste Tänzer, hat sie gesagt in ihrem ausgesprochen sächsischen Dialekt.“
„Jetzt muss ich dich unterbrechen“, sagt Berti, als sie vor dem Gasthof „zum Sternen“ angelangt sind. „Das ist der ‚Sternen‘." Da geh ich auch oft hin zum Tanzen. Ich glaube, nächsten Samstag ist hier auch wieder Tanz. Komm!“ Und er packt Otto am Ärmel und zieht ihn über den Vorplatz zum Eingang hin. Dort steht eine Tafel, auf der mit Kreide in großen Buchstaben „Nächsten Samstagabend Tanz“ geschrieben steht.
„Und dann, ist nichts daraus geworden? Erzähl doch weiter!“, fordert Berti seinen jungen Kollegen auf.
„Nein“, antwortet Otto. „Wir sind noch ein paar Mal miteinander ausgegangen. Aber ich konnte nicht viel mit ihr reden. Eigentlich war es mir recht. Sie war dumm, und ich mochte ihre komische Sprache ohnehin nicht. Ich habe ihr zu verstehen gegeben, dass ich nicht mehr tanzen möchte und ohnehin bald ich die Schweiz zurückkehren würde. Da hat sie auch kein Interesse mehr an mir gehabt.“
„Und dann hast du eine andere kennen gelernt?“
„Du fragst etwas viel“, gibt Otto zurück.
Unterdessen sind sie bis in die Mitte des Dorfes gelangt, das wahrscheinlich keine hundert Einwohner zählt. Sie biegen nach links ab und gehen bei der Möbelschreinerei Renold vorbei, deren Werkstatt an ein kleines, hübsches Haus angebaut ist, in dem die Witwe Renold einen kleinen Kolonialwarenladen, wie das damals noch hieß, führt. Es ist der einzige Lebensmittelladen in Brunegg.
Weiter oben biegt die Straße nach rechts ab und führt nun bald zum Dorf hinaus auf das Ackerfeld, über das der Weg nun geradeaus auf die Kirche in Birr zu führt.
In der Gaststube im „Bären“, als sie um fünf Uhr ankommen, ist es noch ruhig, nur im Saal werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Die Ländlerkapelle aus Schinznach Bad ist soeben auf einem Fuhrwerk angekommen. Die Musikanten sind abgestiegen und tragen ihre Instrumente, eine Geige, eine Bassgeige und eine Handharmonika herein, und der Klavierspieler geht gleich im Saal aufs Klavier zu, öffnet den Deckel, setzt sich hin und beginnt, die Tasten anzuschlagen, um zu prüfen, ob das Instrument richtig gestimmt ist.
Otto und Berti haben sich bereits in der Wirtsstube niedergelassen. Berti hat sich ein Bier bestellt, Otto einen süßen Most – wenn der Tanz losginge, wäre es noch früh genug für ein Bier. Er hat nicht die Absicht, sich zu betrinken. Beide lassen sich auch ein Brot mit etwas aufgeschnittener Wurst kommen. Sie haben auf dem langen Weg einen rechten Hunger gekriegt. Den ärgsten Durst haben sie unterwegs an einem Brunnen gestillt.
Berti schwärmt von den schönen Frauen, die es in diesem Dorf gebe.
„Warum bist du denn noch ledig, wenn dir so viele gefallen?“, will Otto wissen. Da auch Berti neugierig gewesen ist, wagt er, diese Frage an den Kollegen zu stellen.
„Ach, wenn ich denen sage, dass ich bei Disch arbeite, wollen die alle nur immer, dass ich ihnen gratis Konfekt bringe.“
Otto glaubt nicht, dass dies der wahre Grund ist. Doch er sagt es nicht. Berti schweigt auch.
Als die beiden ihr Abendbrot gegessen haben und es dann im Saal drüben losgeht, wechseln sie hinüber. Es sind noch nicht viele Gäste da, und die Musikanten nehmen sich bald schon eine Pause. Doch allmählich füllt sich der Saal. Berti lädt eine Frau, die er offensichtlich kennt, mit ihren zwei Freundinnen an den Tisch ein und stellt ihnen seinen Kollegen und, wie er sagt, Freund vor.
Otte begrüßt alle drei freundlich, und weil die Musikanten gerade wieder angefangen hatten zu spielen, fordert Otto seine Nachbarin zur Rechten zum Tanz auf.
Otto ist recht groß gewachsen, während seine Tänzerin mehr als einen Kopf kleiner ist als er. Am besten konnte Otto schon immer tanzen mit einer, die ihm mindestens bis ans Kinn reicht. Nachdem er mit allen getanzt hat, muss er feststellen, dass keine seinen Erwartungen entspricht, weder an Größe noch an Schönheit. Während Berti fast immer mit der gleichen tanzt, wechselt Otto mit den zwei andern ab. Weil die Musik ziemlich laut spielt, ist es auch schwierig, sich mit den Tänzerinnen zu unterhalten.
Einmal, als Berti nur zugeschaut hat, sagt er zu Otto, der an den Tisch kommt, nachdem er seine Tänzerin an ihren Platz geleitet hat: „Du bist wirklich ein Naturtalent.“
Otto stutzt einen Moment. Naturtalent? So ein Wort hätte er von Berti nicht erwartet. Es ist sicher ein gescheites Wort. Otto hat es vorher noch nie gehört. Ja, die Natur liebt er. Er ist gern draußen auf dem Land. In Halle war er gern in der Stadt, aber fast noch lieber ging er mit zwei, drei Kollegen und mit deren Mädchen aufs Land hinaus, um über Felder und Wälder und Hügel zu wandern, so wie er daheim oft nach Magdenau oder auf die andere Seite bis Schwellbrunn oder Mogelsberg gewandert ist. Aber dazu brauchte es kein Talent, höchstens so wie es in der Bibel steht im Gleichnis von den Talenten. Geld war damit gemeint. Das brauchte es, wenn man unterwegs einkehren will. Naturgeld? Nein, es musste etwas mit ihm zu tun haben.
Darum fragt er: „Was meinst du damit?“
„Das sagt man so, wenn einer etwas kann, das er nicht gelernt hat“, erklärt Berti, und Otto ist zufrieden mit dieser Antwort.
Otto ist nicht dumm. Gewiss nicht. Er hat in Flawil die Sekundarschule besucht, hat dort auch ein bisschen Französisch gelernt, und in Halle hat er in der Freizeit oft in den Zeitungen gelesen, die meistens in den Wirtschaften, in einen Stecken geklemmt, an einem Kleiderhaken hingen. Da hatte er auch viele neue Wörter kennen gelernt, die er vorher nicht kannte. Aus dem Zusammenhang heraus hat er dann schon gewusst, was so ein Wort bedeutet. Manchmal auch erst, wenn es ihm ein zweites oder ein drittes Mal begegnete.
Auch über die Politik im Kaiserreich weiß Otto ein wenig Bescheid. Mit dem einen oder anderen Kollegen hat er in den zwei Jahren, in denen er in Deutschland war, oft diskutiert und ihnen erklärt, wie die Demokratie in der Schweiz funktioniert, und sie haben über ihren Kaiser Wilhelm II. gesprochen, der gesagt haben soll, man müsse den Dreck des Parlaments und des Parteiapparats wegräumen. Der Kaiser wolle mehr Kriegsschiffe. Und manche sagten, dass es dann bald einmal Krieg gebe.
In Ottos erstem Deutschlandjahr gab es einen Kanzlerwechsel. Der neue Kanzler war wie sein Vorgänger Bülow ein Adliger. Er bemühte sich um einen Ausgleich zwischen den Sozialdemokraten und den Konservativen. Damit fand er aber auf beiden Seiten nicht nur Freunde, sondern auch Feinde.
Davon erzählt er Berti, den er ja noch nicht so gut kennt, jedoch nichts. Er würde ihn später dann schon einmal fragen, auf welcher Seite er stehe, oder es mit der Zeit selber merken.
Berti hat ein rundes Gesicht, aus dem zwei verschmitzt lachende Augen herausschauen. Er hat etwas Bäuerisches an sich, während man in Otto eher einen Städter vermuten würde. Er hat stahlblaue Augen und eine schmale, gerade, etwas zu lange Nase, die aber zu seinem länglichen Gesicht passt. Sein braunes Haar hat er mit einer Scheitel zur Seite gekämmt.
Er zieht die Blicke der Frauen und jungen Mädchen auf sich. Er ist ein Fremder, sieht elegant und gewandt aus. Sie haben ihn hier noch nie gesehen. Sie tuscheln miteinander und fragen sich, woher er kommt.
Nachdem sie sich um Mitternacht auf den Heimweg machten, Berti mit einem ziemlichen Schwips, Otto noch fast nüchtern, fragte Berti:
„Hast du, hat di-ir ei-ne gefallen – ups?“
Otto zuckte mit der Schulter. Doch es war zu dunkel, als dass Berti es hätte sehen können.
„Ha-at dir?“, insistierte Berti. Dann übergab er sich am Wegrand.
Otto musste seinen Kollegen führen, nachdem der sich den Mund ausgewischt und ihn am nächsten Brunnen, wo sie sich auf dem Hinweg den Durst gelöscht hatten, ausgespült hatte. Beide schwiegen, bis sie in den finsteren Wald kamen, wo sich Otto noch nicht so sicher fühlte. Zum Glück war Berti fast wieder nüchtern, so dass er, der beinahe jeden Stein und jeden Baum auch im Dunkeln kannte, die Führung übernehmen konnte.
Otto verabschiedete sich in Othmarsingen von seinem Kumpel und stieg über die knarrenden Stufen in die Kammer, die er durch Vermittlung der Firma Disch bei einer alten Witwe für zehn Franken im Monat hatte mieten können. Da die Vermieterin wegen ihrer Schwerhörigkeit fast taub war, vernahm sie nichts von Ottos Heimkehr.
Otto warf sich, zu müde, um die Kleider und Schuhe auszuziehen, aufs Bett und schlief bis weit in den Sonntagmorgen hinein.
Am nächsten Samstag fragte Berti wieder, ob Otto mitgehen wolle, diesmal nach Brunegg in den „Sternen“. Zwei weitere Kollegen, Paul und Werner, beide um die vierzig, wollten diesmal auch mitgehen. Otto hatte nichts dagegen einzuwenden. Die beiden wollten ohnehin nicht so lange bleiben. Sie wollten später noch weiter nach Lupfig. Sie vermuteten, dort sei auch etwas los.
Dieses Mal brauchten Otto und Berti nicht so weit zu gehen. Otto nahm sich vor, auch nur so lange zu bleiben wie die beiden Älteren. Er wollte nicht wieder einen Betrunkenen am Arm heimführen. Irgendwie würde Berti schon noch ein paar andere Othmarsinger finden.
Die vier nahmen gleich im Saal an einem Tisch Platz und ließen sich die Getränke bringen. Auch Otto bestellte ein Bier.
Bald spielten die vier Musikanten, der Pianist, ein Geiger, ein Handörgeler und ein Klarinettist zum Tanz auf.
Das Fest war schon richtig im Gang, als ein fast zwei Meter großer Mann, der um die dreißig zu sein schien, mit einer ebenfalls auffallend großen Frau in den Saal kam und sich nach einem Tisch umschaute. Da die Musik gerade aufgehört hatte zu spielen und sich die Tanzenden wieder an ihre Tische setzten, sah er, dass in einer Ecke noch zwei Plätze frei zu sein schienen.
„Dürfen wir uns zu Ihnen setzen?“, fragte der Mann mit einer kräftigen, aber doch angenehmen Stimme. Nur allzu gerne hätte Otto Ja gesagt, weil ihm die junge Frau auf den ersten Blick gefallen hatte, doch die anderen drei kamen ihm zuvor, denn sie schienen die beiden zu kennen.
„Nur zu, Schriiner von Brunegg mit deiner schönen Schwester“, forderte ihn Berti auf, und die andern nickten und rückten ein wenig zusammen.
„Ich bin der Schriiner Walti“, sagte der Mann zu Otto gewandt. „Und das ist meine Schwester.
„Darf ich Sie Fräulein Renold nennen?“, fragte Otto zögernd.
„Ja, die bin ich“, antwortete sie. „Aber sie dürfen auch Valerie zu mir sagen.“
„Und ich bin der Otto Pfändler, aber für Sie auch einfach der Otto.“
„Er ist einer von uns, vom Disch in Othmarsingen“, erklärte Werner. „Er ist noch etwas schüchtern. Er ist aus Deutschland gekommen.“
„Aber ich bin Schweizer, aus Flawil im Kanton St. Gallen.“
„Das habe ich gar nicht gewusst“, sagte nun Werner. „Entschuldige, aber du redest wie ein Deutscher.“
„Nein, das ist mein St. Galler Dialekt“, wehrte sich Otto. Im Stillen dachte er: „Es mag sein, dass unser Dialekt nicht so unverkennbar ist wie eurer, der nahe am Berner Dialekt ist.“
Als die Musik wieder zu spielen begann, forderte der Schreiner Walti seine Schwester zum Tanz auf. Sie waren ein wunderschönes Paar, und wenn sie auch mitten unter den Tanzenden waren, ragten ihre markanten Köpfe über die Menge hinaus. Der Schreiner hatte zudem einen auffallend dichten, braunen Haarschopf.
Otto war auch nicht klein, und deshalb getraute er sich in der Pause, den Schreiner zu fragen, ob er beim nächsten Tanz seine Schwester auf die Tanzfläche führen dürfe.
„Da brauchst du nicht mich zu fragen, sondern meine Schwester“, antwortete Walti.
Valerie nickte ihm lachend zu, worauf Otto ihr mit einer leichten Verbeugung die Hand reichte, die sie nahm und sich zum Tanz führen ließ.
Valerie, die schönes braunes Haar hatte, war tat-sächlich noch ein wenig grösser als Otto. Doch sie harmonierten sofort gut zusammen.
„Warum kennen Sie meinen Nachnamen, wenn Sie nicht von hier sind?“, fragte Valerie.
„Ich bin am letzten Samstag bei der Schreinerei Ihres Bruders vorbeigekommen“, erklärte Otto, „da hab ich das Firmenschild gesehen. Deshalb hab ich Ihren Nachnamen gekannt.“
„Sie dürfen mich schon Valerie nennen“, erlaubte sie ihm.
Als sie zum Tisch zurückkehrten, dankte Otto seiner Tänzerin. Und sie sagte: „Ich danke Ihnen, Herr Pfändler.“
„Sagen Sie doch Otto. Wollen wir uns nicht du sagen? Ich dachte sowieso, beim Vorstellen wäre es so gemeint gewesen?“
„Eigentlich schon“, bestätigte Valerie, „aber als Frau traut man sich dann doch nicht gleich.“
Als Otto sah, dass Valerie einverstanden war, rief er die Serviertochter herbei.
„Das wollen wir doch mit einem Schluck Wein begießen. Rotem oder Weißem?“, fragte er.
„Lieber Roten“, bat Valerie.
„Dann bringen sie also eine Flasche Roten. Ich denke, sie haben einen Hauswein. Und nur drei Gläser, bitte“, da er beobachtete, dass seine drei Kollegen eben erst wieder Bier bestellt hatten und untereinander die Köpfe zusammensteckten.
Als die Serviertochter die Flasche brachte und die Gläser abstellte, schob Otto eines Valerie und eines ihrem Bruder zu. Das andere zog er zu sich heran. Als eingeschenkt war, stießen die drei miteinander an.
„Ich will ja nicht egoistisch sein“, dachte Otto, weil er den andern keinen Wein angeboten hatte, „ich glaube zwar nicht, dass die andern drei mit Valerie und ihrem Bruder per du sind. Das sollen sie auch nicht werden. Vielleicht bin ich auch schon ein wenig eifersüchtig.“
Otto hatte gesehen, dass ihn Valerie vorher eine Weile mit ihren dunkelbraunen, mandelförmigen Augen aufmerksam betrachtet hatte, und als sie bemerkte, dass sie dabei ertappt worden war, sofort wegsah.
Walti schien gar nicht so viel Lust zum Tanzen zu haben und nickte immer, wenn Otto ihn anschaute und seine Einwilligung einholen wollte.
Einmal sagte sie, während er sie ein wenig näher zu sich heranzog: „Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der so blaue Augen hat wie du.“
Otto fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. Das hatte bisher in seiner Heimat noch niemand zu ihm gesagt. Nur in Deutschland schienen die Frauen häufiger auf seine Augen zu schauen. Er nahm es von Valerie als Kompliment entgegen und sagte nur: „Danke.“
Als es gegen Mitternacht ging und Walti noch einmal mit seiner Schwester getanzt hatte, sagte er, als sie an den Tisch zurückkehrten zu Otto gewandt: „Entschuldige, wir müssen nun gehen. Es ist Zeit. Weißt du, ich bin für meine Schwester verantwortlich. Unser Vater ist schon vor sechs Jahren gestorben.“
„Das tut mir leid“, sagte Otto.
„Ja, aber“, wandte sie sich lachend an ihren Bruder, „du benimmst dich immer noch wie ein Vater und meinst, mich wie als deine Tochter beschützen zu müssen, und vergisst, dass ich erwachsen geworden bin. Meine Schwestern übrigens auch. Wenigstens das Anni.“
„Die Miggi wohl nicht, die ist doch noch ein Kind“, rechtfertigte sich Walti.
„Vielleicht sehen wir uns wieder einmal“, sagte Valerie an Otto gerichtet.
„Es würde mich freuen“, antwortete er und reichte zuerst Valerie und dann Walti die Hand.
Otto war ein guter und fleißiger Arbeiter und schon bald bei seinem Patron und den Kollegen beliebt. Berti und Otto hatten in kurzer Zeit Freundschaft geschlossen.
Eines Abends, als er nach Feierabend mit Berti im „Pflug“ bei einem Bier zusammen saß, fragte Otto: „Gibt es hier auch eine sozialdemokratische Partei?“
„Bist du ein Sozi?“, fragte Berti zurück. „Willst du der Partei beitreten?“
„Ja“, erwiderte Otto. „Weißt du, ich hab in Deutschland in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mitgemacht. Das ist eine gute Sache. Wir Arbeiter müssen zusammenhalten und für gerechte Löhne kämpfen.“
„Bei uns gibt es das nicht“, sagte Berti. „bei uns im Dorf, wo fast jeder jeden kennt, würdest du schief angesehen. Und der Patron sähe das auch nicht gern. Ich bin zufrieden, wie es ist. Wir müssen ja nicht hungern. Und wenn wir zum Tanz oder zu einem Dorffest ausgehen, reicht das Geld auch noch. Was willst du mehr? In Zürich oder in Basel gibt es sicher eine solche Partei. Aber hier kämst du schlecht an.“
„Dann gibt es auch keine Gewerkschaft?“, fragte Otto weiter. Berti schüttelte nur den Kopf.
„Würdest du mitmachen, wenn ich eine Partei gründen würde?“, wollte Otto wissen.
Berti lachte: „Ich mag dich, Otto. Aber eine Partei gründen? Nein. Hier sind nur die Bürgerlichen und die Katholischen in Parteien, die Bürgerlichen bei den Liberalen und die anderen in der katholisch-konservativen Partei.“
„Vielleicht gehe ich später einmal nach Zürich oder besser noch nach St. Gallen, da bin ich dann näher bei meinen Eltern“, sagte Otto. „Dort werde ich sicher der Partei und der Gewerkschaft beitreten.“
„Hast du auch Geschwister?“, fragte Berti.
„Ja, einen älteren Bruder und einen Bruder und eine Schwester, die jünger sind als ich.“
„Ich habe leider keine Geschwister, und meine Eltern wohnen in Bözberg“, ließ Berti seinen Freund wissen.
Otto sagte nichts mehr. Nach einer Weile unterbrach Berti das Schweigen: „Du kommst doch am Samstag mit nach Schinznach. Wir müssen aber früh gehen. Es ist ein Dorffest, das schon am Morgen beginnt.“
Ja, er komme gerne mit, sagte Otto. Vielleicht würde ja der Schriiner Walti mit seiner Schwester auch wieder dabei sein.
Ja, den Walti trafen sie, als sie sich am Samstagnachmittag zwischen den vielen Leuten hindurchzwängten, die von der einen Seite zur andern über die enge von den Verkaufsständen gebildete Gasse wechselten, und da und dort etwas kauften oder auch nur gafften. Es roch nach frischem Brot und geräuchertem Fleisch, da standen Schuhe zum Kauf, dort hingen Kleider oder Schirme und Handtaschen für die Frauen. Otto hatte schon lange herumgespäht. Walti und Valerie wären doch leicht zu erkennen. Ihre Köpfe würden über alle anderen hinausragen.
Da stolperte Otto fast über ein Bein. Als er hinschaute, sah er, dass das Bein dem Schriiner Walti gehörte. Der stand gebückt über der Auslage an einem Stand und hatte sein linkes Bein zu weit in die Gasse hineingestreckt, als er mit der rechten Hand nach einem Gegenstand auf einem höheren, hinteren Brett griff. Fast wäre er, durch den Anrempler erschreckt, über die Auslage des Marktfahrers gefallen.
Walti nahm das Scharnier, das er gerade prüfen wollte, in die andere Hand und erhob sich, ehe er den Arm ausstreckte und zuerst Berti und dann Otto, die Hand reichte.
„Kommst du am Abend auch noch in den ‚Bären‘?“, fragte Otto. Nach Valerie zu fragen, wagte er nicht.
„Nein, ich muss hier nur noch zu einem Kunden und geh dann nach Hause“, antwortete Walti.
Berti drängte weiter, als der Verkäufer Walti im Auge behielt, der immer noch das Scharnier in der Hand hielt. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er einem hätte nachlaufen müssen, der mit einem seiner Artikel gedankenlos davongegangen war. Nachdem sich Walti auch von Otto verabschiedet hatte, drehte er sich wieder um und legte das Scharnier zurück.
„Warum heißen eigentlich hier so viele Wirtschaften ‚Bären‘?“, fragte Otto, als sie sich dem behäbigen Landgasthof näherten. „Ich höre euch immer wieder von einem ‚Bären‘ reden, und wenn ich meine, es sei der von Birr, dann ist es immer wieder ein anderer.“
Berti erklärte, das komme davon, dass dieser Teil des Kantons Aargau früher zu Bern gehört habe, das im Wappen einen Bären trägt. Auf der andern Seite des Aargaus, gegen den Rhein hinab, würden die Wirtschaften ‚Adler‘ heißen, weil jener Teil des Aargaus früher habsburgisch gewesen sei.
„Du hast vielleicht auch schon einmal die Habsburg gesehen, das Stammhaus der Habsburger in der Nähe von Brugg.“
Otto nickte nur. Er hatte die Habsburg noch nie gesehen, aber er hatte in der Sekundarschule im Geografie- und Geschichtsunterricht davon gehört. Und im Schulbuch hatte er sogar eine Zeichnung davon gesehen. Er erinnerte sich noch gut, wie sie aussah. Denn er hatte sich für diese beiden Schulfächer interessiert.
Beide bestellten sich im Saal je eine Flasche dunkles Bier. Es gab zwar auch helles. Aber kaum jemand trank es. Auch Otto hatte es noch nie getrunken. Das dunkle schmeckte ihm, und er hatte sich daran gewöhnt.
„Der Walti geht offenbar nicht so oft zum Tanz“, sagte Otto, während er den Bügelverschluss der Flasche öffnete und etwas weißer Schaum mit einem Zischen heraustrat.
„Du meinst wegen der Valerie“, sagte Berti. „Glaubst du, ich hätte nicht gesehen, dass sie dir gefällt. Du würdest noch gut zu ihr passen. Die ist sicher noch frei. Mit ihrer Größe wird sie es schwer haben, einen Mann zu finden.“
„Du kennst sie aber nicht näher?“, fragte nun Otto, da er sah, dass er sein Geheimnis nicht bewahren konnte.
„Eigentlich nicht“, erwiderte Berti. „Ich weiß nur, dass sie noch Geschwister hat, ein paar Brüder und Schwestern. Sie scheint mir eine stolze Frau zu sein.“
„Das sieht vielleicht nur so aus, weil sie so schlank und groß ist“, meinte Otto.
Als die Musik dann endlich aufspielte, mochte Otto gar nicht recht tanzen. Keine war wie Valerie. Die einen waren zu mollig, die meisten zu klein für ihn. Er musste immer wieder an Valerie denken, wie leicht es gewesen war mit ihr, wenn auch ein wenig ungewohnt, da sie doch größer war als er.
Zum Glück gab es auch im „Sternen“ in Brunegg immer wieder Tanzveranstaltungen. Otto unterließ keine. Und tatsächlich, schon bei der nächsten kam Valerie, begleitet von ihrem großen Bruder. Sie setzten sich zu Otto und Berti an den Tisch. Es gab ein leises Getuschel. Einige hatten letztes Mal gehört, dass Otto von Deutschland gekommen war. Unter den Bruneggern wurde bald nur noch von dem „Deutschen“ gesprochen. Walti verabschiedete sich schon bald.
„Pass auf meine Schwester auf und bring sie nicht zu spät nach Hause“, sagte er zu Otto, als er ging. Eine Stunde später meinte Valerie, sie müsse nun wohl auch gehen. Otto war gerne bereit, sie nach Hause zu begleiten.
„Du kannst ja nachher noch einmal kommen“, flüsterte Berti, als Otto sich von ihm verabschiedete.
Otto sagte weder Ja noch Nein.
Otto hielt Valerie seinen Arm hin, und sie hakte ein.
Als Otto auf der Straße weiter bis zur Kreuzung gehen wollte, zog Valerie ihn nach links.
„Es gibt da eine Abkürzung“, sagte sie.
Eigentlich wäre ihm der weitere Weg lieber gewesen, aber er ließ sich widerstandslos über den kleinen Wiesenweg führen, der bald hinter einem Gartenzaun enger wurde. Er legte seinen Arm um Valeries schlanke Taille. Nach wenigen Schritten blieben sie stehen und wandten sich einander zu. Es war zwar recht finster. Es hatte weit und breit keine Laterne. Aber jedes sah im andern das Leuchten der Augen, das von innen kam. Langsam näherten sich diese Augen einander, aber auch die Lippen. Und es kam zum ersten scheuen Kuss.
Als Otto spürte, dass sein Blut zu wallen begann, löste er sich aus der Umarmung und nahm Valerie bei der Hand. Die Finger fest ineinander verschlossen, gingen sie weiter und kamen schon bald neben dem Wasch- und Backhäuschen vorbei auf den Hof. Unter der Terrasse im Laubengang gaben sie sich noch einmal einen Kuss, dann trat Valerie unter die Tür, und Otto lauschte ihr nach, wie sie die alte knarrende Treppe hinaufstieg.
Beim „Sternen“ hörte Otto die Musik, aber er hatte keine Lust, noch einmal hineinzugehen. Er wollte sich seine Stimmung, seine glücklichen Gefühle nicht durch die laute Musik und andere Tänzerinnen verderben lassen.
Valerie tanzte gerne mit Otto. Er war ein stattlicher junger Mann, immer gut gekleidet und höflich. Manchmal hörten die anderen Paare auf zu tanzen und schauten nur noch den beiden zu. Sie tanzten geschmeidig. Es war als wären sie zusammengewachsen. Sie fielen nie aus dem Takt. Und beim Walzer tanzten sie sogar linksherum. Ihre Gesichter strahlten. Man sah, dass sie zusammengehörten, verliebt waren. Sie glichen einander sogar. Auch Valerie hatte eine schmale Nase, aber ein eher rundliches Gesicht und straff nach hinten gekämmtes Haar, das sie zu einem Zopf geflochten und aufgesteckt trug. Manches der Mädchen beneidete Valerie. Nicht nur wegen ihrer auffallenden Schönheit. Sie hätten auch gerne mit dem „Deutschen“ getanzt. Aber er tanzte nur noch mit Valerie.
Es war Valerie, die schließlich Otto dazu aufforderte, doch auch ab und zu mit einer anderen zu tanzen.
Im Dorf war schon Eifersucht und Neid aufgekommen. Valerie hatte von einer ehemaligen Schulkameradin gehört, dass die Burschen im Dorf munkelten, der Deutsche trage eine Pistole unter dem Wams. Sie hatte sogar von einer Verschwörung gesprochen. Die jungen Männer schienen es nicht gern zu sehen, dass ein Fremder ihnen die Schönste im Dorf wegnahm, obwohl keiner der Bauernsöhne je die Chance gehabt hätte, sie zu gewinnen.
Otto versicherte ihr, er habe keine Pistole.
„Darum musst du ganz besonders aufpassen, dass sie dir nicht im Wald auflauern“, mahnte Valerie.
„Meinst du, ich würde sonst auf sie schießen?“, fragte Otto.
„Nein, das wäre ja noch schlimmer“, sagte sie entsetzt. „Ich möchte dich doch nicht im Gefängnis besuchen müssen.“
„Ich pass schon auf“, beruhigte er sie, „Berti wartet gerne auf mich. Wenn wir zu zweit gehen, werden sie es nicht wagen. Und Berti würde es schon merken, wenn sie sich aus dem Saal schleichen würden, um uns im Wald aufzulauern.“
Es erwies sich aber als ein falsches Gerücht. Otto und sein Beschützer blieben unbehelligt. Bald brauchten sich Otto und Valerie auch nicht mehr nur beim Tanzen zu treffen. Valerie hatte Otto zu sich eingeladen, um ihn ihrer Mutter und ihren Geschwistern vorzustellen. Otto freute sich und nahm dies als Zeichen, dass Valerie bereit wäre, seine Frau zu werden. Sie hatte ihm auch bald schon einmal gestanden, dass sie sich vom ersten Augenblick an, in ihn verliebt habe.
Es war ein Sonntagnachmittag im Herbst, als Otto nicht über den Hof, sondern draußen auf der Straße neben dem eingezäunten Garten der Witwe Renold heraufschritt und hinten um die Ecke bog, wo auf bunt bemalten Blechtafeln Maggi-Bouillonwürfel und Cailler-Schokoladen angepriesen wurden, dann vorbei über die vier Stufen zur Tür stieg und an dem Griff zog, was im Innern eine helle Glocke erklingen ließ. Otto schaute noch einmal an sich herunter, ob die Pochette richtig in der Brusttasche seines Sakkos stecke, und griff rasch noch an die Fliege, ob auch die nicht schief unter seinem hohen, steifen Kragen sitze. Doch schon öffnete sich die Tür. Valerie hatte von ihrer Kammer unter dem Dach aus ihren Liebsten kommen sehen und war heruntergerannt, um ihm rechtzeitig zu öffnen. Sie führte ihn geradeaus durch den düsteren Korridor, wo es angenehm nach Holz roch, in die Stube, wo ihre Mutter, in einen schwarzen Rock gekleidet, am Tisch saß.
Otto ging auf sie zu.
„Bleiben sie nur sitzen“, forderte er sie auf, als sie aufstehen wollte. Er sah auch so, dass sie eine kleine, runzlige Frau war. Es war kaum zu glauben, dass sie Kinder auf die Welt hatte bringen können, die einmal so groß werden würden.
Die Frau sah ihn aus einem Auge an, das andere hielt sie zugekniffen. Erst bei näherem, heimlichem Zusehen sah er, dass das zweite Auge fehlte. Erst viel später erzählte Valerie ihm, dass ihre Mutter als kleines Mädchen mit dem Bruder gestritten hatte, und dieser eine Schere nach ihr geworfen habe, die sie mitten ins Auge traf.
Die Geschwister waren natürlich neugierig, den Verehrer ihrer Schwester zu sehen. Walti, der im Sommer eine Tochter von den Wirtsleuten des „Bären“ in Birr geheiratet hatte und in das neue, auf der anderen Seite der Schreinerei angebaute Haus gezogen war, brachte auf dem Gang über der Werkstadt seine junge Frau mit, die neben Walti noch viel kleiner schien, als sie war. Sie hatte eine klangvolle, weiche Stimme, die Otto sofort sympathisch war.
Valerie erklärte Otto leise, aber doch absichtlich so laut, dass das junge Ehepaar es hören musste, sie glaube, Walti habe sie nur so oft auch in den „Bären“ zum Tanz mitgenommen, weil er in die Wirtstochter, die Frieda Frey, verliebt gewesen sei.
„Was heißt hier gewesen?“, wehrte sich Walti, „ich bin’s immer noch.“
„Na, hoffentlich“, konterte Valerie.
Miggi, die eigentlich Marie hieß, war die nächste, die von der zweiten Dachkammer neben jener von Valerie herunterkam. Sie schien es gar nicht erwarten zu können, denn man hatte sie gebeten, sich zurückzuhalten und erst nach einer Weile aufzutauchen. Auch sie hatte Otto schon die Straße heraufkommen sehen, zwar erst im letzten Moment, denn sie hatte erwartet, dass er vom schmalen Weglein herkomme, und hatte in die falsche Richtung geschaut.
Als nächster kam Otti, der aber auch auf den Namen Otto getauft war. Er war kleiner als Walti, sogar kleiner als Otto. Er war nach Walter und Valerie das vierte Kind der einäugigen Frau. Eigentlich war zwischen Walter und Valerie noch Kari, auch er war nicht auf Kari getauft worden. Es war der Rufname für Karl. Sein Name fiel an diesem Sonntagnachmittag aber nicht. Otto erfuhr erst später, dass während der Rekrutenschule Kari ein Balken auf den Kopf gefallen sei. Genau wisse sie auch nicht, wie es passierte. Aber seither sei Kari nicht mehr bei Verstand, und er lebe jetzt in der Psychiatrischen Anstalt in Königsfelden.
Auch Anni fehlte, sie war die Mittlere von den drei Töchtern. Sie habe nach den acht Jahren Primarschule, mehr gebe es nicht in Brunegg in dem kleinen Schulhaus, beim Professor Hasler, der Rektor an der Kantonsschule in Aarau sei, den Haushalt gemacht. Seine Frau sei gestorben, und da habe er jemanden gebraucht, der zum Haus und den zwei noch schulpflichtigen Töchtern und einem älteren Sohn aufpasse. Jetzt sei sie aber seit einem halben Jahr als Haushalthilfe und Kindermädchen für zwei kleine Buben bei einer Zahnarztfamilie in Herisau tätig.
Als letzter war Köbi, der jüngste der Brüder, gekommen, der noch bei einem Schulfreund gewesen war.
Valerie hatte extra einen Kuchen gebacken. Dazu gab es Tee und Kaffee.
Zum Nachtessen wollte Otto nicht bleiben. Er wollte nicht unhöflich sein, obwohl ihn auch Valeries Mutter zum Bleiben aufforderte. Schließlich wäre es aber auch unhöflich gewesen, wenn er auf das ehrliche Bitten der alten Frau hin doch gegangen wäre. Also ließ er sich erweichen und blieb.
Er spürte während des Essens, dass sie alle enttäuscht gewesen wären, wenn er nicht geblieben wäre.
Als es dann aber doch Zeit wurde und einige der Geschwister, als erste Walti mit seiner Frau und Otti, sich zurückgezogen hatten, verabschiedete sich Otto und dankte noch einmal für den Zvieri und das gute Nachtessen. Valerie begleitete ihn über die steile Treppe hinaus über den Hof und bis zu dem schmalen Weg, wo sie sich nach einem langen Kuss von ihm trennte und ihm noch nachwinkte, bis sich der „Sternen“ zwischen sie und den Davonschreitenden schob.
Auf dem Heimweg durch den Wald, dachte Otto darüber nach, wie er Valerie fragen könnte, seine Frau zu werden, und ob er nicht vorher, die alte Mutter um die Hand ihrer Tochter bitten müsse. Einen Vater hatte sie ja nicht mehr. Oder müsste er Walti fragen, der das Oberhaupt der Familie zu sein schien. Aber war er das noch, jetzt, nachdem er geheiratet hatte? War das jetzt Otti?
Otto war sonst nicht so zögerlich. Am besten würde es wohl sein, Valerie zu fragen.
Als er sie beim nächsten Zusammensein fragte, ob sie seine Frau werden wolle, sagte sie freudig Ja. Otto war überglücklich. Nun wollten sie zusammen zur Mutter gehen und Hand in Hand vor sie treten, und Valerie würde ihr dann sagen, dass sie beschlossen hätten, zu heiraten. Und so geschah es dann auch, und die Mutter gab dazu ihren Segen.
Am 16. Mai 1913 heirateten Otto und Valerie in der Dorfkirche von Birr. Doch bis es so weit war, mussten die beiden noch ein Hindernis überwinden. Beim Ausgang vom Dorf hatten die Burschen und noch ledigen Männer die Kutsche, in der das Brautpaar zusammen mit Anni als Trauzeugin – Fritz würde als Trauzeuge erst in der Kirche hinzukommen – mit einer langen Stange, die sie über die Straße hielten, aufgehalten. So ohne weiteres wollten sie dann die Braut doch nicht hergeben. Otto musste tief in die Tasche greifen und jedem eine Silbermünze zahlen. Aber auch die Kinder wollten einen Tribut. Sie hatten am Wegrand, wo es auf das Birrfeld hinausging, kleine Nestchen aus Gräsern und Blumen hingelegt, und Anni musste aussteigen und sie mit Bonbons und Schokoriegeln füllen, zu denen sie noch eine kleine Nickelmünze hinzufügte. Auch bei der Einfahrt in Birr war es Aufgabe der Trauzeugin, den wartenden Buben und Mädchen aus der Kutsche heraus Bonbons zuzuwerfen.
Valerie trug ein langes schwarzes Kleid, wie das üblich war, und einen weißen Schleier. Otto kam sich neben der großgewachsenen Braut klein vor, obwohl er kaum eine Handbreit kleiner war. Doch manche in den Bänken streckten ihre Köpfe zusammen und tuschelten, als ob nicht jedermann das selbst bemerkt hätte.
Von St. Gallen waren der ältere Bruder Eduard mit seiner Frau Bertha und der ledige Bruder Fritz mit der Schwester Laura gekommen.
Auch die Eltern von der Egg waren in Flawil zugestiegen. Sie hatten den gut eine Dreiviertelstunde langen Weg unter die Füße genommen. Sie hatten früh aufstehen müssen, denn sie wollten keinesfalls in Flawil den Zug verpassen.
Nach dem Mittagessen im „Bären“ wollten Ottos Eltern und Geschwister schon bald wieder aufbrechen. Schließlich mussten sie in Brugg umsteigen und in Zürich noch einmal. Aber alle waren glücklich, dass ihr Sohn oder Bruder eine so schöne Frau zur Gattin bekommen hatte. Bald würde das Paar nach St. Gallen ziehen, wo Otto Anfang Juni eine neue Stelle bei der Schokoladenfabrik Maestrani antreten würde. Auch eine Wohnung hatten sie auf diesen Termin in Aussicht in einem Zweifamilienhäuschen im Riethüsli, an der Straße, die vom Nest, der Endstation der Straßenbahnlinie 5, nach Teufen führte.
Noch aber war es nicht so weit.
Die übrig gebliebene Hochzeitsgesellschaft war im „Bären“ noch lange beisammen. Ein Pianist und ein Handörgeler spielten zum Brauttanz auf. Alle Gäste und auch die Wirtsleute, die unter der Tür standen, und das Servierpersonal bewunderten das schöne Paar, das sich so schnell drehte, dass Valeries weißer Schleier flog. Es war eine Freude für alle, für die Tänzer und Tänzerinnen, die sich nun aufs Parkett wagten, und die Zuschauer.
Nach einem kleinen Imbiss fuhren Valerie und Otto mit der Kutsche nach Othmarsingen, wo sie ausstiegen und ins Haus und hinauf in Ottos Kammer gingen, die für diese Nacht noch für den unvergesslichen Höhepunkt ihrer Hochzeit diente. Am nächsten Morgen fuhren sie nach Halle an der Saale in die Flitterwochen. Otto wollte seiner Frau die Stadt, in der er zwei Jahre lang gearbeitet hatte, und auch die alte Stadt Leipzig und deren Umgebung zeigen.
Walti brachte mit seinem offenen Lastwagen der Marke Berna die Möbel, die er extra für das junge Paar angefertigt hatte, an die Teufenerstrasse 163. Auf der Ladefläche hatte er ein Büffet, eine Kommode, zwei Nachttischchen, einen Küchenschrank für das Geschirr und einen Esstisch und Stühle mit Seilen befestigt und darüber Blachen gelegt und ebenfalls mit starken Schnüren festgezurrt. Walti hatte noch nie mit seinem neuen Lastwagen eine so lange Fahrt gemacht. Er wusste nicht, wie die Straßen ausgebaut waren. Vielleicht waren sie schlecht imstand und hatten viele Löcher. Da die Reifen aus Vollgummi waren, mussten die Möbel unverrückbar festgemacht sein, damit sie durch das Rumpeln keine Schäden bekommen würden. Eigentlich hätten Valerie und Otto als Beifahrer mitkommen können. Sie hätten beide neben Walti gut Platz gehabt. Aber Valerie wollte lieber mit dem Zug fahren. Sie meinte, es wäre doch etwas eng. Dafür hatte Berti sich anerboten, mit Walti zu fahren. Er hatte für den Samstagmorgen frei bekommen. Er war schon früh in Brunegg in der Schreinerei aufgetaucht und hatte geholfen, die Möbel aufzuladen und zu befestigen.
In St. Gallen waren Valerie und Otto vom Bahnhofplatz aus mit dem Tram ins Nest gefahren. Valerie musste lachen, und Otto stimmte in ihr Lachen ein.
„Das hätte ich nicht gedacht“, sagte Valerie, „dass wir gleich am ersten Tag mit einem Tram ins Nest fahren könnten.“
Es war das erste Mal, dass Valerie mit einer Trambahn fuhr. Otto war in Halle oft mit der elektrischen Straßenbahn gefahren.
Der Kondukteur, der merkte, dass die beiden fremd waren, Otto aber sehr an dem Tram interessiert, sagte ihnen, diese Strecke sei erst vor einem Monat eröffnet worden.
Von der Endstation Nest war es nicht mehr weit zu ihrer Wohnung. Im Schlafzimmer standen schon die beiden Betten, die sie auf Anraten von Walti in einer St. Galler Möbelfabrik mitsamt den Decken und Kissen bestellt hatten. Auch das Geschirr und Besteck lag in Schachteln auf dem Küchenboden.
Es dauerte nicht lange, bis Walti und Berti angefahren kamen und Walti mit der Hupe ihre Ankunft ankündigte. Die drei Männer trugen die Möbel ins Haus, und Otto zeigte, wo sie sie hinstellen sollten. Als der Küchenschrank an der Wand stand, begann Valerie sofort, das Geschirr einzuräumen.
Nachdem Walti und Berti nach einer kleinen Verpflegung, die Valerie mitgebracht hatte – den Durst löschten sie mit Hahnenwasser – wieder weggefahren waren, umarmten sich die beiden. Schon bald danach legten sie sich müde und glücklich in die neuen Betten. Schlafen wollten sie noch nicht. Sie hatten sich umarmt und lagen still und ruhig beieinander.
„Bist du sehr müde?“, fragte Valerie.
„Nein, und du?“
„Ich auch nicht“, flüsterte sie Otto ins Ohr.
Zum ersten Mal in ihrer neuen Wohnung und neuen Betten liebten sie sich lange, bis sie ermattet endlich einschliefen.