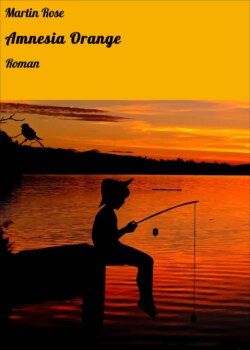Читать книгу Amnesia Orange - Martin Rose - Страница 4
Schwarz
ОглавлениеAm nächsten Morgen erwachte ich aus einem traumlosen, lang währenden Schlaf, vor meinem Fenster ging die Welt unter. Schwere, gräuliche Wolkentürme schoben sich rasend und mit Wucht beiseite, es toste und tobte, ein wenig gedämpft durch die Scheibe, dennoch schien es mir bedrohlich. Als ich aufstand, bemerkte ich, dass sich in der Düsternis ein weißlicher Schimmer zeigte, und tatsächlich sah ich die vielen weißen großflächigen Flocken, die bei genauer Betrachtung wie grobe Bildpunkte durch mein Sichtfeld jagten, horizontal von der einen Seite zur anderen und auch in umgekehrter Richtung, und doch mußten sie irgendwann zur Ruhe kommen, so weiß wie es auf den Wiesen und Wipfeln war, nur schemenhaft konnte ich den Wald erkennen.
Im Foyer machte sich Betriebsamkeit breit: Frühsportler mit Stöcken kamen mit wäßrigen Flocken übersät hinein, aufrecht laufende Personen mit der Aura von Ärzten liefen vorbei, eine Frau hatte einen Stapel Akten unter dem Arm, mit dem sie aus einem Raum hinter der Rezeption hervorkam und in einem Gang verschwand. Ich reihte mich ein in die vier oder fünf Gestalten, die entlang einer Wand vor den Untersuchungszimmern saßen, ängstlich blickende, unglückselige Kreaturen, denen als Neuzugang genauso unwohl zumute war wie mir. Beschwingt kamen zwei junge Ärzte des Weges, ein recht junger, sportlich aussehender und seine junge Kollegin, die ein wenig aufgekratzt schien, zu hoch die Stimmlage, die Wangen gerötet, sie strahlte uns an und warf uns entgegen: „So, wer mag als erstes…!?“ Niemand mochte so recht sich Blut abnehmen lassen zu früher Morgenstunde, und es dauerte eine Weile, bis der blonde Ärztinnenkopf aus der angelehntgelassenen Tür hervorschaute und uns zugleich fragend und ein wenig beleidigt anblickte, weil sich niemand erhoben hatte.
Noch im Speisesaal machte sich eine wuselige Stimmung breit, hastig liefen die einen heraus, angespannt und steif in der Haltung die anderen. Wenige Minuten vor neun Uhr war ich einer der wenigen, die noch an ihrem Tisch saßen, ein letztes Mal einen Schluck Kaffee tranken, sich einen Löffel Müsli in den Mund schoben. Im Foyer schwappte mir überspannte Erwartung entgegen. Die Menschen saßen an den Tischen im rustikalen Stil, alle dem Foyer, mir zugewandt. Eng saßen sie beisammen, quetschten sich auf Bänke, manche hatten sich auf den Boden gesetzt. Ratlos stand ich vor der Menge und suchte mir eine freie Kante auf einer der hinteren Bänke.
Ein hochgewachsener Mann mit forschem Schritt kam aus dem Kellergeschoß ins Foyer hinein, gefolgt, ein paar Trippelschritte rückversetzt, von einem kleinen Heer an Fachpersonal, von Ärzten, Turnlehrern und Masseurinnen. „Das ist Doktor Fichte“, wisperte eine Frauenstimme hinter mir wie eine Souffleuse, und ein junges Mädchen neben mir sagte: „Aha.“ Doktor Fichte nahm samt seiner beschwingten Entourage Stellung ein, frontal vor uns aufgereiht, er wenige Schritte weiter vorne, eine offenbar eingespielte Formation, und der medizinische Direktor sagte mit einem Blick nach draußen: „Guten Morgen an einem Tag, an dem die Welt untergeht!“, und ich dachte, dass das mein Satz war.
Ich beschloß, der Gruppensitzung fernzubleiben, weil ich wußte, das wäre nichts für mich: mit heulenden Frauen im Kreise sitzen. Vor dem Mittagessen lernte ich meinen Bezugsarzt kennen. Doktor Humpe trug das graue Haar zentimeterkurz, das graue Spitzbärtchen verlängerte sein hervorstehendes Kinn noch ein wenig, sein Körper war drahtig, sogar die Unterarme zeigten zähe Muskelstränge. Er war ein bißchen blaß für seinen Typus und wirkte trotz seiner straffen Muskelmasse ein wenig zerbrechlich, er war nur wenige Jahre älter als ich. Er saß in einem Lehnsessel und ich ihm gegenüber, die Sessel in leicht seitlichem Winkel zueinander, vermutlich um das Konfrontative der Situation aufzuheben. Der Arzt schwang das eine Bein über das andere, sein Hosensaum rutschte hoch, ich besah mir das mit Haarbüscheln übersäte Schienbein, sah die blaue Socke mit einem gelben Schriftzug auf dem Sockensaum: action. „Na, dann wollen wir uns mal kennenlernen“, sagte Doktor Humpe, und ich erwiderte: „Ja, das wollen wir.“
„Vegetative Dystonie, das ist alles und nichts“, sagte er, „beschreiben Sie doch mal Ihre Beschwerden“, und so zählte ich die Symptome der vergangenen Monate auf, die niemals alle zugleich auftraten, zumeist sukzessive, doch manches Mal rotteten sich drei oder vier zu perfider Effizienz zusammen: ein gestörtes Gleichgewicht, das mir ein schwankendes Schiff unter den Füßen suggerierte, eine allgemeine Aufgelöstheit, als schwirrten die Atome auseinander, dann plötzliche Übelkeitsattacken, zumeist in der Nacht, Frösteln, Schwindel, Ohnmachtsanwandlungen, Summen im Ohr und zuckende Blitze im Blick, die die latent vor sich hin wogenden schwarze Wellen überlagerten – eine allgemeine körperliche Starre, miserabler Schlaf mit miesen Träumen, innere Unruhe, angespannte Erschöpfung, rasender Puls, kribbelnde, manchmal taube Arme und Beine, meist auf der linken Seite, Höhenangst und Klaustrophobie, stockender Atem, Absencen und Verwirrungen, eine schreckhafte Grundierung mit Panikmomenten, erhöhte Herzneurose und plötzlich aufkeimende Todesangst, das ganze vor dem Hintergrund einer latenten Schwermut, und ich fügte an: „Ich würde das mit einer gewissen Durchlässigkeit meinerseits zusammenfassen.“
Doktor Humpe, der sich unbeeindruckt gab, musterte mich eine ganze Weile, dann sagte er: „Das ist allerhand“, und ich bestätigte, dass sich auch nach meinem Verständnis einiges angehäuft hatte, das Leben mir schwer und fremd geworden war, und Doktor Humpe sah mich jetzt mit dem Ausdruck unterdrückter Verwunderung an, als er sagte: „Na ja, so viel ist es auch wieder nicht.“
Er hatte einiges mit mir vor, in den kommenden Wochen. Er sagte, er wolle meine Selbstwahrnehmung als Mann stärken, und ich erwiderte: „Aha“. Er beabsichtigte, meine Ängste aktiv und „von Angesicht zu Angesicht“ anzugehen, und vermutlich sagte ich erneut „aha“, während ich kaum wahrnehmlich in meinem Lehnsessel absackte. Es folgte eine Liste mit Hausaufgaben, die ich in den kommenden Wochen zu absolvieren hatte: Ich mußte Briefe schreiben, an mich als kleiner Junge und an Shirin, Frauen im Haus sollte ich fragen, wie sie mich fanden, vorzugsweise schriftlich verfaßt oder von mir protokolliert, Sport. Gleich am nächsten Tag hatte ich in die Laufgruppe zu gehen, am darauffolgenden zur Rückengymnastik und am Tag danach zu Yoga, jeweils um sechs Uhr morgens, und ich sagte: „Ja, ja“, und dachte: Nein, im Leben nicht!
Er befragte mich nach der beruflichen Situation, und ich wunderte mich nicht, dass sie so früh kam, die alles definierende, einordnende Frage: Was macht er denn. Wenn ich nannte, was ich tat, mußte ich meine Auskunft relativieren, weil ich etwas stets zur Zeit tat und es eigentlich das falsche war, ich fühlte mich niemals einem Soziotop zugehörig. Zurzeit, berichtete ich wahrheitsgemäß, war ich Übersetzer, weil ich zweisprachig aufgewachsen war und das Übersetzen auch ein paar Jahre studiert hatte.
Ahnungslos hatte ich zunächst Rechtswissenschaft studiert, um mich zwei Wochen vor dem Examen vom Juristenwesen abzuwenden: diese Zahlen- und Absatzzählerei, die ewig pedantische Suche nach dem richtigen Begriff, dem alles entscheidenden Wörtchen im Wust unverständlicher Paragraphen, das Durchwühlen von Gesetz zu Gesetz, das nach Schema mechanische Abspulen der Sachverhaltsprüfung, das gebetmühlenartige Herunterdeklinieren vorgestanzter Phrasen, letztlich Versubstantivierung und Erstarren der Sprache und somit der Denkprozesse, das Einfrieren des Intellekts.
Als gescheiteter Jurist, der ich war, wollte ich etwas mit deutscher Sprache machen und bewarb mich um ein Redaktionsvolontariat bei einer Zeitung im Südwesten. Zu meinem Erstaunen bekam ich die Stelle als einer von sechs unter 900 Bewerbern, und scheiterte sogleich als Journalist in jämmerlicher Weise: zu abgründig waren meine Texte, wenn es um Todes- oder Unfälle ging, bei denen ich die Szenerie dreier überschlagener und ineinander verkeilter Autos auf der Bundesstraße samt der Hirnmasse, die sich über den Asphalt ausgebreitet hatte, bildreich beschrieb, statt nüchtern die monotonen Amtsdeutschfakten der Polizeibeamten wiederzugeben, als „Schönschreiber!“ wurde ich geschimpft, was bei einer Regionalzeitung einem Todesurteil gleicht.
Dann wollte ich etwas ganz und gar anderes machen, und verdingte mich als Page in einem Luxushotel in Baden-Baden, doch es entsprach, wie ich nach einer Weile bemerkte, nicht meinem Naturell, das servile Gehabe. Ich schrieb Reisereportagen für Die Zeit, bis mir das Reisen zunehmend anstrengend wurde, mit ersten, sich mir nicht erschließenden körperlichen Kapriolen: Panik, wenn die Tür eines Zuges zuschlug, beispielsweise, der unbändige Drang, die Kabinentür zu öffnen und das Flugzeug zu verlassen, obwohl ein Arzt, der in der Reihe vor mir saß, mir bereits zwei Tavor gegeben hatte. In dieser Reduktion fiel ich bis auf weiteres auf das zurück, das mir am wenigsten ein Bekenntnis zu einer Zunft und Wesensgemeinschaft abverlangte, weil es in der stillen Kammer stattfand: das Übersetzen.
Nachdem Doktor Humpe das Kreuzverhör, wie es mir vorkam, vorerst beendet hatte, untersuchte er mich auf meine Körperlichkeit, maß Puls, Blutdruck und ließ mich aus akupunkturideologischen Gründen die Zunge herausstrecken. Er drückte mich am Bauch und zwickte die Waden, klopfte die Wirbelsäule entlang, horchte mit dem Stethoskop in die Regungen meiner Lunge. Er drückte auf meine Oberarme, und es kam mir vor, als packte er wie der Hirschkäfer eine Fichtennadel, so dünn mußte ihm mein Bizeps vorkommen, und er sagte: „Ihre Muskelmasse ist ein wenig unterentwickelt, und zu dünn sind Sie auch für Ihre Körpergröße, wir werden Sie ein bißchen aufpäppeln“, sagte Doktor Humpe. Er sah mich an und ich ihn, ich sah, wie er zunächst etwas zu sagen zögerte und dann doch noch sprach: „Wir werden auch Ihre distanzierte Haltung ein wenig brechen“, und mir kam es vor, dass er das Wort „brechen“ mit einem aggressiven Unterton sagte.
Nun kam er auf die basisbiographischen Gegebenheiten zu sprechen, mit wem ich wo unter welchen Umständen aufgewachsen war. Er bat mich, meine Mutter zu charakterisieren, und ich sagte spontan: „Wankelmütig, vorwurfsvoll, maßlos überfordert“: mit mir als Kind, mit einem Abendessen, wenn Besuch angekündigt war, mit dem rückwärtigen Ausfahren aus der Garageneinfahrt, beispielsweise. Nachdem ich das Jurastudium abgebrochen hatte, sagte sie: „Das kannst du deinem Vater nicht antun, dass er eines Tages mit dem Gefühl stirbt, aus seinem Sohn ist nichts geworden.“
Ich berichtete, dass mein Vater, seit ich Junge war, schwieg, und als Mann im Elterngefüge selten anwesend war, weil er stundenlange Spaziergänge machte, sich im Keller mit seinen Kriegsschiffchen verbarrikadierte. Als ich später das Studium abbrach, sagte er: „Frauen wollen keine Versager“, danach hüllte er sich erneut in Schweigen, nahezu ohne Unterlaß bis zum heutigen Tag. Natürlich redete mein Vater, über Politik oder Geographie, von Shirin beispielsweise wollte er wissen, aus welchem Teil des Iran ihre Eltern kamen, und er suchte dann Orte und Landschaften in einem Atlas und besah sich noch lange die geologischen und klimatischen Besonderheiten der betreffenden Region. Er wußte durch aufmerksame Zeitungslektüre, wie es sich im Iran mit dem Wächter- und dem Expertenrat verhielt, und wer wen in welche Staatsämter benannte, er wußte, wer die Zarathustra waren und wer die Jünger Mehdis. Doch mein Vater schwieg, wenn es um persönliche Dinge ging, über den Krieg, beispielsweise, seinen Krieg, in den er 1940 als 16jähriger geworfen worden war. Er schwieg, wenn es um unsere, also auch um meine Vergangenheit ging, oder über so etwas wie Liebe, niemals habe ich ihn das Wort Liebe sagen hören. Er war nicht gefühlskalt, er spaltete ab. „Wie meinen Sie das?“, fragte Doktor Humpe.
„Mein Vater leugnet beispielsweise Fakten aus seiner Biographie“, setzte ich an. Ich berichtete von einem Foto, dass ich im Spiegel zu einem Artikel über den Ostfeldzug der Wehrmacht entdeckt hatte: eine braunstichige Schwarzweißaufnahme, auf der ein Soldat eine frappierende Ähnlichkeit mit meinem Vater aufwies, der, das wußte ich damals, mit der Wehrmacht durch den Kaukasus marschiert war; unter dem Foto stand die Bildunterzeile: „Deutsche Kompanie beim Marsch durch die Sowjetunion“. Als ich es näher betrachtete und ein Foto meines Vaters als Schüler, der er vor dem Krieg war, zur Hand nahm, hatte ich keinerlei Zweifel, dass der Mann auf dem Foto mein Vater war, und auch Shirin, die einen Blick auf das Bildnis warf, sagte, dass er es war, zweifelsfrei. Als mein Vater kurz darauf allein bei uns zu Besuch war, betrachtete er recht lange das Foto, das ich ihm nach einem Abendessen mit Wein und Cognac vorgelegt hatte. Er besah es sich lange, schien in Gedanken zu versinken und sagte vielleicht eine Minute lang kein Wort, doch dann streckte er seinen Rücken, legte das Heft beiseite, und sagte: „Nein, das bin ich nicht“. Ich könnte heute noch schwören, dass er es ist.
Doktor Humpe fragte mich, wie ich als Junge war, und ich sagte, ohne nachdenken zu müssen: „Still, verängstigt, introvertiert.“ Als neun- und zehnjähriger und lange noch darüber hinaus versuchte ich, die bösen Männer zu vertreiben, nachdem ich ein verdächtiges Geräusch in der Nacht gehört hatte und aus dem Schlaf geschreckt war, wie mir meine Muter, viel später, als ich schon Erwachsener war, berichtete. Ich zog ein Bettlaken über den Kopf und lief mit ausgebreiteten Armen durch das Treppenhaus und machte „huuh!, huuh!, huuh!“ Meine Eltern waren belustigt, mein Vater hatte einmal ein Foto machen wollen, doch er war zu müde, um im Keller nach dem Blitzgerät zu suchen. Sie nahmen mich dann widerwillig in ihr Schlafzimmer, in dem ich auf dem Boden auf der Gymnastikmatte meiner Mutter schluchzend und vor Angst auf das erste Tagesicht wartete. An den darauffolgenden Morgen, nachdem meine Mutter bereits aufgestanden war und das Frühstück richtete, sagte mein Vater jedes Mal aufs neue: „Ein echter Kerl weint nicht!“, stand auf und verließ das Zimmer.
In dieser Zeit wurde ich schlagartig schlechter in der Schule. Meine Eltern ließen mich ihre Enttäuschung darüber spüren, da ich in der ersten Grundschulklasse so etwas wie ein Klassenprimus gewesen sein muß, sofern das in dem Alter schon möglich ist. Sie steckten mich in Nachhilfeunterricht, an den ich mich kaum noch erinnere, nur vom Logopäden habe ich sehr deutliche Versatzstücke in meinem Kopf. Es habe mir quasi von einem Tag auf den anderen die Sprache verschlagen, sagte meine Mutter einmal, ich habe nicht mehr klar artikuliert, statt dessen undeutlich gesprochen, mit Wortverdrehungen und Lautverschiebungen. Ich erinnere mich, dass ich Texte im Fischers-Fritze-Fische-Genre rauf und runter beten und auswendig lernen mußte. Ich sehe mich in kurzen Hosen, mit einem Kassettenrecorder in die belgische Schule bei uns im Viertel laufen, in der der Logopäde, ein kahler Mann mit grauen Nackenlöckchen und Mundgeruch, seine Privatstunden abhielt. Die Texte waren auf der Rückseite akkurat zurechtgeschnittener und zusammen gehefteter Tapetenfetzen geschrieben.
„Haben Sie Geschwister?“, fragte Doktor Humpe. Still wurde ich, ein sanfter Schwindel entfaltete sich in der Schaltzentrale. „Ich hatte eine Schwester“, sagte ich, „sie starb, als wir neun Jahre alt waren. Ich habe keinerlei Erinnerungen an sie.“ Doktor Humpe sah mich schweigend an, ich sah, wie seine Pupillen sich weiteten, der Blick des Anglers, an dessen Angelhaken soeben ein Karpfen angebissen hat. „Berichten Sie“, forderte er mich mit ruhigem Ton auf. Ein sonderbares, weil frühzeitiges Vertrauen nahm ich in mir wahr, ich war bereit, ihm von meiner Schwester zu berichten, wenngleich ich dazu weitgehend nur als Kolportage imstande war.
Ich wußte so gut wie nichts über den Tod meiner Schwester. Ich nenne sie meine kleine Schwester, obwohl sie 23 Minuten vor mir auf die Welt gekommen war, im Neondämmer des Kreißsaals an einem trüben Wintertag, an dem vermutlich Nieselregen in grauen Schlieren über das graue Brüssel gefallen war. Die Informationen, die meine Eltern mir wie Brotkrumen hinwarfen, waren knapp gehalten wie eine Polizeimeldung in der Zeitung: In der Nordsee ertrunken, während eines Sommerurlaubs auf der Insel Spiekeroog, von einer Strömung ergriffen und hinausgezogen auf das offene Meer. Meine Eltern hatten mir später gesagt, dass ich Glück gehabt hatte, dass wir beide in die Brandung und in die Strömung gegangen waren, von einer Welle waren wir gepackt und herunter gedrückt worden, und nach Minuten erst war ich aufgetaucht, doch von meiner Schwester hatte man noch nicht einmal den leblosen Körper gefunden, nicht am selben Tag, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten, hieß es in der Überlieferung meiner Eltern, und ich konnte mich an all das nicht erinnern.
Noch heute erinnere ich mich lediglich an Bilder von ihr, an die wenigen, die meine Mutter aus der Asche gerettet hatte, in einem verschlossenen Holzkästchen aufbewahrte und mir manchmal, wenn mein Vater nicht im Hause war, überließ. Sie sind mit Tiefenschärfe in mir gespeichert: zwei schilfgrüne, ungewöhnlich große Augen, mit frühreif kokettem Lächeln, die schwarzen Haare zu knappen Zöpfchen gebunden, die wie Lauchstrünke von ihrem schmalen, blassen Gesicht abstehen. Manchmal geraten die Bilder in Bewegung, verändern sich wie ein Phantombild auf dem Bildschirm eines Kriminalisten, bekommen Konturen, wenn ich mir vorstelle, wie sie später ausgesehen hätte. Ich sehe sie vor mir mit zwölf, mit fünfzehn, als junge Frau, ich sehe ihr Gesicht von heute: Sie hat nach wie vor ein mädchenhaftes Antlitz, ein paar Fältchen um die Augen, die Lippen schmal und weich, der Teint blaß und schön, ein neugieriger, wacher, schilfgrüner Blick. Die schwarzen Haare trägt sie glatt nach hinten bis kurz über die Schulter fallend, von einem Haarreif über der Stirn gehalten, und so frühreif erwachsen sie aussah, als sie neun Jahre alt war, so wirkt das Gesicht jetzt mädchenhaft und jung.
Es gab Situationen in meinem Leben, nach Tagen, an denen ich nicht an sie gedacht hatte, da sah ich eine Frau in der U-Bahn, ein junges Mädchen auf einem Bahnsteig, eine junge Mutter mit Kinderwagen auf der Straße, und ich erschrak, weil ich meine Schwester sah, einen Kinderwagen schiebend, auf einen Zug wartend, verträumt in der U-Bahn in einem Buch lesend, vielleicht spielte sie mit der rechten Hand an einer Strähne, versunken in eine andere Welt. Es fällt mir schwer, zu beschreiben, was in solchen Augenblicken in mir vorging, ein Glücksgefühl überkam mich jedes Mal mit Wucht, und dann Erschrecken, Verwirrung, Schuldgefühl.
Wenn ich als Jugendlicher und junger Erwachsener in den Alben geblättert hatte, sah ich die blinden Flecken, die sich wie quadratische und rechteckige Schatten über die bebilderten Familienarchive legten. Von manchen der verbliebenen Fotos, die ein hauchdünnes, pergamentähnliches Papier voreinander schützte, schien ein Teil abgeschnitten worden zu sein, die mit geradem Scherenschnitt verkürzten Bildflächen sahen aus wie korrigierte Nahaufnahmen aus meiner Kindheit. Und auch heute noch, wenn ich mir die Fotos ansehe, stechen mir die Freiflächen, die durch den stärker verblaßten Hintergrund beinahe wie eingerahmt wirken, ins Auge. Es gibt ein anämisch wirkendes Foto, das mich am Strand zeigt, das Meer liegt hinter mir und ich blinzele, und an der Stelle, an der das Bild abrupt endet, sind zwei Finger zu sehen, die auf meinem rechten Unterarm liegen, zwei blasse, schmale Mädchenfinger.
Ich erinnere mich, wie ich als Junge, ich muß zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, meinen Vater dabei beobachtet hatte, wie er die Bilder vernichtete. Ich konnte, als habe ich eine Vorahnung gehabt, nicht schlafen, ging zu fortgeschrittener Nachtstunde die Treppe hinunter in die untere Etage. Ich sah meinen Vater durch den Türspalt, sah, wie er auf dem Boden kniete und in Zeitlupentempo die Alben wälzte, einzelne Fotos herausnahm und andere mit einer Schere bearbeitete, bevor er sie dem Album entnahm und in das Feuer des Kamins warf. Manchmal wippte sein Kopf eine Weile hin und her, ein verlangsamtes Nachnicken, bevor er sich der nächsten Seite zuwendete. Lautlos setzte ich mich auf eine der kalten Stufen der Steintreppe, hörte das Lodern des Feuers, das metallene Geräusch, wenn mein Vater die Schere auf den hellbraunen Kachelboden legte.
Vielleicht saß ich auf der Treppe eine Stunde lang, vielleicht länger, ich mußte eingenickt sein, denn mein Vater, den ich nach wie vor durch den Türspalt sah, saß jetzt im Lehnsessel. Er war blaß und regungslos und blickte auf einen auf dem Boden vor sich liegenden Punkt. Von rechts, aus der Küche kommend, hörte ich die leisen Schritte meiner Mutter, die vor dem Kamin stehen blieb. Im Feuer wölbten sich die letzten Ecken und Kanten der Fotos, sie lösten sich auf mit leisem Zischen und einer kleinen bunten Stichflamme. Meine Mutter ging zu meinem Vater, rüttelte ihn sanft, und nachdem er nicht reagierte, ertastete sie seinen Puls, legte ihr Ohr an seinen Mund, schüttelte ihn fester, und als er die Augen zum ersten Mal bewegte, meinte ich, ein Schluchzen zu hören. Meine Mutter beugte sich vornüber, legte ihren Kopf auf die Brust meines Vaters und umklammerte ihn. Sie strich mit dem Handrücken über seine Wange, und mein Vater sah meine Mutter ratlos und verloren an, er ließ sich an ihrem Arm aus dem Lehnsessel ziehen, und ich hörte meine Mutter sagen: „Du legst dich ins Bett, ich mache dir eine Kraftbrühe und einen Lindenblütentee, du legst dich jetzt hin“, und als sie ihn zur Wohnzimmertür führte, lief ich lautlos die Treppe hinauf und verkroch mich unter meiner Decke.