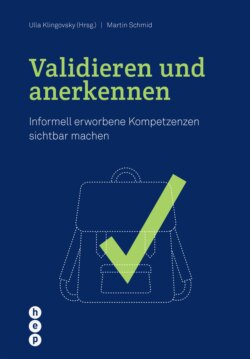Читать книгу Validieren und anerkennen (E-Book) - Martin Schmid - Страница 4
Anerkennung und Validierung als erwachsenenpädagogische Handlungspraxis
Оглавлениеvon Ulla Klingovsky
Grundlage des vorliegenden Bandes ist eine intensive Auseinandersetzung mit der in jüngster Zeit prominent gewordenen erwachsenenpädagogischen Handlungspraxis des Validierens. In der sogenannten Wissensgesellschaft scheint die Validierung von Lernprozessen über die Lebensspanne – unabhängig davon, ob Lernen sich in formalen, non-formalen oder informellen Kontexten vollzieht – ein funktionales Erfordernis geworden zu sein. Angesichts der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte verlaufen die meisten Berufslaufbahnen längst nicht mehr geradlinig, und einmal in der Ausbildung erworbenes Wissen scheint kaum mehr ausreichend, um die eigene «Employability» ein Leben lang aufrechtzuerhalten. Die Unterstützung der lebenslangen berufsbiografischen Gestaltung diskontinuierlich gewordener Erwerbsbiografien scheint deshalb ein erstrebenswertes Ziel.
Das Thema der Validierung von Lernergebnissen gewinnt vor allem im Zuge der Einführung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) an Bedeutung. Diese Programmatik basiert auf der Idee einer kompetenzorientierten Ausgestaltung des europäischen Bildungsraums, in dem die Lernergebnisse und Kompetenzen, die für die konkrete Anwendungspraxis erforderlich sind, handlungsleitende Funktion haben. In zahlreichen bildungspolitischen Kontexten und Initiativen, in wissenschaftlichen Projekten und Publikationen werden Modelle erarbeitet, die die im Laufe des Lebens in unterschiedlichen Situationen erworbenen Lernergebnisse feststellbar machen und «validieren» sollen. Die national umzusetzenden Qualifikationsrahmen folgen der Überzeugung, dass die künftige Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft nur sichergestellt werden können, wenn alle Ressourcen und Potenziale der einzelnen Mitglieder so gut wie möglich genutzt werden. Dies beinhaltet neben der Ausgestaltung eines qualitativ hochwertigen formalen Bildungssystems auch die Wertschätzung und formale Zertifizierung des informellen Lernens sowie des non-formalen Lernens im institutionellen Rahmen – Lernformen, die bislang kaum zu formal anerkannten Schul-, Berufs- oder Studienabschlüssen führen. Diese Programmatik geht mit zahlreichen Versprechen einher – mit diskursiven Begründungsfiguren, die die Einführung von Kompetenzfeststellungsverfahren begleiten und dabei weit über die Diskussion um spezifisch ausgewiesene Qualitäts- und Gütekriterien (Objektivität, Validität und Reliabilität) hinausweisen.
So sollen gemäss dem «humankapitaltheoretischen Kompetenzansatz» (Traue 2010, S. 57) Kompetenzvermessungen zu einer Steigerung des «Humankapitals» führen; es wird davon ausgegangen, dass die statistische Qualifikationsstruktur der Bevölkerung insgesamt verbessert werden könne. Kennzahlen, Kompetenzskalen und Punktesysteme gewähren angeblich eine effizientere Verteilung des Humankapitals innerhalb von Unternehmen und sorgen damit für einen Anstieg der Produktivität ebenso wie für eine erhöhte Innovationsfähigkeit. Schliesslich könnten auch Personen mit geringer formaler Qualifikation für anspruchsvollere Aufgaben qualifiziert werden (vgl. Prokopp 2010).
Auf gesellschaftspolitischer Ebene besteht die Erwartung, dass sich die Effizienz des Bildungssystems erhöhe und dass sich der Zugang dazu verbessere. Zudem soll der Blick auf vorhandene Kompetenzen eine bessere Planung von bildungspolitischen Entscheidungen in Hinblick auf das lebenslange Lernen und Massnahmen im Sinne der Arbeitsmarktpolitik ermöglichen. Generell sind die Erwartungen an mögliche Auswirkungen der Kompetenzvermessung für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa derart hoch, dass durchaus von Heilsversprechen die Rede sein kann (vgl. Zürcher 2007).
Nun ist die Orientierung an arbeitsmarktbezogenen Erfordernissen allerdings nicht ursächlich für die Beschäftigung mit Lernerfahrungen in der Erwachsenenbildung. Der Wert von Vorerfahrungen in Lernprozessen wurde mit John Deweys erfahrungsbasierter Lernkonzeption prominent und prägte Generationen erwachsenenpädagogischer Lerntheorien (vgl. Faulstich 2005). Für Dewey war die Sichtbarmachung und Anerkennung dieser Lernerfahrungen im Lernprozess zentral: «The beginning of instruction shall be made with the experience learners already have. […] This experience and the capacities that have been developed during its course provide the starting point for all further learning» (Dewey 1938, S. 74).
Bildungsangebote, in denen man sich seines Könnens vergewissert, über vorhandenes Wissen Bilanz zieht, biografische Lernleistungen würdigt und weiterentwickeln kann, sehen in der Erwachsenenbildung demnach auf eine lange Tradition zurück. Es ist bekannt, dass Frauenverbände und engagierte Aktivistinnen in der Schweiz erste Verfahren der Bilanzierung im Sinne des Empowerment entwickelt und erfolgreich eingeführt haben (Arpagaus 2016). Gewerkschaften begründen den Nutzen der Validierung für die Sicherung der beruflichen Laufbahn noch heute damit, dass sich die berufliche Handlungskompetenz wesentlich arbeitsintegriert und berufsbegleitend weiterentwickelt. Ebenso wurde und wird gegenwärtig im Zuge von Flucht- und Migrationsdiskursen über die Anerkennung von Kompetenzen, die in aussereuropäischen Bildungsräumen erworben wurden, und die Integration dieser Personen in den europäischen Arbeitsmarkt debattiert. Vor diesem Hintergrund scheint es naheliegend, die Themen «Anerkennung» und «Validierung» im Rahmen des lebenslangen Lernens im Zuständigkeitsbereich der Erwachsenen- und Weiterbildung zu verorten. Mit welcher Perspektive auf gesellschaftliche Problemlagen und mit welchem pädagogischen Aufgabenverständnis sich die Erwachsenenbildung für dieses Erfordernis allerdings zuständig erklärt, das sind Fragestellungen, an denen sich der vorliegende Band orientiert.
Martin Schmid ist es dabei gelungen, nicht nur die Grundlagen und Begründungsstrukturen unterschiedlicher Validierungs- und Anerkennungsverfahren zu veranschaulichen, sondern auch ihre je spezifische Ausrichtung und Methodik sowie ihre Ziele und Bewertungsmassstäbe zu sezieren. Dabei wird deutlich, dass aktuelle Anerkennungs- und Validierungsverfahren in der Erwachsenenbildung unterschiedliche theoretische, sozial- und bildungspolitische sowie insbesondere auch ökonomische Bezugspunkte aufweisen. Es ist ein zentrales Verdienst von Schmids Arbeit, dass sie die Bedeutung des Anerkennungsbegriffs in der Validierungsdiskussion akzentuiert und für die erwachsenenpädagogische Handlungspraxis untersucht. Aus einer erwachsenenpädagogischen Perspektive, die sich kritisch auf die Bedingungen und Verhältnisse bezieht, die bestimmte Diskurse und Verfahren – hier die Kompetenzerfassung – als Gegenstand hervorbringen, drängt sich diese Frage geradezu auf. Denn eine professionelle erwachsenenpädagogische Handlungspraxis des Validierens und Anerkennens muss sich fragen, mit welchen Vermessungspraxen welche Aspekte des Menschen genau erfasst und quantifiziert werden und was in den Verfahren überhaupt als messbar und relevant erscheint. In der Diskussion von Anerkennungs- und Validierungsverfahren wird damit die Frage virulent, welche theoretische Fundierung der Anerkennungsbegriff erfährt. Entgegen dem umgangssprachlichen Begriffsverständnis bezieht sich die philosophische Kategorie der Anerkennung nicht allein auf die zwischenmenschliche Wertschätzung im Sinne einer ethischen Grundhaltung. Vielmehr bezeichnet der Begriff der Anerkennung seit dem deutschen Idealismus weit grundlegender das auch in Kompetenzfeststellungsverfahren konstitutive Wechselverhältnis zwischen Subjektivität und Sozialität (Kuch 2012, S. 39ff.). So verstand Johann Gottlieb Fichte unter «Anerkennung» das wechselseitige Verhältnis selbstbewusster Individuen, die, um die Freiheit der anderen nicht zu gefährden, ihre eigene Handlungsfreiheit begrenzen. Dieser Gedanke begründet unsere heutige Rechtsvorstellung. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der den Begriff der Anerkennung von Fichte aufnahm und entscheidend erweiterte, konzipierte eine Theorie der Anerkennung, die als Bindeglied zwischen «Ich» und «Wir», zwischen Individuen und Gemeinschaftsformen oder sozialen Systemen und Institutionen vermittelt. Dieses Verhältnis ist allerdings nicht unproblematisch, wie ein Blick auf die Hegel’sche Figur von «Herr und Knecht» verdeutlicht (vgl. Hegel 1975, S. 145): Auf der einen Seite kann kein Individuum ohne Integration in eine Gruppe (z.B. die Familie) ein individuelles Bewusstsein ausbilden. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite aber ohne Anerkennung zwischen Individuen der Vollzug bestimmter Gemeinschaftsformen nicht möglich. Die Komplexität besteht darin, dass jede Seite die andere zugleich voraussetzt, wie sie sie auf der anderen Seite negiert. Der Grundbegriff der Anerkennung macht es demzufolge möglich, die Freiheit des Subjekts in Verschränkung mit der Freiheit des anderen zu verstehen. Dies beinhaltet die Idee einer grundlegenden Abhängigkeit in der Realisierung von Freiheit. Das Subjekt ist nicht selbstgenügsamer Ausgangspunkt und freischwebender Vollzugsort von Freiheit, vielmehr erlangt es Freiheit nur in Abhängigkeit von anderen. Wir bedürfen der Anerkennung durch andere, weil wir durch sie Selbstverhältnisse ausbilden und eine soziale Existenz erlangen. Gleichzeitig sind wir durch die Anwesenheit der anderen limitiert.
Für Verfahren, die auf die Vermessung von persönlichen Kompetenzprofilen zielen, ist dieses gegenseitige Konstitutionsverhältnis nicht unbedeutsam. So müssen solche Verfahren beispielsweise stets berücksichtigen, dass im Zentrum der Überlegung um die Kompetenzerkennung der Mensch als Inhaber und Träger von Kompetenzen erscheint, die das Ergebnis individueller Lernleistungen darstellen, deren Potenz vermessen werden soll. In der Konsequenz einer problematischen Vermessungslogik würden die getesteten Personen nun weniger als freie Individuen zur Geltung kommen, sondern entlang vorgegebener Kriterien sozial relationiert; die vergleichbar gemachten Einzelnen würden zueinander ins Verhältnis gesetzt. Dies wäre ein Verfahren, das keinen anderen Zweck erfüllte, als bekannte Formen institutioneller Selektion und gesellschaftliche Hierarchisierung zu legitimieren und zu reproduzieren (vgl. Bourdieu 1993; Gould 1988).
Immer wenn die Attribuierung von Kompetenz mit der Vorsilbe «In-» korreliert, befördert eine Messung von Kompetenzen die zunehmende Beschäftigung mit Inkompetenzen. Damit verweist die Vermessungslogik auf Potenziale und Fortschritte ebenso wie auf Defizite und Ressourcen, welche die Richtung der weiteren (Lern-)Arbeit des Menschen an sich selbst anzeigen. Frühe Kritiker der Vermessungslogik deuten diese Form der Objektivierung der Subjekte als Zuspitzung eines technokratischen Positivismus, der durch die Quantifizierung von Qualitäten die Dynamik individueller Selbst- und Weltverhältnisse und gesellschaftlicher Veränderungen stillstellt. «Seinem geschichtlichen Wirken nach ist der Test […] eine Vorrichtung am Fliessband jenes höchst präzisen Produktionsverfahrens, das den reduzierten, nach Standardausmessungen gearbeiteten Menschen liefert, den Menschen, den man brauchen, das heisst verbrauchen kann» (Sonnemann 1981, S. 185). Aber selbst wenn die Vermessung von Kompetenzen nicht mehr (allein) darauf zielt, ein Individuum zum Objekt äusserlicher Testnormen zu machen, ist dem Zusammenhang von äusserer Norm und individueller Lernleistung nicht zu entkommen. Auch Verfahren, die lediglich ein entsprechendes Feedback anstreben, unterstellen, dass der Mensch als Träger seiner Kompetenzen für seine eigenen Lernleistungen verantwortlich gemacht werden kann. Indem sich die Kompetenzmessung mit den Imperativen der Wissensgesellschaft verbindet, in denen die eigenen Kompetenzen selbstverantwortlich und eigeninitiativ kontinuierlich verbessert und erweitert werden müssen, kippt sie von der Objektivierung zur Subjektivierung. Dementsprechend wäre «die wichtigste Kompetenz jedes Kompetenzsteigerungszentrums die Kompetenzsteigerungskompetenz» (Reichenbach 2007, S. 74).
Man kann das weite Feld der Anerkennungstheorien etwas holzschnittartig in ein positives und ein negatives Paradigma unterteilen. Reicht die erste, «positive» Traditionslinie von Fichte und Hegel bis zu Charles Taylor und Axel Honneth, so führt die zweite, die «negative» Traditionslinie von Jean-Jacques Rousseau bis zu Jean-Paul Sartre und Louis Althusser. Zu dieser Linie zählen auch Judith Butler und Nancy Fraser (vgl. Balzer 2007). Während die von Axel Honneth und Charles Taylor entfaltete Anerkennungstheorie darlegen kann, inwiefern die wechselseitige Anerkennung zwischen Subjekten für die Herausbildung von Selbstverhältnissen wesentlich ist, und auf diese Weise zu einem Verständnis des Sozialen gelangt, in dem die Freiheit des Subjekts mit der Freiheit des anderen verschränkt ist, bleibt das Verständnis von Machtverhältnissen und Anerkennungsordnungen darin seltsam vernachlässigt. Anerkennung wird hier als Medium betrachtet, das Wechselseitigkeit und Gleichheit ermöglicht und Subjekte bildet oder befähigt.
Den Ausgangspunkt der «negativen» Anerkennungstheorie bilden demgegenüber die spezifischen Formen der entzogenen Anerkennung. Missachtung, Entwürdigung oder Beleidigung sind Phänomene, in denen sich der einschränkende und unterwerfende Charakter der Anerkennung zeigt., Die «negative» Variante der Anerkennungstheorie macht darauf aufmerksam, dass Strukturen der vorenthaltenen Anerkennung und der Missachtung mit Formen sozialer Macht verbunden sind. Rassistische Exklusion, geschlechtliche oder körperliche Ungleichheit und die Diskriminierung von Minderheiten verweisen auf Positionierungen im sozialen Raum und erweisen sich als das Ergebnis von Machtstrukturen, die auf sehr intime Weise mit vorenthaltener Anerkennung verbunden sind. Vor diesem Hintergrund bedarf die Beschäftigung mit Anerkennungsverfahren einer umfassenden Analyse all jener Praktiken, durch die bestimmte Menschen und ganze soziale Gruppen missachtet werden – und zwar, in den Worten von Nancy Fraser, «innerhalb der gesamten Gesellschaft, nicht nur im Recht und durch das Recht» (ebd., S. 253). Aus dieser Perspektive werden soziale Klassifikationen und kulturelle Repräsentationen ebenso wie symbolische Interaktionen in und mittels Anerkennungs- und Validierungsverfahren zum Schauplatz symbolischer Machtverhältnisse.
Vor diesem Hintergrund steht der Begriff der Anerkennung nicht für ein weiteres Themenfeld der ohnehin zahlreichen und vielfältigen Diskurse in der Erwachsenenbildung, sondern für eine zentrale Dimension erwachsenenpädagogischer Theorie und Praxis schlechthin: In der Auseinandersetzung von Ich und Welt, in der Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeiten und in der Bearbeitung dieser komplexen Verstrickungen konstituiert sich eine modern-reflexive Erwachsenenpädagogik. Sie ist dem grundlegenden Ziel verpflichtet, Individuen in der Entwicklung selbstbestimmter und rational begründeter Entscheidungs-, Handlungs- und Urteilsfähigkeit zu unterstützen, vorhandene Macht- und Ungleichheitsverhältnisse zu reflektieren und die Konstitution eines gesellschaftlichen Allgemeinen unter Berücksichtigung individueller Besonderheiten zu befördern. Es bietet sich an, diese Dimensionen der Anerkennungsthematik künftig für eine reflexive Validierung von differenten Modi lebensbegleitender Bildung fruchtbar zu machen (Schäffter/Schicke 2016).
Rezipiert man den anerkennungstheoretischen Diskurs unter dem Aspekt einer erwachsenenpädagogischen Handlungspraxis, so ist der Dialektik von Bildung und Herrschaft (Heydorn 1970) angemessen zu begegnen. Mit ihrer gesellschaftlichen Selektions- und Allokationsfunktion stellen Anerkennungs- und Validierungsverfahren einen formalisierten Anforderungskatalog zur Reproduktion sozialer Ungleichheit dar, wie sie sich mit Blick auf die lebensbegleitende Reflexionsfunktion der Erwachsenenbildung auch als «Möglichkeitsraum für Bildungs- und Berufswege, für Übergänge, Einstiege, Wiedereinstiege, Quereinstiege, Aufstiege» (Schäffter/Schicke 2016, S. 29) erweisen könnten.
Dabei stellt sich die theoretisch wie praktisch anspruchsvolle Frage, wie Anerkennung und Validierung als erwachsenenpädagogische Handlungspraxen so gestaltet werden können, dass «Fähigkeiten von Menschen» als politisch relevanter Sachverhalt neu verhandelt werden können. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil sich pädagogische Handlungsfelder aus einer anerkennungstheoretischen Perspektive unter dem Gesichtspunkt einer je dominanten «Anerkennungsordnung» respektive ihrer Funktion als «Anerkennungsarena» analysieren lassen. Eine «Anerkennungsordnung» bezieht sich nach Nothdurft auf das je spezifische System von Standards, Kriterien und Gesichtspunkten, aus dem heraus Anerkennung für spezifische Leistungen gezollt oder eben versagt wird (vgl. Nothdurft 2007, S. 118). In der Anerkennungsordnung ist geregelt, «wer (Autorität) für was (performative Leistung) in welcher Weise (Anerkennungsmodi) Anerkennung gewinnt bzw. gewährt» (ebd.). Die «Anerkennungsarena» bezeichnet dabei «die spezifischen sozialen Gelegenheiten, in denen kultur-, milieu- oder gruppenspezifisch Anerkennung erstrebt bzw. gezollt wird» (ebd.). Derartige Konzeptionen sind anschlussfähig, um Anerkennungsverfahren unter dem Aspekt von Autorität, Macht und Einfluss zu untersuchen.
Zusammengefasst, gibt es unterschiedliche Aspekte, an denen die erwachsenenpädagogische Relevanz des anerkennungstheoretischen Diskurses mit Blick auf eine erwachsenenbildungsrelevante Gestaltung von Validierungs- und Anerkennungsverfahren deutlich wird. Neben den allseits proklamierten zentralen Dimensionen der Validierung, wie der Sichtbarmachung und Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen, der damit erhofften Durchlässigkeit im Bildungssystem, der effizienten Nutzung verborgener Potenziale auf dem Arbeitsmarkt und dem angestrebten «Mehr» an Partizipation und Chancengleichheit gibt es eine Kehrseite der Medaille, die im schlechtesten Fall zu direkten «Nebenwirkungen» führen kann. Neben dem Problem der «Kolonialisierung von Lebenswelten», die durch die Nutzbarmachung des gesamten Menschen für die Produktionssphäre droht (Welton 1995), besteht die Gefahr, dass durch eben jene Sichtbarmachung unter den gegebenen Anerkennungsordnungen und -arenen wiederum Selektionsmechanismen wirksam werden und neue soziale Benachteiligungen entstehen.
Bezogen auf die Anerkennungsproblematik, bleibt die bisherige Diskussion um Anerkennung und Validierung also durchaus ambivalent, besonders dort, wo dem Individuum die weitgehende Verantwortung für erforderliche Lernprozesse zugewiesen wird, deren Anerkennung durch eine übergeordnete Instanz in grosszügigem und tolerantem Gestus gewährt werden soll. Wird Anerkennung demgegenüber begrifflich als relationales Bedingungsgefüge zwischen Struktur, Andersheit und Subjektkonstitution gefasst, können die Bedingungen und Verhältnisse, unter denen Validierung und Anerkennung stattfinden, reflexiv werden. Damit wäre ein Grundstein für die (Re-)Konzeption bildungsförderlicher Anerkennungsordnungen gelegt.
Es ist ein Verdienst der Arbeit von Martin Schmid, die Diskussion auf Basis einer fundierten Auslegeordnung zu eröffnen. Dabei liegt mit diesem Band nicht nur erstmals im deutschsprachigen Raum eine substanzielle Klärung verwendeter Begriffe und Unterscheidungen vor, sondern darüber hinaus eine Systematisierung vorhandener Validierungs- und Anerkennungsverfahren sowie ihre theoretische Fundierung und praktische Ausgestaltung. Die komparative Anlage der Untersuchungen bezieht dabei länderspezifische Besonderheiten ein und setzt die entwickelten Verfahren zu den jeweils vorhandenen Strukturen der nationalen Bildungssysteme in Beziehung. Auf diese Weise ist eine Archäologie der Ordnung von Verfahren entstanden, die zum Referenzwerk für die weiteren Bemühungen um Anerkennung und Validierung in der Erwachsenenbildung werden wird.