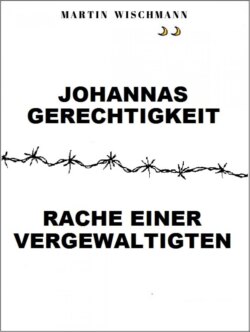Читать книгу Johannas Gerechtigkeit (Rache einer Vergewaltigten) - Martin Wischmann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
05. April 1968
Оглавление„Wer tut nur so etwas? Welcher Irre erschießt einen Bürgerrechtler, der für Gewaltlosigkeit eintritt?“, fragte Rudolf Wenk seinen am Frühstückstisch sitzenden Schwiegervater Karl König, während im Hintergrund weiter die aktuelle Nachrichtenmeldung aus dem alten Küchenradio drang. „Ich weiß es nicht, Rudolf“, entgegnete der Endfünfziger, „vielleicht handelt es sich bei dem Attentäter um einen Fanatiker, der etwas dagegen hat, das unterschiedliche Kulturen in Frieden miteinander leben. Der Hass unter den Menschen ist so alt wie diese Welt, seit Urzeiten, seit dem Mord von Kein an seinem Bruder Abel, so man an die Bibel glaubt. Ich garantiere dir, dass der gestrige Mord an Martin Luther King nicht der letzte seiner Art bleiben wird. Gestern war es ein farbiger Bürgerrechtsaktivist, der in Amerika gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde, morgen ist es vielleicht ein weißer Politiker in Europa, …oder jemand wie du und ich.“ „Überleg mal“, sagte Rudolf, während er aus einer mit Blumenmotiven verzierten, zart rosafarbenen Porzellan- Kaffeekanne kräftig duftenden schwarzen Kaffee in zwei gleichermaßen verzierte Kaffeetassen goss, „sie sagten, dass Martin Luther King nur neununddreißig Jahre alt wurde, gerade mal zwölf Jahre älter, als ich gerade bin. Wie die Zeit so spielt, drüben in Memphis verlor ein Friedliebender sein Leben und hier bei uns in Deutschland, im schönen Hessenland wird zur gleichen Zeit, am 04. April 1968 ein Baby geboren. Ich kann es noch gar nicht fassen, nun Vater eines kleinen Mädchens zu sein.“ „Du sagst es, Rudolf“, stimmte Karl König nickend zu, „es ist auch für mich ein Wunder, zum zweiten Mal Großvater, …Opa zu sein. Ein Jammer, dass meine liebe Erika es nicht mehr erleben durfte. Sie war noch so jung, als sie starb. Und jetzt, …jetzt wäre sie zweifache Großmutter und hätte ihre wahre Freude an den Enkelkindern.“ Mit einem knappen, „Tja, wirklich traurig“, stimmte Rudolf kopfnickend seinem Schwiegervater zu, während er mit den beiden fast randvollen Kaffeetassen, behutsam Richtung Küchentisch schritt und sie dort vorsichtig abstellte. Die beiden Männer genossen sichtlich zufrieden den starken Bohnenkaffee, dessen wohliges Aroma die gesamte Räumlichkeit der Küche ausfüllte. Der hochgewachsene, schlanke Rudolf saß mit einem dunkelblauen Trainingsanzug bekleidet auf einem der knarrenden, alten Holzstühle und blickte entspannt aus dem Küchenfenster, hinüber zu der im Morgennebel liegenden Wiese, die sich hinter dem Haus anschloss. Der legere Trainingsanzug wurde von Rudolf gerne in der Freizeit getragen, denn im Berufsleben waren gut geschnittene Anzüge mit Krawatte und Lackschuhen Pflicht, denn als Versicherungsvertreter kam es für ihn auf ein gepflegtes Äußeres an. Aus dem gleichen Grund trug er sein mittelblondes Haar stets akkurat frisiert und kurz, Vorgaben des Arbeitgebers, denen sich Rudolf wortlos unterordnete. Karl hingegen, saß mit einer abgewetzten Jeanshose und bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Hemdsärmeln, einen Arm auf den schweren Eichenholz Küchentisch gestützt da und schlürfte den Kaffee Zug um Zug auf. Sein rot-weiß kariertes Hemd hatte einige Flecken an der linken Seite, denn der Mann betrieb eine kleine Landwirtschaft, bestehend aus Kühen, Rindern, Schweinen und Hühnern auf dem Anwesen, welches seit Generationen als Birkenhof bekannt war, da um das Anwesen herum zahlreiche, meist ältere Birken standen. Auch an diesem Morgen hatte der stämmige Mann mit dem dunklen, dichten Schnurrbart, -den man in der Region Schnorres nannte, und den kleinen freundlichen Augen schon die Tiere gefüttert und die Ställe ausgemistet, bevor er den wohlverdienten Kaffee zu sich nahm. Für gewöhnlich kochte seine Tochter Marianne Wenk, die vierundzwanzigjährige Ehefrau von Rudolf den Frühstückskaffee, ebenso half sie seit ihrer Kindheit mit ganzer Kraft auf dem Hof mit. Somit wusste man auf dem Hof, was echte Arbeit ist, denn in der Landwirtschaft gibt es keine Stechuhr und keine Feier- und Sonntage und Karl beneidete gerade in den letzten Jahren, seid seine Kraft spürbar nachließ, einige seiner ehemaligen Schulkameraden, die Beamte oder bleistiftspitzende Staatsdiener, wie er sie augenzwinkernd nannte, geworden waren, denn am Schreibtisch würde seiner Meinung nach Alles, aber keine Sache stattfinden, die den Begriff Arbeit verdiene, was nicht selten zu Unstimmigkeiten führte. Doch in den letzten fünf Wochen war Karl auf sich alleine gestellt, aufgrund der Schwangerschaft seiner Tochter. Karl fiel die harte Arbeit als Landwirt schon lange nicht mehr so leicht wie früher, darum war er froh, als ihm Rudolf am Vorabend die Nachricht der glücklich verlaufenen Geburt aus dem Krankenhaus mitbrachte. Mutter und Kind waren wohlauf. Dies freute freilich alle miteinander am meisten, denn die bodenständige Familie war sich immer bewusst darüber, dass einzig die Gesundheit das höchste Wohl auf Erden, -das größte Glück überhaupt darstellt. Sowohl Rudolf als auch seine noch im Krankenhaus befindliche Ehefrau Marianne waren von ihren Eltern an den christlichen Glauben angelehnt erzogen worden. Zwar nicht beinhart streng, aber Werte wie Nächstenliebe, Menschlichkeit und Anstand waren hoch angesetzte, wichtige Werte, -das Anhäufen und Vermehren von Besitztümern und Reichtümern war ihnen, -selbst nur als Denkansatz völlig fremd und unverständlich. Die Familie lebte Tag für Tag und wusste, dass jeder neue Morgen, der Beginn eines weiteren Arbeitstages war. Gewiss, die Arbeitszeiten von Rudolf, der bei einer mittelständigen Versicherungsgesellschaft seit gut fünf Jahren beschäftigt war, waren seit Jahren die gleichen, -er arbeitete von Montag bis Freitag, je von neun bis achtzehn Uhr und hatte etwa vier Wochen Urlaub pro Jahr. Im Grunde war bei ihm jede einzelne Arbeitsstunde gleich, glich wie ein Ei dem anderen. Hätte er an einem einzigen Tag im Jahr auch nur drei Minuten nach achtzehn Uhr Feierabend gehabt, hätte er es rot im Kalender vermerkt, Die freien Tage am Wochenende nutzte Rudolf jedoch immer, um sich von der “schlauchenden Arbeitswoche“, wie er es nannte, -häufig von Schwiegervater Karl belächelt, zu erholen. Auf dem Hof, bei der Landwirtschaft, half er so gut wie nie, was seinem Schwiegervater von Anbeginn der Ehe mit Marianne missfiel. Karl hätte sich einen Schwiegersohn gewünscht, der mit ganzer Kraft in die Landwirtschaft eingestiegen wäre, denn so wie jetzt würde der Hof nicht mehr lange zu bewirtschaften sein, …vermutlich. Karls Hoffnung war es, dass er mit nunmehr neunundfünfzig Jahren noch so lange zusammen mit Tochter Marianne die Arbeit würde leisten können, bis ein Mitglied der nächsten Generation auf dem Hof vollzeitig einsteigen würde. Aber der Nachwuchs müsste dies auch wollen. Und würden die Jahre bis dahin nicht doch zu lange für Karl werden? Das neugeborene Mädchen wäre frühestens in zwei Jahrzehnten vor die Entscheidung zu stellen, den Hof zu übernehmen, Interesse ihrerseits vorausgesetzt. Ungefähr gleich lange würde der zweijährige Erstgeborene von Rudolf und Marianne noch Bedenkzeit haben, dessen war Karl sich bewusst. Die große Verantwortung einen selbst kleinen Bauernhof zu führen, durfte nicht überstürzt entschieden werden. Ein Bauernhof bedeutet harte Arbeit, im Grunde rund um die Uhr und war das genaue Gegenteil der Ponyhofromantik, die viele unwissende Großstädter auf dem Land vermuteten, wie Karl es immer wieder betonte, wenn das Thema auf die Zukunft des Hofes fiel. Karl meinte stets, dass er einen echten Mann an den Händen erkenne. Sind die Handflächen weich und rosafarbig hat der Weichling, wie er es nannte, auf dem Land nichts zu suchen. Nach Karls Philosophie mussten Männerhände hart, rau und von dicker Hornhaut bedeckt sein, -einen Händedruck, gleich eines Schraubstockes ausüben können und völlig temperaturunempfindlich sein. Karl wusste, was Anpacken bedeutet, weil er von Kindesbeinen an das Arbeiten, das schwere Arbeiten gewohnt war. Die Zeit, einen halben Tag die Füße hochzulegen, hatte ein Bauer nicht, denn jedes Tier, egal ob Milchvieh, Borsten- oder Federvieh musste versorgt werden, mit allem was dazu gehörte. Dieser Verantwortung musste sich jeder ernsthafte Anwärter auf die Hofübernahme bewusst sein. Schon lange kreisten die Gedanken von Karl um das Thema der Hofzukunft. Und auch wenn er ein wenig traurig darüber war, das Rudolf am Hof kein Interesse zeigte, so war er doch andererseits auch stolz auf seinen Schwiegersohn, denn in seiner Arbeit als Versicherungsangestellter blühte er auf und führte den Job zuverlässig und mit großem Fleiß aus. Immer wieder betonte Karl auch, dass Rudolf gutes Geld verdiene, ohne sich zu überanstrengen. Meist schoss Karl solche Verbalpfeile ab, wenn er müde gearbeitet und leicht gereizt war, aber es blieb stets bei einem Satz. Aber im Herzen wusste Karl, das Rudolf ein treusorgender Ehemann und Familienvater war. Einzig die Auffassung von Arbeit unterschied die zwei Männer, ansonsten respektierten sich beide gegenseitig. Während Rudolf noch ein wenig in seiner Aktentasche, die auf dem Stuhl neben ihm stand, herumkramte, wie er es immer tat, bevor er sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz machte, trug Karl, dessen Gedanken noch immer bei der Zukunft des Hofes waren, die beiden leeren Kaffeetassen, zu dem kleinen Spülbecken unweit des Esstisches. „Karl“, sagte Rudolf, während er seine Aktentasche verschloss, „ich werde heute nach der Arbeit rüber zum Krankenhaus fahren. Der Arzt hat gemeint, dass Marianne und das Baby, wenn nichts dazwischen kommt, heute Abend nach Hause dürfen. Freust du dich auf Johanna?“ „Johanna, …an den Namen muss ich mich erst noch gewöhnen, …natürlich freue ich mich auf die kleine Krott. Du weißt ja, wie ich es meine. Hier in unserer Gegend bezeichnen wir liebevoll ein kleines Mädchen als Krott, es ist sozusagen eine süße kleine Kröte.“ Während Rudolf wortlos zu den Kleiderhaken ging, welche an der Rückseite der Küchentür befestigt waren, um seine hellgraue Anzugjacke abzuhängen, fuhr Karl fort: „Rudolf, warum hängst du denn deinen Wams, -deine Jacke immer in der Küche auf? Sie nimmt doch den Geruch des Essens an.“ „Mach dir keine Gedanken“, erwiderte Rudolf, „ die Jacke ist nicht so empfindlich. Die Küche wird auch in Zukunft ein guter Platz für sie sein, …sicher besser als unser Schlafzimmer, wenn es nach den vollgeschissenen Windeln von Johanna stinkt. Oje, …bei Marianne darf ich nichts von stinkenden Windeln sagen, …du weißt doch, …für Mütter stinken die Windeln nicht, sie muffeln höchstens.“ „Wie wahr“, ergänzte Karl, „wenn ich daran denke, wieviel Stoffwindeln Marianne in den nächsten Monaten waschen muss. Da hat sie viel zu tun, …aber so ist das halt, … Windelwaschen ist Frauenarbeit.“ „Gottlob, da hast du recht“, nickte Rudolf, „ich habe vorsorglich einen ganzen Schwung neuer Stoffwindeln gekauft, falls Marianne mit der Wäsche nicht nachkommt. Gott sei Dank ist der kleine Dietrich seit einigen Wochen aus den Windeln raus, so hat Marianne nicht noch die doppelte Arbeit. Obwohl Dietrich mit seinen zweieinhalb Jahren eigentlich ganz früh sauber ist, zumindest im Vergleich zu mir. Meine Mutter hat mir immer vorgehalten, dass ich noch an meinem vierten Geburtstag Windeln anhatte.“ „Großer Gott“, fuhr Karl auf, „da war deine Mutter aber nicht zu beneiden, bei so einem hosenscheißenden Balg, oder?“ „Ja, so war ich eben“, antwortete Rudolf, „nun muss ich mich aber fertigmachen. Die Arbeit ruft.“ Rudolf spähte auf seinem Weg durch den Hausflur einen kurzen Moment in das offen stehende Schlafzimmer, um einen Kontrollblick auf seinen kleinen Sohn Dietrich zu werfen, der friedlich schlafend in dem kleinen Kinderbettchen, welches direkt neben dem elterlichen Ehebett stand, vor sich hinschlummerte. Dann verschwand er hinter der Badezimmertür. Knapp zehn Minuten später kehrte der Mann in die Küche zurück, fein heraus geputzt in seinem grauen Anzug, dem weißen Hemd und der blassvioletten Krawatte. Dazu die schwarzen Lackschuhe und die vergoldeten Manschettenknöpfe. Der eigentliche Geruch der Küche, bestehend aus einer Mischung von Kaffeearoma und etlicher sonstiger, teils undefinierbarer Geruchsrichtungen, zu denen auch Karl nicht unerheblich beitrug, wurden schlagartig von Rudolfs starkem Rasierwasser überdeckt. Der Mann verwendete das scharfe Wasser allmorgendlich, obwohl es wie Feuer auf der empfindlichen Gesichtshaut brannte. Karl hingegen pflegte überhaupt kein Rasierwasser zu nehmen, denn man könnte seiner Meinung nach die Haut mit reinem Leitungswasser wesentlich pfleglicher behandeln, als mit dem Geldabzockerwasser. „Ich bin fertig, Karl“, rief der Schwiegersohn, während er seine Aktentasche griff und anschließend aus der schmalen Schublade des massiven Holztisches seinen Autoschlüssel hervor holte, „kannst du bitte nachher nach Dietrich sehen? Er schläft noch, …seine frischen Anziehsachen liegen neben dem Bett auf der Kommode. Schau, dass er genug isst, aber pass bitte auf, dass er nicht alleine die steilen Treppen betritt. Meinst du, du schaffst es? Heute Abend sind wir ja alle wieder da. Ich hole Marianne und Johanna vermutlich direkt nach der Arbeit ab.“ „Alles klar“, antwortete Karl nickend, „schließlich habe auch ich schon Kinder großgezogen. Unsere Marianne kam ja mitten im zweiten Weltkrieg zur Welt. Meine Güte, das waren Zeiten, …so etwas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und den Luxus von vorgefertigten Stoffwindeln, die man nach Gebrauch nur waschen muss, hatten wir seinerzeit nicht, …wir mussten Stoffreste und dergleichen nehmen. Heute in den Sechzigern habt ihr es so gut.“ „Alles gut“, fuhr Rudolf leicht gereizt seinem Schwiegervater fast ins Wort, „also dann, …bis heute Abend, …mit einem neuen Familienmitglied.“ Karl nickte seinem Schwiegersohn wortlos zu und begab sich, während dieser leise das Haus verließ, zum Schlafzimmer, in dem der kleine Dietrich noch immer ganz leise schnarchend schlief. Der Großvater warf einen kurzen Kontrollblick auf sein Enkelkind und schritt anschließend zur Haustüre hinaus, die er bis zum Anschlag offen stehen ließ, um das Wachwerden des kleinen Dietrich nicht zu versäumen und setzte sich auf die alte, verwitterte Holzbank, die sich unweit der Haustüre an der Hauswand, auf welche das erste morgendliche Sonnenlicht fiel, befand. Er atmete ein paar Mal schwer durch, nachdem er auf der Bank Platz genommen hatte und genoss die warmen Strahlen der Aprilsonne auf seinem Gesicht und den Unterarmen. Die ersten Vögel zwitscherten von den naheliegenden Birkenbäumen, die das ganze Anwesen in Unmengen umgrenzten. Die langsam höher steigende Sonne vertrieb rasch die Morgenkühle, die allmorgendlich noch von den kalten Nächten kündete. Die Aprilnächte waren noch richtig frisch, doch der Frühling war nicht mehr aufzuhalten, dessen war Karl sich bewusst. Sein Blick schweifte über die Teile des Anwesens, die von der Bank aus einzusehen waren. Das gesamte Areal umfasste das zweigeschossige Wohnhaus, eine große, hallenartige Scheune, mehrere Stallgebäude und großflächiges Wiesen- und Weideland. Umgeben war der Hofbereich von mehr oder weniger unberührter Natur, lediglich alle paar Hundert Meter befand sich eine Feldscheune oder ein weiterer Hof, von denen einige jedoch nicht mehr bewohnt waren und zum Verkauf standen. Bis zum nächsten größeren Ort, -der Kleinstadt Weilburg an der Lahn, waren es etwa acht Kilometer entlang der Landstraße. Dort, am malerischen Flusslauf der Lahn gelegen, arbeitete Rudolf und dort besorgte die Familie auch ihre Einkäufe. Frankfurt am Main war die nächstgelegene Großstadt, aber mit etwa fünfzig Kilometer Entfernung war sie so weit weg, dass Rudolf und seine Frau Marianne meist nur ein- bis zweimal im Jahr hinfuhren. Rudolf liebte die zahlreichen Museen der Stadt, Marianne hingegen hätte am liebsten ständig den städtischen Zoo besucht. Karl dagegen verließ so gut wie nie die Umgebung des Hofes. Sein Leben spielte sich fast nur dort ab. Die Stunden, ja fast jede Minute, waren mit einer bestimmten Tätigkeit verbunden und verplant, selbst die morgendliche Ruhepause auf der Bank, vorausgesetzt das Wetter spielte mit. So saß Karl auch diesmal entspannt auf der Bank, bis die Rufe des wachgewordenen Dietrich die morgendliche Stille unterbrachen und den Opa aus dessen Gedanken rissen. „Ma, …Mama“, schallte es aus dem Inneren des Hauses. Der Großvater erhob sich mit einem leichten Stöhnen von seiner Bank, denn seine beiden Kniee schmerzten bereits seit Jahren, besonders wenn er sich aus sitzender oder liegender Position erhob. Karl hatte gerade einmal den Türrahmen der offen stehenden Haustüre durchschritten, da erblickte er bereits, den im Flur stehenden kleinen Enkeljungen. „Na, guten Morgen, mein lieber Dietrich. Gut geschlafen, mein kleiner Enkelsohn?“, begrüßte der Großvater den Zweijährigen, der sofort seine Ärmchen nach vorne streckte, um hochgehoben zu werden. Karl beugte sich etwas ungelenk zu dem Kind herunter, nahm den kleinen Blondschopf auf seinen rechten Arm und trug ihn in die Küche, um ihn auf der gepolsterten Eckbank wieder abzusetzen. Der lächelnde Junge sah sich suchend im Raum um, während er „Mama... Mama“ sagte. „Die Mama kommt später“, sagte Karl dem leicht unruhigen Kleinkind, während er Milch in eine hellblaue Tasse goss und anschließend mit dem großen Brotmesser eine Scheibe von dem säuerlich riechenden Brotlaib abschnitt, um sie sogleich mit Butter und Erdbeermarmelade zu bestreichen. „Weißt du, kleiner Mann“, fuhr der Opa fort, während er dem Jungen die Milch und das Brot servierte, „die Mama kommt später. Sie bringt ein neues Baby mit, …mit dem kannst du dann fein spielen. Es heißt Johanna, …Joohaannaa, Johanna und Dietrich, verstehst du?“ Der kleine Blondschopf mit dem wild zerzausten Haar, sah Karl ungläubig an, während er mit beiden Händen eifrig damit beschäftigt war, das klebrige Marmeladenbrot zu verspeisen. Bald war das halbe Gesicht des Kindes erdbeerrot verschmiert. Karl, der sich unterdessen mit seiner zweiten Tasse Kaffee neben das Kind gesetzt hatte, schaute milde lächelnd dem kleinen Dietrich, -dem Dreikäsehoch, wie er ihn auch hin und wieder nannte, beim Essen zu. „Nachher hilfst du mir auf dem Hof, mein Kleiner, in Ordnung? Damit du Schritt für Schritt daran gewöhnt wirst, wozu des Menschen Hände gebraucht werden und du echte harte Männerhände bekommst“, stellte der Senior oberlehrerhaft mit erhobenem Zeigefinger in den Raum, obwohl er es ja nicht ganz ernst damit meinte. Es ging Karl vielmehr darum, den Jungen zu beschäftigen und ihn dennoch auf dem weitflächigen Hofgelände nicht aus den Augen zu verlieren. Dietrich, der sich nach dem Frühstück nur widerstrebend von seinem Opa frischmachen und umziehen ließ, folgte diesem anschließend hinaus auf den im strahlenden Sonnenschein liegenden Hof. Das Kind sah lustig aus, mit seinen blauen Gummistiefeln, der mit Hosenträgern gehaltenen Jeanshose, dem roten Wollpulli und der ebenso roten Wollmütze. Die Zwei liefen zielstrebig auf den Hühnerstall zu, aus dessen Innerem es bereits lautstark gackerte. Bei dem Stall handelte es sich um ein komplett aus Holz errichtetes Gebäude, in dem die etwa fünfzig Hühner und vier Hähne die Nächte verbrachten. Die Fensteröffnungen des Stalles waren zum Teil mit schmutzigen Scheiben, durch welche man nicht mehr schauen konnte, bestückt, zum Teil aber auch mit engmaschigem Drahtzaun versehen. Die Zaunmaschen waren so eng, dass kaum ein Finger von Karl hinein passte. Das wichtigste war, das der Hühnerstall bei Nacht dicht abgeschlossen war, es durfte nicht der geringste Spalt nach Außen vorhanden sein. Zu groß wäre das Risiko gewesen, das ein Fuchs oder ein Marder ein Huhn gerissen, also getötet hätte, um es zu verspeisen. Die Lautstärke der Hühner wurde noch mehr, als Karl mit lautem Gepolter die quietschende, schwergängige Holztür des Stalles öffnete und in den kleinen, vom Hauptstall mit einer Holzwand getrennten Raum trat, in dem sich die Futtervorräte der Tiere befanden. Während Karl auf die drei Säcke, die auf einer Holzpalette auf dem Boden standen und jeweils so hoch wie der kleine Dietrich waren, zuging, sagte er zu seinem Enkel: „So Dietrich, nimm dein kleines, rotes Eimerchen dort aus der Ecke und komme zu mir.“ Der Junge sprang vor Freude mehrmals auf der Stelle nach oben, was ein lautes Poltern auf dem Bretterboden und ein schreckhaftes Herumflattern des Federviehs im Hauptstall zur Folge hatte. „Pariere, du Balsch! Erschrecke nicht die Hühner mit deinem Getrampel“, wies der Mann seinen Enkel mit ernster Stimme an, wobei der Ausdruck Balsch, -die hessische Variante des Wortes Balg für ein ungezogenes Kind, -von Karl in keinster Weise böse gemeint war. Dietrich nahm also seinen kleinen, roten Eimer vom Boden und ging zu seinem Großvater, der vor den Futtersäcken stehend, inzwischen eine gelbe Plastikschaufel in die rechte Hand genommen hatte. „Halte den Eimer schön hoch“, wies der Mann, das immer noch leicht hopsende Kind an, 2und halte endlich still!“ Als der Kleine schließlich seinen Eimer ruhig vor sich hielt, entnahm Karl mit der Schaufel aus jedem der drei Futtersäcke eine geringe Menge der jeweiligen Futtermischung, die hauptsächlich aus Getreide und Saatgut bestand und füllte damit das kleine Eimerchen fast bis zum Rand. Einen etwas größeren und verbeulten Blecheimer füllte er ebenfalls fast randvoll auf, legte danach die Schaufel beiseite, nahm den Eimer in die linke Hand und rief mit erhöhter Lautstärke, um das laute Gackern der Hühner und Hähne zu übertönen seinem Enkel zu: „Komm Dietrich, nimm dein Eimerchen und folge mir. Komm, mach schon, wann wollen wir denn fertig werden?“ Karl ging mit dem großen Eimer voran aus dem Hühnerstall heraus, dicht gefolgt von Dietrich. Beide gingen um den Holzbau herum, bis zur Rückseite, wo sich eine Schiebetüre, die an beiden Seiten mit jeweils einer Holzschiene fixiert war, befand. Karl schüttete einige Meter von der geschlossenen Türe entfernt, den Inhalt seines Eimers in einem weiten Halbkreis auf den graslosen, von den Hühnern kahlgefressenen Erdboden. Unaufgefordert tat der kleine Dietrich das gleiche wie sein Opa. Kaum war das kleine Eimerchen leer, stellte das Kind ihn zur Seite und las verschiedene Futterkörner vom Boden wieder auf. Am meisten schienen ihn die sonnengelben Maiskörner zu interessieren, denn im Nu hatte er wieder zwölf bis vierzehn eingesammelt und in seinen nahe stehenden Eimer zurück geworfen. „Geh zur Seite, Dietrich, … geh weg vom Futter“, rief ihm der Großvater entgegen, „ich lasse jetzt die Hühner raus. Gib acht.“ Der Junge reagierte allerdings nicht, so dass er, als Karl mit einer ruckartigen Bewegung, die etwa ein mal ein Meter große Schiebetüre nach oben riss, immer noch mitten in den Futterkörnern stand. Mit ohrenbetäubendem Geschrei versuchten alle Hühner gleichzeitig nach außen zum begehrten Futter zu gelangen. Alle rannten, sprangen oder flogen sogar ein paar Meter weit aus dem plötzlich offen stehenden Käfig hinaus in die allmorgendlich neugewonnene Freiheit. Tag für Tag schienen sie die gleiche Freude zu empfinden, wenn Karl oder seine Tochter Marianne die Türe öffnete. Dietrich ließ sich von dem Gewimmel aus Hühnern, krähenden und miteinander raufenden Hähnen, umherfliegenden Federn und dem Lärm des Federviehs nicht stören. Scheinbar unbeeindruckt von der Menge der Tiere, inmitten derer er sich befand, stolzierte er mit dem Plastikeimer umher. Zeitgleich betrat Karl die gegenüberliegende Haupttür des Hühnerstalles, um durch eine Zwischentür, die sich neben den drei Futtersäcken befand, in den Ruhebereich der Hühner zu gelangen. Dieser im Halbdunkel nur spärlich von zwei dick eingestaubten Glühbirnen beleuchtete Raum war mittels einiger, etwa eineinhalb Meter hohen hölzernen Zwischenwände in vier kleinere Räumlichkeiten unterteilt. Der Boden war durchgehend mit Stroh, meist steinhart festgetreten, bedeckt. Je eine Hälfte der abgeteilten Räume war mit kinderunterarmdicken, waagerecht von Zwischenwand zu Wand angebrachten Holzstangen versehen, die in einer Höhe von einem knappen Meter den Hühnern als Sitz – und Ruheplatz dienten. An den Längsseiten der Räume standen mit Heu gefüllte hölzerne, ehemalige Gemüsekisten, die zum Teil mit frisch gelegten weißen oder hellbraunen Eiern bestückt waren. Diese Eier waren Karls Ziel beim Betreten des Hühnerstalles. Ei für Ei legte er behutsam in den flachen Weidekorb, der an einer Wandseite an einem Haken hing. Karl kontrollierte mehrmals am Tag die Kisten nach frisch gelegten Eiern. Zudem erneuerte er alle zwei bis drei Tage die Strohschicht auf dem Boden und das Heu in den Legekisten. Die drei flachen Wasserschalen in der Stallung musste er an manchen Tagen sogar zweimal auffüllen, zum einen weil die Hühner, -vor allem im heißen Sommer viel Durst hatten und tranken, zum anderen weil oftmals Stroh vom Boden in die Schalen gelangte und das Trinkwasser aufsog. Beim Blick aus dem Stall, stellte Karl mit Schrecken fest, das sein Enkel mitsamt dem roten Eimer zurück ins Wohnhaus ging und etwa zehn Hühner dem Jungen folgten, denn ein Eimer ließ das Geflügel stets Essbares vermuten. Karl lief mit ungelenken, für ihn flotten Schritten hinterher, bis in die Küche, wo der kleine Dietrich bereits den Eimerinhalt, -die aufgesammelten Maiskörner, komplett ausgeschüttet hatte und sich die Hühner freudig darüber her machten. Karl klatschte mit ernstem Blick laut in die Hände und rief dabei: „Raus aus der Küche. Haut ab, ihr Mistviehcher!“ Voller Aufregung rannten fast alle zielstrebig durch den Hausflur nach draußen. Eines aber huschte unter die Eckbank, rannte aber schließlich doch davon, als Karl mit der flachen Hand zweimal auf die Sitzfläche der alten Eckbank schlug. Dietrich hatte von dem ganzen Durcheinander einen derartigen Schrecken bekommen, das er heulend in der Mitte der Küche stand. Sein Großvater trat gemessenen Schrittes auf ihn zu und überlegte einen kurzen Moment, ob er den Kleinen übers Knie legen sollte, um ihm den Hosenboden zu versohlen, so wie es Karls Vater vor etwa einem halben Jahrhundert fast tagtäglich mit dem kleinen Karlchen tat. Als er dem kleinen Kind jedoch in die verweinten, roten Augen blickte, ließ er mit den Worten, „Mein Vater oder mein Großvater hätten mir den Hintern grün und blau versohlt, wenn ich die Hinkel, …die Hühner ins Haus gelockt hätte. Na ja, ich bin Jahrgang 1910. Und du, du bist Jahrgang 1966, …andere Zeiten, andere Sitten“, von dem Gedanken ab. „Komm Dietrich“, sagte stattdessen der Mann zu dem Kind, „wir gehen wieder rüber in den Stall, der Korb mit den Eiern steht noch da. Komm mit.“ An diesem Tage wurde Karl König so richtig bewusst, was es bedeutet, wenn man alleine das Vieh auf dem Hof versorgen muss, -die Hühner, Schweine, Kühe und Rinder, -sie auf die Weiden bringen und das Milchvieh melken muss, das Misten der Ställe und das abendliche Füttern nicht zu vergessen. Dazu noch ein kleines Kind betreuen und versorgen. Karl war bereits am Mittag körperlich und geistig fix und fertig, -krummgebuckelt, wie er selbst sagte. Er sehnte den Abend und die Rückkehr von Marianne, Rudolf und der neugeborenen Johanna herbei.
Kurz bevor am Abend die Sonne unterging, war der kleine Dietrich völlig übermüdet in den Armen seines Großvaters eingeschlafen. Er war es nicht gewohnt, ohne seine Mutter zu sein und wehrte sich lange ausdauernd gegen seine größer werdende Müdigkeit, welche aber schließlich doch über ihn siegte. Karl atmete erleichtert durch, legte den Schlafenden behutsam ab, nahm anschließend eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank, schaltete das Radio an und setzte sich, erneut schwer atmend an den Esstisch. Wieder war die erste Meldung, die aus dem Radio drang, die Todesnachricht über den brutal ermordeten Bürgerrechtler Martin Luther King aus Amerika. Die Stimme aus dem Radio sagte: „Der 04. April 1968 wird als dunkler Tag in die Geschichte der Friedensbewegung eingehen.“ Karl ergänzte: „In unsere Geschichte wird der 04. April 1968 als der Geburtstag unserer Johanna eingehen. Aber so ein feiger, hinterhältiger Mord ist schon verabscheuungswürdig, …schlimm. Das Werk eines Irren.“ Die Bierflasche war nach wenigen Minuten schon geleert, so dass Karl, der noch immer Durst verspürte, -Brand hatte, -wie er selbst zu sagen pflegte, eine weitere Flasche aus dem Kühlschrank nahm und abermals am Esstisch Platz nahm. Nach einem zügigen Schluck und einem tiefen Rülpser, rief der Mann aus: „Dem Braumeister, der dieses Bier geschaffen hat, gehört ein Denkmal gesetzt.“ Dem zweiten Bier folgte ein drittes, dem wiederrum die vierte Flasche folgte. Längst hatte der Angetrunkene das Radio abgestellt und saß still in dem fast geräuschlosen Raum. Die Stille der Küche wurde lediglich von dem Ticken der Wanduhr und dem kaum hörbaren, sonoren Brummton des Kühlschrankes gestört. Die Lampe der Küche hatte Karl ausgeschaltet, lediglich die zweistrahlige Wandbeleuchtung des nahen Flures spendete dem Türbereich der Küche einen schmalen Lichtkegel, der sich jedoch im Großraum des Zimmers verlor. Karl liebte diese fast ganz dunkle, indirekte Beleuchtungsweise, aber nur wenn er alleine war. Helle Räume bedeuteten für ihn Leben und Leben bedeutete Menschen. Folglich mochte er keine hell beleuchteten Räume, wenn er alleine war. Wenn Karl alleine in einem hellen Raum saß, musste er an Erika, seine vor Jahren verstorbene Ehefrau denken. Dies machte ihn jedes Mal traurig und trieb ihn in den Alkohol, der seiner Meinung nach der anhänglichste Freund des Einsamen ist. Zu Erikas Lebzeiten hatte der Mann keinen Tropfen Alkohol angerührt. Erika und Karl hatten eine harmonische Ehe geführt, Erika war die erste Frau in Karls Leben und Karl war der erste Mann für Erika. In den dreißiger Jahren, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatten sie sich kennen gelernt und waren mit Ausnahme einiger Kriegsjahre nie voneinander getrennt gewesen. Beide hatten freilich auch schon den ersten Weltkrieg miterlebt, wenn auch nur als kleine Kinder, denn Beide wurden im Jahre 1910 geboren, Karl zwei Monate vor Erika. Während Karl mit der vierten Bierflasche in der Hand in der fast stockdunklen Küche saß, dachte er an Erikas Worte, die in Etwa lauteten: „Wer nicht in Kriegszeiten lebt, keinen Hunger leidet und gesund ist, hat keine Probleme.“ Ja, Erika hatte nach eigenen Worten, seit dem Kriegsende im Jahre 1945 ein problemfreies Leben geführt. Sie sah stets das Positive und konnte es nicht verstehen, wenn Menschen grundlos stritten oder sich sogar ab und zu scheiden ließen. „Diese Menschen dort, sie versündigen sich an ihren Kindern“, sagte sie, als sich in den fünfziger Jahren die Eheleute vom nahen Nachbarhof scheiden ließen, obwohl sie drei Kinder hatten. Für solche Personen hatte sie nur Mitleid und hätte ihnen gerne geholfen, wenn sie nur die Hilfe angenommen hätten. Gedankenversunken und müde döste Karl auf dem Küchenstuhl vor sich hin, die Augen tränenerfüllt durch die Erinnerung an Erika und die Gewissheit, dass sie sich im Jenseits wieder begegnen würden. Karl war sich sicher, das Erika in einer bestimmten Art, stets bei ihm war und dieser Glaube war tröstlich für den Witwer. Da zuckte plötzlich ein Lichtschein durch das Küchenfenster. Er blendete den Mann, der aus dem nachdenklichen Entspannungszustand aufgeschreckt den Blick, der an die Dunkelheit gewöhnt war, Richtung Fenster warf. Nicht mehr ganz Herr der eigenen Sinne, durch den Genuss der vier Bierflaschen, verfolgte Karls Blick den gelbweißen Lichtschein, der auf dem weitflächigen Hofgelände sein Unwesen trieb. Um besser sehen zu können, kniff er kurz die Augen zu, doch die dabei hervortretende Tränenflüssigkeit ließ das Gesehene noch verschwommener erscheinen. Mit den Worten: „Was ist das? Was zum Teufel geht hier vor?“, wischte sich der Verwunderte mit dem linken Hemdsärmel die Augen trocken. Endlich konnte er wieder scharf sehen, so scharf, dass er erkannte, dass es sich bei dem großen Lichtkegel in Wirklichkeit um zwei nebeneinander befindliche Lichtquellen handelte. Einen Augenblick später erloschen die beiden Lichter und der Mann vernahm durch das gekippte Küchenfenster, das ihm vertraute, leichte Geräusch des Quietschen, das entstand wenn Rudolf die Fahrertür seines Autos öffnete. Mit einem Mal war Karl hellwach. „Sie sind zurück. Meine Güte, sie sind zurück und ich erkenne die Autolichter nicht, ich alter Schluckspecht, ich Schluckowski“, sagte er aufgeregt zu sich, während er versuchte, mit beiden Händen die vier leeren Bierflaschen, so schnell wie möglich in dem Bierkasten neben der Eckbank verschwinden zu lassen. Begleitet von mehreren Jammerlauten, aufgrund der immer wiederkehrenden starken Knieschmerzen, schritt Karl, in der dunklen Küche nur gelenkt von dem schmalen Lichtschein aus dem Flur, hinüber zum Lichtschalter, um die große Küchenlampe, die etwa in Schulterhöhe über dem Esstisch hing, einzuschalten. Kaum war dies geschehen, öffnete sich kaum hörbar und vorsichtig die Haustüre des Bauernhauses. Auf dem Anwesen der Familie König war es völlig normal, dass die Haustüre von früh morgens bis spät abends offenstand, beziehungsweise nicht abgeschlossen war. Dies hatte sich auch nicht geändert, als Marianne vor drei Jahren, -im April 1965 ihren Rudolf Wenk heiratete. Im Grunde war es überall auf dem Land Gang und Gebe, dass die Haustüren nur in der Nacht abgeschlossen wurden. Mit vorsichtigen Schritten und den Worten: „Karl, bist du noch wach? Wir sind zurück“, betrat Rudolf den Flur, dicht gefolgt von seiner Frau Marianne. Gemessenen Schrittes trat der ältere Mann auf die sichtbar stolzen zweifachen Eltern zu und hieß sie herzlich willkommen, fast ohne den Blick von dem geflochtenen, mit rosa Stoff bedeckten Körbchen zu nehmen, dass Rudolf mit der rechten Hand fest umschlossen hielt. „Kommt rein. Kommt in die Küche“, wies Karl mit einer richtungsweisenden Geste seiner Hand, Tochter und Schwiegersohn in die wohltemperierte Räumlichkeit, die als Zentrum des Hauses galt. Rudolf stellte behutsam den Korb, aus dessen Innerem ein leichtes Atemgeräusch zu hören war, auf die Sitzfläche der Eckbank. Seine Frau Marianne setzte sich, nachdem sie ihre Jacke ausgezogen hatte, unmittelbar neben den Babykorb und nahm mit größter Vorsicht die schützende und wärmende Decke von dem Neugeborenen. Karls erste Worte waren beim Blick auf seine vierundzwanzigjährige Tochter: „Du siehst mitgenommen aus, Marianne. Wie geht es dir?“ Die Frau, die sowohl ihrem Vater als auch ihrem Mann, bezüglich der Körpergröße nur bis zu den Schultern reichte, allerdings über einen gewaltigen Körperumfang verfügte, antwortete kurz und knapp: „Gut geht es mir.“ „Wie geht es dem Kind? Ist es wohlauf? Hoffentlich ist es gesund und kräftig“, fuhr Karl fort. Lächelnd nickend nahm die Frau eine zweite, dünnere Decke, welche den Säugling bedeckte zur Seite und gab somit den Blick auf die neue Erdenbürgerin frei. „Allmächtiger“, stieß Karl aus, „das Kind ist ja knallrot…und so faltig. Habt ihr es schon untersuchen lassen und ihm die Brust gegeben?“ Rudolf, der frischgebackene zweifache Papa antwortete schmunzelnd: „Ja ja, Karl. Alles in Ordnung mit Johanna. Und die Farbe und Falten sind doch normal für Neugeborene. Die Falten wachsen sich aus. So war es doch auch vor zwei Jahren bei Dietrich. Erinnerst du dich noch? Übrigens, schläft der Kleine schon? Wie war euer Männertag?“ Karl antwortete nickend: „Dietrich schläft wie ein Siebenschläfer. Er hat mir artig und fleißig auf dem Hof geholfen. Und ihr Beide, habt ihr Hunger? Ich mache euch eine Hausmacher Wurstplatte zu Ehren der neuen Erdenbürgerin. Wollt ihr, habt ihr Kohldampf?“ Beide, Marianne und Rudolf stimmten dem stolzen Großvater zu, der sogleich mit dem Zubereiten der belegten Brote begann. Kaum zehn Minuten später stellte der Senior eine große Porzellanplatte, die förmlich unter den Unmengen der dick belegten und beschmierten Brotscheiben verschwand, auf den Küchentisch. Auf den herzhaften, mit Butter bestrichenen Roggenmischbrotscheiben sah man rohen und gekochten Schinken, Leber -und Blutwurst, Käseaufschnitt und Streichkäse, sowie Salamiwurst. Jede der Brotscheiben war zudem mit einer kleinen, längs aufgeschnittenen Gewürzgurke garniert, ein wahrer Gaumen -und Augenschmaus. Die Wurstplatte war ein typisches Mittag -oder Abendessen auf dem Lande in Mittelhessen, denn es galt seit Altershehr, die auf dem Hof und den Feldern verbrauchte Arbeitskraft wieder mit sättigenden Lebensmitteln aufzufrischen. Demzufolge griffen der täglich hart arbeitende Karl und seine nicht minder fleißige Tochter kräftig zu, während Rudolf, aufgrund seiner körperlich weniger anspruchsvollen Berufstätigkeit bereits nach drei halben Brotscheiben gesättigt war. Karl schmatzte vor sich hin, ließ ab und an seinen Blähungen freien Lauf, dabei immer wieder den Blick auf die kleine, zierliche Johanna gerichtet, die ruhig und friedlich in ihrem Körbchen schlief. Der kleine Dietrich bekam von alldem gar nichts mit. Er schlief und schnarchte unbeeindruckt von den Neuigkeiten um ihn herum. Es wurde in dieser Nacht weit nach Mitternacht, bis der letzte Bewohner des Birkenhofes endlich einschlief und sich unter dem mondklaren Nachthimmel Ruhe ausbreitete, die jedoch mehrmals unterbrochen wurde, weil die kleine Johanna lauthals schreiend auf sich aufmerksam machte.
Die Zeit verging und im Sommer 1972 kam für den sechsjährigen Dietrich ein neuer Lebensabschnitt unaufhaltsam näher, -der Tag seiner Einschulung in der acht Kilometer entfernten Schule. Bereits am frühen Morgen waren seine Eltern Marianne und Rudolf ziemlich aufgeregt, denn sie hatten so etwas, -die Einschulung des eigenen Kindes, ja noch nicht mitgemacht. Ihre eigenen Einschulungen in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges waren für Beide nicht unbedingt mit freudigen Erinnerungen verbunden. Wobei, -genau genommen hatten sie, wenn sie sich darüber unterhielten, gar keine konkrete Erinnerung an den ersten Schultag, wohl aber an die folgende Zeit in der Schule. Sowohl Marianne als auch Rudolf erinnerten sich an den Schmerzen verursachenden Rohrstock, mit dem die Schulkinder bis in die fünfziger, -in manchen Landteilen auch bis in die sechziger Jahre gemaßregelt wurden, wie es verharmlosend genannt wurde. Realistisch beschrieben schlug der Lehrer die Kinder mit dem Stock. Marianne erinnerte sich vor allem an die grausam schmerzenden Rohrstockhiebe auf den Handrücken, während bei Rudolf die Schläge auf den nackten Hintern, -die häufig blaue und rote Spuren hinterließen, in schmerzlicher Erinnerung geblieben sind. „Ein Glück“, sagte Marianne, als sie den aufgeregten Dietrich am Morgen anzog, zu ihrem Mann, „ein Glück, dass heutzutage der Rohrstock nicht mehr zur Ausrüstung der Lehrer zählt. Meinst du nicht auch, Rudolf?“ „Da hast du recht. Gott sei Dank gehören diese mittelalterlichen Sitten der Gewaltausübung der Vergangenheit an“, antwortete der Mann, während er die hellblaue, mit allerlei Leckereien gefüllte Schultüte, die der fein frisierte Dietrich voller Stolz ansah, vom Tisch aufhob und nochmals prüfend in Augenschein nahm. Die Tüte war fast so hoch wie der Junge, als er zusammen mit seinen Eltern zum Auto marschierte. Den orangefarbenen Schulranzen auf dem Rücken und die mit beiden Händen umschließende Einschulungstüte haltend, wirkte der zierliche, schlanke Dietrich ziemlich überladen. Vater Rudolf hatte sich extra für diesen Tag Urlaub bei der Versicherungsgesellschaft genommen. Mutter Marianne war vor lauter Aufregung schon vor vier Uhr morgens aufgestanden, um neben der allmorgendlichen Stallarbeit bloß nichts wichtiges an diesem Einschulungsehrentag zu vergessen. Als der alte Karl am frühen Morgen, zur gleichen Zeit wie immer in den Kuhstall kam, hatte Marianne bereits alle Kühe gemolken, so zeitig war sie dran. Folglich fuhren die Eltern entspannt und locker mit dem aus dem offenen Fenster, seinem Opa zum Abschied winkenden Dietrich davon, Richtung Schule davon. Karl, der es vorgezogen hatte, auf dem Hof zu bleiben, da große Menschenmengen Beklemmungsgefühle bei ihm auslösten, winkte mit der rechten Hand seinem Enkeljungen hinterher. Seine nach unten hängende linke Hand wurde von der zierlichen Hand Johannas umfasst. Das Mädchen, welches ebenfalls freudig dem davonfahrenden Auto hinterher winkte, war inzwischen vier Jahre alt und ebenso munter und aufgeweckt wie ihr Bruder Dietrich. Beide Kinder waren rank und schlank, denn sie bewegten sich auf dem Hof praktisch von früh bis spät. Sie halfen der Mutter und dem Opa bei der Landwirtschaft, kletterten auf die Bäume oder den Heuboden in der Scheune, fingen davon rennende Hühner liebend gerne mit den Händen ein, indem sie ihnen hinterher rannten, bis diese erschöpft langsamer wurden und fanden praktisch immer irgendeine interessante Beschäftigung auf dem weitflächigen Anwesen des Hofes. Langeweile kannten die Kinder nicht. Johanna liebte es besonders, wenn sie morgens ihrer Mutter oder Opa Karl helfen durfte die Schweine aus dem Stall zu lassen. Das vierjährige Mädchen hatte diesen Vorgang schon unzählige Male beobachtet und miterlebt. Ein Erwachsener öffnete den Metallriegel der Schweinestalltür und musste sich dann von der Tür entfernen, denn die drei erwachsenen Schweine stießen, wenn sie das laute Türriegelgeräusch hörten, wie besessen gegen die sich schlagartig durch ihre Körpermaße auffliegende Tür und drangen in den eingezäunten Außenbereich, wo sie eine Wasserwanne und einen Futtertrog vorfanden. In ihrem Freigehege blieben die Borstentiere bis zum Abend. An einem leicht verregneten Morgen, einige Wochen nach Dietrichs Einschulung, wollte die selbstbewusste Johanna eigenständig auf dem Hof mithelfen. Ihr Papa zog gerade den von Schulvorfreude erfüllten Dietrich an, Mutter Marianne befand sich im Kuhstall und Opa Karl war mit den Hühnern und dem Einsammeln der Eier beschäftigt. Johanna sprang fröhlich mit ihren blassroten Gummistiefeln von Pfütze zu Pfütze über den verregneten Hof, zielstrebig Richtung Schweinestall. Ihr fast hüftlanges, braunes Haar bewegte sich dabei im Takt der Sprünge in mehreren nassen Strähnen hin und her. Am Stall angekommen, kletterte das Mädchen über den hölzernen Zaun, um zur Seitenwand zu gelangen, an welcher sich die Tür befand. Ganz leise, um von den Schweinen nicht bemerkt zu werden, versuchte Johanna den Türriegel zu öffnen, was jedoch zuerst misslang, da er durch Rost und verbogenes Material sehr fest saß. Das Kind zog und drückte, so fest es konnte, an dem Riegel, bis er sich plötzlich ruckartig bewegte. Durch den unvermittelt entriegelten Metallgriff, rutschte die Kleine auf dem nassen, verschlammten Boden des Schweineaußengeheges mit den Füßen weg und fiel nach vorne auf die Knie und die linke Hand. Sich seitlich emporstreckend versuchte Johanna mit der rechten Hand instinktiv die Stalltür zuzuhalten, doch die Schweine stießen mit einer solchen Wucht dagegen, das die Vierjährige rücklings zu Boden gerissen wurde und praktisch gleichzeitig einen starken Schmerz, verursacht durch den Tritt eines Schweines, im Gesicht verspürte. Die Tiere liefen wie immer zielstrebig und flott auf ihren Futtertrog zu und beruhigten sich, während sie grunzend die mit Regenwasser aufgeweichten Futterreste des Vortages verzehrten. Johanna hingegen versuchte, schlammüberzogen von Kopf bis Fuß, wieder auf die Beine zu kommen und lauthals heulend über den Absperrzaun zu klettern, um rasch das Schweinegehege zu verlassen. Dort kam ihr Vater Rudolf schon entgegen gerannt, nahm das schreiende Etwas auf den Arm und brachte es so rasch es ging ins Haus. Mama und Opa eilten ebenfalls herbei, denn Johanna heulte weiterhin herzzerreißend. Karl gab nach einem ersten prüfenden Blick auf Johannas blutendes Gesicht mit ernstem Blick die Anweisung: „Das Kind muss sofort ins Krankenhaus, Rudolf! Fahr gleich los, aber fahre bloß langsam, kein Risiko!“ Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass Johannas Wange unmittelbar neben der Nase eine tiefe Wunde aufwies, die sogar genäht werden musste. Marianne weinte sich in den folgenden Wochen förmlich die Augen aus, denn der behandelnde Arzt erklärte, dass Johanna wohl ihr ganzes Leben eine Narbe auf der Wange behalten würde. Rudolf und selbst Johanna versuchten häufig Marianne zu trösten, denn der Anblick der Narbe im Gesicht ihrer über alles geliebten Tochter machte die Mutter sehr traurig. In ihrer weiteren Entwicklung wurde Johanna von der sichtbaren, durchaus auffallenden Narbe gar nicht behindert oder beeinflusst, denn sie war selbstbewusst und machte sich nichts aus der “lustigen Narbe“, wie sie, sie gerne nannte. Seit Dietrich zur Schule ging, wurde er allmorgendlich von einem Elternteil, meist vom Vater, zur Bushaltestelle gebracht. Diese befand sich einen knappen Kilometer vom Birkenhof entfernt und war über einen asphaltierten Weg zügig zu erreichen. Mittags, wenn der Vater noch auf der Arbeit war, lief Dietrich entweder alleine heim oder aber in Begleitung von Mama und Schwester Johanna, wenn sie ihn an der Bushaltestelle abholten. Ganz selten, vielleicht einmal im Monat, wurde der Junge auch von seinem Großvater Karl abgeholt, der den Kilometer aber nicht lief, sondern mit seinem alten Traktor zurück legte. Als im Sommer 1974 Dietrich in die dritte Schulklasse kam und Johanna im Alter von sechs Jahren eingeschult wurde, änderte sich der Tagesablauf ein wenig, denn die beiden Geschwister durften von nun an gemeinsam, ohne Begleitung Erwachsenen, morgens zur Bushaltestelle gehen und mittags von derselbigen alleine nach Hause laufen. Die Kinder fühlten sich ab diesem Moment noch freier und nutzten öfters den Heimweg, um unterwegs hinter den zahlreichen Bäumen verstecken zu spielen, was nicht selten dazu führte, das Marianne aus der Haustüre heraus lauthals nach Johanna und Dietrich rief, da pünktlich das Mittagessen auf dem Tisch stand und Opa Karl sehr ungeduldig wurde, wenn er hungrig am Tisch saß und mit dem Essen warten musste, weil die Enkelkinder trödelten.
Der März 1976 begann für Johanna und Dietrich, wie er nicht schöner hätte sein können. Die zwei Kinder kamen in der Schule gut mit und erfreuten sich an den herrlichen Schneemassen, welche ihnen die größte Freude bescherte. Auf dem Anwesen des Birkenhofes hatten ihre Eltern und Opa Karl Unmengen von Schneehügeln aufgehäuft, die von den Beiden liebend gern zum Hochklettern und Runterrutschen genutzt wurden. Johanna und Dietrich konnten gar nicht verstehen, warum die Erwachsenen über den Schnee schimpften, wo er doch so viel Freude bereitete und Spaß machte. Eines Mittags enddeckte Johanna auf dem Heimweg von der Bushaltestelle im mittlerweile stark abgeschmolzenen Schnee etwas buntes, dass ihre Neugierde weckte. Sie lief die wenigen Meter vom fast schneefreien Weg hinüber zur Wiese, auf der sich etwas violettes aus dem Schnee erhob. Erstaunt bückte sich das Mädchen und rief alsbald erfreut zu ihrem Bruder, der sich noch auf dem Weg befand: „Dietrich, …schau mal. Hier hat jemand Blumen im Schnee versteckt. Schau, wie schön sie sind.“ Der Junge, der mittlerweile zehn Jahre alt war, sprang mit einigen großen Sätzen über die im Sonnenschein liegende Wiese, die bis auf wenige Stellen, an denen das graue Gras nach langer Winterruhe hervor trat, noch mit Schnee bedeckt war. Bei Johanna angekommen, sagte er zu seiner zwei Jahre jüngeren Schwester: „Die Blumen hier hat niemand versteckt. Das sind doch die Schneeglöckchen, die wachsen schon, wenn noch Schnee liegt. Weißt du? Das hat mir mal Opa Karl erklärt.“ Staunend betrachtete Johanna die herzallerliebst hübschen Blumen und sagte schließlich: „Komm Dietrich, wir gehen schnell heim und erzählen es Mama und Opa und heute Abend auch Papa, wenn er heimkommt. Sie freuen sich bestimmt. Meinst du nicht auch?“ „Vielleicht“, antwortete Dietrich mit leicht gelangweiltem Unterton. Auf dem Heimweg kam den Kindern fast nie ein Auto auf dem abgelegenen Weg entgegen, höchstens mal der Traktor vom Opa, oder einer der wenigen anderen Traktoren, deren Besitzer in der Nachbarschaft wohnten. Doch diesmal war es anders. Johanna und Dietrich waren nach der Begegnung mit den Schneeglöckchen vielleicht drei, vier Minuten unterwegs, als ihnen ganz langsam ein dunkles Fahrzeug entgegen kam. Dessen dunkel getönte Scheiben und der schwarze Lack glänzten derart in der Sonne, das Johanna ungläubig ihren Bruder fragte: „Was ist das für ein Auto? Warum schauen die zwei Männer da drin so böse aus?“ Dietrich stand wortlos mit starrem Blick da, während der langgestreckte Wagen mit den beiden schwarz gekleideten Insassen langsam an den Kindern vorbei glitt. Der Junge hatte schonmal ein solches Fahrzeug gesehen. Es war zu Hause im Fernsehen, bei einem dieser Filme, die die Eltern und der Opa gerne sahen. Unvermittelt sprach Dietrich seine Gedanken aus: „Johanna, das war ein Totenauto. Die kommen, wenn jemand gestorben ist. Aber was machen die hier bei uns?“ Johanna ergänzte: „Komm, wir laufen schnell heim und erzählen es. Komm, beeile dich. Vielleicht weiß Mama und Opa noch gar nicht, dass etwas passiert ist.“ Die Kinder rannten so schnell sie konnten Richtung Birkenhof. Ganz außer Atem bogen sie kurze Zeit später auf das Hofgelände ein, wo sie erstaunt feststellten, dass das Auto ihres Papas bereits vor dem Haus stand. Johanna, die hinter Dietrich hergerannt war, rief erschöpft ihrem Bruder zu: „ Da ist ja Papas Auto. Ist er nicht auf der Arbeit?“ Bevor der Junge antworten konnte, sahen er und seine Schwester, dass ihre Eltern mit ernstem Gesicht aus dem Haus kamen und zielstrebig auf die Kinder zugingen. Rudolf bückte sich zu den Kleinen herunter, während Johanna fragte: „Habt ihr das schwarze Auto gesehen, mit den beiden Männern?“ Der Vater antwortete: „Ja, …das Auto war bei uns…Opa Karl ist tot, …er ist heute früh gestorben. Er hatte ein sehr ,sehr krankes Herz.“ Mit ganz leiser Stimme fragte Johanna, während ihr Bruder mit nach unten gesenktem Kopf zu weinen anfing: „Ist der Opa jetzt im Himmel?“ Mutter Johanna nickte wortlos, dabei liefen ihr Ströme von Tränen aus den Augen. Selbst Vater Rudolf konnte seine Tränen nicht zurück halten und weinte bitterlich. Der Todesfall von Karl war ein schwerer Schlag für die gesamte Familie, denn er war immer auf dem Hof anwesend gewesen. Niemand war es je gewohnt, dass Karl nicht da war und somit gab es stets beim Ruf nach Vater, Karl oder Opa eine Antwort. Diese Antwort war nun verstummt, nie mehr würde sie jemand auf dem Hof hören. Alle trauerten. Am meisten litt jedoch seine Tochter Marianne unter dem Verlust des Vaters, der mit Mitte sechzig bereits sterben musste. Besonders schlimm war es für sie, wenn morgens ihr Mann und die Kinder aus dem Hause gingen und sie alleine auf dem Hof war. Nach einigen ernsten Gesprächen beschlossen die Eheleute Wenk, dass sie sich von dem Großteil der Tiere des Hofes trennen wollten. Marianne traute sich die ganze Arbeit, die mit den Schweinen, Kühen und Rindern einher ging, alleine, ohne Karl, nicht zu. Das Füttern, melken und ausmisten wäre ihr vielleicht noch möglich gewesen, aber alles drumherum, die ganze Feldarbeit mit Gras, Heu, Stroh und vielem unerwartetem mehr, war einfach zu viel. Und Rudolf war als Anzugträger für echte Arbeit, wie Karl zu Lebzeiten öfters zu Marianne gesagt hatte, nicht gemacht. So kam es, dass sie innerhalb weniger Wochen, das gesamte Vieh, mit Ausnahme der Hühner, an andere Landwirte und einen Metzger verkauften. Die Hühner wollten alle behalten, denn sie sorgten dafür, dass sowohl im Inneren des Hofes als auch um das Wohnhaus und die Stallanlagen herum, den ganzen Tag über munteres Leben herrschte. Davon abgesehen bereitete es den Kindern Spaß, mit dem Korb die Hühnereier einzusammeln und mit dem Federvieh Nachlauf zu spielen, wenn man sie erschreckte. Zudem verdiente sich die Familie durch den Verkauf des Großteiles der Hühnereier etwas Geld hinzu, dass freilich durch den Einkauf des Hühner- Körnerfutters wieder ausgegeben wurde. So schwer es auch war, die Zeit und das Leben mussten auch ohne Karl weitergehen. Und es ging auch weiter. Marianne genoss es sogar allmählich, das mit dem Verkauf vieler Tiere wesentlich mehr Freizeit zur Verfügung stand. Ein Umstand, den sie früher gar nicht kannte. Die lange Zeit der Sommerferien 1976 nutzte die ganze Familie, um den Hof ein wenig zu renovieren, vor allem kamen an den trostlos trist wirkenden Holzwänden der Ställe und der Scheune, freundlich strahlende Farben zum Einsatz. Dietrich und Johanna halfen fleißig mit beim Anstreichen. Niemals vorher hatten die Kinder ein solches Gefühl des Stolzes in sich, wie in diesen Ferien. Jede neu gestrichene Wand, jede Tür und jedes Geländer, erzeugte bei den Kleinen einen regelrechten Freudeausbruch, denn sie merkten unmittelbar, dass sie wirklich etwas sinnvolles und sichtbares erschaffen konnten. Fast waren das achtjährige Mädchen und ihr zehnjähriger Bruder ein wenig traurig, als ihre Malerarbeiten und auch die Sommerferien zu Ende gingen. Doch auch das neubegonnene Schuljahr wurde rasch wieder zur Alltagsnormalität mit seinen tagtäglich gleichen Abläufen. Jeden Morgen gingen die Beiden zusammen zur Bushaltestelle, kamen jedoch immer öfter zu getrennten Zeiten heim, denn Dietrich hatte an mehreren Tagen in der Woche länger Schulunterricht als Johanna.
Das neue Schuljahr war noch keine zwei Wochen alt, als Johannakurz nach zwölf Uhr mittags aus dem Bus stieg, ihren mit dem Schulbus weiter fahrenden Schulkollegen zuwinkte und Richtung Birkenhof den Fußmarsch heimwärts antrat. Es war ein heißer Sommertag und Johanna hatte ihre dünne Strickjacke, die sie am Morgen noch anhatte, im Inneren des Schulranzens verstaut. Sie trug einen knielangen, gelbfarbigen Rock und ein weißes T-Shirt, das hüftlange Haar hatte ihr am Morgen Mutter Marianne zu einem Zopf geflochten. Schon aus einiger Entfernung konnte Johanna erkennen, dass ihr ein dunkel gekleideter Mann, der etwas weißes in der Hand hielt, …vielleicht ein Stück Papier, entgegen kam. Er hatte eine kurze Hose und ein kurzärmliges Hemd an und war unglaublich dick und weißhäutig. Für das Mädchen war dieser Mensch, bei dem sie vergeblich einen Hals suchte, ein Fremder, denn sie kannte im Grunde alle Personen, die in der Elternhausumgebung wohnten, vor allem weil es nicht viele waren. Die Achtjährige näherte sich Schritt für Schritt dem schweren Mann, der bestimmt einen Kopf größer als Vater Rudolf war. Der Unbekannte war mittlerweile stehen geblieben und sah suchend in die lichte Hecke, die sich unmittelbar neben dem asphaltierten Weg befand. Dabei pfiff er und rief: „Terry, …bist du da drin? Terry, …Terry?“ Als Johanna sich ihm auf wenige Meter genähert hatte, drehte er sich dem Kind entgegen und sagte, während er weiter näher kam: „Hallo, ich suche meinen Hund. Hast du ihn gesehen? Hier habe ich ein Bild von ihm.“ Der Übergewichtige hielt dem Mädchen einen Zettel hin, auf dem ein weißer, struppiger Hund abgebildet war und sagte weiter: „Er ist schon öfters abgehauen, …und jedes Mal fand ich ihn hier. Diesen Weg kennt er.“ „Meinen sie, er ist in der Hecke oder da hinten zwischen den Bäumen?“, fragte Johanna und ging währenddessen ein paar Schritte nach vorne, bis sie, begleitet von dem Mann, in den schattenerfüllten Randbereich der weitflächigen Hecke eintrat. „Da ist er! Da hinten“, rief der Fremde plötzlich, „siehst du ihn?“ Johanna kniff suchend die Augen zusammen und sah in die Richtung, in welche der Mann mit der rechten Hand deutete, dabei weiter langsam voran gehend. Plötzlich spürte sie eine Art Schlag und ziehende Schmerzen, denn der Mann hatte das Kind unvermittelt gepackt. Eine Hand hatte er in Johannas Gesicht geschlagen und drückte sie derartig fest auf Mund und Nase, das kaum mehr das Atmen möglich war. Seine zweite Hand umklammerte den Haaransatz des Mädchens, unmittelbar unter dem Gummiband, welches den langen Haarzopf fixiert hielt. In diesem schmerzhaften Klammergriff, aus dem es kein Entkommen gab, zerrte der plötzlich schnaufende und schwitzende Mann Johanna einige Meter weiter in das Unterholz, bis zu einem vermoderten, mit Moos überzogenen Baumstamm, der schon Jahre auf dem laubbedeckten Boden liegen musste, so verwittert war er. Hinter dem Stamm drückte der Dicke das Kind zu Boden, so das des mit dem Bauch nach unten zum Liegen kam. Ruckartig riss er anschließend den Schulranzen vom Rücken des Mädchens, um unmittelbar danach den Kopf der Kleinen fest auf den Erdboden zu drücken. Johanna spürte den Druck der kräftigen Hand an ihrem Hinterkopf, während ihr schmerzendes Gesicht auf den moosigen Untergrund gepresst, vor Schmerz brannte. Das Kind, vor Schock wie erstarrt, nahm wie in Trance wahr, dass sich der Mann über sie beugte und in ihr Ohr flüsterte: „Wenn du dich bewegst oder ein Wort sagst, bist du tot!“ Ohne die geringste Kraft im Körper, vor Angst wie gelähmt, nahm Johanna dennoch genau wahr, wie eine zitternde, massige, feuchte Hand des Unbekannten unter ihren Rock glitt, die Unterwäsche wegriss und ihr so weh tat, dass sie am liebsten laut aufgeschrien hätte, doch vor Todesangst blieb ihr Mund stumm. „Kein Ton, …kein Wort“, keuchte das verschwitzte Gesicht in das Ohr des Mädchens und fuhr weiter mit den Worten fort, „Augen zu, …ich tue mit dir, was ich will. Und du machst, was ich dir sage, sonst tue ich dir noch viel mehr weh. Schließ die Augen!“ Johanna tat wie ihr befohlen, vor Angst nach Luft ringend und unter wahnsinnigen Schmerzen spürend, wie sie von etwas Unbekanntem immer und immer wieder grausamst berührt wurde. Die bärenstarken Hände warfen den wehrlosen Kinderkörper auf den Rücken und das Kind glaubte zu ersticken, da das gewaltige Gewicht des Angreifers auf ihm lastete, den Kindermund aufriss und auch dort ungeheuerliche Schmerzen verursachte. Innerlich bis zum Bersten angespannt, zitternd am ganzen Körper, glaubte Johanna wahrzunehmen, das Druck und Schmerzen nachließen. Nach undefinierbarer Zeit des angstvollen Abwartens, drehte sich der schmerzende Leib mit weiter geschlossenen Augen erneut in die bäuchlings auf dem Erdboden liegende Position. Gedanken durchzuckten Johanna, die noch immer einen wie wild rasenden Puls hatte. „Was hat der ekelhafte Mann mit mir gemacht? Was macht er, wenn ich die Augen öffne? Ist er noch hier? Tut er mir noch mehr weh? Schlägt er mich tot? Warum war er so böse?“ Frage um Frage, auf die es keine Antworten gab, bis das Kind auf einmal merkte, dass sich wie von selbst seine Augen ein wenig öffneten. Fünf, sechs Meter vor sich konnte Johanna auf dem Waldboden ihren Ranzen liegen sehen. Der Blick ging nach links und rechts, fast ohne den schmerzenden Kopf zu bewegen. Dann hob sie den Kopf ein wenig an und blickte sich abermals um. Sie war allein, ihr Peiniger war nicht mehr da. Sie spuckte etwas übel schmeckendes, von dem sie annahm, dass es wohl von dem Waldboden, auf den sie ja gedrückt worden war, aus und sah sich weiterhin prüfend um. Zitternd am ganzen Körper stand Johanna ganz langsam auf, von Kopf bis Fuß schmerzend, um erschrocken festzustellen, dass ihre Unterhose neben ihr auf dem Waldboden lag. Mit unkontrollierten Bewegungen zog sie sich weinend und wimmernd an und setzte abschließend den Schulranzen auf. Schmutzig war sie seltsamerweise nicht, nur ihr Bauch und die Beine fühlten sich nass und kalt an, durch das feuchte Moos, auf das der Gewaltverbrecher das Kind gedrückt hatte. Mit schweren Schritten, die Umwelt wie durch einen Schleier wahrnehmend, trat Johanna den Weg nach Hause an, wobei ihr unkontrolliert tausend Gedanken und Fragen ohne Antworten durch den Kopf schossen, die wie Seifenblasen zu zerplatzen schienen und nach jedem Platzen der doppelten Anzahl von unbeantwortbaren Fragen Platz machten. Aber sie war sich sicher, die Eltern durften von diesem Zwischenfall nichts wissen, zu sehr schämte sie sich. „Außerdem blute ich ja nicht“, sagte sie kaum hörbar mit weinend, brüchiger Stimme zu sich selbst, ganz so, als wolle sie sich selbst Mut machen. Tatsächlich gelang es dem Mädchen Daheim keinen Verdacht bei seiner Familie aufkommen zu lassen. Dies fing bei ihrer Heimkehr, unmittelbar nach der grauenvollen Vergewaltigung an, als sie zuerst von ihrer Mutter, die hinter dem Haus im Gemüsegarten arbeitete, unbemerkt ins Badezimmer ging, um sich frisch zu machen und das Haar durchzukämmen. Danach, als sie zu ihrer Mutter in den Garten ging, fing sie zwar unvermittelt an zu heulen, doch sie nannte als Grund der Traurigkeit, den Todesfall von Opa Karl. Marianne glaubte dem Kind und tröstete es. Seitdem war für Johanna jedoch kein Tag mehr so, wie vor dem Verbrechen. Es gab keinen einzigen Tag und keine Nacht, ohne dass Johanna angstvoll zusammenzuckend aufschreckte und in Gedanken den dicken, ekelhaften Mann sah, der sie grob und schmerzerzeugend anfasste, festhielt mit seiner Körpermaße und ihr sehr weh tat. In der Schule kam es durchaus vor, dass sie urplötzlich erschreckt auffuhr, nur weil die Lehrerin ihren Namen nannte. Diese Schreckhaftigkeit entschuldigte und erklärte das Mädchen mit dem Schweineunfall vor Jahren auf dem elterlichen Hof, bei dem auch die Narbe auf ihrer Wange entstanden war. Die Narbe war, genau wie der Arzt es vorher gesagt hatte, sichtbar geblieben, doch Johanna störte sich nicht an ihr. Viel, viel schlimmer war die Narbe, die der Gewaltverbrecher, der Kinderschänder dem Mädchen zugefügt hatte, denn sie saß fest verwurzelt im Kopf, in den Gedanken und im gesamten Körper, für alle Zeit, bis zum letzten Atemzug. Die Unbekümmertheit, die kindliche Naivität, sorgenfreie fröhliche Gedanken und das Vertrauen gegenüber Anderer hatte der Fremde ihr genommen. Geborgen fühlte sich Johanna zwar in gewisser Weise in der Schule, am allermeisten aber Daheim, bei den Eltern und Bruder Dietrich. Die beiden Geschwister verbrachten viel Zeit miteinander, sei es beim Ballspielen, Radfahren oder sonstigen abwechslungsreichen Aktivitäten auf dem Hof. Es war fast, als ob Dietrich ohne Worte spürte und fühlte, dass seine Schwester eine besondere Obhut, den Schutz des größeren und älteren Bruders benötigte und tatsächlich verstanden die beiden sich oft wortlos.
Es war irgendwann im Herbst 1977, als die neuneinhalbjährige Johanna ein dickes Lexikon aus Vaters Bücherregal nahm und es, mehr oder weniger planlos, durchblätterte. Als sie bemerkte, dass jeweils oben in der Ecke Jahreszahlen verzeichnet waren und darunter im jeweiligen Artikel Geschichten und Geschehnisse des genannten Jahres beschrieben wurden, lockte sie die Neugierde zu dem Jahr 1968, -ihrem Geburtsjahr. Das Kind glaubte insgeheim, dass es etwas über sich selbst in dem Lexikon finden würde. 1966, …1967, und eine Seite weiter das Jahr 1968. Gespannt las Johanna alles was dort über ihr Geburtsjahr geschrieben wurde. Mit den Texten konnte das Kind wenig anfangen. Dort standen Begriffe wie “Prager Frühling“, “Krieg in Vietnam“, “Robert F. Kennedy“ und “Bürgerrechtler King“. Alles Worte und Namen, die Johanna nicht einordnen konnte. Doch da huschte sie auf einmal hoch, denn sie las etwas Bekanntes. Ihr Geburtstag war dort vermerkt, jedoch nicht mit ihrem Namen, aber das Datum 04.April 1968 passte genau auf sie. War an diesem Tag noch etwas geschehen, außer ihrer Geburt, fragte sich Johanna gedanklich. Gespannt las das Mädchen den Text durch: „Bürgerrechtler Martin Luther King von weißem Fanatiker ermordet. Täter James Earl Ray wird zu 99 Jahren Zuchthaus verurteilt.“ Überrascht und nachdenklich nahm Johanna das Buch unter den Arm und ging in die Küche, wo Mama und Vater zusammen Geschirr spülten und abtrockneten. „Mama, Papa“, rief das Kind, während es zur Eckbank ging und das Buch ablegte, „wisst ihr, dass Martin Luther an meinem Geburtstag ermordet wurde? Wer war eigentlich Martin Luther?“ Rudolf drehte sich schmunzelnd um und sagte: „Du meinst wohl Martin Luther King, den Bürgerrechtler aus Amerika?“ Johanna nickte zustimmend. Rudolf trocknete seine Hände ab, ging zu seiner Tochter an den Tisch herüber und nahm dort Platz. Dann fing er zu erzählen an: „Ich weiß es noch wie heute. In den Morgenstunden nach deiner Geburt saßen Opa Karl und ich hier in der Küche, im Radio kam die Todesnachricht über Martin Luther King. Er war ein friedliebender, hochintelligenter Mensch, der von irgendeinem verrückten Irren erschossen wurde. Ich denke, er war ein wirklich guter Mensch. Er wollte vor allem die weniger schlauen und Ungerechtigkeit verbreitenden aufklären und zu besseren Menschen machen, aber sein irrer Mörder hatte etwas dagegen, weil bei vielen dummen Menschen, Gewalt die Stelle im Kopf ausfüllt, die üblicherweise für Intelligenz und Nächstenliebe gedacht ist. Tja, und Martin Luther Kings Todestag ist dein Geburtstag. „Hat das eine Bedeutung mit dem gleichen Tag, …werde ich dadurch besser oder schlechter?“, fragte Johanna, -und bekam von Mutter Marianne, die noch immer am Waschbecken stand, die ernst betonte Antwort: „ Natürlich nicht! Natürlich hat es keine Bedeutung für dich!“ „Egal“, fuhr Johanna fort, „ich merke mir den Namen Martin Luther, …Martin Luther King trotzdem. Vielleicht haben wir das ja mal in der Schule.“ „Gut möglich“, sagte Rudolf, „in dem Lexikon findest du alles Mögliche. Nicht nur über Attentate.“ „Attentate, …was sind Attentate? Hab ich noch nie gehört“, stellte Johanna überrascht in den Raum und ihr Vater antwortete: „Ein Attentat ist ein Anschlag auf eine oder mehrere Personen. Der Täter versucht dabei andere Menschen umzubringen, also zu töten. So wie damals Martin Luther King. Und seinen Mörder, der ihn umbrachte, nennt man Attentäter.“ Johanna nickte verständnisvoll mit nachdenklichem Gesichtsausdruck. Als sie in der folgenden Nacht wach im Bett lag, zogen vielerlei Szenen an ihrem inneren Auge vorbei. Sie sah in Gedanken ihren dicken, dunkel gekleideten Peiniger und stellte sich vor, dass er der Attentäter von Martin Luther King wäre. In einem anderen Szenario sah sie den dicken Fremden im Wald, und sich selbst mit einer Schusswaffe auf ihn zielend. Dieser Gedanke tat Johanna gut, denn in dieser Vorstellung hatte sie die Macht über den Vergewaltiger. Der weißhäutige, ekelhaft aussehende, nach süßsaurem Schweiß stinkende, fette Mann wurde somit zum Opfer, -sie selbst zum überlegenen, -die Szene kontrollierenden Täter. In der Folgezeit malte sie des Öfteren Bilder mit Opfer -und Tätermotiven. Stets sollte der unbekannte Dicke das Opfer darstellen und die langhaarige Person sie selbst, -als überlegene Täterin. Niemals mehr sah sich Johanna in ihrer Vorstellung als Opfer, doch in ihren Träumen wurde sie oftmals von den Geschehnissen des Sommers 1976 eingeholt, mit all ihren detaillierten Einzelheiten. Das gedankliche Täter- Opfer Spiel wurde für Johanna mit der Zeit dermaßen wichtig, dass sie im Alter von elf Jahren beschloss, ihrem Vater eine Frage zu stellen. Rudolf fuhr, solange sich das Kind erinnern konnte, jeden Donnerstag zum Schießtraining in den Schützenverein. Ob er sie mal mitnehmen würde, fragte sich das Mädchen. Was würde schon passieren können, dachte sich die Tochter und ging somit am nächsten Donnerstag, -als Rudolf sich gerade die Schuhe anzog, zu ihrem Papa und fragte selbstbewusst: „Papa, dürfen auch Kinder im Schützenverein zusehen?“ Die Antwort überraschte sie, denn Papa sagte: „Ja, …das dürfen sie. Sie dürfen zusehen, freilich nur hinter der Absperrung, wegen der Sicherheit. Und bei uns im Verein dürfen Kinder ab vierzehn Jahren selbst schießen. Wir haben drei Jungs im Verein, die üben mit dem Luftgewehr.“ „Luftgewehr, was ist ein Luftgewehr? Hab ich ja noch nie gehört“, stellte Johanna fragend in den Raum. „Ein Luftgewehr ist ein relativ leichtes Gewehr, so zusagen, um in den Schießsport hinein zu kommen, also zum Einsteigen. Ich persönlich schieße mit sogenannten Kleinkaliberwaffen. Mit solchen hat schon Opa geschossen. Er war richtig gut, war sogar mehrmals Schützenkönig“, antwortete Rudolf ausschweifend. Interessiert fragte das Mädchen nach: Wer wird Schützenkönig?“ „Er wird bei Wettkämpfen ermittelt. Der, der am besten schießt wird Schützenkönig. Und das war mehrmals Opa Karl. Er war richtig gut. So gut wie Karl, kann ich nicht schießen, aber ich bin trotzdem zufrieden“, sagte Rudolf mit zufriedenem Gesichtsausdruck. „Nimmst du mich mit in den Schützenverein? Du fährst doch gleich hin“, überrumpelte Johanna förmlich ihren Vater. „Nein, heute nicht, Johanna. Schließlich hast du morgen Schule. Das wird sonst zu spät heute Abend“, entgegnete dieser, fügte jedoch ergänzend hinzu, als er Johannas trauriges Gesicht sah: „Am Wochenende habe ich eine Überraschung für dich, lass dich überraschen.“ Johanna wurde am besagten Samstagmorgen bereits weit vor Sonnenaufgang wach, denn vor lauter Nervosität hatte sie auch in der Nacht kaum geschlafen. Die ganze Zeit, seit Donnerstagabend hatte sich das Kind gefragt, welche Überraschung der Vater wohl hatte. In der Küche am reich gedeckten Frühstückstisch, hielt ihre spannungsgeladene Aufregung unvermindert an, während Marianne und ihr Mann Rudolf in einer Seelenruhe frühstückten und Bruder Dietrich erwartungsvoll nach jedem Bissen in das marmeladebestrichene Brötchen, durch das Küchenfenster hinaus in den Hof blickte. Der Junge wartete gespannt auf seinen Schulkollegen Hans und dessen Vater. Die Zwei Freunde waren begeisterte Fußballer und wollten mit Hans` Vater zu einem etwa fünf Kilometer entfernten Bolzplatz fahren, um mit einigen, weiteren Schulfreunden zu spielen, so wie sie es fast jeden Samstagmorgen gegen neun Uhr taten. Dietrich sprang rasch von der Eckbank auf, als um zehn Minuten vor neun eine unüberhörbare Autohupe erklang. „Tschüss, sie sind da“, sagte der Junge, während er zur Haustüre eilte und kurz darauf auf der Rückbank eines schwarzen italienischen Kleinwagens das Birkenhof Anwesen verließ. Beim Blick auf die Wanduhr sprach Marianne: „Also, auf den Vater von Hans ist immer Verlass, stets pünktlich, so wie es sich gehört“. „Freilich“, bestätigte Rudolf kopfnickend, „scheinbar denkt er wie wir. Wir kennen das Wort Unpünktlichkeit ja auch nicht. Immer fünf Minuten vor dem Termin da sein, …besser zehn Minuten, -das zeichnet einen intelligenten Menschen aus.“ Rudolf wischte sich mit einer Serviette den Mund ab und begann den Frühstückstisch abzuräumen, denn auch Marianne und Johanna waren rundum gesättigt und zufrieden. Dann sagte er zu seiner Tochter: „Johanna, wenn du Mama beim Abtrocknen hilfst, kannst du anschließend hinter die Scheune, zum Holzstapel kommen. Du weißt doch noch, …Überraschung!“ Das Mädchen konnte es kaum erwarten, als es kurz darauf um das Haus herum, Richtung Scheune rannte. „Papa, da bin ich.“, rief es Rudolf zu, der schon neben dem flachen Holzstapel stand. Seine Hände ruhten auf einem kleinen Koffer, der auf dem Stapel lag. „Hier drinnen ist die kleine Überraschung für Dich, die ich versprochen habe“, sagte der Mann mit ruhiger Stimme, „aber es ist kein Geschenk, weil es eigentlich nichts für Kinder ist. Du darfst es nur benutzen, wenn ich dabei bin, okay?“ Johanna nickte verständnisvoll, während ihr Vater mit einer langsamen Bewegung den Deckel des Köfferchens aufklappte. Beim Blick auf den Kofferinhalt rief Johanna mit weit aufgerissenen Augen aus: „Das ist ja eine Pistole, …eine echte Pistole, Papa!“ Rudolf nickte mit ernstem Gesicht, fragte sich aber gleichzeitig gedanklich, ob er mit dieser Überraschung für seine Tochter nicht doch unüberlegt die Büchse der Pandora geöffnet hatte. Doch dann sagte er: „Ja, es ist eine echte Pistole, eine Luftpistole, mit allem was dazu gehört. Reinigungsbürste, spezielles Schmierfett, …Patronen natürlich. Wenn du willst zeige ich dir, wie die Waffe gehandhabt wird.“ „Na klar, will ich“, antwortete Johanna freudig, während Vater die Pistole aus dem Koffer nahm. Er hielt den Griff der Luftpistole mit der einen, -und den fingerdicken Lauf der Waffe mit der anderen Hand fest umschlossen, übte dann einen etwas größeren Druck auf das Gerät aus und klappte sie auf diese Weise, -sehr zum Staunen Johannas, in der Mitte auseinander. „Ich klappe die Pistole auf, um sie mit einer Patrone zu laden“, erklärte Rudolf, „man muss das sehr vorsichtig machen, weil im Inneren der Waffe ein Federmechanismus einen Gegendruck ausübt. Laden muss ich sie deshalb. Für dich ist das am Anfang noch zu gefährlich, Johanna.“ Ferner fuhr Rudolf fort: „Gib mir bitte dort aus der kleinen Dose eine Patrone, aber nur eine.“ Das Mädchen tat, was der Vater ihr sagte und nahm einen der silbrig grau glänzenden Gegenstände aus Metall aus der Dose. „Die ist aber klein, …die Patrone, richtig klein“, stellte das Kind erstaunt fest. „Sieh sie dir genau an“, erklärte Papa, „an einer Seite ist sie offen und an der anderen verschlossen. Die Patrone muss immer mit der geschlossenen Seite nach vorne in der Pistole sein. Versuche mal, hier oben im Hohlraum, die Patrone einzulegen. Aber vorsichtig, damit sie sich nicht verkantet. Sie muss ganz leicht reingehen.“ Gespannt versuchte sie ganz aufgeregt, -mit Daumen und Zeigefinger die Patrone haltend, die Pistole zu laden. Zu ihrer eigenen Verwunderung gelang es sofort und Rudolf klappte mit einer langsamen, ruhigen Aufwärtsbewegung des Pistolenlaufes, die Waffe wieder zu, während er zeitgleich mahnend zu erklären anfing: „Jetzt wird es gefährlich, denn die Pistole ist geladen. Das Wichtigste, dass du niemals vergessen darfst ist, nie, wirklich niemals auf Menschen oder Tiere zu zielen. Verstehst du, Johanna?“ „Ja, Papa. Ich werde niemals auf Tiere zielen“, antwortete das Kind, mit einer unüberhörbaren stimmlichen Erregung, so dass Rudolf eindringlich mit erhobenem Zeigefinger anmerkte: „Und auch nicht auf Menschen zielen. Ich meine es sehr ernst, Johanna, sonst bekommst du die Waffe nicht!“ Das Mädchen nickte respektvoll, ohne den gebannten Blick von der Pistole zu nehmen, deren Lauf senkrecht nach zum Boden wies. Mit der freien Hand deutete Rudolf nach vorne, zur rückwärtigen Wand des ehemaligen Schweinestalles, der ebenso wie die Kuh -und Rinderställe seit dem Verkauf der Tiere leer stand und lediglich als Abstellraum diente. „Schau Johanna, da vorne an der Wand, …der Querbalken. Da hängt ein altes Hufeisen. Ich will mal versuchen, den Innenbereich des Eisens zu treffen. Jetzt ist Konzentration wichtig“, erklärte der Vater. Johanna beobachtete aufmerksam ihren Vater, dessen rechte Hand mit der Pistole sich langsam mit dem durchgestreckten Arm bis zur Horizontalen hob und sein Zeigefinger mehr und mehr den Abzug der Waffe zurück bewegte. „Papa, deine Hand mit der Pistole zittert! Musst du sie nicht ruhig halten, um das Ziel zu treffen“, fiel Johanna störend ihrem Vater in die Konzentration, der aber nicht auf die Worte der Tochter reagierte. Der zielende Arm wurde etwas ruhiger, während er mit dem rechten Auge das Ziel anvisierte und zeitgleich das Linke schloss. Und dann, …“Pch“, der Schuss. Er war gar nicht so laut, wie Johanna erwartet hatte. Lauter war das metallische Geräusch, welches vom Schweinestall herdrang.
„Schlechter Schuss“, stellte Rudolf mit neutraler Stimmlage fest, „ich habe nur das Hufeisen getroffen, nicht den Innenbereich, zwei Zentimeter am Ziel vorbei. So, Johanna von Orleans, jetzt bist du dran.“ „Johanna von was“, fragte das Kind unwissend. Schmunzelnd antwortete der Vater, während er behutsam die Luftpistole nachlud: „Johanna von Orleans. Sie war eine Nationalheldin in Frankreich und lebte so um das Jahr 1400. Luftpistolen gab es damals zwar noch nicht, aber mit Pfeil und Bogen konnte sie sicher gut umgehen.“ „Ich heiße ja auch Johanna“, erkannte das Mädchen, „ich will auch so werden wie Johanna von Or…“ „Johanna von Orleans“, wiederholte Rudolf den Namen, „aber wir leben heute in anderen Zeiten. Ohne Krieg und Gewalt, zumindest hier bei uns in Deutschland.“ „Meinst du wirklich, Papa“ , sagte Johanna nachdenklich ernst schauend, denn beim Wort Gewalt erschien ihr vor dem inneren Auge der Fettwanst, der die vergewaltigte. Rudolf nickte der Kleinen zu und reichte ihr die nach unten gerichtete Pistole. „Nimm sie in die rechte Hand und umschließe anschließend den Pistolengriff noch mit der Linken“, wies der Vater seine Tochter an. Dabei trat er hinter das Kind, bückte sich ein wenig und zielte mit geübtem Blick an Johannas Kopf vorbei, über die Pistole, bis hin zum Hufeisen an der Wand, „versuche das die obere Kerbe und der kleine Metallzipfel ganz vorne am Lauf, zusammen mit der Mitte des Hufeisens einen Punkt bilden. So zielt man nämlich. Die beiden Punkte da oben an der Pistole nennt man Kimme und Korn.“ Der Vater war beim Blick auf die Hände seiner Tochter erstaunt, wie bewegungslos und ruhig sie waren, denn die Pistole bewegte sich keinen Millimeter. Weiter fuhr er fort: „Ziele ganz genau und bewege den Zeigefinger am Abzug erst wenn du ganz sicher“, “Pch“, wurde der Satz von Rudolf durch den für ihn unerwartet frühen Schuss unterbrochen. „Guter Schuss“, staunte der Mann, „komm, wir sehen mal nach, wo die Kugel gelandet ist, ob sie innerhalb oder außerhalb des Hufeisens eingeschlagen ist.“ Als Rudolf, der seiner Tochter voraus lief, an der Wand ankam, sah er mit offenem Mund, staunend auf das Hufeisen und sagte: „Du hast Glück gehabt, der Schuss ging genau in die Mitte. Gut gemacht, …Glückwunsch Johanna.“ „Johanna von Orleans“, ergänzte das Mädchen, „aber ich hatte doch kein Glück, …ich habe doch gezielt.“ Rudolfs Gesichtsausdruck wirkte kurzzeitig etwas ratlos, denn er glaubte weiterhin an einen Glückstreffer, ließ aber dennoch seine Tochter noch weitere neun Male schießen, denn sie wollte unbedingt zehn Schüsse abgeben. Das Ergebnis verblüffte den langjährigen Freizeitschützen doch sichtlich, denn Johanna traf zweimal das Hufeisen und siebenmal das Zentrum in der Mitte. Lediglich ein Schuss, -und zwar der letzte traf außerhalb des Hufeisens auf die Wand, wohl weil infolge der ungewohnten Belastung der zierliche Kinderarm vom Gewicht der Waffe ermüdet war. Rudolf staunte nicht schlecht und Mutter Marianne hatte ein breites, stolzes Lächeln auf ihrem ohnehin runden Gesicht. Unbemerkt von Tochter und Mann hatte sie aus dem offenen Fenster des Schlafzimmers den ersten Schießversuchen Johannas zugeschaut.
Gerne hätte Rudolf seine Tochter direkt in den Schützenverein mitgenommen, doch dies war nach den Vereinsvorschriften erst ab dem vierzehnten Lebensjahr möglich. Abgesehen davon wollte Johanna gar nicht mehr mit in den Schützenverein. Das regelmäßige Üben hinter den Ställen mit ihrem Vater, gefiel ihr viel mehr. Im Alter von zehn, elf Jahren durfte sie sogar mit den schwereren Kleinkaliberwaffen üben, die verschlossen in Rudolfs Waffenschrank im Keller aufbewahrt wurden. Der Vater erklärte seiner Tochter, dass sie mit Niemandem über die Schießübungen mit den größeren Pistolen oder sogar dem Gewehr reden sollte, denn alle Waffen waren auf Rudolf angemeldet und durften ohnehin von Kindern nicht benutzt werden, schon gar nicht außerhalb einer offiziellen Schießanlage auf einem privaten Grundstück. Schweigen fiel Johanna nicht schwer, denn sie war nie von den Gedanken getrieben, mit anderen über das eigene Gefühlsleben zu sprechen. Zu sehr blockierte die Vergewaltigung, die sie mit
acht Jahren über sich ergehen lassen musste, ihr innerstes Wesen, ihre Einstellung zu anderen Menschen und die Offenheit Freundschaften zu knüpfen. Johannas Bruder Dietrich war in dieser Hinsicht ganz anders, denn er wurde fast täglich von Freunden besucht oder er fuhr selbst mit dem Fahrrad in die Nachbarschaft. Hin und wieder spielte Johanna ein wenig mit, doch meist nicht lange. Im Allgemeinen verschwand sie wortlos in ihrem Zimmer oder turnte und kletterte in der Scheune oder den leerstehenden Ställen herum. Im Klettern war sie ein echtes Naturtalent und nicht selten meinte ihre Mutter Marianne, dass ein Affe an ihr verloren gegangen sei. Und immer wieder las Johanna voller Begeisterung in dem Lexikon, in welchem sie erstmals von dem Attentat auf Martin Luther King erfuhr. Ein paar Jahre vor King wurde am 22.November 1963 ein amerikanischer Präsident namens John Fitzgerald Kennedy auf offener Straße erschossen, las das Mädchen unter der Jahreszahl 1963. Den Namen Kennedy fand Johanna mehrmals in dem Buch. Sie fragte bei ihrem Vater nach und erfuhr, dass der 1968 umgebrachte Robert Francis Kennedy ein Bruder des bereits fünf Jahre vorher ermordeten Präsidenten war. „Das ist ja interessant“, sagte Johanna überrascht zu ihrem Vater, „zwei Brüder und Beide kamen durch Attentate um. Was für ein Zufall. Waren die zwei Männer gute Menschen?“ „Das ist schwer zu sagen“, antwortete Rudolf mit tief ernstem Gesicht, „beide waren Politiker und Politiker haben Freunde und Feinde. Ein Politiker vertritt seine Meinung oder die Meinung seiner Partei und die finden die Einen gut und die Anderen schlecht. Manchmal streiten sich auch Leute, die der gleichen Partei angehören. Politiker zu sein ist sehr schwer, denn man kann es nicht allen recht machen. Die Wahrheit des Einen ist eine Lüge für den Anderen. Also ich beneide keinen Politiker, auch wenn sie sehr viel Geld mehr verdienen als ich. Viele sagen, sie bekommen zu viel Gehalt für, dass, was sie leisten. Schwer zu verstehen, Johanna, oder?“ Nickend antwortete das Mädchen: „Ja, sehr schwer. Aber ich glaube, dass die zwei Brüder bestimmt ein wenig komisch waren, sonst wären sie doch nicht beide Attentaten zum Opfer gefallen.“ „Mag sein“, stimmte der Vater neutral zu, „vielleicht, …vielleicht auch nicht.“
Es war der 13.Mai 1981, die mittlerweile dreizehnjährige Johanna saß auf der Eckbank in der Küche und blätterte in einem dicken Buch, welches von der Geschichte des Alpinismus handelte. Die vielen, meist schwarz-weißen Fotos darin begeisterten und beeindruckten das Mädchen sehr, denn die abgebildeten Berge schienen allesamt sehr hoch und steil zu sein. Neben den zahlreichen Abbildungen der Gipfel, Felswände und Gletscher waren außerdem jede Menge Gesichter zu sehen. Männer, die nicht älter als Vater Rudolf zu sein schienen. Es waren Bergsteiger, die in ihrer Zeit herausragende Leistungen vollbracht hatten. Da war ein Kletterer mit dem Namen Hans Dülfer und ein weiterer namens Hans Pescosta abgebildet, jeweils mit der Anmerkung im Text .“Gefallen im ersten Weltkrieg“. Johanna fragte ihre Mutter: „Mama, gefallen im ersten Weltkrieg. Was heißt das?“ Marianne, die gerade damit beschäftigt war, an ihrem Puzzle, dass einen Leuchtturm inmitten der Meeresbrandung zeigte, zu arbeiten, antwortete: „Gefallen im Krieg bedeutet Gestorben im Krieg. Entweder erschossen oder durch andere Einwirkungen wie Bomben oder so. Krieg ist immer schlimm. Kein schlauer Mensch will Krieg.“ Johanna kletterte in Gedanken mit, während sie sich eine Bergfotografie nach dem anderen ansah. Sich an senkrechten, teilweise sogar überhängenden Wänden empor zu bewegen, das wollte sie auch können. Ihr war aber trotz ihres jungen Alters durchaus bewusst, das Klettern in den Gebieten der Kalkalpen, Dolomiten, Westalpen und wie die anderen Regionen, welche in dem Buch beschrieben waren, auch hießen, sehr gefährlich war. Ein Blick auf das Foto eines sympathisch aussehenden jungen Mannes namens Paul Preuß erinnerte sie jedes Mal, wenn sie das Buch durchsah an die Risiken des
Extremen Kletterns. Preuß unternahm über zwölfhundert Bergtouren, von denen hundertfünfzig Erstbegehungen schwierigster Alpenwände waren, las Johanna voller Bewunderung. Doch am 03.Oktober 1913 stürzte er an einem Berg namens Mandlkogel im Dachsteingebirge tödlich ab, da er als Pionier des Freikletterns Hilfsmittel wie Seil und Haken ablehnte. Er wurde nur 27 Jahre alt. Johanna blätterte gerade im mittleren Teil des Buches, als ihre Mutter schnell vom Puzzletisch aufsprang und das Radio, welches auf angenehme Zimmerlautstärke eingestellt war, lauter stellte. “Attentat auf Papst Johannes Paul den Zweiten“, drang es aus dem kleinen Gerät, dass auf der Küchenarbeitsfläche links neben dem Kühlschrank stand. Das Mädchen wurde sofort hellhörig, denn bisher hatte es nur aus Büchern über Attentate erfahren, -und nun erlebte sie es hautnah am Radio mit. In den folgenden Tagen verspürte Johanna eine unaufhörliche Erregung, wenn im Radio, im Fernsehen oder in der Zeitung von dem Papstattentat berichtet wurde. Das katholische Kirchenoberhaupt hatte die zwei Pistolenschüsse in Bauch und Arm zwar überlebt, kämpfte aber trotzdem lange mit dem Tod. Es waren die Berichte des Attentates auf den Papst, 1981 auf dem Petersplatz in Rom, die Johannas Wesen und ihre Gedanken unwiederbringlich veränderten. Wenn sie mit Vater Rudolf, die zum festen Wochenprogramm gewordenen Schießübungen machte, sah sie seit dem Monat des Papstattentates nicht mehr das alte Hufeisen oder die von Rudolf gerne als Zielobjekt genutzte leere Blechdose, welche an einem stabilen Draht aufgehängt war, sondern Gesichter von Menschen, vor ihrem geistigen Auge. Sie schoss also in Gedanken auf ihren dicken Peiniger, aber auch auf Personen, die sie aus der Zeitung oder dem Fernsehen kannte und die ihr unsympathisch waren. Rudolf und Marianne erfuhren von der düsteren Gedankenwelt der eigenen Tochter nicht das Geringste, denn diesbezüglich schottete sich die Jugendliche strikt nach Außen ab. Doch das innere Leiden Johannas, vor allem wenn sie nachts alleine und hellwach, teilweise stundenlang heulend, im Bett lag, war grauenvoll.