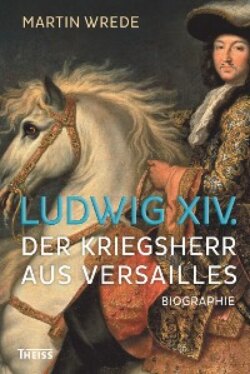Читать книгу Ludwig XIV. - Martin Wrede - Страница 16
„Nicht nur das Recht, sondern die Pflicht der Könige“ – Der erste Krieg, 1667/68
ОглавлениеDer niederländische Staatsmann Johan de Witt sah 1664 schwere Zeiten voraus, für sein Land wie für Europa. Und die Ursache der Schwierigkeiten schien ihm in Frankreich zu liegen oder, genauer gesagt, beim König von Frankreich. Das Land, so formulierte de Witt, habe einen jungen, sechsundzwanzigjährigen Herrscher, der an Körper wie Geist gesund sei und kraftvoll. Der Autorität habe und den Willen, sie geltend zu machen. Der ein Land regiere, das von einer kriegerischen Nation bewohnt sei und das große Reichtümer besitze. Dieser König müsste schon eine ganz ungewöhnliche, ans geradezu Wunderbare grenzende Mäßigung zeigen, wenn er jenen Ehrgeiz von sich weisen würde, der doch jedem König eigen sei, nämlich den, die Grenzen seiner Länder zu erweitern.15
Die Äußerung findet sich in einem Memorandum, das für die Versammlung der Generalstaaten bestimmt war. Sie muss weder als verwegen noch als vermessen gelten. Denn de Witts Analyse traf ganz und gar zu: Frankreich war in der Mitte der 1660er-Jahre tatsächlich in besserer Verfassung als alle Nachbarn und Rivalen. Es hatte den Dreißigjährigen Krieg siegreich bestritten und dann in der direkten Auseinandersetzung mit Spanien die Oberhand gewonnen. Der Pyrenäenfriede hatte gezeigt, dass es nunmehr die Vormacht Europas war. Die königliche Armee war in jenen Jahren zeitweise auf die zuvor nie gekannte Stärke von 150.000 Mann angewachsen. Denn 20 Millionen Franzosen (oder 17 …) konnten inzwischen auch mehr Soldaten stellen und ausrüsten als ihre Nachbarn. Und anders als in früheren Zeiten war es nun tatsächlich eine Armee allein des Königs: direkt und nur ihm verpflichtet, befreit vom Einfluss hochadeliger Größen, die ihre Gefolgsleute (nach ihrem Belieben) dem König zur Verfügung stellten – oder eben auch nicht.16
Der Blick auf den König, auf Ludwig XIV. selbst, war gleichfalls nur allzu treffend: Von hohem Selbstgefühl, durchdrungen von seinem Rang und dem seines Hauses bzw. der französischen Krone, im vollen Bewusstsein der Mittel, die Frankreich besaß, sah er sich an der Spitze der europäischen Fürstengesellschaft. – Er hatte die Fronde bezwungen, in Deutschland den Frieden verbürgt, gegen die Türken den Sieg garantiert. Und als seit 1661 selbstregierender Fürst sollte er, wie de Witt richtig vorhergesagt hatte, nun sehr viel stärker als jeder Erste Minister oder aber als die Vertreter eines republikanischen Staatswesens die Verpflichtung verspüren, sich auch darüber hinaus in der Welt einen Namen zu machen, also seiner Krone Respekt, seinen „gerechten Forderungen“ Nachdruck zu verschaffen – und dies alles, wie sich verstand, im Zweifel durch die Gewalt der Waffen. Daran, dass Ludwig zum Krieg bereit war, gab es wenig Zweifel. Ebenso wenig daran, dass er selbst ins Feld ziehen würde.
Zugrunde lag dieser spezifisch monarchischen „Bellizität“, d.h. der Bereitschaft eines Fürsten, zu den Waffen zu greifen (oder vielmehr der bereitwilligen Annahme, dieser Griff sei unabweisbar), natürlich das zeitgenössische Herrscherbild. Der König hatte von alters her zwei grundlegende Funktionen: Recht zu sprechen und Schutz zu gewähren. Wehrhaftigkeit war dem Herrscheramt eingeschrieben. Hinzu traten die Gebote der Ehre bzw. der Kampf um Reputation. Wollte der Monarch seinem Amt und dem gern angeführten Vorbild der Vorfahren gerecht werden, hatte er seine Stellung in der Welt zu wahren und nach Möglichkeit zu mehren: d.h. seinen Platz im andauernden Konkurrenzkampf der europäischen Fürsten. Schwäche gestattete dies eigentlich nicht, Nachlassen wurde mit Missachtung gestraft bzw. mit Forderungen nach weiterem Zurückweichen. Spanien war eben im Begriff, das zu erfahren. Ein Fürst konnte nicht darauf verzichten, „gerechte“ Ansprüche auf Land, Rang oder Titel zu vertreten und dies eben im Zweifel auch mit den Waffen, wollte er nicht seine Reputation beschädigen. Er hätte dadurch gleichsam Vorfahren wie Nachkommen verraten. Duldsamkeit war in dieser Logik nichts anderes als die Tugend der Gescheiterten.
Außerdem galt für den Fürsten das Gleiche wie für die europäische Adelsgesellschaft in ihrer Gesamtheit: Man bewies sich in der Welt als Individuum vor allem in den Waffen. Und dies umso nötiger, als Rolle, Amt und Stand es forderten. Turniere mochten aus der Mode gekommen sein, Duelle waren es nicht, und Kriegsteilnahme war es schon gar nicht. Es galt für den Einzelnen, kriegerische Fähigkeiten zu zeigen, vor allem aber Mut und Todesverachtung. Tapferkeit, gar Verwegenheit und Entschlusskraft brachten Ruhm ein – gloire. Für vorsichtige Manövrierkunst galt das nur bedingt. Verhandlungsgeschick rangierte in einer anderen Kategorie. Ruhm aber war die Währung, nach der sich der Wert eines Mannes bemaß, wenn er denn „von Stand“ war, und also erst recht der eines Fürsten. Auch das Männlichkeitsideal der Zeit hatte hier seinen Platz. In einer solchen Perspektive also war der Krieg tatsächlich nicht so sehr das Recht, sondern er war die Pflicht der Könige, wie Ludwig XIV. dies in seinen „Memoiren“ erklärte.17
Dass seine Herrschaft eine kriegerische werden würde, entschied sich nun zur Mitte der 1660er-Jahre. 1665 starb Philipp IV. von Spanien, Ludwigs Onkel und Schwiegervater. Er hinterließ, das ist bereits angesprochen worden, ein geschwächtes Reich und einen minderjährigen Thronfolger von gleichfalls schwacher Gesundheit. Direkte Erbansprüche resultierten hieraus für die französische Krone noch nicht, der Vorrang der männlichen Thronfolge stand außer Zweifel. Freilich war eine komplexe, aus völlig verschiedenen Teilen zusammengesetzte Monarchie wie die der spanischen Habsburger weder politisch noch rechtlich ein einziger Block. Für die spanischen Kronen – Kastilien, Navaronna und Aragon – galten eigene Regeln, für die italienischen Besitzungen ebenso und für die südlichen Niederlande natürlich nicht minder, zumal auch diese wiederum aus mehreren Einzelherrschaften zusammengesetzt waren. Im wichtigsten dieser Territorien, dem Herzogtum Brabant, hatten französische Kronjuristen nun ein privates Erbrecht entdeckt, das die ältere Tochter eines Erblassers gegenüber ihren jüngeren Brüdern begünstigte. Hierauf, auf dieses sogenannte Devolutionsrecht, gründete Ludwig im Namen seiner Frau territoriale Ansprüche und Forderungen. Der 1659 ausgesprochene pauschale Erbverzicht sei im Übrigen ungültig, da die als Gegenleistung hierfür aufzufassende Mitgift nie gezahlt worden war.
Das Letztere war zweifellos zutreffend. Das Erstere, die erbrechtliche Argumentation, allerdings war fragwürdig. Ludwig, so ließ sich entgegnen, erhob seine Forderungen nämlich nicht als Privatmann, sondern als Souverän. Er wollte Brabanter Land nicht als Herr von Beersel, Dilbeek oder Kampenhout besitzen – als Beispiele für beliebige Adelsgüter –, sondern das Herzogtum im Ganzen, als Landesherr. Und er wollte das beanspruchte Territorium mit Frankreich verbinden. Ein Privatrecht konnte dafür umso weniger die Grundlage sein, als das im Lande gültige Lehnsrecht und damit der Herzogstitel keinen weiblichen Erbgang kannten. Ansprüche hätten sich also nur darauf beziehen können, was Philipp IV. in Brabant als „Privatmann“ besessen haben mochte, nicht als König bzw. Herzog – und das war nicht feststellbar, die Aufspaltung gar nicht vorstellbar. Rein juristisch war das Problem im Grunde weder zu lösen noch überhaupt zu fassen. Doch lag dort, wie meist, auch gar nicht der entscheidende Punkt. Denn die „Devolution“, die dem Krieg den Namen geben sollte, war natürlich nur ein Vorwand und als solcher ohne Weiteres erkennbar. Der kaiserliche Diplomat Franz Paul von Lisola verfasste einen ebenso sarkastischen wie wirksamen Kommentar.18
Entscheidend war stattdessen vielmehr, dass Ludwig XIV. meinte, es seiner Ehre zu schulden, die vagen Ansprüche seiner Gemahlin zu vertreten, über die niemand anders als er selbst richten konnte. Und er sah die Gelegenheit, mit einem siegreichen Waffengang jenen Ruhm zu erwerben, dessen er in seiner Position bedurfte. Ludwig brauchte den Krieg zur Bestätigung seines Ranges und auch seiner selbst: Gott hatte ihn als König über Frankreich eingesetzt, damit er etwas daraus machte. Dass das militärisch wie politisch geschwächte, finanziell ausgeblutete Spanien zu effektiver Gegenwehr nicht in der Lage sein würde, war allen Beteiligten klar, was den französischen Entschluss zum Krieg natürlich eher verstärkte als abschwächte. Nur scheinbar im Gegensatz zu dieser Haltung stand die in ihrer Selbsteinschätzung defensive Motivation der jetzt einsetzenden französischen Expansionspolitik. Frankreich hatte sich seit den Tagen Karls V. von Spanien und dem Haus Habsburg eingekreist gesehen: Nord- und Ostfrankreich hatten mehr als einmal spanischen Invasionen offengestanden. Wiederholungen wollte man nun ausschließen, ein für alle Mal. Und man wusste jetzt, dass man es konnte.19
Es ist entbehrlich, den militärischen Fortgang des Konflikts im Einzelnen zu verfolgen. Im Sommer 1667 rückten französische Truppen, der König mit ihnen, in die Spanischen Niederlande und die zu Spanien gehörende Freigrafschaft Burgund (Franche Comté) ein. Zu Feldschlachten kam es nicht. Frankreich verfügte über eine Armee von 130.000 Mann, Spanien hatte dem nichts entgegenzusetzen. Die spanischen Kräfte reichten lediglich dazu aus, Festungen und Städte im Land notdürftig zu verteidigen. Doch auch in der Belagerungskunst war die französische Armee überlegen. Zahlreiche kleinere Plätze vor allem in Flandern wurden rasch zur Übergabe gezwungen, ebenso die große Festung Lille (niederl. Rijssel). Die gesamte Franche Comté fiel innerhalb von nur drei Wochen in französische Hände. Es schien eine Frage der Zeit zu sein, wann Gent, Brüssel, Luxemburg – der Rest der Spanischen Niederlande – folgen würden. Dass dies dann freilich nicht geschah, hatte keine militärischen Gründe, sondern politische, und zwar solche, die weit in die Zukunft wiesen. Denn Ludwigs Vorgehen, die Leichtigkeit seiner Erfolge bzw. der absehbare Zusammenbruch der spanischen Position riefen die nördlichen Nachbarn auf den Plan.20
Die Republik der Niederlande war zwar bis dahin ein traditioneller Partner der französischen Krone gewesen, doch rührte diese Partnerschaft aus dem gemeinsamen Gegensatz zu Spanien. Für Frankreich war Spanien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und besonders während der Religionskriege eine Bedrohung gewesen; die Republik hatte sich in dieser Zeit erst ihre Unabhängigkeit von spanischer Souveränität erkämpfen müssen. Schon im Westfälischen Frieden hatten sich die Vorzeichen aber geändert: Die Niederländer schlossen Frieden mit Philipp IV., verließen das Bündnis mit Frankreich. Eine geschwächte spanische Krone als Nachbar verbürgte mehr Sicherheit als die aufsteigende französische. Man wollte, wie ein zeitgenössisches Sprichwort sagte, Frankreich zwar als Freund, nicht aber als Nachbarn (Gallus amicus, sed non vicinus). 1667 trat das Problem dann mit neuer Aktualität hervor, und die Führung der Republik reagierte umgehend. Ein Seekrieg mit England wurde beendet, das Bündnis mit dem ehemaligen Gegner gesucht und ebenso das mit Schweden. Die so formierte Dreierallianz (Triplealliance) wollte den Konflikt durch Vermittlung beenden, d.h. durch Beendigung der französischen Expansion: Die Spanier sollten den Franzosen territoriale Zugeständnisse machen, Frankreich im Gegenzug von weiteren Forderungen absehen. Andernfalls würden die Verbündeten zugunsten Spaniens aktiv in den Konflikt eingreifen.
Auf einen längeren Krieg gegen weitere Gegner war Ludwig XIV. zu diesem Zeitpunkt nicht vorbereitet. Er beugte sich daher der Vermittlung bzw. der – wie er es sah – Erpressung. Der Friede von Aachen im Frühjahr 1668 sprach Frankreich einige wichtige Städte und Festungen zu – etwa in Flandern das schon genannte Lille sowie Courtrai und Tournai, im Hennegau Charleroi, Ath und Binche –, er bewahrte aber die Spanischen Niederlande in ihrer Substanz.
Dass es bei diesem Ergebnis nicht bleiben würde, zeichnete sich freilich sehr schnell ab. Denn für den Rest des 17. Jahrhunderts und für den Anfang des 18. mutierte fortan die Republik der Niederlande zum neuen „Erbfeind“ der Krone Frankreich – bis dahin war es natürlich Spanien gewesen.21 Fortschritte, weitere Erwerbungen über den Aachener Frieden hinaus, wurden ein selbstverständliches Ziel. Denn Wohlfahrt des Landes, Ehre der Krone und Ruhm des Herrschers erforderten sie zwingend. In der Realität, d.h. in der realen Wirksamkeit mochte die Reihenfolge der Faktoren eine andere gewesen sein.