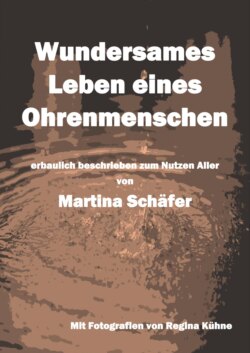Читать книгу Wundersames Leben eines Ohrenmenschen - Martina Dr. Schäfer - Страница 2
I. Erstes Kapitel, in dem er sich und zwei verschiedene Methoden der Ohrenreinigung vorstellt.
ОглавлениеSchon immer hatte ich ein sehr feines Gehör.
Meine Ohren stehen weit ab vom Kopf, Segelohren, durch das Stimmengewirr der Mitmenschen zu segeln, Radar fürs dazwischen Klingende.
Auch die Nase ist sehr fein.
Weniger die Augen: Ich finde alle Menschen schön. Sogar Frauen. Das kann manchesmal recht hinderlich sein.
Landschaften mochte ich schon immer, da man die ja hören und, nachdem man so auch ihre Perspektive aufgebaut hat, in ihnen herum laufen kann wie Fledermäuse durch ihre eigentlich undurchschaubaren Nächte fliegen.
Man sagt zu uns auch gerne Hans-guck-in-die-Luft, doch das stimmt im tieferen Sinne nun wirklich nicht, denn wir schauen im Grunde genommen Nirgendwo hin, also weder in die Luft noch auf den Boden, weshalb Ohrenkinder chronisch aufgeschlagene Knie haben und Ohrenjugendliche ungewöhnlich viel Geschirr beim Abspülen zerschlagen.
Wenn überhaupt wohin, schauen wir in unsere eigenen Kopfgewölbe hinein, in denen sich im Laufe von Lebensmonaten und –jahren all jenes Sehgerümpel anlagert, das wir nicht vermeiden können, aller Lärm, der sich Spinnweben gleich in den Gehirnwindungen fest klebt, all das wüste Äussere, dass die diversen Kopfareale voll- und verstellt, alle Unvermeidlichkeiten, denen Ohrenmenschen erst so nach und nach und im Laufe ihres Lebens Herr werden können und wovon diese vita narrativa nun Kunde geben soll.
Kinderärzte meinten, solche Segelohren, solch abstehende, seien eine Folge des jactatio nocturnis, dem ich zwischen Geburt (meiner) und erstem Geschlechtsverkehr heftigst und nächtelang frönte. Begleitet von mehr oder minder melodischem Gesang fremder und eigener Melodien.
Das konnte wohl manchesmal recht nervend sein. Leiern nannten die Erwachsenen diese Angewohnheit.
Ich selbst fühle mich einsam, wenn Nichts klingt. Andere Leute fühlen sich so, wenn sie im Dustern stehen.
Ich sagte: Wenn Nichts k l i n g t!
Lärm gibt es überall und zur Genüge! Wie in einer Mitternachtsdisco. Die Hölle ist ein berieseltes Kaufhaus. Die Anderen haben Angst im Dunkeln. Angst habe ich keine! Ich fühle mich allein, wenn man nichts hört. Das ist ein grosser Unterschied. Ohrenmenschen sehen Nichts, wenn sie nichts hören.
So stellt doch die Baumaschinen ab, sonst stolpere ich über eure rot-weiss gebänderten Latten!
Also: Abfalten der Ohrmuscheln durch kontinuierliches Hin- und Herwenden des Kopfes bis in eine gewisse Nacht hinein, der berühmten und berüchtigten e r s t e n Nacht, primae noctis mit einer langen, schlanken, joggenden Kommilitonin.
Seit dem habe ich die sittliche Reife, in meinem eigenen Kopf spazieren zu gehen, wenn ich mich langweile oder alleine bin.
Was Ohrenmenschen schnell und sehr häufig passiert.
Wir langweilen uns selbst im Kino nach den ersten fünf Minuten. Doch wir sind daran gewohnt seit dem Kindergarten und können diese unendliche Langeweile in einer Welt aus Flecken, Formen und Fäkalien gut überspielen.
Dort, in der eigenen Hirnschale, ist es sichtlich leiser wie im Rest der Welt. Wer die Wirkung eines Stroboskops mal erfahren hat, weiss, was ich meine.
Ja, diese merkwürdige Welt mit ihren Menschen darin!
Die einzige Chance eines feinfühligen Kindes – Ohrenkinder und Ohrenmenschen sind heutzutage sehr in der Minderheit, gewissermassen herausgemendelt aus dem humanitären Genbestand seit der Aufklärung (Was für ein Wort! Als könne man bei Licht besser denken! Oder an einem knall-kalt-klaren Januarwintermorgen!) – besteht darin, selber möglichst viele Geräusche und Effekte von sich zu geben. Selber singend und sprechend hört man die Anderen zum Glück nicht so genau. Das ist angenehm und gut.
Auf diese Art überspielen wir auch die allgegenwärtige Langeweile in einer offensichtlichen Welt. Kein Mensch langweilt sich in der Gegenwart eines Ohrenmenschen, was zur Folge hat, dass auch Niemand auf die Idee kommt, w i r seien leidend an unendlicher Langeweile.
Manchesmal im Leben, als ich noch jünger und unausgeschlafener war, ertappte man mich beim Einschlafen in Sitzungen oder auf langwierigen Geburtstagsparties. Das war ein Erbe meiner Klavier- und Latein lehrenden Grossmutter. Dem lässt sich aber durch regelmässiges Ausschlafen am Morgen und gesunde Ernährung gut begegnen. Heute bin ich einflussreich genug, Sitzungen spätestens auf einen frühen Nachmittag zu verlegen und geburtstagsgeilen Freunden einen hübschen Brunch mal zur Abwechslung vorzuschlagen.
Ein weiteres Problem sind die beweglichen Antennen, die Verlängerungen unserer Gehörgänge. Man sieht sie kaum und das ist für unsereins recht unangenehm in dichteren Menschenmengen. Alle Welt latscht darauf herum, wenn die Fäden herabhängen oder zerknittert die feinen Tentakel, wenn sie durch die Luft wehen.
Wenn Ohrenmenschen nicht reden, singen oder sonst lauthals herumgestikulieren, entrollen sich ihre Sensoren automatisch aus den Tiefen des Innenohres heraus. Ohne unser Zutun schleichen sie sich zwischen alle Zeilen des Gesagten, lüften den Deckel der Meinereien, hören allerlei schräge Unter-, Ober- und Zwischentöne.
Ausgesprochenes schmettert als Solotrompete direkt in die Ohrgänge herein, dass es nur so fetzt. Das Ungesagte darunter brummelt als Trommelwirbel. Hintergedanken summen im Ostinato mit, Grundeinstellungen erscheinen im liegenden Bordun und plötzliche Meinungsänderungen als Flötendiskant. Gedankensprünge schmerzen das Ohr wie überblasene Blockflöten und Nichts ist so unangenehm wie eine schlecht gelogene Dissonanz, ein falsches Lächeln ähnelt dem Kratzen eines Violinbogens in der ersten Geigenstunde.
Schon in frühester Kindheit entdecken Ohrenbabies ganz eigenständig das homöopathische Prinzip, welches immer Gleiches mit Gleichem vergällt. Natürlich in stark verdünnten Zuständen. Tatsächlich, seien wir mal ehrlich, was ist das Singen eines Kindes in der Dunkelheit im Vergleich zum Röhren einer Boeing 747 quer übers Haus hinweg?
Ohrenkinder in statu hori (erster und oft einziger Tag im Kindergarten) sind also so weit, mittels eigenen Geschreis ihre empfindlichen Tentakel bei sich zu behalten. Später, in statu scolae, der ja nun eine unausweichliche staatliche Zwangsmassnahme für die nächsten 8 Jahre darstellt, meinen sie oft, Alles das wieder ausspucken zu müssen, was ihnen da so in die Ohren geträufelt wird. Das ist halt gut gegen Bauchweh und Schulversagen. Und bewahrt ihnen den Respekt vor ihren Lehrerinnen und Lehrern, die ja auch mal vollkommen sein können, so von Kindern und anderen Leuten genau hin gehört werden könnte.
Doch auf dieses Problem der externen Introspektion, also, der früh angeborenen Angewohnheit vom Aussen her das Innere anderer Menschen und Steine zu hören, man könnte auch sagen, den vollkommenen Traum vom Anderen, werde ich in einem späteren Kapitel zu sprechen kommen.
Wie auch immer, die meisten Ohrenkinder überleben dank der Technik des Zurücklärmens und werden trotzdem älter, weiser.
Sie überleben das Geschrei der Erwachsenen, entwickeln Vorsicht und werden auch abgebrühter, denn man will ja noch älter und noch reifer werden. Oder? Wozu sonst leben sie in dieser kakophonen Welt?
Sie schütteln allabendlich und allnächtlich den Stimmenstaub aus ihren Ohren: Jactatio nocturnis, das nächtliche Kopf Hin- und Her Werfen.
Angeblich ein Zeichen schwersten Hospitalismus, liegt es bei uns in der Familie. Alle haben es oder hatten es oder werden es haben, da Alle musikalisch sind, auch wenn sie das gar nicht sein wollten, wie ich.
Musikalisch sein in diesem Ausmass, wie wir Ohrenmenschen daran leiden, bedeutet nämlich, nicht einmal Musik, jedenfalls die meiste, aushalten zu können.
In jüngeren Jahren schlimmer wie in älteren.
Man kann einfach nicht brav in die Flötenstunde wackeln, wenn schon zwei Blockflöten miteinander – sorgfältig gestimmt und getrimmt von der wirklich liebenswürdigen und sanften Flötenlehrerin – durch die Gehörgänge schrillen wie Sandpapier. Was die begeisterte Flötendame aufjauchzen lässt, ob soviel musikalischer Sensibilität. Ein Juchzer, der wiederum am Ohr des Ohrenkindes ankommt wie eine Ohrfeige.
So verweigerte ich im zarten Alter das Musikmachen, was in einer solchen Familie dem Pinkeln auf einen Altar gleich kommt.
Heute, das sei zum Trost meiner Herkunftsfamilie gesagt, singe ich in einem Chor, denn solange ich dort in dem überheizten Probensaal, inmitten anderer Altistinnen sitze, schweigt stille der Lärm der Welt, der allemal unangenehmer zu ertragen ist, wie das achtzigjährige Vibrato einer ehemaligen Industriellengattin.
Ja – ganz richtig, das ist eine weitere Seltenheit, welche vielleicht sogar hin und wieder genetisch an die Ohrenfeinerei gebunden ist: Ich bin zu allem Überfluss auch noch ein Altist. Der Stimmbruch ging nicht ganz an mir vorüber aber terzenhaft gemässigt. Eben kein Bruch sondern eher eine feinfühlige Gradwanderung von hier nach da. Es gab keine Schwelle und kein Stolpern – auch keine rites de passage oder ähnliches (als solche diente eher besagte erste Nacht) sondern nur ein leichtes Absinken des Jungensoprans.
Kowalski sei Dank werden solch sängerische Grenzgänger heutzutage nicht mehr diskriminiert. Da geht’s uns ähnlich wie den lesbischen und schwulen Geschwistern sowie den Damen vom Tenor.
Darüber hinaus, trotz alledem und zusätzlich hatte ich als Einziger Erfahrungen mit Säuglingsheimen (als Säugling, nicht als Kinderarzt!), wodurch das familieninterne Wackeln doch auch rasant verstärkt wurde.
Bis ich dann gesellschaftlich anerkanntere Methoden der Ohrenreinigung entdeckte, worüber ich in den nächsten Kapiteln berichten werde, gelang es mir immerhin, meine Ohren auf diese eine oder diese andere Weise sauber zu halten, die Tentakel gepflegt und die Seele halbwegs im Gleichgewicht.
Denn das ist ja das Hauptproblem von uns Ohrenmenschen: Nicht die Feinhörigkeit an sich, sondern Dreck und Lärm und schmutzige Geräusche, unnötiger Stimmenballast im stroboskopischen Alltag. Die Welt, in welcher ich in meiner ersten radikalen Politphase kurz nach der Pubertät gerne Diktator geworden wäre, gleicht einem überbesetzten Symphonieorchester, drei Minuten vor dem gemeinsamen A und dem Auftritt des Publikums.
Als Diktator hätte ich alle schlechte Musik verboten.
Darunter verstand meine verehrungswürdige, Cello spielende Mutter (welch angenehm tiefes, ruhiges Instrument!) grundsätzlich alle Musik, die nach dem Spätherbst 1847 komponiert wurde sowie grundsätzlich alle Arten von Opern, Operetten und Musicals. Was dumm war, denn ich konnte natürlich die Songs der rotzfrechen Blumenverkäuferin alle locker daher trällern, da ich für die Schauspielerin schwärmte und wäre gerne der junge Mann am Gartentor von Professor Higgins gewesen. Über Schlager und dieses schmuddelige Ding, genannt U-Musik, wurde in meinem Mutterhaus kein Wort verloren. Man redet ja auch nicht über Scheisse und in diesen prärevolutionären Zeiten nicht über Sex und Religion.
Ich ging da entschieden weiter wie sie und hätte Alles, da Alles zu laut, verboten: Schlicht ein Jahrtausend Musikgeschichte gestrichen.
Dass Polyphonie eine Kulturkrankheit ist, welche ab dem Hochmittelalter wie rasend um sich griff werde ich erst in dreissig Jahren, in einem der letzten Kapitel, lernen.
Als Diktator würde ich heute in einem gewissen Ausmass das Singen gregorianischer Choräle durch kleine Frauengruppen in leeren, gut abgeschlossenen Kathedralen, mit weitem Wiesenareal drum herum gestatten aber keine vaterlosen Familien.
Natürlich lernte ich, bis zu dieser weisen Erkenntnis, neben Wackeln und homöopathischem Widerstand noch einige andere Methoden der Ohrenreinigung, dem Abwaschen der Staubfängersegel allen Gewäschs und tausender Tiraden.
Zumal ja eben, jus primae noctis mit der munteren Joggerin (sie studierte Biologie, ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr), das Wackeln sich verflüchtigte.
Doch ich möchte den folgenden Kapiteln nicht vorgreifen, sind der Narreteien doch auch so genug. Ich würde sie gerne fein säuberlich und nacheinander an einer Schnur auffädeln, denn Augenmenschen sind leicht zu verwirren durch das tatsächliche Nebeneinander des Geschehenen. Für die muss man eine ordentliche Kordel durchs Leben ziehen, deren Knoten die Illusion des Nacheinander aufrechterhalten.
Man kann zwar Stereo hören, schliesslich hat jeder Mensch mindestens zwei Ohren, meistens jedenfalls, aber nicht Stereo sehen wie die Insekten, was manche Zeitgenossen wohl gerne wären: Gepanzert bis dorthinaus und Innen weich wie Butterrahm, denn die Augachsen kreuzen sich im anvisierten Punkt, während sich Hörachsen – und derer gibt es viele -, nun mal schlichtweg im Unendlichen kreuzen, wenn überhaupt, da sie sich kreisförmig ausbreiten.
Augenmenschen brauchen diesen Faden, möglichst rot, damit er sich auch gut abhebt von den vernähten Geschehnissen.
Pantomimen fädeln sich manchesmal einen unsichtbaren Faden durch beide Ohren, ziehen ihn hin und her, beide Gehörgänge putzend und das limbische System dazwischen gleich mit, wie Raucher ihre Pfeifen mittels Pfeifenputzer putzen.
Das mag als Visualisierung zu Beginn der vita narrativa und zum Ende der Einleitung dienen, denn Augenmenschen müssen immer Alles ein wenig oder sogar sehr fest visualisiert haben, gewissermassen vor die Augen und Füsse geschmissen:
Man stelle sich das Leben eines Ohrenmenschen vor wie diesen Pantomimen, doch mit zwei Unterschieden:
Erstens: Der unsichtbare weiche Kaschmirfaden des Mimen ist im wirklich real harten Leben ein Laubsägeblatt mit beidseitigen Zacken.
Zweitens: Statt des rein geistig vorgeführten beidhändigen Ziehens Hin und Her, das Keinem weh tut, nicht einmal dem Mimen, sägt in der beinharten Realität rechts der Lärm der Welt und links das Quasseln des Homo Sapiens am strapazierten Innenohr und dem limbischen Born der Reflexe.
Menschen können wegschauen, sich die Nase zu halten, Finger vom heissen Herd lassen, den Mund geschlossen und nur Wasser trinken tagelang. Aber Weg-Hören, das kann kein Mensch.
Nicht einmal die Augenmenschen.
Selbst der tumbeste Alltagsmensch hört durch seine Ohropax das Schnarchen des Lebenspartners, wenn auch Beziehungsstress-vermeidend gedämpft. Finger-in-den-Ohren schützen kaum vorm Morgenstreich und Ohrenschützer lassen noch allerlei Gesumse und Gebrumse der Welt durch.
Ohrenmenschen können jedoch gleich und von vorneherein auf solche technischen Spielereien verzichten. Gnadenlos dringt die Welt mit ihren Menschen ins Innerste ein. Das lässt sich gar nicht verhindern, nur leicht vermeiden durch die beiden oben beschriebenen Ohrreinigunsmethoden, welche die Gehörtentakel etwas zauseln und im Zaume halten.
Möglicherweise liegt das daran, dass sich freiere Membranzellen des Innenohrs irgendwie als genetische Marmelade auf unserer Haut verteilt haben. Es gibt eine sehr schmerzhafte Frauenkrankheit, in welcher sich die Zellen der Gebärmutter die Freiheit genommen haben, überall im Körper der gepeinigten Frau allmonatlich ihre blutigen Umtriebe zu halten.
Ohrenmänner hören täglich Alles, ohne die Ohrmuscheln vorklappen zu können.