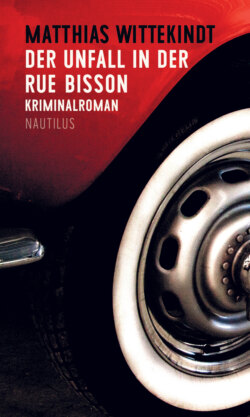Читать книгу Der Unfall in der Rue Bisson - Matthias Wittekindt - Страница 6
ОглавлениеAm Freitagabend um zehn nach sieben ist noch nichts entschieden.
Alain hat zwei Stunden lang gegen June Tennis gespielt. In der Halle des Centre Fleur, denn draußen regnet es in Strömen.
Die Frauen aus seinem Freundeskreis verstehen nicht, warum er ausgerechnet mit ihr so regelmäßig spielt. June ist weder schön noch auffallend geistreich und selten von irgendetwas zu begeistern. So spielt sie auch Tennis. Mit einer Zähigkeit, die ihre Gegner am Ende einfach zermürbt. Alain tritt gegen keine lieber an als gegen sie.
Beim Duschen nach dem Spiel spürt er, wie sein Herz das Blut durch die Adern drückt, wie schnell sich sein Körper von der Anstrengung erholt. Einen Moment lang fühlt er sich aus allem herausgehoben, ja beinahe unsterblich.
Nach dem Duschen trocknet er sich ab, was er stets etwas hastiger tut als die anderen Männer. Obwohl er gut aussieht und einen durchtrainierten Körper hat, wäre er niemals auf die Idee gekommen, sich langsam abzutrocknen, sich womöglich ein paar Sekunden lang unverhüllt zu zeigen. Manche tun so was ja gerne.
Vielleicht hängt sein scheues Benehmen damit zusammen, dass er jünger ist als die meisten Männer, die ins Centre Fleur gehen, um sich auszupowern. Vor zwei Wochen ist er 28 geworden, wirkt aber eher wie Anfang 20. Dazu kommt, dass Alain eher weibliche Gesichtszüge hat. Wohl deshalb trägt er immer teure und geschäftsmäßige Anzüge. Solche, wie nur Männer sie tragen. Seine Schuhe sind noch edler, wobei er stets welche wählt, die ausgesprochen rustikal wirken.
Nachdem er sich angezogen hat, blickt Alain durch ein Fenster nach draußen. Viel ist nicht zu sehen, denn es wird bereits dunkel. Es ist kurz vor Ostern, die Möglichkeit eines vorgezogenen Frühlings hatte sich Mitte März angedeutet, doch es war wieder kälter geworden. Jetzt regnet es seit Tagen bei Temperaturen um die zehn Grad, und die Böden sind so vollgesogen, dass nichts mehr versickert. Auf den gepflügten Äckern hat er von der Straße aus große Wasserflächen gesehen. Wasser sammelt sich auch in den selten bepflanzten Balkonkästen der Cité Nord, auf den geteerten Flachdächern und in den Spurrillen älterer Straßen.
Es ist jetzt Viertel nach sieben.
Nachdem Alain sich angezogen und sorgfältig gekämmt hat, geht er ins Lacombe, eine Mischung aus Restaurant und Kneipe, zu der nur Mitglieder des Centre Fleur Zugang haben. Eine gut gekleidete Frau, die er nicht kennt, kommt an seinen Tisch, beginnt ein Gespräch. Dabei zeigt sie nach draußen und sagt, es würde wohl noch ein paar Tage so weitergehen mit dem Regen. Alain bleibt wie immer höflich, gibt ihr aber, als sie das Gespräch in eine andere Richtung lenkt, zu verstehen, dass er an einer näheren Bekanntschaft nicht interessiert ist.
Um zwanzig nach sieben kommt sein Freund Michel und setzt sich zu ihm. Sie bestellen zwei Bier, und Alain fragt, ob sie nicht noch zum Bahnhof gehen sollen. Michel hat keine Lust. Also trinken sie. Später kommen noch Nina und ein paar aus dem Freundeskreis. Yvonne sitzt alleine an der Bar, was sie sonst nicht tut, und Nina erzählt etwas Lustiges, über das auch gelacht wird. Alain lacht nicht über Ninas Geschichte. Vielleicht hat sie zu viel getrunken. Er findet jedenfalls, dass sie ein bisschen merkwürdig, ein bisschen überdreht ist.
Und doch hat nichts auf eine Bedrohung hingedeutet.
Wäre Alain unter normalen Umständen drei Tage später nach dem Abend befragt worden, er hätte vermutlich gesagt, es sei wie immer gewesen. Zehn Tage später hätte er sich möglicherweise an nichts mehr erinnert.
Es geht alles zu schnell.
Weil sie wütend ist. Auf eine Art, die ihr guttut, denn sie hat sich durchgesetzt und ist dabei, in Ordnung zu bringen, was sie angerichtet hat.
Wie gut, dass sie sofort gehandelt und sich reingestürzt hat, denn sie kennt sich. Wenn sie erst mal damit begonnen hätte, alles abzuwägen, die Gefühle der anderen, die Gefahren, die Möglichkeit zum Beispiel, dass am Ende die Polizei vor ihrer Tür steht, hätte sie angefangen zu zweifeln und am Ende nichts unternommen. Yvonne gehört zu den Frauen, die sich auf ihre Intelligenz verlassen, auf ihre Fähigkeit zu kommunizieren. Aggressiv eingreifen, das gehört für gewöhnlich nicht zu ihrem Repertoire. Wie hat sie neulich gesagt: ›Es mag Frauen geben, die stolz darauf sind, sich bei allem durchzusetzen. Ich gehöre nicht zu der Sorte.‹
Ein paar Tage noch, dann ist Ostern. Sie wird eine Freundin besuchen. Das ist lange abgemacht und wird, da ist sie sich sicher, auch stattfinden. Wir denken uns ja oft ganz unbesorgt in eine konkrete Zukunft hinein. Wahrscheinlich wird sie ihrer Freundin wieder einen Korb mit blühenden Pflanzen mitbringen, weil die einen Garten hat. Sie wird auch dem Sohn ihrer Freundin etwas mitbringen, denn sie ist seine Patentante. Sie selbst hat noch keine Kinder, aber sie ist auch erst 29. Trotzdem hat sie zu dem Sohn ihrer Freundin ein so nahes Verhältnis, kümmert sich so liebevoll um ihn, als würde sie schon jetzt wissen, dass sie nie Kinder haben wird. Solche Vorahnungen hat sie manchmal. Und niemand rechnet natürlich damit, dass ein Leben mitten im Normalen auf einmal zu Ende sein könnte.
Ihr Zorn hat Einfluss auf die Geschwindigkeit, und im Moment denkt sie weder an Ostern, noch an ihr Patenkind und schon gar nicht an den Tod. Alles in Yvonnes Kopf geht wahnsinnig schnell, aber natürlich wägt sie auch in diesem Tempo noch immer Möglichkeiten ab. Möglichkeiten, in denen die Polizei eine zwar ungenaue, aber doch bedrohliche Rolle spielt.
Rot. Man sieht ihr Auto trotz des Regens. Sie hat die Scheinwerfer eingeschaltet. Deren Licht sieht man im Regen. Deren Licht sogar am besten.
Sie steuert ihren Alfa Romeo auf einen Kreisverkehr zu, sieht dort ein Auto und erschrickt. Sie beschleunigt, schafft es und verlässt den Kreisverkehr gleich an der ersten Ausfahrt.
Die Rue Bisson.
Alleebäume.
Als sie die Scheibenwischer auf eine höhere Stufe stellen will, vertut sie sich und schaltet versehentlich auf die höchste. Die Wischerblätter rasen über die Scheibe, sie sieht nur noch Licht und erschrickt. Wie eben beim Anblick des Autos. Und verliert die Orientierung. Sie schaltet erneut. Zu hastig. Die Scheibenwischer bleiben stehen. Innerhalb von zwei Sekunden sieht sie nichts mehr außer einem wilden Geprassel. Der Tod, ja … Aber doch nicht in diesem Moment. Nur zwei Stufen hoch, nicht drei … Die Zeit kann sich nicht dehnen, aber man hat manchmal das Gefühl, sie täte es. So dauert es erneut eine, vielleicht sogar zwei Sekunden, bis sie den Schalter auf Stufe zwei stellt. Als sie es geschafft hat, sieht sie, dass sie nicht mehr auf der Fahrbahn … es rumpelt schon unter den rechten Rädern, und die Bäume … Gott, wie dumm, nur ein winziger Moment, nur diese dämliche Sache mit dem Schalter für die Scheibenwischer.
Und nun geschieht das Wunder der Gleichzeitigkeit: Sie nimmt, noch während sie ihren Alfa Romeo im letzten Augenblick vom tödlichen Baum wegsteuert … Bitte, oh Gott! … noch während sie es schafft, ihr Leben mit einer blitzschnellen Reaktion zu retten, nimmt sie wahr, dass die Rücklichter des Wagens, den sie verfolgt, sich entfernt haben. Das menschliche Gehirn kann so was: zwei Sachen gleichzeitig. Wir sind Raubtiere. Wir sind auch phantastische Fluchttiere.
Neuer Gedanke.
Sie hat nicht damit gerechnet, dass er flüchten würde. Sie hätte ihn nicht für so dumm gehalten. Das eben – immerhin wäre sie fast gestorben – hat sie abgelenkt, wahrscheinlich ist das der Grund. Sie wird später nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen ist, seit sie in ihr Auto stieg. An ein anderes Bild wird sie sich dafür umso genauer erinnern. Das Bild zeigt einen 40 Jahre alten orangefarbenen BMW 2002, der unter einer Traverse steht, an der starke Lampen befestigt sind, deren Licht senkrecht nach unten strahlt. In ihrer Erinnerung wird das Ganze aussehen, als hätte jemand eine weiße Schraffur über ein Foto gelegt. Second Layer. Aber erklärlich. Es regnet wie Sau.
Wie viel Zeit? Sechs Minuten. Oder sieben. Oder nur vier? Und dass sie mit einem Scheibenwischer auf Stufe drei nicht leben konnte und deshalb fast gestorben wäre. Nun, sie lebt, aber das Geschaffte wird bald nicht mehr zählen. Und so wird sich später der unerträgliche Gedanke in ihr breitmachen, dass der Wagen, den sie verfolgte, vielleicht gar nicht beschleunigt hat, sondern dass vielmehr sie selbst, auf Grund der Irritation mit den Scheibenwischern, ein paar Sekunden lang den Fuß vom Gas nahm. Dass sie so gesehen nicht das Recht hatte, ihn zu jagen wie einen Flüchtigen. Aber das alles weiß sie noch nicht. So wenig wie sie weiß, dass sie vom ersten Moment an im Nachteil war. Die Naturgesetze, so komplex sie auch sind, lassen sich Jahr für Jahr genauer berechnen. Man kann sogar Vorhersagen treffen. Welche Entscheidung ein Mensch in einer Stresssituation trifft, ist dagegen kaum zu prognostizieren. Niemand hätte voraussagen können, dass eine Frau wie Yvonne unter diesen Wetterbedingungen, auf einer Straße mit tiefen Spurrillen, randvoll mit Wasser, nach einem gerade überstandenen Beinahecrash das Gaspedal ihres Wagens bis zum Bodenblech durchtreten würde. Aber das tut sie. Das ist die Wut, die sie nicht kennt. Da, zwischen den Bäumen! Man kann es selbst in dem dichten Regen sehen. Auch wenn ihr roter Alfa Romeo genau genommen ein Oldtimer ist, er beschleunigt noch immer sehr gut, das kleine mörderische Ding.
Und dann … passiert etwas Unvorhersehbares, und alles kommt aufs Entsetzlichste an sie heran.
Da steht er. Man sieht ihn in Menschenansammlungen nur, wenn sich niemand vor ihm befindet, denn mit seinen 1,65 geht er manchmal unter. Der etwas aufgeblähte, luftgepolsterte Blouson vermittelt zwar noch immer den Eindruck, er hätte einen Bauch, doch der ist seit zwei Jahren weg, genau wie der Schnauzbart. So was kann einem Mann passieren. Auf einmal hat er eine Frau und drei Kinder, und der Bauch und der Schnauzbart … Voilà. Geblieben sind seine Ruhe und ein freundliches, rundes Gesicht mit kleinen, wachen Augen. Lieutenant Ohayon beobachtet gerade eine Gruppe Menschen, bemerkt einen bestimmten Ausdruck in den Gesichtern: verängstigt, manche auch wütend …
Was er sieht, bringt ihn dazu, sich an etwas zu erinnern. Vor fünf Wochen waren er und seine Frau Ines in der neuen Bücherei von Fleurville und haben dort einen Vortrag über die Entwicklung des griechischen Staatswesens gehört. Da wurde ein Satz gesagt, der ihm ungeheuer wahr vorkam. Den Rest von dem, was der Referent über die griechischen Philosophen und Staatsmänner vorgetragen hatte, war ihm schon beim Verlassen des Saals mehr oder weniger entfallen. Es waren einfach zu viele kluge und komplexe Sätze gewesen. Eindeutig zu viele für ein Gehirn, das funktioniert wie seins. Aber dieser eine Satz, an den muss er jetzt denken.
Kleine Geister werden durch Erfolge übermütig, Misserfolge machen sie niedergeschlagen.
Ohayon hat eine recht genaue Vorstellung davon, was mit den kleinen Geistern und der Niedergeschlagenheit gemeint ist. Er selbst nennt sie übrigens immer ›kleine Seelchen‹, weil das, wie er findet, netter klingt. In den verschiedenen Disziplinen herrscht Uneinigkeit darüber, wie man sich denn so ein kleines Seelchen vorzustellen habe. Ein Pfarrer würde darunter sicher etwas anderes verstehen als ein Psychologe. Ein Ermittler – und das ist ja sein Beruf – würde, im Fall, dass die Niedergeschlagenheit des kleinen Seelchens in einer Gewalttat gipfelt, von Motivlage sprechen. Misserfolge machen die kleinen Seelchen nämlich seiner Erfahrung nach nicht nur niedergeschlagen, sie machen sie bisweilen sehr wütend. Der griechische Satz, den er in der neuen Bücherei von Fleurville gehört hat, müsste seiner Meinung nach in jedem Ermittlerhandbuch stehen, denn neun von zehn Gewaltverbrechen werden eben genau von diesen niedergeschlagenen kleinen Seelchen begangen.
Ohayon senkt den Kopf, denkt nicht mehr an seinen Satz.
»Florence, bitte! Jetzt schluck doch erst mal dein Würstchen runter, ich verstehe kein Wort, wenn du mit vollem Mund sprichst.«
»Warum ist das alles aus Glas?« Ohayons Tochter kaut noch immer. Sie stehen zusammen mit vielen anderen auf einem Bahnsteig, denn der neue Bahnhof von Fleurville wird gerade eingeweiht.
»Das ist aus Glas, weil man das heute so macht. Das ist modern.«
»Und was ist das, modern?«
»Was neu ist und allen gefällt.«
»Ich finde das hässlich.«
»Dann guck woanders hin.«
Väter müssen so was können. Umschalten.
»Aber wie machen die das? Entsteht das Licht im Glas?«, will jetzt Ohayons Frau wissen, auch sie isst ein Würstchen.
»Du, also … mich darfst du nicht fragen.«
Lieutenant Ohayon stört sich nicht im Geringsten daran, nichts zu wissen. Er ist ja auch kein Grieche. Stattdessen gibt er seiner Tochter eine Serviette und beißt dann lustvoll von seinem Würstchen ab. Wobei er darauf achtet, dass ihm nicht Senf auf den Blouson tropft. Das Würstchen hält er in der linken Hand, denn die Rechte ruht auf dem Griff des Kinderwagens, in dem die Zwillinge liegen und Gott sei Dank schlafen. Er erkennt seinen Chef, Roland Colbert. Der unterhält sich gerade mit Marie Grenier von der Spurensicherung. Sie sind alle da und in bester Stimmung. Die Einweihung des neuen Bahnhofs gleicht einem Volksfest.
Schräg hinter Ohayon steht der Pfarrer. Er hat sich noch nicht bewegt, aber man sieht ihn jetzt, weil ein grauhaariger Mann, der ganz frappierend an Karl Marx erinnert, einen Schritt zur Seite getreten ist. Dieser falsche Karl Marx trägt einen gut geschnittenen grauen Anzug mit einer kleinen blauen Plakette am Revers. Dazu einen teuren, ebenfalls blauen Siegelring. Er scheint den Pfarrer zu kennen, denn er hat ihm gerade etwas ins Ohr geflüstert. Was hat er gesagt? Der Pfarrer sieht jetzt aus, als sei er gewillt, gleich eine wütende Stegreifpredigt zu halten. Er gehört zu der Sorte Mensch, die kategorisch denkt und beim Reden manchmal spuckt. Letzte Woche zum Beispiel hat er vor 265 Schäfchen etwas Ungeheuerliches gesagt. Auch bei dieser Predigt war Karl Marx anwesend, er saß in der ersten Reihe. Ja und da stand also der Pfarrer auf seiner Kanzel und sprach zu ihnen: ›Du magst habgierig sein so viel du willst, Gott ist genug!‹
Gott wäre für Yvonne Clerie letztlich geschäftsschädigend, denn sie ist Psychologin. Und Psychiaterin. Die Arme! Wenn man genau hinsieht … Yvonnes Hände zittern zwar nicht, aber das liegt nur daran, dass sie das Lenkrad ihres Wagens mit aller Kraft festhält. Wäre da mehr Licht, man würde sicher ihre weißen Knöchel sehen. Dabei fährt sie gar nicht. Ihre Haare sind nass und ihre Schultern auch. Man sieht es immer, wenn das Licht über sie streicht.
Und sie wünscht sich so sehr, sie könnte die Zeit zurückdrehen. Nur für eine halbe Stunde.
Da war sie zusammen mit Alain, Michel und ihrer Freundin Nina im Lacombe. Es wurde Sex Bomb von Tom Jones gespielt und ihre Freundin Nina hatte offenbar eine lustige Geschichte erzählt, jedenfalls wurde an ihrem Tisch gelacht.
Jetzt sitzt Yvonne in ihrem roten Alfa Romeo und weiß, dass sie Schuld hat am Tod eines Menschen. Das Schuldgefühl, das sie empfindet, ist nicht brennend, es ist dumpf. Und sie wünscht sich immer wieder dies eine. Die Zeit zurückzudrehen, es ungeschehen zu machen. Man sieht ihre Augen hinter der Frontscheibe, aber man sieht sie nicht gut. Erstens prasselt Regen aufs Glas, und zweitens ist es dunkel im Auto. Nur hin und wieder wischt ein Schein blauen und roten Lichts über ihr Gesicht, ihre Haare und ihre Schultern.
»Da ändert sich schon wieder die Farbe!« Ohayons Tochter hat ihr Würstchen inzwischen aufgegessen.
»Gefällt es dir also doch!«
»Nein.«
Florence ist gerade in einer etwas anstrengenden Phase, denn sie hat entdeckt, was für eine Macht das Wort ›nein‹ besitzt. Sie ist jetzt fast sieben und allmählich zeigt sich eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Nicht, dass es Anzeichen dafür gäbe, dass sie klein bleiben wird. Aber die Augen, das runde Gesicht. Vielleicht wird sie die lustigen Bäckchen von Ohayon übernehmen und irgendwann zum Anbeißen hübsch aussehen.
Schuld am Tod eines Menschen, das ist erst mal nur ein Gefühl, das muss noch lange kein Straftatbestand sein. Dieser ganze Bereich: Unterlassene Hilfeleistung, mangelnde Sorgfaltspflicht, Unachtsamkeit, ist für Juristen schwer einzugrenzen. Nicht nur die Gerichte haben da Schwierigkeiten, auch die Betroffenen selbst geraten ins Schwimmen. Einige haben nämlich den Hang, sich über die Maßen schuldig zu fühlen. Und für manche von ihnen wäre es das Beste, wenn gleich die Polizei käme und sie festnähme. Dann können sie alles beichten und sind raus aus diesem schrecklichen Dilemma mit der Schuld. Ein einfühlsamer Ermittler wie Ohayon brächte sicher Verständnis dafür auf, dass auch eine Frau wie Yvonne mal die Kontrolle verliert. Er würde bei ihr auch erst mal dieses schreckliche Gefühl der Hilflosigkeit abmildern, sie in den Arm nehmen und halten.
Nur weiß Ohayon nichts von dieser schrecklichen Sache und Yvonnes Schuld. Er kann schließlich nicht an zwei Orten zugleich sein. Man wünscht sich so was manchmal, aber es gibt keine über allem stehende Instanz, die ihm zurufen könnte: Du wirst woanders ganz dringend gebraucht, die Eröffnungsfeier am Bahnhof ist doch völlig unwichtig! – Unwichtig? Seine Tochter Florence freut sich seit Tagen auf das angekündigte Feuerwerk! Im Film kann man so was irgendwie hinmogeln. Durch Schnitte, musikalische Themen, asynchrone Bild-Text-Überblendungen oder so. Aber was hätte das noch mit der Wirklichkeit zu tun? Nein. Ohayon ist heute nicht zum Dienst eingeteilt, Resnais hat Dienst, so steht es am Brett. Und Resnais hat ihn bis jetzt nicht angerufen. Die Realität hat selten den Wunsch, etwas abzukürzen, zu überbrücken oder Yvonnes Leid zu mildern. Und vielleicht wäre das auch gar nicht gut. Vielleicht gehört dieses Leid, dieses Schuldgefühl einfach nur ihr. Nur Yvonne.
»Michel ist tot.«
Sie hatte zuerst gar nicht daran gedacht, Nina anzurufen. Sie hat einfach nur dagesessen und in die blinkenden Lichter der Feuerwehrfahrzeuge gestarrt, blau und rot und etwas verschwommen hinter dem Regen.
Einige Schaulustige sind bereits aus ihren Fahrzeugen gestiegen, stehen mit hochgeschlagenem Kragen rum und machen Aufnahmen mit ihren Smartphones. Das registriert sie kaum.
Dann endlich fällt es ihr ein. Sie löst sich aus ihrer Erstarrung und wählt Ninas Nummer. Aber die geht nicht ran. Yvonne sieht auf ihre Uhr und versteht nicht warum. Eine Weile beschäftigt sie der Umstand, dass ihre Freundin nicht an ihr Handy geht, so sehr, dass sie den Toten und ihre Schuldgedanken vollkommen vergisst. Als sie Nina fünf Minuten später endlich am Apparat hat, sagt sie zunächst gar nichts von dem, was sie doch eigentlich sagen wollte. Stattdessen fragt Yvonne ihre Freundin mit einer Schärfe, die einem Verhör gleicht, darüber aus, warum sie eben nicht zu erreichen war. Erst dann kommt der Satz, der ihr doch der Wichtigste war.
»Michel ist tot.«
»Wer weiß davon?«, fragt Nina sofort. Das irritiert Yvonne.
»Alle. Bald alle. Die Feuerwehr ist schon da, und die von der Gendarmerie kommen bestimmt auch gleich.«
»Wo stehst du?«
»In der Rue Bisson. Ich sehe sein Auto.«
»Du musst da weg! Sofort.«
Weiße Schwingen aus Wasser bilden sich bisweilen links und rechts, denn Yvonnes Alfa Romeo fährt durch Pfützen.
Jetzt ist sie bereits zwei Kilometer vom Tatort entfernt. Sie fühlt sich noch immer hilflos, aber der Moment reinsten Schuldgefühls ist dabei, sich aufzulösen in eine Argumentation, die bald in innere Dialoge übergehen wird. Es geht schnell. Die Gedanken werden konkreter: ›Die von der Feuerwehr waren beschäftigt, es gab viele Schaulustige, niemand hat auf mich geachtet …‹
Ihr Handy klingelt.
»Ich bin’s noch mal. Wo bist du, Yvonne?«
»Gleich zu Hause.«
»Wir treffen uns bei Michel.«
»Nein!«
»Wir treffen uns bei Michel. Bitte. Du darfst mich jetzt nicht im Stich lassen. Ich bringe Werkzeug mit. Fahr nicht zu dicht mit dem Auto ran.«
In diesem Moment klingelt Marie Greniers Handy. Alle warten auf die Ansprache des Bürgermeisters. Marie wird sie verpassen. Sie sucht sich, noch während sie in ihr Handy spricht, erste Anweisungen erteilt, ihren Weg durch die Reihe. Ohayon blickt ihr nach und sein Gesicht sieht ein paar Sekunden lang anders aus als vorher.
Zweimal blinkt eine Taschenlampe. Nur kurz. Yvonne zuckt zusammen, als sie Nina neben ihrem Auto entdeckt. Und die hat tatsächlich Werkzeug dabei.
»Danke, dass du gekommen bist, Yvonne, ich … Wir müssen leise sein.«
Keine Umarmung, keine Tränen, kein Geständnis.
Yvonne folgt ihrer Freundin zu einer Tür. Aber wie sie geht! Was ist während der Fahrt passiert? Vor 20 Minuten fühlte sie sich noch so schuldig, dass sie nicht mehr in der Lage war, sich zu bewegen. Jetzt geht sie, und auch wenn es in der Dunkelheit nur schlecht zu erkennen ist, sie geht zügig. Es ist der typische Gang einer Frau, die innerlich repetiert: ›Egal wie schlimm es wird, das muss ich jetzt machen.‹
»Die Tür schließt er nie ab«, erklärt Nina, und Yvonne nickt, als wäre diese Bemerkung völlig in Ordnung. Sie lässt sich von Nina ein paar Gartenhandschuhe geben und streift sie über. Kein Widerspruch, keine Frage. Das ist ungeheuerlich! Noch vor einer Stunde hörten sie Sex Bomb von Tom Jones, jetzt stehen sie vor der Tür eines Mannes, der eben durch eine von ihnen ums Leben gekommen ist, und ziehen sich klobige Gartenhandschuhe an. Solche aus Leder, wie normalerweise Männer sie tragen. Yvonne nimmt es hin, dass ihre Freundin einen großen Schraubenzieher am Schloss ansetzt, um es aufzuhebeln.
Doch dann zögert Nina. Warum? Yvonne weiß es nicht, niemand würde darauf kommen.
Nina Havelot sieht vor ihrem inneren Auge ein Klavier. Und die damit verbundenen Gedanken bewirken, dass ihr Tränen in die Augen schießen, dass sie anfängt zu zittern und den Schraubenzieher nicht in den Schlitz zwischen Türblatt und Rahmen bekommt, dass sie absetzen muss, dass sie sich umdreht und … Jetzt endlich nimmt Yvonne ihre Freundin in den Arm und hält sie. Auch ihr selbst ist zum Heulen zumute. Weil Michel ja ein Freund war. Weil niemand vorhatte, ihn zu töten. Und genau das sagt sie dann auch.
»Ich wollte es nicht.«
»Wir wollten es beide nicht.«
Der kurze Dialog gibt Nina die Kraft, die sie braucht, sie kriegt den Schraubenzieher in den Schlitz.
Wie professionell sie vorgehen. Nina hat, kaum, dass sie im Haus sind, die Vorhänge zugezogen und Yvonne eine der beiden Taschenlampen gegeben. Schubladen werden durchsucht.
Sie handeln einvernehmlich. Bis jetzt ist noch keine von ihnen auf den Gedanken gekommen, die andere könne mehr Schuld an Michels Tod haben als sie selbst.
»Hier«, sagt Nina nach fünf Minuten.
»Zeig.«
Wer soll das alles erklären? Die Vorgänge, die Motivlage, die Antriebskräfte. Die beiden sind noch nie irgendwo eingebrochen, und jetzt … Mit einem großen Schraubenzieher die Tür aufgehebelt! An Handschuhe gedacht! An Taschenlampen! Beide haben sich auch noch die Schuhe abgewischt, mit einem Lappen, den Nina mitgebracht hat. Nina! Die betreibt ein kleines Musikstudio und ist dabei, sich als Musikproduzentin zu etablieren. Eine Frau, die mit Musikern an Sounds bastelt. Sie hat einen Sohn, der noch im Krabbelalter ist, eine Mutter, die ihr hilft, das Kind aufzuziehen, und eine unglaublich tolle Espressomaschine, die sie allerdings nur manchmal benutzt, und jetzt … studiert sie zusammen mit Yvonne im Schein einer Taschenlampe einen Vertrag. Geradezu unsinnig. Aber das ist das Bild, mit dem sich die Realität präsentiert.
Als sie sich neben ihren Autos trennen, sagt Nina: »Danke.« Dann fängt sie noch einmal an zu weinen. Gut, das könnte der nachlassende Druck sein. Sagt dann mit leicht fremder Stimme noch einmal: »Danke.« Und zuletzt etwas klarer: »Du hast mich gerettet, Yvonne. Alleine hätte ich mich das nie getraut.«
Nur gut, dass Yvonne nicht auch noch sagt: »Gern geschehen.« Aber denkbar wäre es gewesen. In dieser Realität.
Wie kann man das Groteske ordnen, wie es erklären? Offenbar erzeugen die Umstände Taten. Ob da überhaupt noch von einem Wollen die Rede sein kann? Andererseits: Manche Menschen sind so gemacht, dass sie handeln, wenn sie bis zum Hals in der Scheiße stecken.
Sie fahren ab. Das Licht ihrer Autos schalten sie erst an, als sie 300 Meter von Michels Haus entfernt sind, die kleinen, hinterhältigen Seelchen.
Es ist leicht, Leute zu verdammen für Taten, die man nur von außen beobachtet. Um ein vernünftiges Urteil abgeben zu können, müsste man wissen, warum sie das alles getan haben. Ein kategorisches ›Nein!‹ hatte plötzlich in Yvonnes Kopf das Regiment übernommen. Noch im Lacombe. Mehr ist nicht bekannt.
Was für Schlüsse würde ein Ermittler aus diesem kategorischen Nein einer Frau ziehen? Wenn er gleichzeitig weiß, dass das Opfer ein Mann ist? Hoffentlich keine voreiligen.
Sie fahren hintereinander. Da es stockfinstere Nacht ist, ergibt sich ein Bild, an dem Liebhaber von Experimental-filmen ihre Freude hätten. Das Bild ist schwarz, und in ihm schweben vier rote Punkte, die, immer paarweise, ein bisschen hin und her pendeln. Natürlich, das sind die Rücklichter. Nach einer Weile könnte niemand mehr sagen, ob sie über- oder hintereinander fahren. Zwei Kilometer, dann kommen die Frauen an eine Stelle, an der die Straße sich gabelt. Dort trennen sich ihre Wege. Und was mit den roten Punktpaaren passiert, versteht sich von selbst.
Brigadier Resnais bekommt nichts mit von all diesen Ereignissen. Er steht im strömenden Regen neben einem völlig zerstörten BMW 2002 und sieht Feuerwehrleuten bei der Arbeit zu. Die haben gerade beschlossen, den Wagen mit großen Zangen aufzuschneiden, um den Fahrer rauszuholen. Der lebt zwar noch, sieht aber so schrecklich aus, dass Resnais kein zweites Mal hinsieht. Es riecht nach Eisen, Öl und verbranntem Gummi.
»So kriegen wir ihn nicht raus, der Wagen muss erst mal vom Baum weg«, kommandiert der von der Feuerwehr, der das Sagen hat. Die routinierte Bestimmtheit, mit der er spricht, hilft Resnais, den Unfall als das zu sehen, was er ist. Ein Pech. Der Preis für einen idiotischen Moment.
›Wird’s wohl nicht schaffen‹, hat ihm der Notarzt vor zehn Minuten erklärt. Resnais, hoch aufgeschossen, jungenhaft, immer korrekt, dreht sich um, spürt seine neuen Stiefel am äußeren Knöchel und am dicken Zeh. Gleichzeitig trifft unablässig Regen seine Haut, der kommt fast waagerecht, getrieben von Böen.
Zweihundert Meter die Rue Bisson runter steht ein großes Dieseltier als Schatten mit Blinklicht. Es hat 15 Tonnen Kies geladen, wie der Fahrer ihm vorhin erklärt hat. Mehr als das mit dem Kies und etwas Wirres über einen Feuerlöscher hat Resnais bis jetzt nicht aus dem Fahrer des LKW rausgekriegt.
»Warten Sie ein bisschen, ehe Sie ihn vernehmen, der steht unter Schock«, hatte der Notarzt geraten.
Ein lautes Geräusch hinter ihm. Zwei Ketten spannen sich. Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr beginnt damit, den orangefarbenen BMW vom Baum wegzuziehen. Männer laufen weg, denn der Baum gibt alles her, was er an Regen gespeichert hat, und dazu auch noch Äste und letzte Blätter vom Herbst.
»Geht es Ihnen jetzt besser? Können Sie eine Aussage machen?«
»Er wollte mich überholen und hat sich plötzlich gedreht.«
»Einfach so? Sind Sie vielleicht auf die andere Spur …?«
»Nein.«
»Wissen Sie, ob hinter Ihnen einer war? Einer, der ausgeschert ist?«
»Hab nichts gesehen.«
»Und nach dem Unfall?«
Der LKW-Fahrer zuckt mit den Schultern.
»Sie sind ausgestiegen …«
»Klar! Um zu sehen, ob er Hilfe braucht, klar.«
»Dann müssten Sie ja ein Auto gesehen haben, wenn da noch eins war. Oder ist einer an Ihnen vorbeigefahren?«
»Hab keins gesehen. Der sah so schrecklich aus, und er hat sich bewegt. Den Kopf hin und her, als wollte er ›nein‹ sagen. Der wird sterben, oder?« Nachdem er das gesagt hat, taumelt der Mann ein Stück zurück, muss sich an seinem LKW festhalten.
Resnais ruft einen Kollegen und bittet ihn, den Fahrer nach Hause zu bringen.
Marie Grenier von der Spurensicherung ist endlich da, was Resnais erleichtert. Sie ist schick angezogen mit einer Öljacke drüber. Maries Mitarbeiter, die alle die Zwillinge nennen, ziehen sich gerade ihre Kapuzen zu.
»Fangt schon mal an«, ordnet sie an, »zuerst alles an Spuren auf der Straße.« Dann wendet sie sich an Resnais. »Hast du im Krankenhaus Bescheid gesagt, dass er zu uns gebracht wird, falls er es nicht schafft?«
»Noch nicht.«
»Ruf Roland an, dass er eine richterliche Erlaubnis zur Obduktion einholt.«
Resnais zuckt mit den Schultern. »Ich glaube nicht, dass ihr viel findet. Der Regen und … wahrscheinlich war ja auch nichts, außer dass er zu schnell war. Und dann noch der Zustand der Straße …« Er zeigt auf die Spurrillen, in denen Wasser steht, hart getroffen von Tropfen.
»Wie ist das passiert?«
»Er wollte den Laster überholen und hat dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.«
»Wie? Der setzt so spät noch zum Überholen an? Ich meine, die Straße mündet gleich da vorne in die Rue Belleville. Da stimmt doch was nicht. Nee! Ohayon soll sich hier gleich morgen früh mal umsehen. Hast du nach Zeugen gefragt?«
»Klar, die kamen aber alle erst, nachdem es passiert war. Und der LKW-Fahrer meint, er hätte kein weiteres Fahrzeug gesehen.«
Einer der Zwillinge ruft: »Hier liegen rote und orangefarbene Lacksplitter!«
»Denk dran, Resnais, dass Roland eine richterliche Verfügung besorgt, ich will ihn mir ansehen, falls er es nicht schafft. Jetzt gucke ich mir erst mal den Laster an, nicht, dass der am Ende den BMW von der Straße gedrückt hat. Hat der Arzt dem Fahrer Blut abgenommen?«
»Hm.«
Die Zwillinge sammeln ihre Lacksplitter ein. Sie haben starke Lampen aufgestellt, deren Licht flach bis hierher dringt. Dass die Straße in diesem Licht ganz fabelhaft glitzert, darüber verliert niemand ein Wort.
Noch in der Nacht verfasst Resnais seinen Bericht. Da der Tote keine Papiere bei sich hatte, ist seine Identität noch nicht eindeutig geklärt. Der Wagen ist auf Michel Descombe zugelassen, aber das muss überprüft werden. Also schickt Resnais der Frau vom Sozialdienst eine Mail, in der er sie bittet, sich mit den Eltern oder Verwandten des Opfers in Verbindung zu setzen, damit die ihn identifizieren.
Es ist halb zwei, als er nach Hause kommt und sich zu seiner Frau ins Bett legt. Constance will ihm unbedingt von der Einweihung des neuen Bahnhofs erzählen, aber Resnais schläft ein, ehe sie auch nur drei Sätze gesagt hat.
Als er aufwacht, ist es fast eins. Zuerst versucht er das, was er gerade gedacht hat, zu verdrängen und wieder einzuschlafen. Er redet sich ein, er hätte geträumt, dabei weiß er genau, dass es nicht so ist. Der Gedanke im Moment des Aufwachens war bewusst gewesen und hatte einem Befehl geglichen. Er lauscht angestrengt. Als er sich sicher ist, dass seine Frau tief schläft, steht er so leise wie möglich auf und schleicht in die Küche.
Er macht Licht. Aber auch das zaubert keine andere Realität herbei. Es gibt etwas Wichtiges zu tun, und doch hat er bis jetzt nicht den Mut aufgebracht, es zu erledigen. Er kennt sich, sein Verstand wird keine Ruhe geben. Also geht er wieder ins Schlafzimmer und holt seine Sachen. Dann schleicht er zurück in die Küche. Das alles kommt ihm richtig vor. Als er schon fast damit fertig ist, sich anzuziehen, merkt er, dass sein rechter Strumpf fehlt. Er zieht also den Schuh über den nackten Fuß. Zuletzt nimmt er im Flur seinen Mantel vom Haken, fühlt, ob die Schlüssel in der Tasche sind, und verlässt das Haus.
Er durchquert seinen Garten auf präzise verlegten Platten aus Sandstein und folgt dann der Straße, die durch die Südpol genannte Siedlung führt. Sie beschreibt einen Kreis, wobei sie sich leicht hin und her schlängelt, damit die Autos nicht zu schnell fahren. Alle Häuser der Siedlung sind weiß. Sie sind alle zur selben Zeit im selben Stil von der selben Baugesellschaft errichtet worden, und doch wirkt jedes, auf fast schon erschreckende Weise, individuell. Es gibt keine Zäune, und die Vorgärten am Südpol sind nicht mehr als geschorene Flächen mit Büschen und Zwergbäumen, deren Laub selbst im Sommer rot und herbstlich aussieht.
Im Moment ist allem, was er sieht, jegliche Farbe entzogen.
Während er geht, denkt er an eine Frau. Die ist zwei Jahre jünger als er und trägt fast immer rote Kleider. Mit ihr muss er dringend reden.
Was hindert mich …?
Er gehört doch zu der Sorte Männer, die Frauen gefällt.
Trotz dieser guten Voraussetzungen hat er das Gespräch immer wieder verschoben. Warum traut er sich nicht? Weil sie jünger ist als er? Weil sie schön ist? Weil so viel auf dem Spiel steht?
Seit fast einem Jahr hat er sich immer wieder damit getröstet, dass sie früher oder später auf ihn zukommen würde. Er hätte gerne mit seiner Frau über sie gesprochen, aber das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Seine Frau hätte ihn ermutigt: ›Na los, Alain, trau dich!‹
Nein, er kann nicht mit seiner Frau über sie reden, denn über manches sprechen Männer besser nicht mit ihren Frauen.
Müsste man dieser nächtlichen Wanderung einen Titel geben, so würde er lauten: Das Gefühl, wenn man etwas unbedingt will.
Allmählich lässt der Druck nach. Ein idiotischer Druck, denn letztlich macht er ihn sich ja selber.
Als er nach der dritten Runde auf sein Haus zugeht, haben sich seine Gedanken geklärt. Nichts zwingt ihn, irgendetwas zu übereilen, sein Leben ist doch in Ordnung, so wie es ist. – Nun … Nicht so ganz offenbar, denn das ist nicht der erste Spaziergang dieser Art. Als er die Haustür vorsichtig aufschließt, kommt ihm ein amüsanter und auch erleichternder Gedanke: Wahrscheinlich gibt es in Frankreich hunderte, wenn nicht tausende von Männern, die zeitgleich mit ihm solche nächtlichen Wanderungen unternehmen.
Er zieht sich gefasst und sicher auf dem Flur vor dem Schlafzimmer aus, doch als er die Tür vorsichtig öffnet, ist er wieder beunruhigt. Er stellt sich vor, dass seine Frau genau in dem Moment, wo er in der Tür steht, das Licht anmachen und fragen würde: »Wo warst du? Warum hast du deine Sachen unter dem Arm?«
»Wo kommst du her?«
»Geh schlafen.«
»Wie siehst du denn aus! Und du riechst nach Benzin. Was ist passiert?«
»Ich hatte ein Problem beim Tanken. Komm, geh wieder schlafen.«
Nina muss nun doch lächeln. Ihre Mutter sieht aus wie ein Gespenst, in ihrem Nachthemd. Nachdem sie sie ins Schlafzimmer gebracht hat, geht Nina nach oben in ihr Studio, setzt sich im Dunkeln auf einen Stuhl.
Das Klavier … Damit setzen die Gedanken ein, und die sind weit entfernt von den Straftaten, die sie heute Nacht begangen hat. Ist das eine Fähigkeit? Eine Ungeheuerlichkeit?
Sich kaum eine Stunde nach einem Einbruch, wahrscheinlich einer Verdeckungstat, als Kind zu sehen, als elfjähriges Mädchen. Dabei ist sie nun wirklich kein Mädchen mehr. Nina ist 28 Jahre alt und mit ihren 1,82 groß für eine Frau. Man hat sie nach der Lieblingsschwester ihrer Mutter benannt, einer talentierten Sängerin, die es fast bis in die Oper von Paris geschafft hätte. Leider war sie mit 21 an einer schweren Krankheit gestorben.
Diese erste Nina war bereits acht Jahre tot, als sie selbst geboren wurde, und ihre Mutter hatte ihr, ohne an irgendwelche Implikationen zu denken, den Namen der Toten gegeben. Und Klavierunterricht, denn sie war Klavierlehrerin.
Ein komischer Gedanke macht sich in Ninas Kopf breit: Vielleicht wäre alles, was in dieser Nacht geschehen ist, nicht so passiert, wenn ich nicht musikalisch begabt wäre, wenn Mutter mich bei Familienfeiern nicht hätte vorspielen lassen, wenn sie nicht immer wieder gesagt hätte: ›Wie meine Schwester …‹
Nina hat, seit sie mit dem Klavier begann, eine sonderbar kalte innere Haltung entwickelt. Nicht, dass sie anderen Menschen gegenüber kalt wäre, nein, sie ist sogar ziemlich lustig, wirkt auf Außenstehende verspielt und manchmal auch ein bisschen verwirrt. Aber das täuscht. Sie kann sich mühelos von sich selbst distanzieren. Man könnte auch sagen, sie ist extrem diszipliniert. Nur hat sie zum Leidwesen ihrer Mutter kein besonderes Faible für die Oper oder große Orchesterwerke entwickelt. Ein paar Jahre Keyboard in verschiedenen Bands, aber das war es nicht. Denn es gibt noch etwas, das zu ihr gehört. Etwas, das weder mit ihrer Mutter noch mit ihrer Tante zusammenhängt. Nina hat eine Schwäche für Geld.
Also ist sie Musikproduzentin geworden, und seit zwei Jahren läuft es.
Irgendwann steht sie auf, räumt ein paar Kinderspielzeuge zusammen und verlässt ihr Studio. Sie geht nach unten und legt sich ins Bett. Im Licht ihrer Nachttischlampe, in der Sekunde, bevor sie die ausmacht … Ein kurzes Erschrecken.
›Michel ist tot.‹
Was für eine Verzögerung. Was für eine ungeheuerliche Verzögerung. Es hat fast vier Stunden gedauert, bis Yvonnes Satz in ihrem Bewusstsein angekommen ist.
Wenn all diese Grautöne eine Färbung haben, dann geht sie ins Grünliche. Die Qualität der Farbe unterstreicht, dass es sich um das Dienstzimmer eines Staatsbeamten handelt, einen Raum der geregelten Vernunft.
Eine Weile steht das Bild in vollkommener Stille. So bleibt Zeit, alles in Ruhe zu erkennen und zu überprüfen. Wie es ein Inspizient oder ein Requisiteur tun würde, kurz bevor das Publikum eingelassen wird. Nun, es ist keine Bühne. Auf Ohayons Schreibtisch liegen Papiere, der Blick aus dem Fenster, das eine komplette Wand einnimmt, wäre fesselnd, wenn der konstant und dicht fallende Regen nicht alles eintrüben würde.
Die Tür öffnet sich, es ist der Staatsbeamte.
»Dann auf ein Neues …«, begrüßt Ohayon den anstehenden Arbeitstag ergeben und hängt seinen klatschnassen Blouson auf einen Kleiderhaken. Nachdem das erledigt ist, reibt er sich die Hände, eine Geste, die möglicherweise Vorfreude ausdrückt, und geht dabei zielstrebig zu seinem Gummibaum. Er prüft, wie feucht die Erde ist, weil man ihm mal gesagt hat: ›Nicht zu trocken, nicht zu nass!‹
Er muss nicht gießen. Also blickt er ein paar Sekunden aus dem Fenster. Schließlich entsteht vor der einlullenden Dumpfheit des Regens eine sinnliche Vorstellung, die ein kleines Gefühl schönster Vorfreude, ja sogar eine Geruchsimagination auslöst. Ohayon befüllt also seine Kaffeemaschine und schaltet sie ein, denn jede Arbeit braucht einen guten Beginn.
Während die Maschine anfängt zu spucken, setzt sich Ohayon an seinen Schreibtisch und beginnt damit, die Unterlagen des Vorgangs Friseur zusammenzustellen, um die Sache in den nächsten Tagen an die Kollegen in Metz zu übergeben. Während er das tut, hat er das Bild der Kantine der Gendarmerie vor Augen und denkt an Pasta mit Meeresfrüchten.
Die Tür geht auf, Brigadier Resnais tritt ein. Wie immer exakt in seinen Bewegungen und etwas nachlässig in der Art, wie er redet.
»Wir hatten letzte Nacht einen ziemlichen Crash in der Rue Bisson. Nur ein Auto, der Fahrer saß allein drin und … du weißt ja, wie die aussehen, wenn sie seitlich auf einen Baum aufprallen.«
»Schrecklich?«
»Der Mann ist eine halbe Stunde nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Den Unfallwagen hat Marie herbringen lassen. Sie meint, du sollst dich da mal umsehen«, Resnais legt ein dünnes Dossier auf Ohayons Schreibtisch. »Maries Zwillinge haben Lacksplitter auf der Straße gefunden. Es könnte eine Kollision gegeben haben. Also eine Kollision noch vor der Stelle, wo er sich dann gedreht hat.«
»Was ist denn überhaupt passiert?«
»Ein BMW wollte einen Laster überholen, hat plötzlich angefangen, sich zu drehen, und ist dann seitlich gegen einen Baum geprallt. ›Kam angerast wie ein Irrer‹, hat der Fahrer des Lastwagens gesagt.«
Ohayon beginnt, den Bericht zu studieren, und Resnais fällt auf …
»Du siehst müde aus. Gestern noch lange gefeiert?«
»Auf dem Bahnhof? Nein, wir hatten ja die Kinder dabei. Wir sind gleich nach dem Feuerwerk gegangen.«
»Und? Wie gefällt er dir, unser neuer Bahnhof?«
»Schick. Ein riesiger Würfel aus Glas. Aber das Tollste sind natürlich die Farben. Ich weiß nicht, wie die das machen, in den Glasscheiben entsteht Licht, und das wechselt dann die Farbe. Sieht ein bisschen aus wie ein Zauberwürfel. Kennst du die noch?«
»Du magst das Moderne?«
»Absolut.«
»Hätte ich nicht gedacht.«
»Aber die Leute. Die Leute … Ich hatte das Gefühl, dass denen das nicht mehr gefällt, dass bei uns alles so schick daherkommt und dass so viel gebaut wird. Du hättest sehen sollen, wie die geguckt haben! So in der Art von: ›Wollen wir nicht.‹ Sogar als unser Bürgermeister seine Ansprache gehalten und gesagt hat, dass da ab nächstem Jahr der TGV hält und man in zwei Stunden in Paris ist, haben sie rumgemuffelt. Und der Pfarrer hat sich natürlich auch wieder eingemischt und gesagt, Fleurville wäre jetzt Babel. Aber das Feuerwerk war klasse, Florence hat sich riesig gefreut.«
»Das ist das Wichtigste. Aber weißt du, was komisch ist?«
»Na?«
»Dass Monsieur Descombe so spät zum Überholen angesetzt hat, so kurz vor der Einmündung in die Rue Belleville. Das konnte er kaum noch schaffen. Das sagt auch Marie.«
»Monsieur Descombe war der Fahrer?«
»Auf den ist der Wagen jedenfalls zugelassen. Er hatte keine Papiere dabei, und ihn wiederzuerkennen, so wie er aussah … Die Zwillinge haben ihn ein bisschen hergerichtet, da kommt nachher jemand, um ihn zu identifizieren.«
Ohayon kennt die Rue Bisson. Die Straße hat den Charakter einer Allee und beginnt an einem Kreisverkehr nicht weit vom Centre Fleur entfernt. Sie ist etwa einen Kilometer lang und beschreibt einen gestreckten Bogen. Nach 500 Metern zweigt ein Feldweg ab.
Dort steht ein Mann, der sich genau jetzt, da Ohayon den Feldweg vor Augen hat, auf diesem Feldweg aufhält und ihn inspiziert. Es ist einer von Maries Zwillingen, ein gut ausgebildeter Fachmann der Spurensicherung. Er hat eine Art Zelt aufgebaut, und seine Kapuze vorne so eng zusammengezogen, dass sein Gesicht kaum noch zu sehen ist. Gerade deckt er die Plane auf, die während der Nacht eine undeutliche Spur geschützt hat. Er wird die Spur fotografieren und ausmessen. Sein Gesicht zeigt, genau wie das von Ohayon, den Ausdruck stabiler Konzentration und innerer Ruhe, denn er ist ein Mann, der exakt das tun wird, was er sich vorgenommen hat. Niemand wird ihn dabei unterbrechen, ablenken oder vorschlagen, dass er auch anders vorgehen könne. Das Wort Arbeit hätte einen besseren Klang, würde es immer so zugehen.
»Also willst du dir die Unfallstelle noch mal ansehen?«, fragt Resnais, da Ohayon bereits zwanzig Sekunden schweigt, »oder legen wir die Sache zu den Akten? Du musst das entscheiden.«
Ohayon hat nur halb zugehört, denn nachdem er den Verlauf der Straße imaginiert hat, ist ihm ein Gedanke gekommen.
»Der LKW-Fahrer hat dir gesagt, Monsieur Descombe wäre wie ein Irrer von hinten auf ihn zugekommen?«
»Ja.«
»Also ein Raser.«
»Sieht so aus.«
»Du kannst mal Folgendes machen …«
»Telefonieren?«
»Ich möchte wissen, seit wann Michel Descombe seinen Führerschein hat, ob er früher schon in Unfälle verwickelt war, rote Ampeln überfahren hat, oder … Sein Verhalten im Verkehr eben.«
Er wird sich später daran erinnern, dass er zwei Einkaufstüten, eine gefüllt mit Pfandflaschen, in Händen hielt, als der Anruf kam.
»Michel tot? – Nein.«
Alain erschrickt in einem Maß, dass er der Frau vom Sozialdienst dreimal widerspricht. Er wird fast wütend, als sie ihn bittet, den Toten zu identifizieren.
Alains Frau ist schon früh am Morgen zu ihrer Schwester nach Nancy gefahren, er kann mit niemandem reden.
Seine Hand geht ein Stück hoch, Richtung Mund. Bilder einer Leichenhalle tauchen auf, Bilder, die er nur aus dem Fernsehen kennt. Eine totale Fälschung. Selbst der Begriff ›Leichenhalle‹ ist falsch. Er blendet die Bilder aus und verhält sich tapfer. Eben wie ein Freund. Das muss jetzt gemacht werden. So schlimm es auch ist.
Bevor Alain das Haus verlässt, um zur Gendarmerie zu fahren, stellt er sich vor den Spiegel im Flur und überprüft den korrekten Sitz seiner Kleidung. Dabei sieht er vor seinem inneren Auge das Bild eines aufgesprungenen Kofferraums, aus dem ein Geist herausflattert.
Kann man Alains Kofferraumbild mit der Klaviererinnerung von Nina vergleichen? Haben der Schock und die beginnende Trauer bei Alain und Nina etwas ausgelöst, das am Ende gar nichts mit dem Unfall zu tun hat? Neigen die kleinen Seelchen dazu, sich auf diese Weise der Realität zu entziehen? Schwer zu sagen. Freude ist viel leichter darzustellen als Trauer, denn zur Freude gehört, dass sie sich offenbaren will. Trauer dagegen will sich verbergen und manchmal sogar betrügen.
Ohayon ist aufgebrochen, um den Lastwagenfahrer noch mal zu befragen, Maries Mitarbeiter baut das Zelt ab, das er über der Spur auf dem kleinen Feldweg aufgestellt hatte, Marie unterhält sich am Rand eines Sees mit einem Förster, neben dem Förster sitzt ein hechelnder Hund, der heute schon eine Belohnung bekam, Alain Chartier betritt die Gendarmerie.
Obduktion, Gerichtsmedizin, da muss er hin. Alain fährt mit dem Fahrstuhl nach unten, in merklich kühlere Regionen. Als er den Raum betritt, in dem die Toten untersucht werden, ist Marie Grenier nicht da. Die hat noch am Feensee zu tun. Aus dem hat man am Morgen die Leiche eines alleinstehenden Elektrikers geborgen. Der Mann war bereits Mitte Januar als vermisst gemeldet worden. Im Grunde waren die Umstände seines Todes schon zwei Tage später geklärt, da ein Nachbar und der Bruder ausgesagt hatten, er ginge manchmal zum Eisangeln. Und tatsächlich: Neben dem Loch, das er gebohrt hatte, war das Eis eingebrochen. Sie hatten damals Taucher runtergeschickt. Ohne Erfolg.
Um Spaziergängern einen schrecklichen Fund zu ersparen, hatte sich der Förster bereit erklärt, sobald das Eis weg war, jeden Morgen den See zu umrunden. Heute hatte sein Hund angeschlagen. Einer von Maries Zwillingen ist gerade dabei, die stark aufgeblähte Leiche des Elektrikers abzuspülen.
Alain tritt vorsichtig näher.
Der Tote, der gewaschen wird, ist nicht Michel, aber den hat Alain im Moment auch vollkommen vergessen. Der Mann, der die Leiche behutsam abspült, wendet ihm den Rücken zu und bemerkt ihn nicht. So hat er Gelegenheit, etwas zu sehen, das ihn merkwürdigerweise nicht im Geringsten schockiert. An einigen Stellen hat sich das Fleisch in Fetzen von einem Gesicht gelöst. An der linken Schulter kommen die Knochen raus, und auch die Rippen liegen an einigen Stellen bloß. Alains Faszination überdeckt jedes andere Gefühl. Das Fleisch des Ertrunkenen ist so erweicht, dass es teilweise vom Wasser gelöst und weggewaschen wird, und als der eigentlich doch sanfte Strahl das Gesicht trifft, höhlt er neben der Wange ein Loch aus, in das die Nase hineinsackt. Fünf lange Minuten sieht Alain zu, wie der Tote gereinigt wird. Erst dann tritt er vorsichtig ein paar Schritte zurück und sagt endlich den Satz, den er schon längst hätte sagen sollen: »Guten Tag. Ich soll hier meinen Freund Michel Descombe identifizieren, der gestern verunglückt ist.«
Der Mann dreht das Wasser ab, geht zu einer Schublade und zieht sie auf. Er hantiert geschickt mit einem sehr langen Reißverschluss, das Geräusch prägt sich Alain für immer ein.
»Lassen Sie sich Zeit.«
Alain erkennt seinen Freund sofort. Auch ihn haben sie bereits gewaschen und etwas ›in Ordnung‹ gebracht, seine Haare sind noch ganz nass. Alain meint sofort zu wissen, dass sein Freund unter Schmerzen gestorben ist, denn das Gesicht, das er doch so gut kannte, ist ganz unwürdig deformiert. Alain ist weder aufgeregt, noch empfindet er Ekel. Im Gegenteil. Er lässt sich viel Zeit damit, seinen Freund zu betrachten. Und dabei hat er sich doch vor diesem Gang gefürchtet, hat gemeint, Schuldgefühle würden ihn überwältigen.
Erst auf dem Weg nach Hause bricht es durch. Er muss seinen weißen Twingo an den Rand fahren und knallt dabei mit seinem rechten Vorderrad hart gegen den Bordstein. Den hat er nicht gesehen, Tränen haben ihm die Sicht genommen. Fast eine Stunde bleibt er da stehen. Heulkrämpfe. In Schüben. Dieser Moment, wenn das einzige Taschentuch sich vollkommen auflöst. Zweimal klopfen wütende Fußgänger, die Schirme in der Hand halten, gegen die beschlagene Scheibe, denn er steht wirklich idiotisch. Und unablässig prasselt Regen aufs Dach seines Wagens, hämmert in sein überreiztes Nervensystem.
Ohayon tut der Regen gut, denn er hält ihn munter. Gerade hebt er die Hand wie zum Gruß. Im Wetterbericht wird seit Tagen Sturm angekündigt, bei ihnen angekommen sind bis jetzt nur böiger Wind und viel Regen. Im Moment hat sich der Wind gelegt, und so fällt die Flut als grauer Schleier auf kahle Bäume, schlammige Ackerböden, eine Straße. Der LKW-Fahrer kann dem Regen nichts abgewinnen.
»Muss das unbedingt hier draußen sein?«
»Also: Sie sind hier gefahren. Mit Ihrem Laster.«
»Kies, 15 Tonnen.«
»Verstehe. Und wenn Sie so fahren. Mit Ihrem Kies. Kommt es da vor, dass Kies hinten rauskommt? Mal ein paar Steinchen oder so?«
»Kann passieren, deshalb halten die meisten auch Abstand.«
»Und dann?«
»Der kam wie ein Irrer ran, Licht voll aufgeblendet, und ist dann aber noch hinter mir von der Straße abgekommen und rein in den Baum. Idiotisch, hier noch zu überholen, wo die Straße gleich da oben in die Rue Belleville mündet.«
»Sie haben ausgesagt, dass Sie nicht wüssten, ob hinter Ihnen noch ein anderes Auto war.«
»Hab keins gesehen.«
»Noch mal ganz in Ruhe und von vorne«, bittet Ohayon, »lassen Sie sich Zeit.«
Das ist kein blöder Standardsatz, das ist ein guter Standardsatz, denn die Erinnerung, wenn sie berichten soll, neigt zum Besonderen, Unwichtiges wird gerne übersprungen.
»Also gut, ich fuhr hier, und ich habe die Angewohnheit, immer mal in den Rückspiegel zu gucken. Und da sah ich, dass ein Wagen extrem schnell von hinten rankam. Scheinwerfer voll aufgeblendet. Aber ich hab nicht weiter darauf geachtet. Ich nahm den Fuß vom Gas und fing an runterzuschalten. Dann hörte ich ein Geräusch, und als ich in den Rückspiegel …«
»Moment. Das Geräusch. War das eine Kollision?«
»Das Quietschen seiner Reifen, als er sich gedreht hat.«
»Vorher kein Geräusch.«
»Nur das Gequietsche. Aber da war er noch zwanzig Meter hinter mir. Dann ist er mit der Seite in den Baum, und da dachte ich: ›Scheiße, den hat’s erwischt.‹ Da hab ich dann meinen Kipper voll abgebremst. Ein Reflex, verstehen Sie?«
Ohayon nickt.
»Ich dachte, dass ich was tun muss, dem helfen und den Krankenwagen rufen. Es dauerte aber eine Weile, bis ich stand, weil …«
»… 15 Tonnen Kies. Warum eigentlich noch um die Uhrzeit?«
»Zeit ist Geld. Meinen Sie, die hören nachts auf zu bauen? Ich bin raus und hin zu dem Auto und hab da auch schon die Feuerwehr angerufen, und die sagten, sie informieren die Gendarmerie und das Krankenhaus. Ach ja, den Feuerlöscher hatte ich auch dabei. Nicht einfach, den loszukriegen, hab mich noch an der Plombe verletzt. Hier, sehen Sie?«
»Wo ist der Feuerlöscher befestigt?«
»Im Fußraum, auf der Beifahrerseite.«
»Da haben Sie sich reingebeugt und … Wie lange?«
»Bis ich ihn los hatte? Was weiß ich? Jedenfalls bin ich dann hin, so schnell ich konnte. Aber der Wagen brannte nicht. Der war nur ganz zerquetscht und hatte sich um den Baum gewickelt. Es roch nach Gummi und Eisen. Hätten Sie gedacht, dass man Eisen riechen kann?
»Oh ja.«
»Da saß einer drin, der war so kaputt, das werd’ ich mein Lebtag nicht vergessen. Ich hab trotzdem versucht, mit ihm zu reden, weil sein Kopf sich plötzlich bewegte. Hin und her ging der, als wollte er ›nein‹ sagen. Der war noch nicht tot. Aber er hat nicht geantwortet. Also bin ich einfach dagestanden, mit entsichertem Löscher, falls der Wagen doch noch anfängt zu brennen. Aber den Mann richtig angucken, das konnte ich nicht mehr, das war zu schlimm, da war kein Gesicht mehr. Die ihn dann rausgeholt haben, die von der Feuerwehr: Respekt. Zwei von denen waren höchstens zwanzig. So war das. Ich stand mit einem Fuß die ganze Zeit im Schlamm, in einer Pfütze, die sich da gebildet hatte, wo der Asphalt aufhört. Richtig tief drin, ich hatte einen klatschnassen Socken. Hab ich erst viel später gemerkt.«
»Verstehe.«
Ohayon will den Mann entlassen. Doch bevor er das tut, blickt er sich um. Er sieht etwa 500 Meter entfernt die Einmündung der Rue Bisson in die Rue Belleville, dann einen von Pappeln umstandenen Bauernhof, der etwa 150 Meter von der Straße entfernt liegt, und zuletzt das andere Ende der Rue Bisson.
»Kommen Sie.«
Sie gehen die Straße hoch, Richtung Kreisverkehr. Dabei kommen sie an einem von Marie Greniers Zwillingen vorbei, der gerade eine Fotoausrüstung in seinem Fahrzeug verstaut.
»Also, noch mal.«
»Was noch mal? Hier am Kreisel ist doch gar nichts passiert.«
»Na, hier sind Sie doch in die Rue Bisson abgebogen. Von wo kamen Sie denn?«
»Na, von da, vorbei am Centre Fleur, Rue Jesse Owens.«
»Sie fahren also auf den Kreisel zu. Es ist kurz nach acht, es ist schon ziemlich dunkel. Aber da sind ja noch ein paar unterwegs. Da haben Sie doch sicher noch andere Autos gesehen. Ich meine, bei einem Kreisverkehr müssen ja alle aufeinander achten, wenn sie sich einfädeln.«
Eine Weile passiert nichts, außer dass der LKW-Fahrer konzentriert nachdenkt.
»Stimmt«, sagt er schließlich. »Weil ich immer nur an den Unfall gedacht habe und an die Rue Bisson.«
»Ja?«
»Na, wie Sie sagten, ich musste ja in den Kreisel erst mal reinfahren, und da muss ich runterschalten, bremsen … Aber da hat mich einer reingelassen. Ich dachte noch, ›der weiß, wie das ist, mit einem Laster voll Kies‹. Der hat mich vorgelassen, so dass ich nicht bis auf null abbremsen musste. Aber ob der dann hinter mir gewesen ist, in der Rue Bisson …?«
»Was für ein Wagen war das?«
Es dauert wieder ein bisschen, dafür kommt es dann ganz entschlossen: »Keine Ahnung.« Dann noch mal entschlossen: »Ach doch! Rot war der! Ich glaube, ein älteres Auto, ein BMW oder so.«
Genau in diesem Moment fährt ein Peugeot-Kombi von der Gendarmerie an ihnen vorbei. In ihm sitzt einer der Zwillinge. Er hat es eilig, denn er will seinem Kollegen bei der Obduktion eines Elektrikers assistieren.
Sie hat gerade so böse an ihn gedacht. Sie könnte die Tat glatt noch mal begehen.
Yvonne Clerie sitzt seit 45 Minuten auf einem bequemen Stuhl, als ihr diese schlimmen Gedanken kommen. Der Mann ihr gegenüber hat zum Glück nichts gemerkt. Er ist ihr letzter Patient. Später wird nur noch ein Drogenabhängiger kommen, einer, bei dem es mit Reden allein nicht mehr getan ist.
Der Mann, der ihr seit 40 Minuten erzählt, warum sein Leben sich so entwickelt hat, dass er jetzt Hilfe braucht, ist weit davon entfernt, Drogen zu nehmen. Es sei denn, man bezeichnet drei Gläser Wein – aber erst abends! – als Drogenproblem. Seine Geschichte unterscheidet sich weniger von den Geschichten anderer, als er glaubt. Letztlich besteht das Problem darin, dass er sich nicht traut, eine Gehaltserhöhung zu fordern. Von da aus hat er in den letzten Monaten ein Selbstbild konstruiert, das darauf hinausläuft, dass er sich viel zu vieles im Leben nicht traut. Im Zuge seiner Amateuranalyse hat er die Welt, wie er sie sieht, so kompliziert gemacht, dass er seit einiger Zeit nicht mehr schlafen kann. Deshalb sind aus den drei Gläsern Wein inzwischen auch schon mal vier geworden.
Fachlich ausgedrückt: Routine.
Routine war es auch bei Maries Zwillingen. Gerade verlassen sie mit hochgeschlagenen Kapuzen die Gendarmerie, und einer von ihnen erzählt von seinem letzten Skiurlaub in den Bergen. Pulverschnee. Er war wegen des Elektrikers drauf gekommen, weil das Wort ›Eisangeln‹ ein paar Mal gefallen war. Ohayon grüßt mit einer knappen Bewegung der Hand, als er auf dem Parkplatz der Gendarmerie ihren Weg kreuzt. Er hat noch eine Vernehmung vor sich, vor seinem inneren Auge steht das Bild eines pappelumstandenen Bauernhofs.
Nachdem der Patient gegangen ist, wartet Yvonne auf ihren Spezialfall. Ob er überhaupt kommen wird? Ihre ehrenamtlichen Spezialfälle sind nicht immer zuverlässig, und dass sie vor zwei Jahren begonnen hat, sich um diese Menschen zu kümmern, war möglicherweise ein Fehler. Denn es kommen immer mehr. Irgendwann könnte mal einer darunter sein, der gefährlich ist. Gleichzeitig weiß Yvonne, dass einige von denen, die bei ihr Hilfe suchen, möglicherweise unter unwürdigen Umständen zugrunde gehen werden, wenn sie ihnen nicht hilft und ihr Leid beendet. Einige von denen, die zu Yvonne kommen, sind nicht mehr in der Krankenkasse, manche leben auf der Straße. Sie stellt also Anträge, kümmert sich darum, dass sie Medikamente an diese Patienten ausgeben darf. Es sind keine klassischen Junkies, sondern Schmerzpatienten, bei denen es aus dem Ruder gelaufen ist. Und es gibt bei ihr auch keine Hilfe, wenn man nicht in die Therapiestunde geht. Ein ganzer Tag pro Woche geht dafür drauf, plus ein Abend für den Papierkram. Sie fühlt sich verantwortlich, manchmal zu verantwortlich. Da muss sie aufpassen, die Grenze im Auge behalten, darauf achten, dass kein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Nur wie soll man ein Abhängigkeitsverhältnis vermeiden, wenn Menschen zu einem kommen, die in Not sind?
Während sie also, nervöser als sonst, auf ihren Spezialpatienten wartet, wird eine Frage unangenehm, fast bohrend. Sie hatte nach dem Unfall versucht, Nina zu erreichen, und die war fünf Minuten lang nicht ans Telefon gegangen. Wo war sie …?
Yvonne ist schnell klar, dass sie ihre Freundin auf völlig unsinnige Weise belastet, um ihre eigene Schuld an Michels Tod einzuschränken.
Es läuft darauf hinaus, dass Yvonne die halbe Stunde vor Michels tödlichem Unfall immer wieder in Gedanken durchspielt. Dabei geht es ihr vor allem darum, in welchem zeitlichen Abstand Autos einen Parkplatz verlassen haben. Anfangs meint sie, alles sei eindeutig und leicht zu erinnern. Dann wird ihr klar, dass es Lücken gibt. Aber auch Neues. Sie hatte in ihrem Erinnerungsfilm zunächst immer nur sich und Nina gesehen. Und natürlich Michels orangefarbenen BMW, wie er da im Regen unter der Traverse stand, an der starke Lampen und so weiter. Aber dann war ihr plötzlich eingefallen, dass auch Alain das Lacombe verlassen hatte. Noch vor Michel, ihr und Nina. Aber Alain? Konnte der etwas gemerkt oder getan haben? – Nein, eigentlich nicht.
Und so kommt sie nach einer Weile auf ihre Freundin zurück. Nina war gestern Abend sehr schnell mit allem gewesen. Sie hatte Einbruchwerkzeug dabei. Dafür, dass der Einbruch sich letztlich nur aus Michels völlig unerwartetem Tod ergeben hatte, war sie verdammt gut vorbereitet gewesen.
Das ist ungeheuerlich, das passt gar nicht zu ihr. Sie zieht nicht nur ihre Freundin Nina als Mitschuldige heran, jetzt hat sie auch noch den armen Alain aufs Feld gestellt. Bis jetzt steht er noch am Rand, aber er ist schon da.
Hör auf!
Sie kann aber nicht aufhören. Und so macht sie einen gedanklichen Rückwärtssprung und fragt sich, wie gut sie Nina eigentlich kennt. Was für ein Unsinn! Sehr gut natürlich! Sie kannten sich schon als Kinder. Da sie später in verschiedenen Städten studiert haben, verloren sie sich ein paar Jahre lang aus den Augen. Ist in der Zeit etwas mit Nina passiert …? Dann waren sie beide kurz nacheinander nach Fleurville zurückgekehrt. Als hätten sie sich abgesprochen. Sie hatten noch darüber gelacht und sich gefreut. Denn nichts ist so wichtig, so fest und unverbrüchlich wie eine Freundschaft aus Kindertagen.
Geld war Nina schon immer wichtig, hat sich das in den Jahren verstärkt?
Yvonne verbietet sich diesen Gedanken. Bei allem, was sie denkt, steht sie selbst im Mittelpunkt. Als ob alle Handlung einzig von ihr abhinge. Dabei könnte sie doch auch überlegen, was für Gedanken Nina oder Alain sich wohl über sie machen, und was für Schlüsse die beiden aus diesen Gedanken ziehen.
Plötzlich muss Yvonne an ein Abenteuer denken. Sie und Nina waren damals nach Madrid getrampt, obwohl sie wussten, dass junge Frauen da vorsichtig sein sollten. Nina hatte Yvonnes Befürchtungen zerstreut, indem sie ihr ein Klappmesser gezeigt hatte, das sie für den Fall der Fälle in ihrer Hosentasche trug. Und dann hatte sie ein komischer Belgier mitgenommen. Nina hatte sich, wie immer, nach hinten gesetzt …
Es klingelt.
Yvonne Clerie verlässt die Küche und geht durch den Flur zur Haustür. Es ist bereits dunkel. Manche ihrer Freunde meinen ja, es sei leichtsinnig, so spät noch Süchtige in ihrem Haus zu empfangen. Genauso gefährlich, wie sich von einem Belgier mitnehmen zu lassen. Kurz bevor sie die Tür öffnet, nimmt sie sich etwas vor. In einer halben Stunde ist sie hier fertig, dann wird sie ins Centre Fleur fahren, ein paar Runden schwimmen und anschließend im Lacombe essen, so viel sie Lust hat. Und zwar heute mal ohne auf irgendwelche Kalorien zu achten.
Sie öffnet die Tür.
Es ist ein Abhängiger, der da unter dem Licht steht, aber nicht der, auf den sie gewartet hat. Seine Haare und Schultern sind klatschnass.
»David.«
»Bitte …«
»Was willst du?«
»Wie immer.«
»Wer hat dich gebracht?«
»Ich bin selbst gekommen.«
»Du bist Auto gefahren?«
»Bitte, es geht mir schlecht. Ich muss ruhig werden.«
»Komm rein.«
Während sie David vorausgeht, muss sie wieder an den Belgier denken. An die Ereignisse im Auto damals. Daran, wie hysterisch Nina geworden war, mit ihrem Klappmesser. Am Ende hatte der Belgier sie angezeigt. Und das nur, weil sie und Nina etwas falsch verstanden hatten.
»Ich will eine Spritze.«
Warum hat er das gesagt? Er bekommt nie eine Spritze. Irgendwas an David scheint heute anders zu sein als sonst.
Während Yvonne nach dem richtigen Medikament sucht, beobachtet sie ihn, und was sie sieht, ist beunruhigend. Normalerweise redet David wie ein Wasserfall. Heute schweigt er, und … sieht er nicht gerade in Richtung ihres kleinen Zimmertresors? Dann in Richtung ihres neuen Laptops. Oder bildet sie sich das nur ein?
Es ist nicht zu übersehen, dass David sich an einem Punkt der Unentschlossenheit befindet. Er hat die Unterlippe etwas heruntergezogen, manchmal zieht er seine linke, dann wieder die rechte Schulter ruckartig hoch. Plötzlich kommt seine Hand vor und fasst sie am Handgelenk.
»Du gibst mir doch nichts, was mir schadet?«
»Ich bin Ärztin, David. Warum sollte ich dir schaden?«
So merkwürdig hat er sich noch nie verhalten. Er hat Recht, er muss dringend ruhig werden. Oder ist sie wegen ihrer Schuld an Michels Unfall so überdreht, dass sie Gespenster sieht? Ihr Kopf arbeitet auf Hochtouren, David selbst hat sie auf einen Gedanken gebracht. Sie könnte ihm eine so hohe Dosis Beruhigungsmittel spritzen, dass er nicht mehr handlungsfähig ist. Es würde nur ein paar Minuten dauern, bis das Medikament wirkt.
Und was, wenn er nach der Spritze einfach nur ›danke‹ sagt und verschwindet? Er ist möglicherweise mit seinem Auto gekommen. Hat er das nicht eben an der Tür angedeutet …?
Er würde sich also in sein Auto setzen, losfahren und bei voller Fahrt einschlafen. Dann hätte sie noch ein Menschenleben auf dem Gewissen. Aber David kann doch gar nicht mehr Auto fahren, mit seinem Rücken und seinen Beinen, normalerweise fährt sie zu ihm. Yvonne bleibt stark, verweigert die Spritze, gibt ihm seine Tabletten und ermahnt ihn, in keinem Fall mit dem Auto zu fahren. Gut gemacht.
»Komm nicht wieder hierher, ich komme übermorgen zu dir. Hast du verstanden, David?«
Er sagt nicht mal ›danke‹. Ohne ein weiteres Wort verlässt er ihren Behandlungsraum, humpelt durch den Flur. Die Tür. Er zieht sie sogar noch zu.
Yvonne bleibt hinter der Tür stehen und lauscht. Sie wartet darauf, dass ein Auto anspringt und losfährt. Sie ist froh, dass sie ihn nicht mit einem Beruhigungsmittel vollgepumpt hat. Und da wird ihr auf einmal klar, dass sie in ihrem jetzigen Zustand eigentlich nicht arbeiten darf. Es geht ihr nicht anders als David. Sie hat das dringende Bedürfnis, ruhig zu werden. Und so beschließt sie, noch während sie an der Tür steht, am nächsten Morgen zur Polizei zu gehen, um alles zu sagen. Sie muss lachen, und dieses Lachen ist ungeheuer befreiend. Warum ist sie auf diese einfache Lösung nicht früher gekommen? Sie wird gleich Nina anrufen, denn auch für die wird ihr Entschluss eine Befreiung sein. Yvonne geht zurück Richtung Wohnzimmer. Zunächst wirken ihre Schritte leicht, doch nach zwei Metern bleibt sie abrupt stehen. Warum zögert sie? Warum blickt sie nach oben? Direkt in den Halogenstrahler, der den Flur beleuchtet.
Ihre Augen sind hellblau und noch nicht getrübt. Ihre Schuhe und die Kleidung, die sie wohl vor dem stetig fallenden Regen schützen sollen, so was bekommt man selten an einer Frau zu sehen. Das alles sieht so unförmig aus, dass Ohayon nicht einschätzen kann, was für Formen der Körper darunter hat. Die Haare haben exakt die gleiche Farbe wie die Wolldecke, die um sie gewickelt ist. Alles ist von Nässe durchtränkt, bildet fast eine Einheit.
»Und Sie sind Lieutenant?«, fragt sie keck, »das ist eine hohe Position auf einer Gendarmerie. Der Cousin meines Mannes war bis vor ein paar Jahren Lieutenant in Nancy.«
»Warum sagen Sie das?«
»Weiß nicht, man hat ja seine Vorstellungen davon, wie so jemand aussieht.«
»Sie waren gestern Abend draußen? Es hat stark geregnet.«
»Ich musste. Weil ja Feuerwerk angekündigt war! Ich wollte eine Ziege in den Stall hinterm Haus bringen. Wenn’s knallt, rennt die manchmal gegen den Zaun. Die anderen stört das nicht, aber Ziegen sind eben nicht alle gleich.«
Ohayon nickt mit einer Gelassenheit, als könne er ihren Ausführungen vollständig folgen.
»Ich hab hingeguckt, als ich den Motor gehört habe. Wie ein Irrer ist der gefahren. Und genau in dem Moment wollte der andere, der direkt hinter dem Laster hing, dann wohl auch überholen, und dann hab ich nur noch gesehen, wie sich der Verrückte gedreht hat, zweimal ganz rum, bis er dann an dem Baum hängengeblieben ist. Der ist tot, hab ich gedacht. Aber selbst schuld, der ist gefahren, als wäre er auf der Flucht. Ist ja nicht der erste Unfall, den wir hier hatten. Drei allein in diesem Jahr!«
»Da fuhr ein Auto hinter dem Laster?«
»Ja.«
»Ganz sicher?«
»Ich habe Augen im Kopf.«
»Wo ist der hin?«
»Abgehauen, runter zur Rue Belleville und dann Richtung Berge. Der Wagen, der abgehauen ist, der hat noch mehr Lärm gemacht als der andere. Weil der Auspuff kaputt war, genau wie bei meinem Enkel. Bei dem klingt der Wagen auch so kaputt. Und dafür hat er noch viel Geld bezahlt, dass der so klingt wie ein Rennauto. Sollen sie sich doch totfahren, ich bin 82.«
»Und welche Farbe hatte der Wagen?«
»Rot. Ein roter BMW.«
»Noch mal langsam. Ein roter BMW fuhr direkt hinter dem Lastwagen, und ein zweiter BMW hat versucht, ihn zu überholen. Zwei BMW?«
»Genau.«
»Das konnten Sie sehen? Ich meine, es wurde bereits dunkel.«
»Haben Sie denn Augen im Kopf?«
»Schon.«
»Ich bin viel draußen. Und außerdem sehen wir Frauen sowieso viel mehr Farben als ihr.«
»Ist das so?«
»Ich hab nicht mehr so viel Land, wie als mein Mann noch lebte, aber …« Sie zeigt ruhig und genau. »Das geht bis da rüber, bis zur Rue Belleville. Sehen Sie da hinten die Kühe? Da vor dem Knick.«
»Kühe? Ah ja, jetzt sehe ich.«
»Ich bin alt, ich kann nicht jeden Abend überall hinrennen, um die Tiere zu zählen. Ich muss mich auf meine Augen verlassen.«
»Natürlich, aber die Farben der Autos im Regen …«
»Wissen Sie, wie viele Sorten Wolken es gibt, wie viele Farben der Himmel hat?«
»Nein.«
»Bei Ihnen wird es vielleicht dunkel, wenn es dunkel wird, bei mir nicht.« Ein eindeutiges Zeichen, an dem zwei Finger und ihre Schläfe beteiligt sind. »Der ihn überholen wollte, hatte seine Scheinwerfer aufgeblendet, außerdem strahlt es vom Centre Fleur hier rüber, wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist. Ich muss abends in meinem Schlafzimmer sogar die Vorhänge zuziehen.«
»Als der Wagen anfing, sich zu drehen, war er da schon neben dem roten BMW oder noch ein Stück dahinter?«
»Sie meinen, ob der Rote die Spur gewechselt hat und schuld ist?«
»Genau.«
»Das würde ich nicht beschwören. Als ich das sah, wusste ich ja noch nicht, dass mal wichtig wird, wer gerade wo ist. Laut waren sie beide und schnell.«
Ihre Gedanken mögen anders geordnet sein als seine, aber ihre Beschreibungen und Schlussfolgerungen sind exakt. Ohayon macht trotzdem noch einige Tests mit ihr, und sie ist tatsächlich in der Lage, die Farbe der Wagen, die auf der Rue Bisson fahren, korrekt zu identifizieren. Bei der Bezeichnung der Wagentypen vertut sie sich ein paarmal.
Zwanzig Minuten später steht Ohayon vor der Glasfront seines Büros und blickt über die Stadt.
»Du wirst es nicht glauben!« Resnais ist aufgeregt, hat wieder nicht angeklopft. »Da ist nichts. Michel Descombe hat seinen Führerschein seit elf Jahren. Kein Unfall. Keine rote Ampel überfahren. Nie geblitzt worden.«
»Und doch rast er plötzlich wie ein Irrer die Rue Bisson runter und überholt an einer Stelle, an der das kaum noch zu schaffen ist.«