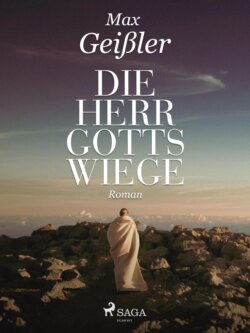Читать книгу Die Herrgottswiege - Max Geißler - Страница 3
1. Der Waldwinkel.
ОглавлениеIn einem Grenzgebirge unseres deutschen Vaterlandes liegt ein sehr schönes Tal, das trägt den Namen die Herrgottswiege.
Derartige Ortsbezeichnungen haben für die Menschen der Einsamkeit nichts Wunderliches; diese Menschen sind zwar meist wortkarg, und je älter sie werden, desto tiefer zieht das Schweigen in Falten um ihren Mund, bis zuletzt so viele Haken und Furchen sich ineinanderhängen, dass es scheint, als könne nur ein grosser Schreck die schmalen Lippen sprengen; aber sie sind nachdenklichen Gemüts, und es schlagen sich aus ihren Herzen tausend Fäden zu allen Dingen, die um sie sind.
Fremden gegenüber sind sie in jenem Gebirge von einer fast störrischen Verschlossenheit; denn sie verachten die hochmütige Art der Städter, die sich gemeinhin für etwas besseres halten, etwa weil sie elektrisches Licht brennen, sich alle Jahre zweimal nach einer neuen Mode einkleiden und ein wenig Gelehrsamkeit aus der Schule ins Leben tragen, die nicht einmal so viel wert ist, dass sie darüber vor der Lächerlichkeit bewahrt bleiben.
Diese Einsamen wissen auch, dass sie nicht so über die Welt und ihre Erscheinungen reden können, wie es denen draussen geläufig ist, und dass sie nicht zehn Worte für jedes Ding haben, mit denen sich über alles schwätzen lässt, was einem vorgedruckt oder vorgedacht worden ist — sondern an ihnen ist alles einfältig ... was von töricht hinwiederum so weit entfernt ist wie der Himmel von der Erde.
Weil sie alles, was sie reden, zuvor selbst und gründlich gedacht haben und das Denken seine Zeit braucht, kommen sie selten zum Worte. Und weil die wenigen Dinge, die sie seit dem ersten Tage ihres Lebens gesehen haben, für dies ganze Leben um sie stehen bleiben, so denken sie sich noch viel tiefer in sie hinein als in ihr eigenes Herz; denn dieses sehen sie nicht. Jene Dinge aber — seien es wie in der Herrgottswiege die Wälder, das Gestein, die Quellen, die Säume oder die blauen Türen des Himmels, hinter die sie sich die Wohnung Gottes dichten, und noch etliches andere — jene Dinge bekommen in ihren Augen oft ein fast seltsames Leben. Und daher rühren die mancherlei Bezeichnungen, die für den, der von draussen in die Einsamkeit solcher Menschen tritt, meist etwas herrlich Belebtes haben.
Warum diese Namen dasind, wissen sie wohl, aber sie reden dem Fremden gegenüber doch nicht davon, weil sie meinen, er lache darüber, oder weil man von derlei Selbstverständlichkeit überhaupt nicht spricht.
Dagegen erscheint ihnen der Gedanke töricht, dass es einmal eine Zeit gegeben haben könne, in der die Bezeichnung dieses oder jenes Ortes noch nicht dagewesen sei; denn sie sind darüber mit sich einig: der Name — weil sie nie einen anderen hörten — müsse so ungeheuer lange bestehen, dass es gar keine andere Möglichkeit gebe, als: er war schon immer.
So trug auch die Herrgottswiege ihren Namen schon immer, und es konnte auch gar nicht anders sein; denn erstens ist es eine Talmulde von ganz ungemeiner Lieblichkeit. Von Hang zu Hang schlägt sich der sanfte Bogen eines sehr dichten und im späten Frühling sehr blumenreichen Rasens. Es zerschneidet — wie das bei Gebirgstälern die Regel ist — kein Wasser dieses köstliche Rund der Wiese, und doch hat der Grund zu allen Zeiten genau den Grad von Feuchtigkeit, den er braucht, um im Verein mit der Luft und der Sonne den Teppich des köstlichsten Grases zu weben, der sich denken lässt.
Dieser Teppich liegt noch ein Stück an den beiderseitigen Hängen empor, gleichsam als hätten die Fichten ihre Füsse auf seine Säume gestellt; denn nach dem Rasen kommt hüben und drüben ein dunkelgrüner Bergwald, ebenfalls von ganz unvergleichlicher Schönheit.
In diesem Walde fliesst an beiden Talwänden ein fussbreites Wasser, aus dem er seine Kraft und Schönheit trinkt, bis er geschlagen wird, was immer nach achtzig Jahren geschieht. Alle achtzig Jahre kommen dann die Fuhrwerke der Holzhändler und führen die Stämme fort.
Von den fussbreiten Wässern im Walde wissen die Menschen, dass sie wohl vordem — natürlich vor einer ungeheuren Menge von Jahren — ein einziger Bach gewesen seien, der mitten durch das Tal floss, diesem Tale seine sanfte Rundung wusch und die Schätze des Bodens aus dem oberen Walde herbeitrug, aus denen nun in jedem Jahre das grüne Wunder des Rasens steigt.
An jener Stelle, an der aus den Klüften und der Dunkelheit des oberen Waldes der Bach in die Herrgottswiege fiel, haben ihn einmal Menschen in die Bahnen an den Talhängen geleitet, in denen er noch heute ist. Von dem einstigen Bett ist jede Spur verloren, seit er die Wiege mit beiden Armen umfängt. Die ihm den Weg an die Hänge wiesen, meinten wohl: wenn es käme, dass auf dem Grunde so viel des Wassers zu wenig würde, wie es zu seiner Zeit oft zu viel gewesen sein mag, so könne man die Bächlein durch zwei Staue zum Überlaufen bringen und so lange die Hänge und die Talsohle bewässern, als man Lust habe. Die Staue sind aber, soweit Menschen denken, nicht gesehen worden; denn sie haben sich nie als nötig erwiesen — wenn sie überhaupt jemals dagewesen sind.
Die Leute meinen: so alt wie die Teilung des Baches, ist auch der Wald an den Hängen; denn vordem hat der Sonnenbrand Stein und Erdreich geglüht, wo nun die dunkelgrünen Streifen der Fichten sind.
Weiter hinauf wachsen die Mauern und Türme zerklüfteten Gesteins; darin treiben Stürme, Regen und Winter ihr Wesen. Sie zermahlen den Fels in den Rissen; es fliegt ein Same hinein und steigt ein neues kümmerliches Leben daraus.
Und ganz oben ist der Himmel; der ruhet diesseits und jenseits des Tales auf den Mauern und Türmen. Und wer wissen möchte, warum diese reinlich hingebettete Schönheit den Namen Herrgottswiege führt, der braucht nichts zu tun, als etwa an einem Sommermittage sich auf den Rasenteppich zu legen und mit offenen Augen gegen die blaue Kuppel des Himmels zu schauen. Dann ist plötzlich ein sanftes Wiegen um ihn; das fängt bei den Wipfeln der Fichten an; die Wässer plaudern dazwischen, als wollten sie helfen, und zuletzt ist das weiche Schaukeln im ganzen Tale, als stünde der Herrgott irgendwo hinter den Felsen und zöge heimlich an einem goldenen Bande von Sonne.
Das Tal ist nach Mittag hin offen, und — als habe das Waldgebirge zwei mächtige Arme ausgestreckt — greifen die beiden Felsmauern gegen Süden, fassen eine Fülle von Licht und stellen sich gegen die Stürme.
Die Decke des Rasens reicht nach rückwärts nicht bis an das Ende des Tals, sondern nur bis an die wenigen Häuser, die gegen dies Ende hin an den sanften Lehnen unter den Waldstreifen oder in der Wiese stehen. Zwischen ihnen führen schmale Steige durch das Gras. Es ist auch ein breiterer Fahrweg da, der aber nach der offenen Seite des Tales zu so gut wie garnicht benutzt wird, sondern nur an dem Teil auf der rückwärtigen Seite des Dorfes — wenn man die Handvoll Häuser denn ein Dorf nennen will —, der durch den Wald führt.
Die Häuser heissen im ganzen Gebirge wie der Talgrund: die Herrgottswiege.
Auf dem Waldwege fahren die Leute im Herbst die Streu für die wenigen Stücke Vieh in ihre Schuppen, und sie nennen ihn den Kirchsteig; denn die Herrgottswiege ist einem Dorfe jenseits des Höhenzuges im Norden eingepfarrt. Auch müssen die Kinder diesen reichlich einstündigen Weg, der in seinem oberen Teile recht beschwerlich ist, zur Schule gehen — immer unter dem Dache der dunklen Bergfichten, die so hart an den Pfad treten, dass man nur ein ganz schmales Band des Himmels sehen kann.
Nach Süden zu beginnen vor der Talöffnung alsbald wieder grosse gräfliche Forsten, so dass in dieser Richtung von menschlichen Wohnstätten auf eine noch längere Wegstrecke nichts liegt als einmal das Haus eines Försters oder Waldhüters.
Die Leute, die in der Herrgottswiege leben, sind fast alle darin geboren, woher es kommt, dass auch jedes Geschehnis alle angeht. Sie wissen gewöhnlich schon von Kindheit an, welche von ihnen als Paare später ganz zu einander gehören werden; und wenn es sich ereignet, dass von den Mädchen eins durch eine Liebe aus dem Tale geführt wird, so trägt es neben seinem Glück auch das Samenkorn eines quälenden Heimwehs mit hinaus.
Das Tal ist von einem so köstlichen Sonnenfrieden und so ungemeiner Lieblichkeit, dass es deswegen wahrscheinlich auf seine ganze Länge mit Häusern bebaut wäre. Aber vor mehr als zweihundert Jahren haben die vier Besitzer, die damals in der Herrgottswiege wohnten, einen Vertrag gemacht, dass sie von ihrem Grasland nie einen Fussbreit verkaufen wollten. Dieser Vertrag sollte Gültigkeit haben auch für alle ihre Nachfolger; denn jene Ahnen hatten erkannt, dass die helle Heimlichkeit dieses Grundes ihr Glück sei, und dass der Ertrag der grossen Wiese und des Waldstücks, das jeder nach Norden zu besass, hinreichend wäre zur Erhaltung eines zwar sehr bescheidenen Wohlstandes, aber auch einer immerwährenden Zufriedenheit.
Es konnten sich, nachdem dieser Vertrag gerichtsmässig fertiggestellt war, in der Herrgottswiege fortan nur im rückwärtigen Gemeindewalde Menschen ansiedeln, was hinwiederum fast unmöglich war, weil die Gemeinde des Kirchdorfes ihren Besitz nicht veräusserte.
So ist es geschehen, dass im Laufe von zweihundert Jahren nur wenige Häuser in der Herrgottswiege entstanden. Die dawaren, vererbten sich von den Eltern auf die Kinder, und nur aus einem waren die Menschen allgemach hinausgestorben. Zuletzt sass nur noch eine sehr alte Frau darin, und als sie fast hundert Jahre geworden war und ohne Hilfe nicht mehr sein konnte, kam eines Tages ein fremdes Paar in das Tal. Die beiden Leute handelten mit Bürsten, waren staubgrau und sonnverbrannt von langer Sommerfahrt, und namentlich die Frau hatte ein phantastisches Aussehen.
Sie boten ihre Waren auch in dem Hause der Greisin zum Kauf, das am Hange steht. Es ist ein sehr schöner und alter Nussbaum vor diesem Hause — wie denn die Herrgottswiege die einzige Stelle in jenem Gebirge ist, an der diese Bäume gedeihen.
In seinem Schatten sass die Greisin und redete mit den fahrenden Leuten. An diesem Tage wurde der Handel fertig: das Geld wurde zusammengebracht, die Bürstenbinder kauften das Haus und wurden sesshaft, die Alte blieb wie zuvor in ihrem Stübchen und starb im folgenden Herbst hinweg.
Danach vergingen einige Jahre.
In der Herrgottswiege hatte man sich mit der Gegenwart der Fremden abgefunden; sie gehörten zwar nicht zu denen, die „schon immer“ dagewesen waren, aber man legte ihnen auch nichts in den Weg. Da sie keine Kinder hatten und ein Handwerk, das in dieser Gegend weit und breit nicht betrieben wird, blieben sie der Gemeinschaft der anderen noch ferner; und es wäre vielleicht gar keine Verbindung zwischen ihnen zustande gekommen, wenn sie nicht beide die Geige in einer Weise gespielt hätten, die den Leuten aus der Herrgottswiege als das schönste und wildeste erschien, was man an Musik hören könne.
Den Mann nannten sie seit dem Tage seiner Ankunft den Bürstenbinder; die Frau jedoch, die Silpa hiess und eine Zigeunerin war, wurde wegen des fremden Klanges ihres Namens mit diesem gerufen. Wie sie sich sonst nannten, wussten die Leute kaum, die Kinder sicherlich nicht, und diese betrachteten Silpa immer mit einem heimlichen Schauer; denn sie dachten: eines Tages müsse durch sie etwas ganz Wunderbares, Unerhörtes geschehen, wie es ihnen von dem Leben und den Künsten der Zigeuner vorgeredet worden oder wie es aus den dämmerigen Quellen des Waldes in ihre Gedanken gekommen war.
Aber es geschah nichts. Und als sie auch die Weisen auf der Geige hundertmal vernommen hatten, wurde das Spiel — wenigstens für die Kinder — zu einem jener Dinge, die schon immer gewesen waren.
Eines aber sahen sie alle nicht, oder sie redeten nicht davon: das war die braune Schönheit des Zigeunerweibes, die unter dem Himmel der Pussta erblüht war. Silpas Haut und die schlanken Linien ihres Leibes waren wie aus gegossenem Erz.
Manchmal sang sie Lieder in jener fremden Sprache die man in ihrer Heimat redete; dann fürchteten sich die Kinder beinahe; und wenn sie Silpa und ihren Mann in den Wald gehen sahen, waren sie froh, dass sie nicht auch zu dieser Zeit gegangen waren. — Übrigens waren die Fremden vom Frühling bis in den Herbst nur für Tage in dem Nussbaumhause; denn während des Winters stellten sie eine grosse Menge Bürsten her, die sie auf ihren Rücken in der schönen Jahreszeit ins Land trugen und verkauften.
Bei alledem blieben sie jedoch ärmer als die anderen in der Herrgottswiege, und weil sie sich ihr Lebtag anders gewöhnt hatten, fand sich auch die Zufriedenheit nicht zu ihnen; denn sie vermochten ihre Herzen nicht auf das heitere Gleichmass vernünftigen Wünschens zu stimmen. Manchmal meinte der Mann, ihre Kunst sollte ihnen helfen, und sie wollten daraus Geld schlagen. Dann höhnte ihn Silpa und sagte: nun sie von dem Binden steife Finger und von ihrer Ehe ein freudloses Herz bekommen habe, fiele ihm das ein — bürstenbinden und geigen vertrüge sich nicht miteinander. Sie hatte auch aus den Linien der Hand und aus anderen Zeichen das Wahrsagen gelernt, das ihr zuvor manch schönes Stück Geld eingebracht ...
In Wahrheit hätten sie trotz all dieser Dinge sich doch zu einander gefunden, wenn die braune Silpa nicht in der Tiefe ihres Herzens ein Geheimnis getragen hätte, das sie, je länger je mehr, von ihrem Manne trennte. Als dieser sie kennen lernte und sie fragte, ob sie sein Weib werden wolle, verschwieg sie ihm nämlich, dass sie schon eines Mannes Weib gewesen sei und dass sie jenem ein Knäblein geboren habe; sie verschwieg auch, dass sie ihm davongelaufen sei, um mit dem Trupp fahrender Leute ihrem Triebe zum Wandern nachzugehen.
An dieser Lüge zerschellte zuletzt ihr Leben.
Um jene Zeit aber regten sich in ihrer Seele die Gespenster der Reue; es wuchs darüber die Sehnsucht nach Kind und Heimat, und es war niemand, dem sie sich hätte offenbaren können.
So rückte ihr der Mann, mit dem sie das Leben teilte, fern und ferner. Nachts stöhnte sie im Schlafe, oder sie weinte in ihre Träume, wenn sie die Stimme des Knaben Vilmos rufen hörte, der nun zwölf Jahre geworden war und vielleicht draussen auf der Pussta lag, ein verwaister Hirte, der sich den Trunk aus dem Euter der Ziegen sog und mit seinen weissen Zähnen eine harte Rinde Brotes zermalmte, und der geschlagen wurde von der Geissel eines alten Zigeunerweibes, weil ihn seine Mutter in die fremde Armut geworfen, als er ihr lästig war. Oder er hatte eine andere Mutter, die ihn hasste ...
Es waren wilde, schwere Gedanken, die Silpa am Herzen frassen; aber sie musste schweigen; denn sie fürchtete sich vor ihrer Lüge. Der Mann ärgerte sich an ihr, und sie ward verstockter ...
Und doch ward viele viele Jahre nach her der Schleier von ihrem Leben gezogen — da war sie schon gestorben in einer Hirtenhütte der Pussta; denn es fiel dem Vroneli im Haus am Brunnen die Geschichte dieses Lebens an einem Frühlingstag in die Hände, zu einer Zeit, in der das Bild der schönen braunen Silpa beinahe ausgelöscht war in dem Gedächtnisse der Leute des Tales. —
Damals erwogen Silpa und ihr Mann in ihrer Armut noch dies und jenes, fanden sich aber nicht recht ins Leben, und vielleicht wären sie voneinandergelaufen, wenn sich nicht eines Tages etwas zugetragen hätte, das das Merkwürdigste ist, was in der Herrgottswiege bis dahin geschehen war.
Es rollte nämlich an einem Sommerabend einer jener grünen Wagen auf dem Wiesenwege ins Tal, wie sie fahrenden Leuten als Wohnung dienen. Er war mit zwei stattlichen Braunen bespannt, ein kleiner Schornstein ragte aus seinem Dach, an den sechs Fenstern waren weisse Vorhänge, und das ganze wandelnde Häuslein sah so blank und freundlich aus, dass die Leute zusammenliefen und die Kinder meinten: darin zu wohnen, wäre die grösste Lust des Lebens.
Vorn auf dem Wagen sass ein Mann, der mochte wenig über dreissig Jahr alt sein; er hatte einen breiten grauen Hut auf dem Kopf und sehr helle Augen unter der Stirn. Diese Augen waren von einem so rätselvollen und tiefen Glanze, wie er sonst nur in Kinderaugen ist, die noch warten, dass irgendwo ein Märchen Wahrheit werde.
Alle Blicke suchten an ihm herum — es war kein Landfahrer, der in seinem Wagen Dinge verborgen hatte, wie man sie auf den Märkten sehen kann; denn er trug städtische Kleidung und hatte ein feines Gesicht, und wenn er sprach, klang es für die Ohren der Leute, als lese er aus einem Buche vor.
Er fragte, ob er seine Pferde in einem Stall unterbringen könne, er werde bezahlen, was man für den Dienst und das Futter verlange.
Und was sich darauf ereignete, war wiederum sehr merkwürdig: weil in zwei Ställen nur je ein Stand frei war und die Pferde neben den Kühen leicht unruhig werden konnten, wurden die zwei Kühe aus dem Stall im Haus am Brunnen in die freien Stände der Nachbarn geführt, und der Fremde wurde eingeladen, er möge nun die Pferde getrost einstellen. — Ein Bett und was sonst für die Nacht nötig wäre, auch Essen und Trinken brauche er nicht, sagte er; denn er führe alles in dem grünen Wagen mit.
Jedes Wort, das er sprach, spannte die Neugier in den Menschen, und zuletzt war sie wie ein Bogen, mit dem einer einen Pfeil in die Decke des Himmels schiessen will.
Als die Pferde versorgt waren und der Sommerabend dunkelrot und leuchtend über das Tal sank, liess der Fremde seine Augen auf allem ruhen, was um ihn war, und sagte: „Ich habe eine lange Reise hinter mir; denn ich habe seit vier Monaten das Land vom Meer im Norden bis zu dem Gebirge der Alpen durchfahren — kreuz und quer und noch weiter. Ich habe viel Schönes und Gewaltiges gesehen in der Zeit, aber nichts, das so voll heimeligen Friedens und leuchtender Stille gewesen wäre, wie die Herrgottswiege.“
Und weil das Bürstenbinderhaus der Stelle am nächsten lag, an der der grüne Wagen auf dem Wege stand, gingen sie alle den Steig am Hang empor und setzten sich unter den Nussbaum; denn es waren da von alters her zwei Bänke und ein Tisch, und wer nicht auf den Bänken Platz finden konnte — auch weil ihn jeder anschauen wollte — der suchte sich eine Stelle an der Erde oder auf der Schwelle des Hauses.
Der Fremde sah nun auch Silpa, wunderte sich über ihre braune Schönheit und fragte, ob sie nicht aus dem Lande Ungarn gekommen wäre.
„Ja,“ antwortete Silpa.
„Dort bin ich auch gewesen,“ sagte er, „und bin durch die Steppen und Heiden gefahren, die sie die Pussta nennen. Ich komme gerade von dort her und habe sie blühen sehen — es ist alles unsagbar herrlich und seltsam.“
Da gingen der Frau die Augen über.
Einer der Männer — es war der Steinhofer, der die Lehre aufgestellt hatte: man müsse dem Herrgott auch manchmal ins Uhrwerk fassen; denn das wolle er so haben — der vom Steinhof sagte danach gerade heraus: „Da Ihr nun in der Wiege zu Gaste seid und so lange bleiben möget, als es Euch gefällt, möchten wir wissen, wie Ihr heisset und was Ihr für ein Geschäft habt. Seid Ihr vielleicht ein Naturforscher?“
„Nennet mich nur Silvanus,“ sagte der Fremde, „eigentlich heisse ich Robert Silvanus Waldschmidt. Und was den Naturforscher anlangt, so habt Ihr nicht falsch geraten — das heisst, ich treibe diese Wissenschaft nur nebenher und zu meiner Freude, wie ich denn alles zu meiner Freude tue und auch zu meiner Freude lebe.“ Er lächelte, weil er ihnen verschwieg, dass er ein Dichter sei ... die Menschen tragen dies Wort alle im Munde, und weiss doch ausser den Dichtern keiner, was ein Dichter ist.
„Da müsst Ihr ein sehr reicher Mann sein, Herr Silvanus, wenn Ihr nur zu Eurer Freude lebt,“ sagte der Steinhofer wieder und strich sich eine Handvoll Erstaunen aus seinem bartlosen Gesicht.
„Das ist ein falscher Schluss,“ antwortete der Fremde. „Es ist vielmehr so, dass ich meine Wünsche auf die Summe Geldes einstelle, die ich besitze. Ich habe in meinem Wagen eine sehr weite und lange Reise unternehmen können, weil ich keinen Pfennig über das hinaus bedurfte, was jeder Tag des Lebens erfordert — ausser dem Preise des Wagens und der Pferde, die ich nun aber verkaufe, so dass ich das angelegte Kapital wiedererhalte.“ Er erzählte ihnen auch, dass diese Art des Reisens vor anderen bequem und lohnend sei und erklärte ihnen die Vorteile vor langen Wanderungen oder Eisenbahnfahrten.
„Ihr müsst uns noch vieles darüber sagen,“ begann wieder der Steinhofer; „wir hoffen, dass Ihr noch morgen oder gar einige Tage in dem Tale bleibt, in dem es Euch so gefällt.“
Die Zigeunerin und ihr Mann waren inzwischen hinzugetreten, und die Frau sagte: „Mit Verlaub, Herr Silvanus — wenn Ihr Euer Haus auf den Rädern verkaufen wollt — was wollt Ihr denn dann beginnen, da Ihr selbst sagt, Ihr hättet kein Geschäft?“
„Dann werde ich sehen, ob in diesem Gebirge oder gar in diesem Tal ein Haus ist, in dem ich wohnen kann, so lange es mir gefällt.“
„Und wenn wir Euch sagen: dieses, vor dem Ihr jetzt ausruht, ist zu verkaufen?“
„Das wäre ein Zusammentreffen der Umstände, wie es selten ist,“ antwortete Silvanus.
„Und wenn wir sogar Euren Wagen und Eure Pferde mit in Zahlung nähmen und Ihr uns nur soviel an Geld zu geben brauchtet, als unser Steinhaus Eurem hölzernen an Wert über ist?“
Der rote Brand war nun ganz ausgelöscht, aber es regte sich von allen Menschen noch keiner; denn die Merkwürdigkeit dieser Stunde fiel über alle — wenn der Himmel seine Sterne als goldene Taler in die Herrgottswiege geregnet hätte, es wäre ihnen nicht wunderlicher erschienen.
Sie fragten und antworteten noch eine Weile, dann sagte Silvanus: „Ich habe nun alles verstanden; denn ihr habt ohne Umschweife zu mir geredet, und ich weiss: ihr zwei wollt in dem grünen Wagen den Weg ins Leben finden, den ihr verloren habt.“
„Es ist genau so, wie Ihr sagt, Herr Silvanus!“ fiel der Steinhofer ein, und die anderen stimmten zu. Danach sagte Silvanus:
„Ich habe die Quittungen über die Summen, die ich bezahlt habe, in meinem Wagen, weil ich alles mit mir führe, was ich besitze — mit Ausnahme des Geldes; davon trage ich nur soviel bei mir, als ich für eine bestimmte Zeit brauche. Die Pferde sind viel besser geworden, als da ich sie kaufte; denn ich habe sie sehr gut gehalten, und der Wagen ist höchstens in der Farbe ein wenig unansehnlicher geworden — ihr könnt euch morgen alles betrachten und euch auch davon überzeugen, dass ich sechshundert Taler dafür bezahlt habe. Nun beredet untereinander, ob euch dieser Preis nicht zu hoch ist.“
Dann gingen sie auseinander; die Kinder und Frauen liefen in ihre Häuser, dem Schlaf oder einer versäumten Arbeit nach, die Männer gingen mit Silvanus zu dem Wagen und sagten: der Bürstenbinder hätte sein Haus vor fünf Jahren um siebenhundertfünfzig Taler gekauft; er habe es aber nicht gut gehalten, und es sei deshalb kaum noch so viel wert.
Danach redeten sie in den Häusern noch eine Weile von diesem Tage, der bis zum Rande voll gewesen war. Silvanus aber sass bei der Lampe in seinem Wagen und las, wie er das des Abends immer zu tun pflegte, da hörte er draussen Tritte und seinen Namen rufen. Er öffnete und sah Silpa mit ihrem Manne.
Weil sie noch auf eine kurze Rede zu ihm herein wollten, schlug er die Stiege nieder, damit sie heraufgehen könnten. Am folgenden Tage würden sie doch nicht ungestört sein, sagte Silpa; sie besahen sich alle Dinge, die in dem rollenden Wohnhause waren; und morgen solle der Herr Silvanus nur bei Zeiten kommen und sich das Haus betrachten, es sei zwar alt, aber in allen Dingen bequem und der Gegend angemessen, und sie wollten den Tausch machen, wenn er ihnen noch hundert Taler in barem Gelde bezahle.
„Wir werden morgen sehen,“ antwortete er. Danach zeigte er ihnen die Einrichtung des Wagens. Der hatte zwei Räume — eine Küche und ein Wohngelass. In der Küche, die der Stiege zunächst lag, waren alle Dinge, die zu einem kleinen Hausstande gehören, auch ein eiserner Herd, von dem der Abzug durch das Dach führte. Jede Sache war so angebracht, dass sie auf der Fahrt nicht rütteln oder gar zerschellen konnte. In dem Wohnraume waren ein Sofa und ein Bett mit weisser Decke, die war so rein, als wäre sie gerade von der Bleiche gekommen. Es waren zwei Stühle da und ein Tisch, auch ein Regal mit vielen Büchern, und vor den Fenstern Läden aus stellbaren Schindeln, die Wind und Wetter abhielten.
Da Silpa alles gesehen hatte, ward sie nachdenklich und sagte: „Es ist hier so sauber und neu und für alles gesorgt, dass Euch das Nussbaumhaus danach wohl nicht gefallen wird.“
„Wir werden morgen sehen,“ antwortete Silvanus wie vorhin. Dann gingen die beiden fort. Der Mann im Wagen aber schloss die Läden, löschte die Lampe aus, die an einer Kette vom Dache hing, und legte sich schlafen. —
Das Nussbaumhaus lag am Saum eines jener Waldstreifen, von denen gesagt worden ist, dass sie sich zwischen Fels und Wiese an der ganzen Länge des Tales auf halber Höhe hinziehen. Es stand aber noch jenseits des flinken fussbreiten Wassers, das ebenfalls am Hange seinen Weg lief, und man musste dieses Wasser, ehe man zu dem Nussbaume gelangte, auf einem Brücklein überschreiten. Danach trat man in den kleinen Hof, der ganz von der Krone des Baumes überdacht war; aus dem Wald aber war für den Standort des Hauses ein Viereck herausgeschlagen worden. Neben und hinter diesem Hause war nur eine sanfte Steigung des Geländes.
Nachdem Silvanus am anderen Morgen alles betrachtet hatte und auch wusste, dass sich nach seinem Geschmack und nach seinen Bedürfnissen ein Anbau herstellen liesse, wurde der Handel fertig.
Es geschah in den nächsten Tagen, was bei einem Kaufe zu geschehen hat, und als die Woche herum war, hatten sie die Wohnungen gewechselt, und die Bürstenbinderleute fuhren in die Welt, um Musikanten zu werden.
Danach kamen Arbeiter, schlugen in einer Schlucht über dem Walde Steine und trugen diese zum Nussbaumhause. Die Leute aus dem Tale fällten um das Haus noch einige Stämme, und es kamen Maurer, die errichteten den Anbau und taten alles, wie es ihnen Silvanus vorschrieb.
Als der Duft der zweiten Mahd über dem Tale lag und in dem Nussbaume schon die ersten Lichter des Herbstes angingen, stand ein schmuckes weisses Haus am Hange, das hatte ein rotes Ziegeldach und schneeweisse Vorhänge hinter den Fenstern. Von dem sagten die Leute: es stehe so blank und wohlbedacht in der Welt wie der Herr Silvanus selber. —
Es war aber noch jemand in dem Tale, der zwar weder darin geboren war, noch lange daselbst gewohnt hat. Er steht auch bei den mancherlei Ereignissen dieser Geschichte immer daneben, wie er sich selbst gleichsam neben das Leben gestellt hatte.
Dieser Mann ist der Maler Berengar.
Er zählte zu der Zeit, da Silvanus in jenen Waldwinkel zog, dreiundzwanzig Jahre, war im Sommer zuvor mit seinem Malgerät ins Tal gekommen und hatte die eine Hälfte des Hauses am Brunnen gemietet, in dessen anderer Hälfte die Witwe eines Holzhauers mit ihren Kindern wohnte, dem dreizehnjährigen dunkeläugigen Vroneli, das später die geheimnisvolle Kette findet, und dem zehnjährigen Knaben Sebastian mit dem flachsenen Schopf — derselbige, der behauptet: zu einem richtigen Menschen gehöre ein Taschenmesser und eine Streichholzschachtel.
Der Maler Berengar war Landschaftsmaler, und zwar — nach dem sicheren Urteile des Dichters Silvanus — ein sehr tüchtiger Landschafter, wiewohl er mit grosser Wahrscheinlichkeit ein ganz ausgezeichneter Bildnismaler geworden wäre, wenn ihn nicht eine Eigentümlichkeit seines Charakters von der Ausübung dieser Kunst ferngehalten hätte.
Man weiss nur von zwei Frauenbildnissen, die er gemalt hat; diese aber sollen von so ungewöhnlicher Vollkommenheit gewesen sein, dass sich in der sehr merkwürdigen Geschichte des Malers Berengar, die der Dichter Silvanus infolge einer nicht minder merkwürdigen Begebenheit gegen das Ende seines Lebens aufschrieb, die Worte finden:
„In diesem grünen Saal war an einem Teile der südlichen Wand ein Vorhang aus dunkelgrünem Sammet und dahinter der wundervoll gemalte Kopf des schönsten Weibes, das Herrn Berengars Augen gesehen haben. Darunter stand der Name Celeste. Es wusste niemand, welche Bewandtnis es mit dem Bilde habe; aber die Menschen meinten, es müssten sich sehr schmerzhafte Erinnerungen für den Herrn Berengar an dies Bildnis knüpfen.“
Silvanus kannte diese Erinnerungen; aber seine Geschichte enthält darüber dennoch kein Wort — als hätte seine Freundestreue den Schleier des Geheimnisses nicht lüften oder als hätte er den Ereignissen nicht vorgreifen wollen; denn das Leben erzählte diese Geschichte nach dem Tode des Herrn Silvanus zu Ende, und die Leute in der Herrgottswiege erfuhren dies Ende — sie erfuhren es aus dem Munde jener dunkeläugigen schönen Frau Celeste selbst.
So wunderlich spielt das Schicksal; denn das Bild hinter dem grünen Vorhange schmückt die Wand des Zimmers eines sehr trauten Hauses in Welschland, an dem stillen Ufer des schönsten Sees der Erde. —
Ausser jenem Bilde mit der Aufschrift Celeste, das Berengar im zweiten Jahre nach seinem Aufenthalt im Tale der Herrgottswiege malte, hat er — wie gesagt — nur ein einziges geschaffen. Es ist wenigstens nie ein drittes oder viertes bekannt geworden. Und dies erste war das der Zigeunerin Silpa. Es weiss aber niemand, wohin es gekommen ist. —
Mit dem Maler Berengar trafen die Leute im Tale fast nie zusammen, ja, sie wussten weiter nichts von ihm, als dass er dasei und dass er an jedem Morgen mit seinen Gerätschaften ausziehe und des Abends heimkehre. Manchmal, wenn er an einer sehr fernen Stelle des Gebirges malte, kam er gar nicht. Sie wussten noch, dass er an Regentagen in seinem Zimmer sass und aus dicken Büchern seine Kunst und ihre Geschichte studierte; ferner, dass er sehr reich sei, weil er bei Einbruch der kalten Jahreszeit in das Land Italien reise und erst mit der Sonne wieder eintreffe, und dass er auf der Welt niemanden habe als einen alten Onkel, der eine Burg am Rhein besässe und deshalb auch sehr reich sein müsse. Mit diesem Onkel wechsele er manchmal Briefe. Ausser dem Grusse aber tausche Herr Berengar mit den Leuten im Tale kein Wort. Er sei trotz alledem nicht hochmütig, sondern sein ganzes Wesen lasse ihm weiteren Verkehr nicht zu.
Manchmal geschah es, dass Silvanus den Herrn Berengar im Walde traf. Sie redeten dann einige Worte über die besondere Schönheit der Landschaft, Berengar nahm das bewundernde Lob aus dem Munde des Herr Silvanus mit freundlichem Dank entgegen, und es schien, als schätze auch der Maler den besonnenen und klugen Menschen an dem Dichter. Im übrigen aber verkehrten die beiden nicht und rieten auch nicht aneinander herum — es schien vielmehr, als hätte sich der eine mit den Eigentümlichkeiten des anderen stillschweigend auseinandergesetzt, und als erachteten sie diese Eigentümlichkeiten für Lebensbedingungen, an die ihnen ihre gegenseitige Schätzung zu rühren verbot.
Und dennoch ist in dem Leben dieser beiden Männer oft eine so überraschende Ähnlichkeit, dass für diejenigen, die dem Glauben an eine Vorherbestimmung des Menschenschicksals zuneigen, bei oberflächlichem Betrachten darin fast ein Beweis der Richtigkeit ihrer Anschauungen erkennbar sein könnte; denn das Leben beider, so seltsam es ist, läuft über sehr weite Strecken in ganz den gleichen Windungen oder in der gleichen Geradheit, und seine Fäden rollen sich oft in Ereignissen ab, vor denen etliche staunend fragen werden, wie es möglich sei, diese Gleichheit anders zu deuten als: Eigenwille vorbestimmenden Schicksals.
Dies ist es aber nicht; die Geschichte aus der Herrgottswiege ist vielmehr ein Zeugnis dafür, dass der Wille des Menschen fast gleichbedeutend mit seinem Schicksale sei und dass die Kraft des Willens in dem geraden Verhältnisse stehe zur Grösse des Glücks.
Wie die Schiffe zwischen den ungeheueren Tiefen des Ozeans und den gewaltigen Mächten der Stürme doch zumeist die Strassen gleiten, welche ihnen das Steuer weist, so läuft auch das Schiff des Lebens nach dem Steuer des Willens. Und Steuermann ist nicht das Schicksal — Steuermann ist der Mensch ... Es liesse sich die Macht des Schicksals dann wohl mit der der Stürme vergleichen? Das wäre auch nicht richtig, sondern die Stürme sind der Tod mit seinen Vorboten, den Krankheiten. Andere Mächte im Leben, die sich uns feindlich entgegenstellen, und die wir als widerliches Schicksal bezeichnen, sind am Ende nicht nur durch den Willen zu überwinden, sondern sie wären durch diesen in den meisten Fällen schon an ihrem Auftreten zu verhindern gewesen.