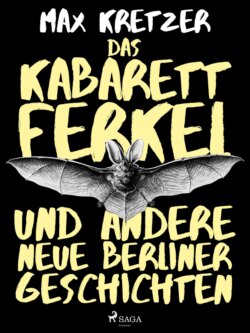Читать книгу Das Kabarettferkel und andere neue Berliner Geschichten - Max Kretzer - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Überwindung.
ОглавлениеProfessor Johannes Murr befand sich in sehr übler Laune, trotzdem eigentlich kein tieferer Grund dazu vorlag, denn abgesehen von einer zeitweilig auftretenden Magenverstimmung fehlte dem allgemein geschätzten Gelehrten nichts von jenen Gütern, die der Mensch herbei sehnt, um alle an ihn herantretenden Wünsche erfüllen zu können. Er lebte in glücklicher Ehe, hatte fünf gesunde Kinder, die ihm andauernd Freude bereiteten, war schuldenfrei, beliebt bei allen seinen Kollegen am Gymnasium, deren Stimmen er sicher war, falls der stets kränkliche Direktor demnächst in den unausbleiblichen Ruhestand treten würde, als dessen berechtigten Nachfolger er sich längst in Gedanken erblickt hatte, und durfte sich infolge einer erst kürzlich gemachten erheblichen Erbschaft auch in dem schönen Traume wiegen, seine Hinterbliebenen dereinst in besseren als sonst üblichen Verhältnissen zurücklassen zu können. Überdies war ihm noch vor kurzem eine Freude erfüllt worden, auf die er kaum mehr gehofft hatte. Sein neuestes Buch „Über das Mitleid“ war erschienen, lag in allen Schaufenstern und hatte auch schon in dem Wust von Neuerscheinungen zahlreiche wohlmeinende Erwähnungen in den Zeitungen gefunden, woraus er schliessen durfte, dass die gelehrte Fachpresse sich jedenfalls eingehend und anerkennend damit beschäftigen werde. Dieses Buch, das eigentlich mehr eine Etymologie des Wortes „mitleiden“ war und, davon ausgehend, einen reichen Wortschatz aller darauf bezüglichen Begriffe enthielt, der sich am Schluss bis zu einer gründlichen philosophischen Auslegung der christlichen Liebe erweiterte, lag nun, schön und würdig ausgestattet, vor ihm auf dem Tisch, und mit der Befriedigung des Schaffenden, der sein letztes Geisteskind am meisten liebt, hatte er es unzählige Male in die Hände genommen, immer wieder darin gelesen und geblättert und es zum Überdruss bereits der ganzen Familie gezeigt, ungefähr wie ein Mann mit einer gewissen kindlichen Schwäche, der davon überzeugt ist, dass sich eigentlich alles um seine Person drehen müsse, wodurch andre wichtige Dinge in den Hintergrund gerückt würden.
Da geschah plötzlich etwas, was er niemals erwartet hätte und was ihm die ganze Laune verdarb. Er erhielt eine Postkarte folgenden Inhalts: „Sehr geehrter Herr Professor! Ich habe mir Ihr Buch „Über das Mitleid“ gekauft und es auch gelesen. Soweit ich etwas davon verstehe, ist es sehr durchdacht, es hat mir im allgemeinen auch gefallen. Nur haben Sie ein Wort vergessen, ohne das wir alle nicht auskommen können und das den Schatz Ihres Wissens mehr vervollständigt hätte. Worauf Sie aufmerksam macht — mit Hochachtung Ihr Schwager Hermann Tipke.“
Dieser Schwager, mit dem sich die Schwester seiner Frau, ein schon etwas spätes Mädchen, seiner Meinung nach nur „verplempert“ hatte, war der einzige, Gott sei Dank nur selten, auftretende Ärger seines Lebens, entstanden aus jener Verwandtschaft, die man nicht ableugnen kann, an die man aber am liebsten nicht erinnert werden möchte. Nach des Professors Meinung wenigstens! Zwar hätte er tiefere menschliche Gründe gegen diesen „Entfernten“, der ihm schon seit Jahren nicht zu nahe getreten war, nicht vorbringen können, aber sein höherer Bildungsgrad, seine verwöhnten Umgangsformen, die ganze Aufmachung seiner Karriere hatten ihn dazu gedrängt, jeden engeren Verkehr mit diesem Angeheirateten zu meiden, der da irgendwo im Osten Berlins, in der Nähe der Spree, ein kleines Versandgeschäft eingemachter Früchte besass und sich nebenbei mit irgend welcher Tierzucht befasste, wofür sich aber der Gymnasialprofessor gar nicht interessierte. Er erfuhr nur hin und wieder so nebenbei etwas davon, und zwar durch seine Frau, die mit der Schwester regen Verkehr unterhielt. Der Mann war ihm gänzlich gleichgültig geworden, und zwar seit der ersten persönlichen Begegnung, die er, um nicht unhöflich zu erscheinen, nicht hatte verhindern können. Er konnte sich nun einmal nicht befreunden mit Leuten, die seinem Gedankengange nicht folgen konnten, keine Ahnung davon hatten, was ein Humanist sei, ihre eigenen Sprachen redeten und obendrein nicht wussten, was sie ausserhalb ihrer häuslichen Tätigkeit mit den Händen anfangen sollten.
Und nun war ihm das Unerhörte passiert: dieser Mann meldete sich ohne jede Anregung, wagte nicht nur Kritik, wenn auch eine versteckte, an seinem durchaus wissenschaftlichen Werke zu üben, sondern tadelte auch auf offener Karte in jener grosszügigen Schleifenschrift, aus der allein schon die geringe Denkfähigkeit des niedriger stehenden Individuums sprach. Ausserdem unterzeichnete er auch noch mit „Schwager“, was sozusagen der Anmassung die Krone aufsetzte und fast wie ein verwandtschaftlicher Hohn klang, verblümt mitgeteilt durch den Ausdruck der Hochachtung, den man aber bei dieser Art von Menschen genügend zu würdigen wusste!
Der Professor, schon nervös geworden durch anstrengende geistige Arbeit, die manchmal bis in die Nacht hinein währte, geriet in äusserste Erregung und verschonte auch seine Frau nicht damit, ohne jedoch die eigentliche Veranlassung zu verraten; denn er schämte sich ein wenig und befürchtete auch, an seinem wunden Punkt erkannt zu werden. Bald aber sagte sich die kluge Frau Professor, die diese Eigenheiten ihres Mannes zur Genüge kannte, dass jedenfalls eine schlechte Kritik eingetroffen sei, worunter gewöhnlich die ganze Familie zu leiden hatte.
Allmählich wurde Johonnes Murr wieder ruhig, denn je öfter er die Karte las, je mehr musste er sich sagen, dass sie eigentlich nichts Unehrerbietiges enthalte, vielmehr lediglich eine durchaus löbliche Anerkennung seines Schaffens, obendrein von einem Käufer seines Buches, dessen Name ihn nur verstimmt hatte. Als unangenehmes Anhängsel blieb der Hinweis auf eine Lücke in seinem Wortschatz übrig, worüber er allerdings nicht hinweg kam. Sein geistiges Gleichgewicht litt darunter, sein ganzer Gelehrtenstolz kam ins Wanken, und er geriet in die Verfassung eines Mannes, der etwas Vollendetes zu leisten geglaubt hat und nun auf Mängel aufmerksam gemacht wird, die er selbst nicht findet. Dieses fehlende Wort machte ihm zu schaffen, wurde gleichsam die Geissel seines Grübelns, und als er sich genugsam erfolglos den Kopf darüber zerbrochen hatte, raffte er sich zu einem Entschlusse auf, der ihm zwar wahnwitzig erschien, ihn aber doch unwiderstehlich dazu trieb, seine Gelehrtengründlichkeit zu erschöpfen.
„Sag mal, liebe Pauline, wie geht’s denn jetzt .. eigentlich ... deinem Schwager?“ horchte er vorsichtig seine Frau bei Tisch aus, nachdem die fünf Sprossen bereits gnädig entlassen waren und er sich noch einen grossen Löffel Flammeri, den er leidenschaftlich gern schleckerte, auf den Teller getan hatte. „Hatte er nicht die Influenza? Es interessiert mich eigentlich nicht, durchaus nicht! Aber deine Schwester hat ihn doch nun mal, und wiederum, siehst du —.“ Dieses „Wiederum“ war sein beliebtes Stichwort, womit er die meisten Nachsätze schmückte. Wie er sich auch daran gewöhnt hatte, niemals „mein“ Schwager zu sagen, um dadurch die Verwandtschaft auf die kleine, runde Frau abzuwälzen.
Der Mangel jeglichen Spottes in seinem Ton überraschte sie, so dass sie ihn vorerst bat, sich noch mehr Kirschsaft zu dem Flammeri zu nehmen, weil sie seine gute Laune aus diesem Genusse herleitete. „Er hat alles gut überstanden,“ erwiderte sie dann. „Ist ihm auch zu gönnen, jetzt, wo das Geschäft blüht.“
„So, so, das Geschäft blüht also,“ sprach er dann weiter, gewissermassen vor Aufregung zerstreut. „Na ja, da draussen wächst das Obst auch besser. Mehr frische Luft, auch mehr Wasser, als hier in der Frobenstrasse. Wiederum aber, siehst du ... Was kosten denn jetzt die besten Pflaumen bei ihm? Ich esse sie so gern, du weisst es.“
Sie lachte. „Er verkauft doch nur eingemachte Früchte. Mit den frischen Pflaumen ist’s vorüber.“
„So, so, mit frischen Pflaumen ist’s vorüber. Aber, liebe Pauline, das weiss ich doch selbst. Ich meinte ja auch die andern ... Man könnte ihn doch eigentlich in Nahrung setzen, aber wiederum, wenn ich bedenke, wie wir miteinander stehen ... Das heisst, mein Kollege Pfau hat mich darauf gebracht, er möchte gern ein Quantum billig beziehen.... Hat deine Schwester, als sie zuletzt hier war, nichts besonderes gesagt? Gar nichts besonderes? Nein?“ Und nach einem Kopfschütteln seiner Frau: „Das heisst, es interessiert mich durchaus nicht ... durchaus gar nicht, aber wenn man ein Buch ‚Über das Mitleid‘ geschrieben hat, siehst du, in dem sich so ein grosser Schatz erschöpfender Worte und Gedanken befindet, dann, siehst du, kommt man sich abgeklärter vor, zur Versöhnung geneigter, und doch muss ich wiederum sagen, dass dein Schwager —. Hat er denn etwas gegen mich?
„Aber nicht das geringste, Männe. Du warst doch immer derjenige, welcher —“
„So so, also er hat nichts gegen mich, und ich war immer derjenige, welcher —. Das sagst du! Aber wiederum ...“ Er unterbrach sich abermals. „Sag mal, Paulinchen, du hast doch auch mein Buch gelesen, und, wie ich dich kenne, gründlich gelesen. Hast du darin etwas vermisst, vielleicht ein bestimmtes, gebräuchliches Wort?“ Da er mit dem Essen fertig war, so rieb er sich die Nase, und als seine Frau verneinte, tat er es noch heftiger. „So so, also nichts vermisst. Dann danke ich dir, aber wiederum kann es vorkommen, dass selbst du, mit deinem Scharfsinn —. Übrigens, weisst du, könnte man ja deine Schwester bitten, die Bestellung an ihn zu machen ... Mahlzeit, liebes Kind ...“
Die vorletzte Instanz war für ihn erschöpft, er musste also die letzte suchen. Bis zum nächsten Nachmittag hielt er es noch aus, dann machte er sich auf den Weg, um Einkäufe zu besorgen, wie er sagte, eigentlich aber nur, um seinem Gelehrtengemüt die Ruhe zu verschaffen. Es war Winter und kalt, als er sich so durch den Weltstadttrubel schob, der mit seinem ewigen Auf und Nieder die Menschen flutenweise durch die Strassen trieb. Aber Johannes Murr sah und hörte nichts. Denn seine Gedanken verdichteten sich zu einem selbstsüchtigen Gelehrtenwahn, der sich inmitten dieser lebensfrohen Menge nur an tote Buchstaben klammerte. Das Wort, das eine Wort, das ihm fehlte! Er schritt dahin über den leise knirschenden, frisch gefallenen Schnee, vorüber an den bunten Schaufenstern, achtlos vorbei an flehenden Kindern, bittenden Frauen und Männern — er, der das grosse Buch „Über das Mitleid“ geschrieben hatte, in dem er bis zur christlichen Legende zurückgegangen war. Was waren ihm die Menschen, wo sein Werk nur zu ihm sprach!
Endlich bestieg er die Elektrische, und nach drei Viertelstunden hatte er sein Ziel erreicht. Er musste erst über einen grossen Hof schreiten, an allerlei Gerümpel vorbei, bis er an ein stallähnliches Gebäude kam, wohin ihn ein Mann verwiesen hatte. Und als er ohne Antwort auf sein Klopfen eingetreten war, schon draussen gelockt durch das Bellen eines Hundes und durch ein vielfaches Piepen und Tirilieren, genoss er einen seltsamen Anblick. Hermann Tipke, ein Mann noch in den besten Jahren, mit rundem Gesicht, in dem zwei kluge Augen manches zu sagen hatten, sass auf einer kleinen Bank inmitten des wohlig erwärmten Raumes, umringt von grossen und kleinen Vogelkäfigen, hatte eine junge Taube in der Hand und fütterte sie mit Erbsen, die er ihr vorsichtig in den Schnabel steckte. Singvögel machten einen heillosen Lärm, ein Rabe krächzte dazwischen und ein weisser Kakadu sprach unaufhörlich seine Brocken. Der Pudel jedoch, der eine verbundene Pfote hatte, humpelte vor seinem Herrn auf und ab, bellte ihn an und trieb sein Spiel mit der Taube, indem er nach ihr schnappte, was sich fast wie Spass ausnahm.
„Ei, Herr Professor! Welche Ehre für mich! Das ist aber —. Wirst du ruhig sein, Vagabund ... Darauf hört er nämlich am besten.“ Tipke erhob sich und lachte, denn er hatte den Pudel gemeint, der ihm sofort zu Füssen kroch.
„Guten Tag. Ich hätte gern Ihre Frau Gemahlin ...“
„Ach so, ach so! Sie ist vorn im Geschäft. Wenn sie das wüsste! Hier ist nämlich mein Reich, meine Erholungsbude für die Mittagsstunde, wissen Sie, Herr Professor. Diese Tiere sind meine ganze Freude. Eine kleine Passion ziert jeden Menschen ... So, Karlinchen, nun geh’ wieder in dein Stübchen.“ Damit schob er das Täubchen in das Holzbauer und verschloss es. „Sie ist nämlich eine Waise — seit gestern erst. Meine Frau hat ihrer Mutter den Hals umgedreht, zur Suppe für unser Jüngstes. Hinter meinem Rücken natürlich, denn so was kann ich nicht sehen ... Aber wollen Sie nicht, Herr Schwag —, Herr Professor ein wenig Platz nehmen? Sie rauben mir sonst die Ruhe.“
Johannes Murr, angenehm berührt von dieser offenen Freundlichkeit, erwog rasch, dass er jetzt am schnellsten an sein Ziel kommen würde, und so setzte er sich auf den alten Rohrstuhl, den der Schwager ihm zugeschoben hatte, und behielt Schirm und Hut in der Hand.
„Entschuldigen Sie, bitte, dass ich Sie bei Ihren Experimenten gestört habe,“ begann er würdevoll, mit einem grossen Blick im Kreise, unter dem die lieben Tierchen aber nicht verstummen wollten. „Ich habe da einen Auftrag meiner Frau zu erledigen, ja hm —, wiederum jedoch möchte auch ich ... Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier so?“ unterbrach er sich, weil er sich scheute, gleich auf sein Ziel loszugehen.
Tipke, der in einem zwar sauberen, aber ausgeblichenen Hausrock steckte und sich wieder bescheiden auf die Bank niedergelassen hatte, zeigte aufs neue seine kernigen Zähne, wobei die überroten Wangen sich blähten. „Ich beschäftige mich mit dem Mitleid, wie Sie, Herr Professor, nur auf andre Art. Ich übe es an lieben Tierchen,“ sagte er zwar einfach, aber doch mit einer kleinen Spitze, wie es den Schulmann dünkte. „Was glauben Sie wohl, wie mir dieser Pudel hier dankbar ist. Vor zwei Wochen hat er sich angefunden, mit zerquetschter Pfote, nun will er nicht mehr fort. Würd’ ich ebenso machen, wenn ich’s so gut hätte.“ Er lachte abermals. „Seinen Herrn kenn’ ich nicht, er kann ihn auch suchen, wenn er ihn haben will. Nicht wahr, Vagabund? ... Meine Frau lacht mich aus darüber, aber soll sie nur! Sie hat vorn mit den toten Früchten zu tun, ich hier mit den lebenden ... Aber jetzt sollen Sie zu ihr, Herr Professor. Sie werden doch unser Gast sein? Frau Gemahlin beehrte uns oft hier, aber nur zum Nachmittagskaffee, wissen Sie. Länger hält sie’s nicht aus — aus Furcht vor Ihnen. Aber es ist doch hübsch, dass auch Sie sich nun herablassen ...“ Diesmal lächelte er nur, aber die herzliche Laune sprach aus seinen Zügen. „Wir müssen erst überwinden, unsere eigenen Schwächen zuerst, ehe wir uns ganz erkennen.“
Der Professor hörte nur zerstreut zu. „Sagen Sie, mein Bester, Sie haben sich da mein Buch gekauft ... Um kurz zu sein, wie heisst denn das Wort, das Sie meinten?“
Tipke lächelte pfiffig. „Ich sagte es ja soeben, Herr Professor, — das Wort, das allein selig macht und das Sie zu mir hergetrieben hat ... oder sagen wir lieber: unbewusst gedrängt hat: nämlich überwinden. Wir müssen alles überwinden, was Böses in uns schlummert: den Hass, den falschen Stolz, den Hochmut, die Selbstsucht und den Eigendünkel. Es gibt kein Mitleid ohne Überwindung, denn wenn wir es üben sollen, so müssen wir erst mitleiden, das heisst, die Vorstellung in uns erwecken, wie uns zu Mute sein würde, wenn wir in die Lage andrer kämen. Und diese Tür zum Mitleid haben Sie in Ihrem schönen Gebäude vergessen. Nichts für ungut, Herr Professor.“
Breit und frisch stand er vor ihm, wie eine kernige Frohnatur, die im Ernste noch den Scherz erblickt. Er hatte den schwarzen Pudel auf die Bank gehoben und kraute ihn nun am Kopf. „Er kam total beschmutzt zu mir, fast mit Kot bedeckt, getreten und zerschunden. Wie hätte ich ihm helfen können, wenn ich nicht erst die Scheu vor ihm überwunden hätte ... Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie sozusagen auch vor mir —.“ Er blickte an sich herab. „Aber nicht aus Mitleid, Gott bewahre! Darum möcht’ ich bitten.“
Der Professor sah zu Boden und sann nach, aber nicht im Sinne des andern. Was ihn allein im Augenblick bewegte, war der Ärger über die Lücke in seinem Wortgedächtnis. Er war und blieb der Gelehrte bis zum Ende. Dann aber dämmerte ihm doch, dass hier ein Denker gewisser Art vor ihm stehe, sozusagen ein Mitdenker seines Faches, der seinen besonderen Dank verdiene. Ohne Geziertheit reichte er ihm die Hand und sagte: „Sie haben recht, ja, Sie haben recht! Das Wort war mir entgangen, ganz und gar entgangen! Gut, dass bald die zweite Auflage nötig sein wird. Wiederum jedoch muss ich dabei betonen, dass ich eigentlich hierher gekommen bin, um —. Ich wollte nämlich Früchte kaufen, und dann, ja dann könnten wir uns ... bei dieser Gelegenheit ... eigentlich vertragen. Sie kaufen Bücher, meine Bücher sogar. Das rührt mich fast. Merkwürdig, wie man sich in einem Menschen täuschen kann! Ich bitte um Verzeihung, vielmals um Verzeihung für meine falsche Auffassung ... Pauline wird sich freuen. Sie müssen jetzt öfters meine Bücher lesen, d. h., Sie könnten sie eigentlich persönlich von mir —.“
Nochmals schüttelte er ihm die Hand. Und ganz von dem Gedanken an die Verbesserung in der neuen Auflage erfüllt, ging er vergnügt mit ihm in die Wohnung.