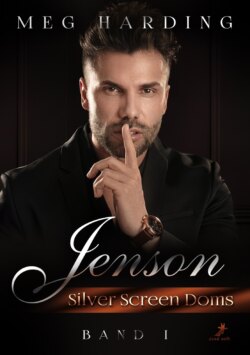Читать книгу Jenson - Meg Harding - Страница 9
Kapitel 4
ОглавлениеJenson erkannte eine Panikattacke, wenn er sie sah, und dieser Junge war mitten im absoluten Meltdown.
„Hey, hey, alles wird gut.“
Er legte seine Hand auf seine Schulter und griff fest zu, um Trost zu bieten, aber ihm nicht wehzutun.
„Alles wird gut. Du musst für mich atmen.“
Der Typ keuchte wie eine Dampfmaschine, und sein Schoß glitzerte voller Glassplittern aus seinem zerbrochenen Fenster und möglicherweise einigen von Jensons Fenstern. Er umklammerte immer noch das Lenkrad. Jenson würde ihn nicht bewegen können, bis er sich beruhigt hatte.
Der arme Junge zitterte so heftig, dass Jenson über das Keuchen hinweg hören konnte, wie seine Zähne klapperten.
„Also schön“, murmelte er. Er griff nach dem Kinn des Jungen und drehte sein Gesicht zu sich, damit sich ihre Blicke trafen. Im schwachen Licht konnte er nicht viel von dem Gesicht des Jungen ausmachen, nur dass es schmal und gespenstisch blass war, seine Augen riesig wie Untertassen, seine Nasenlöcher gebläht wie bei einem Stier. „Ich werde einen Atemzug nehmen, und du wirst mitmachen. Dann werden wir das wiederholen. Hör nicht auf, bis ich es sage. Tu genau das, was ich tue.“
Er machte sich keine Sorgen darüber, dass jemand sie unterbrechen könnte. Er hatte seine Freunde mit der Anweisung zurückgelassen, alle wieder in ihre Häuser zu scheuchen und alle neugierigen Nachbarn abzuwehren.
Jenson machte tiefe, gleichmäßige Atemzüge vor. Es dauerte ein paar Versuche, aber schließlich begann der Mann neben ihm, mit ihm zu atmen. Sein Schlottern ließ nach. Der Todesgriff am Lenkrad wurde lockerer. Die Sehnen in seinem Hals waren weniger angespannt, da Luft es tatsächlich in seine Lungen schaffte.
„Na siehst du. Das ist gut. Weiter so“, ermutigte Jenson den Jungen.
Und der tat es. Er starrte direkt in Jensons Augen. Die des Jungen waren große dunkle Seen von einer Farbe, die, wie Jenson vermutete, blau sein könnte, wenn die Pupillen kleiner waren.
„Wir werden jetzt versuchen, dich hier rauszuholen, okay? Du wirst mir folgen, und du wirst mir sagen, ob dir irgendetwas wehtut.“
Es gab keine sichtbaren Verletzungen, und zum größten Teil vermutete Jenson, dass keine mehr auftauchen würden, als der sichtbar überwältigende Schock und die Panik. Das war mehr als genug.
Cleo erschien hinter seiner Schulter.
„Brauchst du Hilfe? Ist er okay?“
„Ich will ihn hier herausholen. Er steht unter Schock und er hat Glas im Schoß.“
„Will er immer noch keinen Krankenwagen?“
Jensons Blick glitt zu dem Jungen, um zu sehen, wie seine Augenbrauen sich zusammenzogen, und seinen Gesichtsausdruck veränderte. Er schüttelte den Kopf, dann stöhnte er. Eine seiner Hände verließ das Lenkrad, um gegen seine Stirn zu drücken.
„Keinen Krankenwagen.“
„Hast du dir den Kopf angeschlagen?“, fragten Cleo und Jenson zeitgleich.
„Nein, es tut weh wegen der Panikattacke.“ Er verzog das Gesicht. „Mir geht's gut. Nichts kaputt.“ Sein Ausdruck fiel plötzlich in sich zusammen. „Das mit deinem Auto tut mir so leid.“
Jenson spürte die Luft von Cleos überraschtem Laut an seinem Hals. Er seufzte. „Junge, das Auto ist mir scheißegal. Es ist okay.“
Seinem Ausdruck nach zu urteilen, glaubte er das nicht einmal im Ansatz.
Zusammen halfen Cleo und Jenson ihm aus dem Auto, indem sie ihn sorgfältig manövrierten, damit das Glas nirgends in ihm stecken blieb. Jenson schlang einen Arm um seine Taille, als er frei war. Er konnte spüren, dass der Junge zögerte, sich an ihn zu lehnen, aber nicht die Energie hatte, allein zu stehen.
Ben und Dylan warteten vor dem Auto. Die Straße war frei von Nachbarn, obwohl Jenson mehr als ein paar Vorhänge hin und her zucken sah. Er verdrehte die Augen. Die Leute waren so verdammt neugierig. Der Unfall wäre morgen sicher in allen Prominachrichten und wurde wahrscheinlich schon auf Facebook oder YouTube gestreamt.
Dylan folgte Jensons Blick und sah finster drein. „Tut mir leid“, sagte er schulterzuckend. „Wir haben’s versucht.“
„Es ist in Ordnung.“ Es gab wirklich nichts anderes zu tun. „Bringen wir ihn rein und holen einen Abschleppwagen für die Autos.“
Ben und Dylans Augenbrauen verschwanden praktisch in ihren Haaren. Jenson konnte Cleo nicht sehen, aber er vermutete, dass ihre Reaktion ähnlich ausfiel. Er schüttelte den Kopf. Er würde nicht darüber diskutieren, nicht jetzt.
Die Freunde wechselten einen Blick, dann führte Ben den Weg zum Haus, die anderen folgten ihm. Der Junge zog sich von Jenson zurück in seinen eigenen Raum, während sie liefen. Dabei waren seine Schritte wackelig und er wrang den ganzen Weg über die Hände. Er war ein zierlicher Kerl, der sich vorsichtig hielt, die Schultern gebeugt, um den Anschein zu geben, noch kleiner zu sein. Kleiner, als er es eh war und zu dünn, als dass es gut für ihn war, obwohl davon ausging, dass er einmal schlank und muskulös gewesen war. Seine Klamotten saßen etwas zu locker, hatten vielleicht einmal gut gepasst.
Da war etwas an ihm …
Was auch immer es war, es war nicht Jensons Angelegenheit. Selbst, wenn der Junge sein Auto ernsthaft beschädigt hatte. Er würde ihn heute Nacht etwas aufpäppeln und dann seines Weges schicken. Jenson konnte ihn nicht mit gutem Gewissen in dem Zustand allein lassen, in dem er gerade war. Kein Dom, der etwas auf sich hielt, hätte das getan.
Seinem Ausdruck nach zu urteilen, schien der Junge zu denken, er sei ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde, als sie hineingingen. Er schrak zusammen, als die Haustür hinter ihnen zufiel. Sein Blick ruckte hin und her und seine Pupillen waren immer noch stark geweitet. Er atmete immer noch viel zu heftig. Im Licht des Eingangsbereichs war sein Gesicht papierweiß, bis auf die blühenden roten Flecken auf seinen Wangen. Seine Unterlippe war geschwollen, seiner oberen Zähne zeichneten sich deutlich auf der rissigen Haut ab. Sein Haar war ein kupferroter Heiligenschein um seinen Kopf herum und umgab in unordentlichen Locken sein Gesicht. Als er bemerkte, dass sie ihn ansahen, schlang er seine Arme schützend um seinen Oberkörper, und Jensons Brust schmerzte.
„Komm schon. Lass uns hinsetzen. Dylan, kannst du ihm ein Wasser besorgen?“
Dylan ging weg, doch ihr Gast machte keine Anstalten, sich zu bewegen. Er starrte Jenson an, der Mund offenstehend. Als Jenson seinen Kopf neigte, um seine Absicht klarzumachen, zuckte der Junge zusammen.
„Oh. Oh, nein“, sagte er. „Ich … ich brauche nichts.“
Jenson unterdrückte ein Seufzen. Was glaubte dieser arme Junge, was sie ihm antun würden? „Hör mal, Junge, wenn du uns nicht einen Krankenwagen rufen lässt, dann lass uns wenigstens selbst sicherstellen, dass es dir gut geht. Du kannst das eine oder das andere haben, aber wir lassen dich nicht einfach so weiterziehen. Du stehst unter Schock.“
Stumm und ohne weitere Anzeichen von Protest erlaubte er Jenson, ihn ins Wohnzimmer zu führen und ihn zu dem großen, bequemen Sofa dort zu manövrieren. Cleo und Ben nahmen ebenfalls Platz, gaben ihm jedoch in weiser Voraussicht ein paar Meter Platz. Dylan kehrte mit dem Wasser zurück und stellte es auf den Beistelltisch und nahm den Platz neben Ben auf der gegenüberliegenden Seite der Couch ein. Jenson zog eine Ottomane herüber und setzte sich zu den Beinen des Jungen.
Er wartete einen Moment und gab dem Jungen die Chance, die Initiative zu ergreifen, bevor er in Richtung der Flasche Wasser nickte.
„Das solltest du trinken.“
Der Junge nahm zuerst zögerliche, winzige Schlucke und dann größere Schlucke. Die Flasche war in einer Minute leer und der Kunststoff knirschte in seinen unruhigen Händen. Er trug Jeans und eine leicht verblasste, armeegrüne Jacke sowie ein Paar schwarze Chucks. Das Ensemble ließ ihn noch jünger aussehen. Jenson schätzte, er mochte um die zwanzig sein. Wahrscheinlich ein armer College-Junge, der sich das Chaos nicht leisten konnte, in dem er gerade gelandet war.
„Wie heißt du?“, fragte er.
Der Junge sah zwischen allen hin und her und dann zurück zu Jenson. Er leckte sich über die Lippen, seine Finger zuckten um die Flasche.
„Ich bin Mitchell. Es …“
„… tut dir wirklich leid wegen des Autos?“, riet Jenson absolut verwirrt.
Er hatte Leute gesehen, die versuchten, sich aus ähnlichen Situationen herauszuwinden, aber nie so etwas erlebt. Keine so pure Ehrlichkeit und echtes Bedauern. Sobald sie erkannten, wer Jenson war, hörten sie auf, sich um das zu kümmern, was sie getan hatten, und begannen sich darum zu kümmern, was er tun konnte.
Mitchell nickte ernsthaft.
„Das tut es mir auch. Ich wollte das nicht, ich schwöre es. Ich habe den Hund gesehen und wollte ihn nicht anfahren. Ich bin einfach auf die Bremse getreten. Ich habe nicht nachgedacht.“ Seine Unterlippe zitterte und er biss zu, seine Nasenlöcher blähten sich, als er scharf ausatmete. Er zitterte nicht, als er weitersprach. „Ich werde … ich bezahle, um dein Auto zu reparieren. Ich meine, ich habe keine Versicherung.“ Er zuckte zusammen. „Und ich kann nicht sofort bezahlen.“
Jenson öffnete den Mund, um zu protestieren. Er hatte mehr als genug Geld, er konnte sein eigenes Auto reparieren, ohne ein kaputtes College-Kind pleitegehen zu lassen, aber Mitchell hielt seine Hand hoch.
„Ich kann in Raten zahlen. Wenn das okay ist. Bitte.“
Jenson rieb sich das Kinn, sein Blick glitt zu seinen Freunden, die ebenso überrascht aussahen. Er konzentrierte sich auf Mitchell. Wenn das jemand anderes gewesen wäre, hätte er Anzeige gemacht und seine Versicherung würde sich darum kümmern. Aber …
„Mitchell, es ist wirklich nicht nötig. Ich verstehe, dass das ein Unfall war.“
Man konnte es Intuition nennen. Etwas an Mitchell ließ Jensons aufhorchen, seit er ihn aus dem Auto gezogen hatte. Er würde sein Geld nicht annehmen. Da steckte mehr dahinter, als er sehen konnte.
Er erwartete nicht, dass Mitchells die Stirn runzelte, sein Gesichtsausdruck sich verzerrte, Emotionen flackerten wie in einem Kaleidoskop. Die Tränen folgten plötzlich, völlig still, Mitchells Lippen pressten sich so fest zusammen, dass sie alle Farbe verloren. Jenson zuckte tatsächlich zurück, bevor er sich wieder fasste, lehnte sich dann nach vorne und schob seine Hände zwischen die Knie, damit er den Jungen nicht ohne Erlaubnis anfasste.
„Mitchell, ich kapier’s nicht. Bist du verletzt?“
Mitchell schüttelte den Kopf. Die Tränen strömten weiter. Seine Atmung fing an, wie ein Teekessel zu klingen, der pfiff. Er nickte.
Cleo erschien an Jensons Seite.
„Wir gehen in die Küche.“ Sie gab ihm einen wissenden Blick. Er wusste, was das bedeutete. Sie hat das Gleiche gesehen, was er gesehen hat.
Jenson bewegte sich von der Ottomane auf die Couch und ließ ein Stück Raum zwischen sich und Mitchell. Der Junge zitterte, sein ganzer Körper schlotterte hart genug, um es auf der Couch zu spüren.
„Ich werde meine Hand auf deinen Rücken legen, okay?“ Das brachte ihm ein weiteres Nicken. Die Tränen fingen an, von seinem Kinn auf seine Jacke zu tropfen.
Sogar durch die Kleidungsschichten hindurch konnte Jenson spüren, dass Mitchell angespannt war wie ein Brett. Aber nun ja, jeder, der ihn für eine Sekunde ansah, konnte das merken. Er rieb seine Hand von Mitchells oberer Wirbelsäule bis nach unten und wieder nach oben. Er sprach nicht. Langsam ging die Stille in ein Keuchen über, erstickte Laute, die Mitchell dazu brachten, sich vorzubeugen, als er versuchte, sein Gesicht zu verstecken.
Jenson rieb ihm weiter über den Rücken.
Die ganze Sache war roh, und Jenson spürte, wie die Tränen in seinen eigenen Augenwinkeln brannten. Mitchells Körper schüttelte sich vor Anstrengung und schmerzvolles Wimmern mischte sich unter die Geräusche.
Jenson schob seine Hand in Mitchells Nacken und drückte leicht. „Das reicht jetzt, Mitchell.“
Der hartnäckige Junge schüttelte den Kopf.
Jensons Lippen zuckten in einem kleinen Lächeln. Mitchell hatte wahrscheinlich keine Ahnung, aber tief in ihm wartete ein Brat darauf, ans Licht zu kommen. Der schmerzlich vernachlässigte Sub musste jedoch in erster Linie betreut werden. Das war ein Junge, der ernsthafte Aufmerksamkeit brauchte – die Art von Aufmerksamkeit, von der Jenson sehr bezweifelte, dass er sie jemals erhalten hatte.
Die Schluchzer hatten sich zum Schniefen gewandelt. „Komm her.“
Mitchell hielt sein Gesicht mit seinen Händen bedeckt. „Ich bin schon hier.“
„Hat dir jemals jemand gesagt, dass Umarmungen alles wiedergutmachen?“
Mitchells Hände bewegten sich nach unten und beinahe verblüfft sah er Jenson an. „Meine Mutter, als ich fünf war.“
„Es funktioniert auch für Erwachsene. Also komm her.“ Jenson streckte einen Arm aus. Mitchell blinzelte; er hatte große, blassgrüne Augen. Jenson hatte falsch geraten. Doch nicht blau. Sie waren sogar noch wunderschöner.
„Das kann nicht dein Ernst sein.“ Seine Stimme klang brüchig und rau, war kaum mehr als ein Flüstern.
„Oh, doch, das ist es.“
„Du kennst mich nicht mal.“
Wieder fragte sich Jenson, was dieser Junge durchgemacht hatte, dass er durch das Angebot einer Umarmung so niedergeschlagen wurde. „Man sollte niemanden kennen müssen, um Trost zu bieten. Probier es einfach aus. Ich verspreche, du wirst dich besser fühlen.“
Mitchell ruckte vorwärts, dann hielt er inne. Er wischte seine Nase an seinem Jackenärmel ab, blickte misstrauisch. „Willst du Sex, um das, was ich mit deinem Auto gemacht habe, wiedergutzumachen?“
„Jesus Christus, nein“, sagte Jenson entsetzt. „Das würde ich nie tun. Es ist eine Umarmung. Nur das. Keine unangemessenen Berührungen.“
Sein Magen rumorte bei dem Gedanken, dass Mitchell überhaupt auf die Idee kam, eine solche Frage zu stellen.
„Okay.“
Er kam näher und lehnte sich zögerlich an Jenson. Jenson schlang seinen Arm locker um Mitchells Schultern und zog ihn an sich, damit Mitchell das Heben und Senken seiner Brust spüren und damit beginnen konnte, gleichzeitig mit ihm zu atmen. Während die Minuten vergingen, wurde Mitchell entspannter, sein Kopf ruhte auf Jensons Schulter, sein Atmen ging noch etwas rau, aber nicht mehr zu schnell. Als Jenson einige Zeit später auf sein Gesicht blickte, waren Mitchells Augen geschlossen und er schlief tief und fest.
„Also, was machen wir mit dem Sub auf der Couch?“, fragte Ben, die Sorge in seinen weichen braunen Augen offensichtlich.
In solchen Momenten liebte Jenson seine Freunde mehr denn je. So leicht hätte Ben fragen können, was Jenson tun würde, denn schließlich war das nicht jemand anderes Situation. Aber sie steckten zusammen darin, und sobald sie jemanden in Not sahen, agierten sie als Gruppe.
Sie waren um Ben und Dylans Kücheninsel versammelt, Dylans Arme um Bens Taille geschlungen, sein Kinn ruhte auf Bens Kopf. Ben hielt einen Becher heißer Schokolade in den Händen, während der Rest von ihnen Wein vor sich stehen hatte. Es war fast Mitternacht. Dylan hatte sie zum Abendessen eingeladen und zum Abhängen, eine Chance, sich endlich wieder einmal auszutauschen, da Jenson und Cleo nach langen Abwesenheiten wieder in der Stadt waren. Sie unterhielten sich im Wohnzimmer, tauschten Arbeitsgeschichten aus und gaben einander allgemeine Lebensaktualisierungen, als der Tumult draußen ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.
Zu sagen, dass der Sub das Letzte war, was Jenson erwartet hatte, war eine Untertreibung epischen Ausmaßes.
Zuerst war da ein Blitz von Ärger wegen seines Autos – es war ganz neu. Er hatte es kaum zwei Wochen gehabt. Aber als der Fahrer aus dem anderen Fahrzeug nicht herauskam, hatte Sorge eingesetzt. Und als Jenson zur Vorderseite des Autos gelaufen war und die Panikattacke sah, die der Junge hatte, hatte sein Instinkt übernommen.
Er zog sein Glas am Stiel zu sich heran und beobachtete, wie die Flüssigkeit schwankte. „Ich weiß es nicht“, gab er zu. „Es gibt keine Garantie, dass er wirklich ein Sub ist.“
Ben hob eine Augenbraue. „Ich hacke meinen rechten Arm ab, wenn er es nicht ist. Du hast ihm nur das kleinste bisschen Freundlichkeit gezeigt und es gab eine Explosion. Bumm. Überall Emotionen. Ein totaler Meltdown. Das ist ein ernsthaft vernachlässigter Sub.“
Dylan lächelte, grub sein Gesicht in Bens braune Haare und drückte einen Kuss auf seinen Kopf. Er rieb seine Wange an ihm und schmiegte sich an ihn.
„Ich stimme Ben zu. Er bringt was bei mir zum Klingeln, und ich kann verdammt gut sehen, dass er dasselbe mit deinen macht.“
Jenson zuckte mit den Schultern und neigte seinen Kopf in stummem Einverständnis. Er konnte es nicht abstreiten.
„Cleo?“
„Oh, mehr Sub geht gar nicht. Es strahlt von ihm aus. Du sagst ihm, was er tun soll, und die Spannung fließt aus seinem Körper raus.“ Sie nahm einen langsamen Schluck von ihrem Wein. „Aber er weiß nicht, warum. Ich meine, ich schätze, er hat es wahrscheinlich noch nicht bemerkt. Also gibt es hier einen sehr grauen Bereich, in dem wir vorgehen.“
Sie hatte seine Gedanken perfekt in Worte gefasst.
„Ich stimme zu. Es gibt eine Grenze dazwischen, ihm zu helfen und ihn auszunutzen. Ich habe mir heute Abend nicht viel dabei gedacht – ich folgte meinem Instinkt, um ihn so schnell und sicher wie möglich zu beruhigen. Aber was machen wir mit ihm in Zukunft? Ist das wirklich unsere Angelegenheit?“
Ben war absolut ungläubig. „Ja!“
Dylan drückte ihn. „Ben …“
Ben drehte sich in seinem Griff und wandte sich Jenson zu. „Wenn wir einen wie uns in Not finden, ob sie es wissen oder nicht, helfen wir ihnen. Wir klären sie auf. Du kannst ihn nicht einfach schlafen lassen und ihn dann mit einem Es ist okay, mach dir keine Sorgen wieder nach draußen schicken! Das ist Blödsinn!“
„Ben!“ Dylans Stimme war scharf.
„Es tut mir leid, Sir“, sagte Ben. „Ich hätte nicht verfluchen sollen.“ Sein Adamsapfel zuckte, als er hart schluckte. „Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Wir haben die Pflicht, ihm zu helfen. Er ist in unsere Arme gefallen. Es ist Schicksal.“
Jenson glaubte nicht an das Schicksal, aber er wusste, dass es ein wichtiges Konzept für Ben war, sodass er es nicht in den Dreck ziehen wollte. Er trommelte mit seinen Fingern auf die Arbeitsplatte und dachte an Mitchell. Er hatte den Jungen auf der Couch gelassen und eine der kuscheligen Decken, die Ben und Dylan besaßen, über ihn gelegt, um ihn warmzuhalten. Mitchell hatte sich darunter zu einem Ball zusammengerollt, seine Finger hatten sich in den Stoff gegraben, aber er war nicht aufgewacht. Da waren dunkle Ringe unter seinen Augen, und er zuckte im Schlaf. Unruhig. Jenson hatte dem Drang widerstehen müssen, seine kupferroten Locken aus seinem Gesicht zu entfernen und glattzustreichen.
„In Ordnung“, sagte er zu Ben. „Was genau, glaubst du, sollten wir tun?“