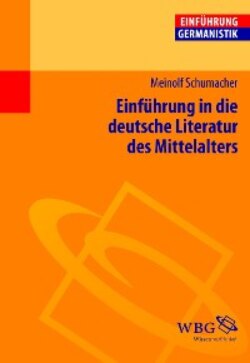Читать книгу Einführung in die deutsche Literatur des Mittelalters - Meinolf Schumacher - Страница 7
ОглавлениеII. Forschungsbericht
1. Phasen der Rezeption mittelalterlicher Literatur vom Humanismus bis zur Postmoderne
Humanistisches Interesse an volkssprachiger Literatur
Obwohl die Humanisten verächtlich auf das von ihnen ‚erfundene‘ Mittelalter herunter schauten, haben sie sich doch intensiv und zum Teil erstaunlich wohlwollend mit seiner Literatur befasst. Das gilt nicht nur für die mittellateinische Dichtung, von der etwa Jakob Wimpfeling 1503 die Kreuzgedichte des Hrabanus Maurus (De laudibus sanctae crucis) aus dem 9. Jh. im Druck herausgab und Konrad Celtis 1501 die Dramen der Hrotsvit von Gandersheim aus dem 10. Jh. erstmals der literarischen Öffentlichkeit zugänglich machte. Es gilt auch für die volkssprachige Dichtung, und zwar gerade für die älteste: So setzt die wissenschaftliche Beschäftigung mit der mittelalterlichen deutschen Literatur wohl mit der ersten Gesamtausgabe von Otfrids von Weißenburg Liber evangeliorum durch Matthias Flacius Illyricus (Basel 1571) ein. Melchior Goldast edierte 1604 erstmals mhd. Lieder, darunter solche von Walther von der Vogelweide, und Martin Opitz publizierte 1639 das Annolied. Diese gelehrt-humanistische Editionstätigkeit lässt sich nicht immer leicht unterscheiden von der gleichzeitig zu beobachtenden Weitertradierung mittelalterlicher Texte, die eher als produktive Kontinuität aufzufassen ist denn als wissenschaftliche Wiederentdeckung: Sebastian Brants bebilderte Druckausgabe von Freidanks Spruchsammlung Bescheidenheit (Straßburg 1508) ist ein solcher Grenzfall. Auch monumentale Handschriftenprojekte vom Beginn des 16. Jh.s wie das Ambraser Heldenbuch (Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. Ser. nova 2663), das als einziger Kodex den Erec von Hartmann von Aue überliefert, zeugen vielleicht von einem bereits antiquarischen Interesse an der mittelalterlichen Dichtung, können jedoch nicht schon als frühe germanistische Texteditionen gelten. Obwohl an den Höfen weiterhin repräsentative Handschriften entstanden, galt im 16. und 17. Jh. zunehmend, dass von der mittelalterlichen Literatur nur noch dasjenige allgemein bekannt war, was im Druck vorlag. Dies führte zu Verschiebungen im literarischen Kanon (RLW s.v. Kanon): Während viele bedeutende Minnesänger in Vergessenheit geraten waren, überboten sich (spät-)humanistische Gelehrte im Lob von mhd. Lehrgedichten wie dem Winsbecke und der Winsbeckin, welche durch die erwähnte Edition von Goldast verbreitet wurden. Die Hochschätzung gerade dieser Dialoge zwischen Vater und Sohn bzw. zwischen Mutter und Tochter macht deutlich, dass das Interesse an der mittelalterlichen Dichtung in dieser Zeit weniger ästhetisch motiviert war. Man schätzte vielmehr die ethisch und sprachlich hoch stehende Literatur der alten ‚Deutschen‘, die für das Herausbilden einer nationalen Identität zunehmende Bedeutung gewann. Dazu gehörte auch der Versuch, das zeitgenössische Entstehen des (erst am Ende des 18. Jh.s dann auch so genannten) Konzepts „Nationalliteratur“ in die ferne Vergangenheit zurück zu projizieren. So bringt etwa Christian Gryphius (Der Deutschen Sprache unterschiedene Alter und nach und nach zunehmendes Wachsthum, 1708) Autoren wie Otfrid von Weißenburg und Hrabanus Maurus als Figuren auf die (Schul-)Bühne, um mit Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen über die Begründung einer deutschen Literaturgeschichte durch Otfrids Evangelienbuch zu beraten.
Altdeutsches in der Aufklärung
Die deutsche Liebeslyrik des Barock (RLW s.v. Barock) griff kaum je auf deutsche Minnelieder, sondern vor allem auf zwar ebenfalls mittelalterliche, allerdings italienische Lyriktraditionen zurück (RLW s.v. Petrarkismus) zurück. Dies mag auch daran liegen, dass im 17. Jh. nur ein geringer Teil der mhd. Dichtung gedruckt war. Das änderte sich im 18. Jh. grundlegend durch wichtige Textausgaben wie der Samlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und XIV. Jahrhundert (3 Bde., 1782–87) von Christoph Heinrich Myller, die viele epische und lyrische Werke erstmals (oder erstmals vollständig) im Druck präsentierten. Gegen Ende des Jahrhunderts waren dem Lesepublikum wohl alle wichtigen alt- und mhd. Dichtungen in Ausgaben oder Bearbeitungen zugänglich. Man hat sie allerdings nicht immer einhellig begrüßt. Berüchtigt ist die Äußerung des Preußenkönigs Friedrich des Großen, dem die Ausgabe von Myller gewidmet war, dergleichen elendes Zeug sei nicht einen Schuß Pulver werth und verdiene es nicht, aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu werden (Brief an Myller vom 22. Febr. 1784). Wo sich hingegen intensives Interesse zeigte, konnte es recht unterschiedlich ausgerichtet sein. Johann Christoph Gottsched etwa setzte die Sammeltätigkeit der humanistischen Gelehrten fort, die er jedoch systematisierte. Seinem rationalistisch-aufklärerischen Literaturverständnis gemäß konzentrierte er sich auf die didaktische und satirische Dichtung des Mittelalters; so wurde die Beschäftigung mit dem Reineke Fuchs zu einem seiner Lebensthemen. Gottscheds großer Antipode, der Zürcher Johann Jakob Bodmer, hob das ästhetische Vergnügen an mittelalterlichen Texten hervor und ließ gegenüber dem aufklärerischen Postulat der literarischen „Wahrscheinlichkeit“ auch das „Wunderbare“ etwa der Gralsromane gelten (RLW s.v. Wahrscheinlichkeit). Er modifizierte jedoch diejenigen Texte der mhd. Epik, die nicht seinen (wirkungs-)ästhetischen Konzeptionen entsprachen, indem er z.B. Wolframs Parzival in Hexameter umschrieb (Der Parcival, 1753) oder vom Nibelungenlied nur den zweiten Teil veröffentlichte (Chriemhilden Rache, 1757). Mit der Entdeckerfreude war das Bedürfnis verbunden, das Entdeckte neu zu beleben. So diente Bodmers Publikation von mhd. Liebeslyrik der Stauferzeit (Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpuncte, 2 Bde., 1758/59) auch dem Zweck, auf die Dichtung der eigenen Zeit Einfluss zu nehmen. Man schuf eine Tradition, um daran anknüpfen zu können. Das taten dann vor allem Dichter aus dem Freundeskreis um den „Göttinger Hain“. Dort wurde „Bodmer, der Held von Zürich“, von Johann Heinrich Voß für die Tat gepriesen, die alten Lieder gleichsam dem Grabe entrissen zu haben, weshalb sie nun durch Autoren wie Johann Martin Miller und Ludwig Christoph Heinrich Hölty neu erklingen könnten. Bei Voß wird zugleich deutlich, welches Motiv hinter der Mittelalternachahmung der Hainbündler steht – man will die romanische Prägung der deutschen Literatur zurückdrängen: „es flieht / Eitler Franken Getändel / Und ausonisches Gaukelspiel!“ (Der deutsche Gesang). Neben dieser patriotisch-nationalistischen Abwehrhaltung gehört zum Komplex „Bodmer und die Folgen“ (Volker Mertens) im 18. Jh. auch die Betonung des vermeintlich Natürlichen der mittelalterlichen Dichtung, die frei von gelehrt-rhetorischem Kalkül gewesen sein soll. Dieses (vor allem durch Rousseau geprägte) Ideal sah man nicht nur bei Homer und Shakespeare, sondern auch im Mittelalter realisiert. Zugleich rückte man den Minnesang in die Nähe der damals beliebten Anakreontik (RLW s.v Anakreontik). In dem Bestreben, „die Einfalt der Empfindungen unserer Minnesinger zu erreichen“ (Brief an Anna Louisa Karsch vom 30. Aug. 1773), dichtete Johann Wilhelm Ludwig Gleim im Stil der Anakreontik etwa 70 Lieder nach (Gedichte nach den Minnesingern, 1773, und Gedichte nach Walter von der Vogelweide, 1779). Der Beginn der kreativen Mittelalterrezeption in der neueren deutschen Literatur beruht somit auf einem zweifachen Missverständnis. Zeigt doch gerade der Minnesang mit seinen Rückgriffen auf provenzalische und französische Vorbilder, dass die ältere deutsche Dichtung keineswegs als besonders ‚deutsch‘ angesehen werden kann, wie auch die Formelhaftigkeit und Topik seiner Rollenlyrik beweist, dass es sich nicht um natürliche‘ oder besonders volksnahe Dichtung handelt. Das jeweils genaue Gegenteil ist der Fall. Dennoch ziehen sich diese Stichworte ‚deutsch‘ bzw. ‚natürlich/volkstümlich‘ hartnäckig durch die weiteren Epochen hindurch.
Die Mittelalter-Projekte der Romantiker
So problematisch es auch ist, die mittelalterliche Literatur als eine ‚natürliche‘ Volksdichtung zu begreifen, so hat doch gerade diese Vorstellung das Mittelalterbild des 19. Jh.s bestimmt. Das aus dem Sturm und Drang (RLW s.v. Sturm und Drang) stammende Konzept der Volkspoesie und speziell des Volkslieds (RLW s.v. Volkslied) sowie der von Johann Gottfried Herder der ‚Kunstpoesie‘ entgegen gestellte Begriff der ‚Naturpoesie‘ kamen den Autoren der frühen Romantik (RLW s.v. Romantik) sehr entgegen. Ähnlich wie in Märchen, Mythen und Sagen sahen sie in Minneliedern ihre „Sehnsucht nach der Natürlichkeit“ erfüllt – wie es Ludwig Tieck in der „Vorrede“ seiner Minnelieder aus dem Schwäbischen Zeitalter (1803) formulierte, in der er sich zugleich gegen „den Glauben an die Barbarey des sogenannten Mittelalters“ wandte. Vergleichbar den anakreontischen Bearbeitungen hob Tieck die angeblich „ungesuchte, einfältige Sprache (…), dieses reizende Tändeln“ der Minnesänger im Umgang mit dem Erotischen hervor; im Unterschied zu Gleim, der den Sinn der alten Lieder mit neuen Worten zu treffen versucht hatte, bewahrte Tieck jedoch möglichst viel an mittelalterlichen Sprachformen. So passte er oftmals nur einige Lautentwicklungen zum Neuhochdeutschen (Diphthongierung, Monophthongierung) hin an und ließ alles andere (z.B. veraltete Konstruktionen, ausgestorbene Wörter) unverändert, wodurch eine archaisierende Sprache entstand, die authentisches‘ Mittelalter evozieren sollte und die für viele spätere Texte der literarischen Mittelalterrezeption charakteristisch wurde. Der patriotische Aspekt kommt nach 1800 zunächst weniger in der Dichtung zum Ausdruck als in der sich gleichzeitig an den Universitäten etablierenden (alt-)deutschen oder germanischen Philologie (RLW s.v. Philologie), der späteren Germanistik (RLW s.v. Germanistik), die sich in ihren Anfängen schwerpunktmäßig mit ‚altdeutschen‘ Schriftzeugnissen beschäftigt hat und zugleich auf Breitenwirkung angelegt war. So folgte Friedrich Heinrich von der Hagen in seiner Ausgabe Der Nibelungen Lied (1807) ganz ähnlichen Bearbeitungsweisen wie Tieck; er ist also nicht grundsätzlich wissenschaftlicher als die Herausgeber vor dem Entstehen der Germanistik. Von der Hagen, ab 1810 Professor für deutsche Sprache und Literatur, pries das Nibelungenlied als „das erhabenste und vollkommenste Denkmal einer so lange verdunkelten Nazionalpoesie“, das wie kein zweites „ein vaterländisches Herz“ bewegen könne. Überhaupt nimmt in dieser Zeit von Napoleonischer Herrschaft und Befreiungskriegen die nationale Instrumentalisierung des Nibelungenlieds zu, in deren Verlauf es schließlich zum „Nationalepos“ der Deutschen avanciert – ganz ähnlich, wie Walther von der Vogelweide zur nationalen Identitätsfigur (als „Sänger des Reichs“) stilisiert werden wird. Die Romantiker erweitern diese aus dem 18. Jh. übernommenen Zuschreibungen (volkstümlich, deutsch) noch dadurch, dass sie mittelalterliche Themen und Sprachformen auch als Option gegen den Klassizismus in der Literatur (RLW s.v. Klassizismus), speziell den der Weimarer Klassik (RLW s.v. Klassik2), aufgreifen. Heinrich Heine wird in diesem antiklassizistischen Zusammenhang die ganze mittelalterliche Dichtung der Romantik als Vorgeschichte zuschlagen: „Was war aber die romantische Schule in Deutschland? Sie war nichts anders als die Wiedererweckung der Poesie des Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bild- und Bauwerken, in Kunst und Leben manifestiert hatte“ (Die Romantische Schule, 1835). So mag es als Gegenreaktion auf diese Vereinnahmung des Mittelalters verstanden werden, wenn Goethe in seiner Abwehr gegen die Romantik dem Nibelungenlied Klassizität zuspricht: „Das Classische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen classisch wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig“ (Gespräch mit Eckermann, 2. April 1829). Als weitere Linie der Mittelalterrezeption lässt sich in der Romantik die Glorifizierung einer untergegangenen Welt erkennen, die weit über den literarisch-künstlerischen Bereich hinausgeht. Novalis setzt dem Schlagwort vom finsteren Mittelalter die begeisterte Formel von den ‚glänzenden Zeiten‘ entgegen: „Es waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte; Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs“ (Die Christenheit oder Europa, 1799). Gegen alle Fortschrittsgedanken wird hier sowohl in religiöser wie in gesellschaftlicher Hinsicht die Rückkehr zu vormodernen Lebensformen propagiert. Dies unterscheidet sich grundsätzlich von der patriotisch-nationalistischen Hochschätzung einer deutschen Vergangenheit seit dem Humanismus, ist doch für Novalis das Mittelalter christliches Europa. Es ist ein provokanter Gegenentwurf zur Neuzeit, der die Verlustbilanz vor allem von Reformation, Aufklärung und Säkularisierung aufmacht und zu einer christlich-konservativen Utopie gestaltet. Andere romantische Autoren sind in dieser rückwärts blickenden Haltung weniger übernational und zukunftsorientiert als Novalis; für sie ist das Mittelalter ein Leitbild für kulturelle und politische Restauration.
Gelehrte Philologie und populäres Erzählen im 19. Jahrhundert
Seit ihren Anfängen schwankte die Germanistik zwischen zwei Aufgaben. Einmal ging es darum, lesbare Textausgaben für das allgemeine Publikum vorzulegen, um damit die altdeutschen Texte bekannt zu machen und somit einem nationalliterarischen Kanon einzugliedern. Und zum andern wollte man philologisch korrekte Editionen erarbeiten, die schon von der Sprachform her nur von wenigen Fachkollegen zur Kenntnis genommen werden konnten, die aber den Status der (alt-)deutschen Philologie als seriöser Universitätsdisziplin absicherten, welche sonst eher als gelehrte Liebhaberei angesehen wurde. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm etwa brachten in ihrer Ausgabe des Armen Heinrich von Hartmann von Aue (1815) zwar nur den mhd. Text heraus, gaben jedoch über eine ausführliche Kommentierung Verständnishilfen für die zeitgenössischen Leser. Karl Lachmann und seine Schüler hingegen verzichteten bewusst auf jedes Entgegenkommen an die Laien: Lachmanns noch heute maßgebliche Ausgaben der Werke Walthers von der Vogelweide (1827) und Wolframs von Eschenbach (1833) haben umfangreiche Variantenapparate, doch keine Übersetzungen oder Kommentare. Gleiches gilt für die von Lachmanns Schüler Moriz Haupt mitverantwortete Sammlung der älteren Minnelyrik Des Minnesangs Frühling (1857), die in inzwischen 38. Auflage noch heute im Buchhandel erhältlich ist. Die vielen wissenschaftlichen Ausgaben, die im 19. Jh. in dieser Form entstanden, erschlossen zwar die mhd. Dichtung in großem Ausmaß, setzten aber sprachhistorische Kenntnisse voraus, die im Hochschulstudium und Deutschunterricht erst erworben werden mussten. Wörterbuchprojekte wie das (noch immer benutzbare) Mittelhochdeutsche Wörterbuch von Georg Friedrich Benecke, Wilhelm Müller und Friedrich Zarncke (1854–1866) boten die lexikographischen Voraussetzungen dafür. Während sich die rezeptive Beschäftigung mit der mittelalterlichen Dichtung immer mehr in Richtung Universitätsstudium entwickelte, also zu einer Spezialistenbeschäftigung wurde, rückte zunehmend der produktiv-kreative Umgang mit mittelalterlichen Stoffen und Motiven in das Interesse der Öffentlichkeit. Populäre Ritterromane (z.B. von Carl Gottlob Cramer, Friedrich de la Motte-Fouqué) prägten seit dem Ende des 18. Jh.s für Jahrzehnte das Bild des Ritterstandes. Kaum zu überschätzen ist der Einfluss eines so erfolgreichen Romans wie des Ekkehard von Joseph Viktor von Scheffel (1855) auf die Vorstellungen vom mittelalterlichen Dichter. Hieran als auch an Erzählungen wie Hadlaub von Gottfried Keller (1876) kann man anschaulich ablesen, wie im 19. Jh. „die Minnesänger zu ihrer Rolle kamen“ (Thomas Cramer). Im politischen Kontext von Nationalstaatlichkeit und Reichsproblematik lässt sich Adalbert Stifters historischer Roman Witiko (1865–67) lesen, gleiches gilt für Wilhelm Raabes Novelle Des Reiches Krone (1870). Wurden mittelalterliche Werke den literarischen Neuschöpfungen zugrunde gelegt, dann waren es oft nicht die von den Philologen bereitgestellten Textausgaben, sondern bereits stark popularisierende Übersetzungen wie die von Karl Simrock.
Drama, Oper, Film
Die bedeutendsten Leistungen der kreativen Mittelalterrezeption hat das 19. Jh. in den dramatischen Künsten hervorgebracht. Zu nennen wären etwa Merlin. Eine Mythe (1832) von Karl Immermann und vor allem das dreiteilige „deutsche“ Trauerspiel Die Nibelungen (1862) von Friedrich Hebbel, das die religiöse Problematik des Aufeinandertreffens von Heiden- und Christentum herausstellt, die im Nibelungenlied im Hintergrund verblieben war. Am bekanntesten sind die großen Musikdramen (RLW s.v. Oper), mit denen Richard Wagner weltweit das Mittelalterbild bis heute stark mitbestimmt, obwohl ihm selbst nichts ferner lag als der mittelalterlichen Dichtung gerecht werden zu wollen. Ein großer „Mittler des Mittelalters“ (Peter Wapnewski) war er allenfalls wider Willen. Aus alten Erzählstoffen schuf Wagner neue Mythenspiele von höchster dramatischer und musikalischer Suggestionskraft. Von Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (1845) und Lohengrin (1848), über den vierteiligen Ring des Nibelungen (1854/74) und Tristan und Isolde (1859), bis hin zu Die Meistersinger von Nürnberg (1868) und zu dem „Bühnenweihfestspiel“ von Parsifal (1882), liegt mit Wagners Opern gewiss das monumentalste Œuvre kreativer Mittelalterrezeption überhaupt vor. Es regte vielfach zur Nachahmung an, provozierte allerdings auch Parodien und Gegenentwürfe wie die Operette Die lustigen Nibelungen (1904) von Oscar Straus oder das Tristan-Drama König Hahnrei (1913) von Georg Kaiser. Besonders häufig wurde Hartmanns Armer Heinrich bearbeitet, so als Oper von Hans Pfitzner (1895), als Drama von Gerhart Hauptmann (1902), aber auch als Novelle von Ricarda Huch (1922). Noch im späten 20. Jh. kam Die Legende vom armen Heinrich (1997) durch Tankred Dorst neu auf die Bühne, der schon 1981 mit Merlin oder das wüste Land einen Theatererfolg verbuchen konnte. Auch Stücke wie Ernst Hardts Tantris der Narr (1907), Reinhold Schneiders Die Tarnkappe (1952) oder Christoph Heins Die Ritter der Tafelrunde (1989) zeugen vom anhaltenden Vertrauen in die dramatischen Qualitäten der mittelalterlichen Epen. Das gilt von Anfang an auch für das im 20. Jh. neu entstehende Genre des Spielfilms (RLW s.v. Film). Fritz Langs monumentaler Zweiteiler Die Nibelungen (1924) ist einer der eindrucksvollsten Stummfilme überhaupt. Bis heute sind Mittelalterfilme vor allem nach Artus-Stoffen oft internationale Kassenschlager – als Fantasy- oder Abenteuerfilme (z.B. Excalibur, 1981; First Knight, 1995) oder auch als Fälle von bitterböser Komik (z. B. Monty Python and the Holy Grail, 1974, dt.: Die Ritter der Kokosnuss). Diese spezielle Komik des Films wirkt inzwischen zurück auf Theater-Dramatisierungen wie John von Düffels Stück Das Leben des Siegfried (2009).
Komponisten und Liedermacher
Mittelalterliche deutsche Lyrik wurde im 19. Jh. durch Schule und Universität als nationales Bildungsgut hochgehalten. Zur Popularität trugen darüber hinaus die Vertonungen bei, mit denen bedeutende Komponisten die Gattung des Kunstlieds immer wieder neu erweiterten (RLW s.v. Kunstlied). So wurde etwa Walthers Lied Under der linden (L. 39,11) mit seinem charakteristischen Tandaradei-Refrain von Norbert Burgmüller, Louis Spohr, Edvard Grieg und Wilhelm Kienzle in der nhd. Fassung von Karl Simrock (Die verschwiegene Nachtigall) vertont; Engelbert Humperdinck, Ferruccio Busoni, Hans Pfitzner, Frank Martin und Jens-Peter Ostendorf blieben dann näher am mhd. Text. Seit den 70er Jahren des 20. Jh.s setzen Versuche ein, dieses und viele andere mhd. Lieder in einem ‚authentischen‘ Mittelaltersound zu präsentieren, der zugleich unterhaltsam sein soll. Es entstehen Mittelalter,bands‘, durch die häufig auch das Lindenlied im populären Musikbereich als Teil der gegenwärtigen Jugendkultur präsent gehalten wird. Gleiches gilt für das parallele Phänomen der Liedermacher(bewegung). Während sich Wolf Biermann eher an französischen Traditionen des MAs orientierte (z. B. Ballade auf den Dichter François Villon), variierte Franz-Josef Degenhardt in Unter der Linde oder Probleme der Emanzipation Walthers Lied als Kritik an traditionellen Geschlechterverhältnissen, was im weiteren Sinne auch für Peter Maffay (Tandaradei), Konstantin Wecker (Der Lindenbaum) und Angelo Branduardi (Sotto il tiglio, là nella landa) gelten kann. Von den Lyrikern der Gegenwart greift Robert Schindel den berühmten Refrain in poetologischer Hinsicht auf (Die Wörter im Futter): Wogegenhin die Wörter tandaradunst / Aufsetzen endlich ihr Gekunst …
Postmoderne Mittelalter-Romane
Die Erkenntnis des 20. Jh.s, dass auch die Moderne bereits historisch zu werden beginnt (RLW s.v. Postmoderne), äußert sich in historischen Romanen, die bevorzugt im Mittelalter spielen. Prägend war dabei der Weltbestseller Il nome della rosa (1980) des italienischen Semiotikers und Mediävisten Umberto Eco. Aus der deutschsprachigen Literatur sind hier die romanartigen Bücher von Dieter Kühn (z.B. Ich Wolkenstein, 1977), Adolf Muschg (Der Rote Ritter. Eine Geschichte von Parzivâl, 1993) und Alois Brandstetter (Der geborene Gärtner, 2005) zu erwähnen.
Rezeptionsforschung, Rezeptionsästhetik
Parallel zu der zunehmenden Rezeption mittelalterlicher Literatur entstand um 1980 ein reges wissenschaftliches Interesse an der medialen „Mittelalter-Rezeption“ (RLW s.v. Rezeptionsforschung), das durch die literaturtheoretische Konzeption der Rezeptionsästhetik beflügelt wurde (RLW s.v. Rezeptionsästhetik). Da es die nachmittelalterlichen Jahrhunderte betrifft, sollten Neugermanisten sowie Medien-, Musik- und Kunstwissenschaftler daran beteiligt sein; in vielen Fällen ist dieser Wissenschaftszweig bis heute jedoch eine Domäne der Mediävisten.
2. Altgermanistik, Germanistische Mediävistik, Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Mediävistik als Teilfach der Germanistik
Die frühe Germanistik als „Deutsche“ oder „Germanische Philologie“ war zunächst, wie gezeigt wurde, vorrangig mit mittelalterlichen Texten befasst, weshalb sich die Neuere deutsche Literaturwissenschaft (RLW s.v. Literaturwissenschaft) und später auch die Germanistische Linguistik als weitere Teilfächer der Gesamtgermanistik von der lange so genannten „Altgermanistik“ abgrenzen mussten. Wir nennen dieses älteste Teilfach, das sich mit der deutschen Sprache und Literatur des Mittelalters befasst, heute in der Regel „Germanistische Mediävistik“ (RLW s.v. Mediävistik). Das Attribut „germanistisch“ betont den disziplinaren Zusammenhang mit dem akademischen Fach und mit der Deutschlehrerausbildung, deren Bestandteil es bildet. Es grenzt es damit auch ab von anderen Fächern und Teilfächern, die sich in irgendeiner Weise mit dem Mittelalter befassen, also etwa von der anglistischen oder romanistischen Mediävistik, von der mittellateinischen Philologie, der mittelalterlichen Geschichte, der theologischen Scholastikforschung usw. Indem man alle diese Disziplinen als „Mediävistik“ bezeichnet, hebt man zugleich einen interdisziplinären Zusammenhang hervor, der berücksichtigt, dass Mittelalterforschung nicht isoliert betrieben werden kann, sondern nur im Fächerverbund. Dadurch entsteht eine Art von doppelter Identität: Die Fachvertreter für germanistische Mediävistik an den Universitäten sind deshalb oft sowohl im Deutschen Germanistenverband (Gesellschaft für Hochschulgermanistik) als auch im (fächerübergreifenden) Mediävistenverband organisiert.
Mediävistik als Kultur- und Medienwissenschaft
Wenn man heute lieber von „Mediävistik“ als von „Altgermanistik“ spricht, dann ist damit ein Modernisierungsanspruch verbunden. Die Mediävistik als „neue Altgermanistik“ (Jan-Dirk Müller) will nicht nur die bewährten philologischen Pfade des Erschließens und Bewahrens altdeutscher Textzeugnisse und ihrer Sprachformen weitergehen, für die seit Lachmann hohe Standards gelten. Sie bringt darüber hinaus ihre Gegenstände programmatisch in kulturwissenschaftliche Debatten der Gegenwart ein (RLW s.v. Kulturwissenschaft). Damit reflektiert sie nun theoretisch, was in vieler Hinsicht zuvor selbstverständliche Praxis war. Seit den gelehrten Bemühungen der Humanisten um die altdeutsche Literatur sind die Schriftzeugnisse des MAs stets im Kontext von Religions- und von allem auch von Rechtsgeschichte betrachtet worden. Wer sich mit den ahd. Zaubersprüchen und Heilsegen befasst, war schon immer gezwungen, sich in der Medizingeschichte um zu tun. Höfische Verhaltenslehren verlangen die Kenntnis der Geschichte der Erziehung und der Umgangsformen. Die Dichtung des MAs gewährt Einblicke in Einstellungen der Menschen zu Sexualität, Nahrungsverhalten, Arbeit und Spiel, Tod, Krankheit, Lust und Schmerz, Erfahrung von Zeit und Raum, Ritualisierungsformen der Aggressivität, Gesprächsstrategien oder politische Konfliktlösungsmodelle. Allein schon durch ihre Gegenstände ist die germanistische Mediävistik deshalb in hohem Maße offen für Fragestellungen von Mentalitätenforschung (RLW s.v. Mentalitätsgeschichte), Historischer Anthropologie (RLW s.v. Literarische Anthropologie), Sozialgeschichte (RLW s.v. Sozialgeschichte), Diskursgeschichte (RLW s.v. Diskurstheorie(n)) oder New Historicism (RLW s.v. New Historicism). Von diesen neueren Forschungsrichtungen bezieht sie theoretische Anregungen, kann aber manche von deren Aussagen durch genaue Textarbeit präzisieren oder gar korrigieren. Ähnliches gilt für das weite Feld aktueller Medienwissenschaften (RLW s.v. Medien), die wie die Mediävistik mit dem Zusammenspiel verschiedenster Zeichenordnungen konfrontiert sind. Dass für eine „Archäologie der Kommunikation“ (Aleida und Jan Assmann) nicht nur die Schrift von Belang ist, sondern auch die Semantik z.B. der Gebärden, Räume, Kleider, Wappen, Düfte, Farben und Klänge, ist in der „Mittelalterlichen Bedeutungsforschung“ (Friedrich Ohly) seit langem akzeptiert, die von der lateinischen Bibeldeutung ausgehend nach der spirituellen Signifikanz der „Dinge“ in Schrift und Welt fragt. Weitgehend neu sind hingegen die Perspektiven, die entstehen, wenn die Mediävistik sich zunehmend als „interkulturelle“ Wissenschaft begreift (RLW s.v. Interkulturalität). Für Germanistik-Studierende aus nicht-deutschen Ländern ist die deutsche Literatur des MAs gleichsam ‚doppelt fremd‘; für deutschsprachige Leser repräsentiert das MA hingegen das „eigene Fremde“ (Ingrid Kasten), das mit unserer Gegenwart weit mehr verbunden ist als etwa die Kulturen der Antike oder des Alten Orients. Dies zwingt dazu, das Eigene und das Fremde nicht einfach zu konfrontieren, sondern differenziert in Beziehung zueinander zu setzen – was dem Zugang zu außereuropäischen Kulturen ebenso zugute kommt wie dem zu Kultur und Literatur des MAs. Sollte es auch nach 1945 noch Reste einer national orientierten Betrachtung der altdeutschen Dichtung gegeben haben, dann sind sie damit endgültig vom Tisch.
Mediävistik als Literatur- und Sprachwissenschaft
Bei den kultur- und medienwissenschaftlichen Ansätzen besteht freilich immer die Gefahr, das Ästhetische bzw. den Kunstcharakter von Dichtungen zu vernachlässigen und die methodologischen Probleme des eigenen Fachs zugunsten interdisziplinärer Fragestellungen in den Hindergrund zu drängen. Germanistische Mediävistik muss sich deshalb zunächst einmal als eine Literaturwissenschaft verstehen, die den literarischen Text weniger als „Quelle“ für eine historische Fragestellung begreift, sondern als Gegenstand der Wissenschaft selbst. An einigen Universitäten firmiert die germanistische Mediävistik deshalb programmatisch als „Ältere deutsche Literaturwissenschaft“. Das sollte allerdings nicht die Differenzen zur Neueren deutschen Literaturwissenschaft verdecken. Allein schon, weil sie es mit Texten aus den älteren Sprachstufen des Deutschen zu tun hat, verlangt sie eine spezielle sprachhistorische, also linguistische Kompetenz, die es verbietet, die germanistische Mediävistik ausschließlich der Literaturwissenschaft zuzuschlagen. Indem sie aus zwingenden Gründen an der Einheit von Sprach- und Literaturwissenschaft festhält, bildet sie ein wichtiges Bindeglied zwischen den oft auseinanderstrebenden germanistischen Teilfächern der Linguistik und der Neueren deutschen Literaturwissenschaft.