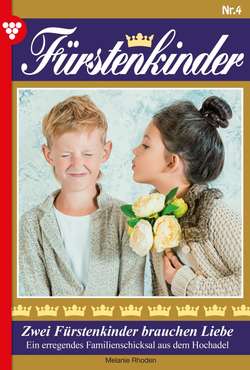Читать книгу Fürstenkinder 4 – Adelsroman - Melanie Rhoden - Страница 3
ОглавлениеFürst Rainer von Wildberg-Kallau steuerte selbst den großen, schweren Wagen. Auf den Waldstraßen nahe dem Schloß fuhr er besonders langsam, weil gerade in den Morgenstunden Wildwechsel eine Gefahr bedeutete. Erst auf der Autobahn konnte der starke Motor seine Kräfte entwickeln. Weniger Spitzengeschwindigkeiten als das zügige Fahren brachte die Reisenden rasch nach dem Süden. Kaum drei Stunden später tauchten schon die mächtigen Umrisse der Berge als blaugraue Schemen auf. Die Zeit verging schnell, weil die Kinder auf den Rücksitzen nett miteinander plauderten. Fürstin Vera saß neben ihrem Mann und schaute verträumt in die reizvolle Landschaft des Alpenvorlandes. Glückliche Stunden zogen als Erinnerungen vorbei; an die glanzvolle Hochzeit auf Schloß Wildberg; an den Augenblick, da ihr bewußt wurde, daß sie Mutter sein werde. Und dann die dramatisch verlaufende Geburt, während der sie meinte, sterben zu müssen! Fürstin Vera wußte noch genau, daß sie unter der Wirkung der schmerzlindernden Mittel nur noch einen Wunsch fühlte, nämlich wenigstens einmal ihr Kind sehen zu können. Sie überstand alle Komplikationen mit dem festen Willen, bei ihrem geliebten Mann und bei ihrem Kind zu bleiben. Die Ärzte sprachen von einem Wunder und verboten ihr jede weitere Schwangerschaft.
»Ich wollte damals auf keinen Fall, daß Ronald als Einzelkind aufwächst«, sagte Fürstin Vera unvermittelt. Erst verstand Rainer nicht gleich, was sie meinte, aber dann fand er sich in ihre Gedanken.
»Du warst wunderbar tapfer«, bestätigte er ihr. »Wie habe ich dich für deinen Leichtsinn verurteilt!«
»Glaub mir, Rainer, wenngleich die Ärzte schwarz in schwarz die Gefahren ausmalten, wußte ich genau, daß ich einmal für meine Kinder nicht sterben, sondern leben sollte!«
Fürst Rainer suchte tastend die Hand seiner Frau, zog sie an die Lippen und küßte zärtlich die Fingerspitzen, bis sie ihn verwies: »Das ist während der Fahrt verboten, mein Lieber. Sicherheit geht vor!«
Lächelnd gab er sie frei und widmete sich wieder ganz der Kunst, völlig risikofrei und rasch zu fahren. Eine Stunde später erreichten sie über eine gute ausgebaute Seitenstraße das Dorf Neu-Galling. An einen Hügel gebaut, lag, protzig und etwas zu groß, das Sanatorium von Professor Wernhoff. Weißgekieste Straßen und Wege führten durch den Park. Kaum hatte der Fürst den Wagen vor dem schloßartigen Gebäude gehalten, begann schon das freudige Rufen der Kinder: »Oma! Ich sehe sie! Oma sitzt auf einer rotgestrichenen Bank!«
Vergeblich mahnte der Fürst, man müsse hier besonders Ruhe bewahren, die Aufregung der Kinder war zu groß. Allerdings ließen sie sich beim Wagen noch ordentlich aufstellen, weil sie erst dann die Geschenke für die Jubilarin ausgehändigt bekamen. Nun aber stürmten sie los, der sechsjährige Ronni Blumen schwingend, die vierjährige Reni hinter ihm her, wobei sie eine große Bonboniere schleppte.
Es gelang Fürstin Thea von Vingenstein, dem Anprall der beiden Enkelkinder sitzend standzuhalten. Mit aufwallender Rührung drückte sie die Kleinen an sich, ließ sich zärtlich küssen und gab dann jedem auch einen Kuß auf die Stirn.
Mit großen, strahlenden Augen schaute sie dem Fürstenpaar entgegen.
»Mama, alles Gute zum Sechziger!« rief Vera, lief auf ihre Mutter zu und umarmte sie. Sie konnte die Tränen des Glücks nicht zurückhalten, denn Mama schaute prächtig erholt aus.
Wohl weil Fürst Rainer ähnliches feststellte, rügte er seine Frau: »Vera, du bist einfach ungalant! Liebste Mama, auch von mir die besten und herzlichsten Wünsche. Bleib auch die zweiten fünfzig Jahre gesund, glücklich und bei uns!«
Er küßte die Hand seiner Schwiegermutter, worauf sie ihn, zum Scherz rügend, ermahnte: »Du mußt nicht nur ganz junge Frauen küssen, mein lieber Rainer. Wenn du schon so galant bist, mich um zehn Jahre jünger zu schwindeln, so darfst du mich sogar auf den Mund küssen! Wir wollen Vera geradezu eifersüchtig machen!«
Fürstin Thea, Veras Mutter, war bester Laune, glücklich über das Kommen der Familie, und sie ahnte nicht, daß dieses Glück nur noch eine kurze Zeit währen sollte.
Vorerst lud sie ihre Gäste in das kleine Appartement, das sie hier in der Klinik bewohnte, und bestellte über das Haustelefon einige Erfrischungen.
»Mama, du hast keinerlei Beschwerden mehr beim Gehen!« stellte Vera glücklich fest. »Die Kur hat Wunder bewirkt, du bist tatsächlich um wenigstens zehn Jahre jünger geworden!«
Vera freute sich darüber so sehr, daß wieder Tränen in ihre Augen tragen. Nur Fürstin Thea grollte ihr: »Vorhin hast du das gar nicht ausgesprochen. Nur Rainer gratulierte mir sogleich zum Fünfziger. Spaß beiseite: Ich fühle mich wie neugeboren. Kinder, ich wünsche mir auch noch einige Jahre, um euer Glück ein bißchen beobachten und mich daran mit erfreuen zu können. Ihr wißt ja nicht, wie froh ich über euer Kommen bin!«
So verging die Zeit sehr schnell. Alle waren glücklich über das Beisammensein. Die Fürstin von Vingenstein horchte deshalb erstaunt auf, als auf dem Korridor ein elektrischer Gong ertönte, und sie sagte: »Das Zeichen zum Mittagstisch. Allerdings denke ich nicht daran, mich an einem so wunderbaren Tag über Professor Wernhoffs Diätküche zu ärgern. Kinder, ich lade euch zu einem exquisiten Mittagsmahl in zweitausend Metern Höhe ein, ins Hotelrestaurant auf dem Klaiberstein!«
Die Einladung wurde mit größter Begeisterung aufgenommen, nur Klein-Reni vergewisserte sich erst: »Oma, gibt es dort oben auch Himbeereis?«
»Frisch vom Gletscher!« schwindelte Oma Thea, womit sie auch Renis Vorbehalte beseitigte.
Und so trieben die Ereignisse auf die Katastrophe zu.
*
Um diese Stunde war selbstverständlich die Hotelbar auf dem Klaiberstein längst geöffnet. Zwei gutaussehende, salopp gekleidete und bestens gelaunte Herren um die dreißig amüsierten sich köstlich in Gesellschaft zweier blutjunger, bildhübscher Mädchen.
»Tim, noch einmal dasselbe!« sagte einer der Herren zum Mixer, der sich beeilte, diesen Wunsch zu erfüllen. Das waren immerhin Gäste, die gewohnt waren, sich jeden Wunsch zu erfüllen, und die auch dafür nicht nach dem Preis fragten.
»Salute!« rief ein Herr.
»Ex!« befahl der zweite, und die Mädchen standen nicht zurück.
»Also gilt es? Start in zwei Minuten. Hinunter bis ins Dorf, dreimal rund um den Kirchenplatz, und dann zurück. Wer als erster wieder hier an der Bar sitzt, hat gewonnen. Aber nur paarweise! Ihr Schönen müßt mitlaufen!«
»Tim zählt bis drei, dann gilt der Start!« befahl einer der Kavaliere.
Der Mixer Tim hatte mitgehört und verstanden, worum es hier gehen sollte. Die beiden jungen Herren fuhren Sportwagen, Letztmodelle. Man wollte also Privatrennen austragen. Ausgerechnet auf der kurvigen Bergstraße über einen Höhenunterschied von beinahe tausendfünfhundert Metern! Auf dem Kirchenplatz würden bestimmt alte, nicht mehr so schnell reagierende Leute unterwegs sein; vielleicht auch Kinder. Tim, der erfolggewohnte Mixer in der Hotelbar, dachte insgeheim: Betrunken! Ihr seid Verbrecher! Was ihr tun wollt, ist geradezu kriminell! Dann sagte er, zuletzt ein beachtliches Trinkgeld erwartend: »Selbstverständlich, meine Herrschaften. Tim erfüllt jeden Wunsch! Mein Kommando gilt: eins, zwei und… drei!«
Beinahe wäre es nicht zu diesem Rennen gekommen, denn eines der Mädchen war so betrunken, daß es kaum noch gerade laufen konnte. Der Begleiter stand auch nicht ganz sicher auf den Beinen, aber nachdem er sich hinter das Lenkrad seines Sportwagens geklemmt hatte, mußte er gleich ordentlich ›auf die Tube drücken‹, weil sein Freund bereits mit radierenden Reifen in die erste Spitzkehre einfuhr. Kavaliersstart mit durchdrehenden Rädern. Lustig aufkreischend, klammerte sich seine reizvolle Begleiterin am Haltegriff fest, und schon stürzte ihr das Band der Straße entgegen.
»Immer die Ideallinie!« schrie ihr der Freund zu, schnitt die Kurve in perfektem Rennstil an, ließ den Wagen mit allen vier Rädern in der Kurve kommen, kurz Gas weg, und dann wieder draufgetreten. Er spürte, welch köstliches Prickeln ihm die Todesgefahr im längst nicht mehr nüchternen Gehirn verursachte. Köstlich! Das war noch lebenswertes Leben!
*
Fürstin Thea von Vingenstein ließ sich von ihrem Schwiegersohn zum Wagen führen. Selbstverständlich bot ihr ihre Tochter den Ehrenplatz an der Seite des Fahrers an, aber die alte Dame beschloß, lieber hinten bei den Kindern zu sitzen.
»Vera, bitte, nimm den Sicherheitsgurt«, ermahnte Rainer seine Frau. Für gewöhnlich tat sie das, ohne daß er sie erst dazu auffordern mußte.
Diesmal aber wendete sie ein: »Ausnahmsweise einmal nicht. Ich habe vorhin meine Bluse von einem Stubenmädchen aufbügeln lassen, denn sie war von dem Sicherheitsgurt während der Fahrt ganz kraus geworden. Rainer, ich kann unmöglich mit ganz krauser Bluse ins Restaurant gehen!«
Es entspann sich zwischen Vera und Rainer sogar ein etwas unwillig geführtes Gespräch; zuletzt gab der Fürst den Argumenten seiner Frau nach.
»Ich werde besonders langsam fahren«, täuschte er sich selbst darüber hinweg, daß er gegen seine Überzeugung handelte. Er fuhr also los. Manchmal schaute er in den Rückspiegel; dann begegneten seine Blicke denen seiner Schwiegermutter. Die Kinder jauchzten vor Vergnügen, weil niemand mit ihnen so lustig spielen konnte wie Oma, wozu auch beitrug, daß sie die alte Dame nun schon längere Zeit sehnsüchtig vermißt hatten.
»Eine wunderbar ausgebaute Straße«, stellte Vera fest. »Nach jeder Kehre bietet sich einem ein völlig anderer Ausblick. Imposant! Rainer, bist du lieb und fährst du einen Augenblick lang in diese Ausweiche?«
Selbstverständlich kam der Fürst dem Wunsch seiner Frau nach, und so ging der Tod haarscharf an ihnen vorüber. Als sie sich nämlich nachher wieder in die Fahrspur einordnen wollten, kam bergab ein roter Sportwagen um die völlig unübersichtliche Kurve gejagt. Es sah aus, als würde sich das Fahrzeug im nächsten Augenblick überschlagen und in die Tiefe stürzen.
»Ein Wahnsinniger!« schrie der Fürst in heller Empörung. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er im offenen Sportwagen zwei junge Gesichter vorbeirasen, beide wie in ekstatischem Lachen verzerrt.
Von solcher geradezu selbstmörderischer Sorglosigkeit noch beeindruckt, lenkte Fürst Rainer den Wagen besonders vorsichtig vom Parkstreifen heraus auf die rechte Fahrbahn. Und dann geschah es im nächsten Augenblick. Binnen weniger Sekunden zerbarsten Leben, Gesundheit und das Glück einer bis dahin heilen Familie in einem unvorstellbar grauenhaften Aufprall.
Wieder jagte nämlich ein Sportwagen um die Kurve, schnitt sie in der Innenlinie an. Auch hier zwei blutjunge Gesichter, in Panik zu einer stummen Fratze verzerrt. Zwei zum lautlosen, gellenden Schrei aufgerissene Münder. Mit einem kaum mehr wahrnehmbaren Krachen prallten die beiden Wagen gegeneinander, vergruben sich Stahl in Stahl. Das Auto des Fürsten wurde gegen die Felswand geworfen, sprang davon zurück, stellte sich quer und wurde umgestürzt. Der talwärts fahrende Sportwagen stellte sich, langsam wie in Zeitlupe vorwärts auf die Stoßstange, balancierte auf den Scheinwerfern und überschlug sich zweimal, sprang auf wie ein Gummiball und jagte in die Tiefe. In der nächsten Sekunde ein markerschütternder Aufprall, gleich darauf knallende Detonationen.
All das hörte und sah Fürst Rainer von Wildberg-Kallau, als gehörte er nicht mehr dazu. Er fühlte sich von einer unsichtbaren Faust vorgerissen, hing schmerzhaft in den Sicherheitsgurten; dann bekam er einen mächtigen Faustschlag ins Genick, einen in die Magengrube. Wenn nur die Kinder nicht so gellend geschrien hätten! Fürstin Thea, soeben sechzig geworden, stieß ein Röcheln aus, das in Ohnmacht erstickte. Und durch die zerschmetterte Windschutzscheibe trug eine unsichtbare Kraft Fürstin Vera davon, warf ihren Körper gegen den Felsen, den Kopf voran. Seltsam verkrümmt blieb die junge Frau auf einer Felszacke hängen. All das geschah in wenigen Sekunden! Der Fürst hing hilflos in den Gurten. Seltsamerweise dachte er noch immer völlig logisch! Er sah ganz bewußt seine geliebte Frau gegen den Fels prallen und wußte, daß sie nun tot war. Schon weit, weit fort von ihm! Das unentwegte Entsetzensgeschrei seiner Kinder machte ihn glücklich. Sie lebten! Wenn nur Fürstin Thea nicht so qualvoll geröchelt hätte…
Die Kinder weinten immer noch. Sie weinten auch noch, als ihr Vater schon das Bewußtsein verloren hatte.
Fremde Menschen versuchten, die Wagentüren aufzureißen, aber sie klemmten. Also schlugen die Retter die sonderbarerweise heil gebliebenen Seitenscheiben ein.
»Nein!« schrie Klein-Reni und streckte die Händchen nach dem regungslos liegenden Körper ihrer Mutter aus.
Ronni klammerte sich verzweifelt an dem fremden Mann fest, der ihn forttrug und in ein anderes Auto setzte. Erst als dieses Auto mit ihm davonfuhr, begann auch der Junge in fassungslosem Entsetzen zu schreien.
*
Etwa eine Stunde später erwachte Rainer Fürst von Wildberg-Kallau langsam aus seiner Benommenheit. Je klarer er wieder denken konnte, desto entsetzter merkte er, in welche Hölle aus Verzweiflung und Trostlosigkeit er zurückkehrte.
Der Sportwagen an der Kurve! Die lautlos schreienden Münder der jungen Menschen in den Sekunden vor ihrem Tod… und Vera! Vera, die wie ein Stein durch die zerborstene Windschutzscheibe fiel, gegen die Felswand prallte.
»Vera!« Der Schrei des Fürsten gellte erschütternd durch die Räume der Klinik. Es war der Verzweiflungsschrei eines Menschen, der nun schlagartig erkannte, daß für ihn das Glück zerborsten war. Im Bruchteil einer Sekunde! Vera… »Vera!«
Eine wachhabende Krankenschwester stürzte an sein Bett, betätigte den Alarmknopf, aber diesen geradezu unmenschlichen Schrei hatten ohnehin auch die Ärzte gehört. Gleich darauf wurde die Tür aufgerissen, zwei Ärzte und einige Schwestern rannten herein. Sie warfen sich über den Fürsten, der mit den übermenschlichen Kräften eines Verzweifelten versuchte, sich freizukämpfen. Dabei spürte er keine Schmerzen.
»Fürst!« schrie ihn ein junger Arzt an. »Ihre Kinder sind unverletzt! Völlig unverletzt!«
»Vera!« röchelte Rainer von Wildberg-Kallau mit letzter Kraft.
Die beiden Ärzte warfen einander vielsagende Blicke zu. Einer streckte die Hand aus, und eine Krankenschwester reichte ihm die vorbereitete Injektionsspritze. Noch einmal bäumte sich der Verzweifelte auf. Die Nadel fuhr ihm in die Vene. Schon einige Sekunden später entkrampfte sich der Körper.
»Sie war sofort tot«, sagte der eine Arzt, als beide wieder im Flur standen.
Und der andere: »Ach ja, keine Sicherheitsgurte genommen. Und wie geht es der alten Dame?«
»Der Chef operiert. Meiner Überzeugung nach: aussichtslos.«
*
Nach drei Stunden war das Schicksal der Fürstin Thea von Vingenstein entschieden. Um etwa dieselbe Zeit erwachte auch Fürst Rainer aus seinem todesähnlichen Schlaf. Wieder mußte er die grauenvollen Stufen zwischen Ahnungslosigkeit und dem Erkennen der tragischen Wirklichkeit durchschreiten. Allerdings half ihm diesmal die dämpfende Wirkung der Medikamente, das Schwerste zu ertragen.
»Professor«, bat er und suchte tastend nach der Hand des weißhaarigen Arztes. »Sagen Sie mir die Wahrheit, ich flehe Sie an! Keine fromme Lüge kann mir helfen. Ich weiß, daß für mich die Welt zusammengestürzt ist, aber ich muß sehen, was mir noch geblieben ist. Die Wahrheit, Professor, auch wenn sie noch so hart ist!«
Professor Wernhoff nahm die Hand des Fürsten in seine. Kein Fieber, und der wild jagende Puls kam von der Aufregung, den Ängsten und den Seelenqualen.
Also begann Wernhoff: »Sie sind unverletzt geblieben, Durchlaucht. Die Sicherheitsgurte haben wieder einmal einem Menschen das Leben gerettet. Ihre Schmerzen stammen nur von der Prellwirkung. Auch die Schockwirkung…«
»Meine Frau ist tot?« unterbrach Fürst von Wildberg-Kallau den Professor. Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Fürst Rainer schloß, von Grauen geschüttelt, die Augen, aber das schreckliche Bild blieb; und ihm war, als hörte er noch immer, und immer wieder, das dumpfe Aufprallen des Körpers am Felsen.
»Tot«, bestätigte der Professor. Seiner Überzeugung nach würde der Patient jetzt sogar den Schock der tragischen Wahrheit eher verarbeiten können als später, wenn er aus der ersten Benommenheit voll erwacht wäre. Außerdem hatten die Krankenschwestern strengsten Auftrag, den Fürsten in keiner Minute unüberwacht zu lassen. Selbstmordgefahr!
»Wo sind die Kinder?« fragte der Fürst beängstigend ruhig. »Sie haben einen Schock erlitten, der sie ihr ganzes Leben lang quälen wird.«
Professor Wernhoff widersprach: »Junge Seelen überwinden das Schwere leichter. Wunden heilen und vernarben mit der Zeit. Im Augenblick begreifen Ihre Kinder die Unabänderlichkeit des Schicksals gar nicht in der letzten Konsequenz, und später verblaßt auch die schrecklichste Erinnerung. Es wird Ihre Aufgabe sein, Fürst von Wildberg-Kallau, Ihren Kindern die Seele für alles Schöne zu öffnen. Denn das Leben ist wunderschön, immer und überall. Auch jetzt noch und für Sie, Durchlaucht!«
»Wo sind die Kinder jetzt?« wiederholte der Fürst seine Frage, die noch immer nicht beantwortet worden war.
Der Chirurg strich mit einer müden Handbewegung über seine Stirn. Er hatte einen schweren Tag hinter sich. »Es wäre wichtig, die Kinder möglichst schnell aus der Atmosphäre der Klinik zu bringen. Deshalb bitte ich Sie, eine Vertrauensperson und Vertraute der Kinder unverzüglich von Ihrem Schloß kommen und die Kleinen abholen zu lassen. Am besten wäre eine Heimfahrt in der Nacht. Wenn die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, werden sie die Wahrheit nur noch wie einen bösen Traum einschätzen.«
Fürst Rainer von Wildberg-Kallau nannte den Namen des Kindermädchens, und eine Krankenschwester notierte sofort die Telefonnummer.
Fürst Rainer bat mit leiser, gepreßt klingender Stimme: »Ich würde aber die Kinder vorher noch gern sprechen und…« Er verstummte, weil der Professor durch ein Kopfnicken ohnehin sogleich seine Zustimmung gegeben hatte. Der Fürst quälte sich, um seine Gedanken einigermaßen klar zu sammeln. »Die Fürstin von Vingenstein? Professor, sie lebt?«
Die Züge im hageren Gesicht des Chirurgen zeichneten sich noch schärfer ab. Selbst nach so vielen Jahren der ärztlichen Pflichterfüllung deprimierte es ihn noch immer nachhaltig, wenn er erkennen mußte, wie ohnmächtig der Mensch nur zu oft dem übermächtigen Gegner, dem Tod, gegenüberstand. Er sagte seltsam hastig: »Habe ich selbst heute nachmittag operiert. Nun müssen wir abwarten.«
»Die Wahrheit!« verlangte der Fürst herrisch, mit harter Stimme. »Herr Professor, ich halte Inventur. Sagen Sie mir doch ehrlich, wieviel mir noch geblieben ist! Fürstin Thea, die Mutter meiner Frau, liebe ich nicht weniger, als wäre sie meine eigene Mutter. Wie groß sind ihre Chancen?«
Leise gestand Professor Wernhoff: »Keine Chancen, wieder gesund zu werden, Durchlaucht. Die Fürstin lebt und wird vielleicht noch drei, vier Monate… Die Fürstin bleibt querschnittgelähmt…«
Rainer von Wildberg-Kallau starrte regungslos zur weißen Zimmerdecke. Seltsamerweise dachte er in diesem Augenblick: In China ist Weiß die Farbe der Trauer, die Farbe des Todes… Und dann: Warum habe ich die Sicherheitsgurte angelegt? Wie sinnlos, daß ich am Leben geblieben bin!
Aber schon im nächsten Augenblick wurde ihm sein verzweifelter Gedanke widerlegt, denn von der Tür her hörte er das kleine, verängstigte Stimmchen Renis: »Papa…«
»Reni!« So schnell es sein schmerzender Brustkorb erlaubte, drehte sich der Fürst um. Neben dem vierjährigen Töchterchen stand der sechsjährige Sohn. Ein echter von Wildberg. Er wußte noch nichts vom Tod seiner Mutter. Deshalb zwang sich der Fürst zu einem ermunternden, heiteren Ton und rief: »Wie seht denn ihr aus! Reni, das Pflaster an der Stirn macht dich ganz besonders hübsch. Und Ronni hält sich bewunderungswürdig…«
»Papa!« Jetzt weinte der Junge verzweifelt auf. Die beiden rannten auf ihren Vater los und warfen sich verzweifelt über ihn. Nur mit Mühe unterdrückte der Fürst einen Schmerzensschrei. Er lächelte den Kleinen ermutigend zu.
»Hört, Kinder«, sagte er nach einigen Minuten, die er gebraucht hatte, um seine chaotisch durcheinanderhetzenden Gedanken einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. »Cilly wird euch noch heute nacht von hier wegholen und nach Hause bringen. Ihr werdet artig folgen und ihr keinen Ärger machen!«
»Ja, Papa«, versprach Ronni, der Ältere, tonlos.
»Keine dummen Streiche!« verlangte der Fürst, wobei er sich zu einem Lächeln zwang.
Und wieder Ronni mit starrem Gesicht: »Ja, Papa.«
Fürst Reiner streichelte mit einer unbeholfenen, zärtlichen Geste über die vom durchlebten Entsetzen schmal gewordenen Wangen seiner Kinder. Sie sollen doch endlich gehen! schrie es in seiner verletzten Seele. Sie sollen gehen und mich nicht so stumm vorwurfsvoll anschauen! Mich trifft doch keine Schuld!
Da stellte Ronni die schreckliche Frage: »Papa, wann wird Mama nachkommen?«
Und die kleine Reni stimmte ein: »Ja, Papa, wird Mama nicht gleich mit uns kommen?«
Der Kopf der diskret im Hintergrund wachenden Krankenschwester fuhr herum, denn sie ahnte, daß nun wieder eine Krisis ausbrechen werde.
»Mama?« würgte der Fürst hervor. Er atmete so schwer, daß es wie Röcheln klang. Es kostete ihn übermenschliche Kräfte. Zu einer Lüge konnte er sich nicht mehr aufraffen, und so sprach er doch die Wahrheit, als er keuchend sagte: »Fahrt nur, Kinder. Mama wird… in ein paar Tagen nachkommen. Für immer.«
Rasch brachte die Krankenschwester die beiden Kinder aus dem Raum, und kaum hatte sich die Tür hinter ihr geschlossen, brach Fürst Rainer von Wildberg-Kallau in ein verzweifeltes Schluchzen aus.
*
Die Ärzte entließen den Fürsten nach zwei Tagen aus der Klinik. Es geschah auf den Wunsch des Fürsten und gegen die Überzeugung der Ärzte. Weil das aber der Tag vor dem Begräbnis von Fürstin Vera war, stimmten sie nach einigem Zögern zu.
Das Kindermädchen Cilly hatte, als es Ronni und Reni abholte, einen neuen Anzug mitgebracht. Als der Fürst sich ankleidete, kam er kaum allein zurecht, weil seine Hände unkontrollierbar zitterten. Endlich hatte er es doch geschafft. Er lehnte die Hilfe einer Krankenschwester mit dem Hinweis ab: »Ich werde mich künftig ganz allein zurechtfinden müssen. Danke, ich brauche keine Hilfe mehr.«
Er bemühte sich, ein völlig ausdrucksloses Gesicht zu wahren, denn niemand sollte ahnen, welch furchtbare Begegnung ihm nun noch bevorstünde. Als er zur Tür ging, zog er die Beine schleppend weiter, als litte er an Lähmungen. Jeder Schritt forderte ihm nicht nur körperliche Kräfte, sondern noch viel mehr seelische Überwindung ab.
»Zimmer neunzehn?« fragte er knapp die Krankenschwester. Seine Stimme klang so unpersönlich und abweisend, daß er erst gar nicht betonen mußte, er wollte allein gehen. Also beschrieb ihm die Schwester den Weg.
»Danke.« Hoch aufgerichtet, beinahe arrogant schleppte sich der Fürst über den Korridor. Nun kam ihm doch die Krankenschwester nach und beobachtete, ob er den Weg allein schaffte. Sie erschrak, als der Fürst sich plötzlich umdrehte und verlangte: »Schwester, besorgen Sie mir sofort Blumen! Ich brauche sie! Sofort… ich habe nicht mehr viel Zeit.«
Schwester Maria lief fort, nahm einfach aus der großen Vase in der Empfangshalle der Privatklinik einen Blumenstrauß und brachte ihn dem Fürsten. Gleich darauf klopfte Rainer von Wildberg-Kallau an Tür Nummer neunzehn. Sein Herz schlug zum Zerreißen heftig, als ihn die noch immer recht schwache Stimme seiner Schwiegermutter zum Eintreten aufforderte.
»Rainer!« rief sie, als sie ihn, noch in der Tür stehend, erkannte. »Wie schön, daß du mich besuchst! Jetzt glaube ich erst, daß alles wieder gut wird, denn du siehst wirklich blendend aus. Setz dich zu mir, Rainer! Eine kleine Stunde eines so lieben Besuchs müssen mir auch diese verständnislosen Ärzte gewähren. Stell dir vor, Rainer, sie wollen mich noch ein paar Wochen hierbehalten, was ich völlig unsinnig finde. Man sollte mich nur aufstehen lassen, und ich würde diesen Unmenschen beweisen, daß ich zumindest mit Krücken humpeln könnte!«
Rainer von Wildberg war seiner Schwiegermutter von Herzen dafür dankbar, daß sie ohne Unterlaß redete und redete. Selbstverständlich begriff er, daß sie damit ihre panische Angst übertönen wollte. So rasch er nur konnte, ging er auf sie zu, neigte sich zu ihr herunter und streifte ihre Wangen mit den Lippen. Mit Mühe verbarg er sein Erschrecken darüber, wie tief diese Wangen in den letzten Tagen eingefallen waren. Die Augen lagen in dunklen Höhlen, wirkten stumpf und trüb.
»Ein paar Blumen«, sagte er und schaute auf die Blüten, um dem angstvoll forschenden Blick der Fürstin auszuweichen. »Wir wollen einer Schwester läuten, denn ohne Wasser…«
Er wußte nicht mehr weiter und spürte, daß er am Rande seiner Kräfte war.
»Ohne Wasser sterben sie schneller und nicht so schön«, sprach Thea von Vingenstein seine Gedanken zu Ende aus. »Rainer, ganz schnell, ehe die Schwester kommt: Sag mir die Wahrheit! Vera?«
Fürst Rainer sank schwer auf den Stuhl, der neben dem Bett stand. Sein Atem ging röchelnd. Dennoch zwang er sich zu einem Lächeln und behauptete: »Liebe Mama, ich bin auf dem Weg zu Vera. Sie befindet sich schon auf dem Schloß…« Sein Blick wurde starr, sein Gesicht wirkte wie versteinert. »Ja, ich gehe zu Vera, sie wartet auf mich…«
In dem Augenblick öffnete sich die Tür, und rasch trat die Krankenschwester in den Raum. Mit einem Blick erkannte sie die Situation, weshalb sie überschwenglich die schönen Blumen bewunderte. Sie holte eine Vase.
»Die Kinder!« drängte Fürstin Thea gehetzt. »Bitte, Rainer, sag du es mir! Weißt du, die Ärzte hier lügen mich alle an und meinen, ich merkte das nicht. Aber ich lasse mich nicht einfach so beruhigen, sondern… Rainer, sag du es mir! Von dir weiß ich: Du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der mich nie belügen würde! Du sagst mir die Wahrheit! Auch wenn… Mein Gott, was bin ich für eine geschwätzige alte Frau. Ich lasse dich gar nicht erst zu Wort kommen.«
In ihrem hager gewordenen und noch immer schönen Gesicht stand die Angst vor der Wahrheit. Aber schon das Lächeln auf den Zügen Rainers beruhigte sie wieder einigermaßen.
»Die Kinder sind unverletzt. Cilly hat sie schon heimgeholt, und ich freue mich unsagbar heute auf das Wiedersehen. Liebste Mama, in einer Viertelstunde etwa wird der Mietwagen kommen und mich abholen.«
Fürstin Thea hielt die Augen geschlossen. Jetzt glaubte sie, daß ihre Tochter lebte, kaum verletzt und schon nach Schloß Wildberg vorausgefahren. Die beiden heißgeliebten Enkelkinder unverletzt! Es waren Freudentränen, die über ihre schmalen Wangen sickerten.
Ich habe die unerschütterliche Verpflichtung, dieser wunderbaren Frau die Wahrheit zu verschweigen und alles zu tun, um sie nie das Grauenhafte erfahren zu lassen! schwor sich in diesen Augenblicken der Fürst.
»Rainer!« riß ihn die Stimme der Gelähmten, der dem Tod geweihten Fürstin Thea, aus seinen Gedanken. »Rainer, versprich mir, daß du mich bald, sehr, sehr bald von hier weg- und heimholen wirst! Ich möchte so gern wieder bei Vera sein!«
»Ja, bei Vera«, murmelte der Fürst.
Eine Viertelstunde später brachte ihn ein Mietwagen fort. Als der Chauffeur startete, bat ihn Fürst von Wildberg-Kallau : »Fahren Sie so schnell, wie Sie nur können. Aber ohne Risiko! Gefährden Sie niemanden.«
Der Berufsfahrer trat den Gashebel nieder. Er wußte nichts von dem Schicksalsschlag, der vor wenigen Tagen die fürstliche Familie getroffen hatte. Deshalb fragte er arglos: »Werden Sie denn so dringend erwartet?«
»Ja«, sagte der Fürst knapp, und sein Gesicht wirkte wie versteinert. »Von meiner Frau.«
Dann sprach er kein Wort mehr, bis der Wagen nach stundenlanger Fahrt in den Park von Schloß Wildberg einbog.
»Geschafft!« rief der Chauffeur erleichtert und fröhlich, denn der stumme Gast im Auto war ihm beinahe schon unheimlich geworden. Im nächsten Augenblick allerdings verschlug es ihm den Atem, denn die Szene wirkte so makaber. Soeben noch blühende Welt, erfüllt von Schönheit und Leben. Aber vor dem Schloß wartete eine schwarzgekleidete Trauergesellschaft. Inmitten von Rosen stand ein Sarg aufgebart. Zu sich, nicht zu dem Fahrer, sagte Fürst Rainer halblaut: »Vera, meine Frau, ich komme schon…«
Dann sprang er aus dem ausrollenden Wagen. Diener stürzten herbei und halfen ihm über die Freitreppe hinauf. Schweigend verneigten sich die Trauergäste, aber der Fürst sah sie kaum.
*
»Es war falsch, Durchlaucht, die Kinder mit zum Begräbnis zu nehmen!« begehrte die sonst meist wortkarge, mürrische Cilly auf, als der Fürst von ihr verlangte, sie sollte Ronni und Reni endlich beruhigen. Seit zwei Stunden lagen sie in ihrem Kinderzimmer und weinten.
Fürst Rainer ahnte, daß dieses Kindermädchen mit den Vorwürfen gegen ihn recht hatte. Sie verstand es, Ronni und Reni vorbildlich zu pflegen; aber sie hatte noch nie Zugang zu den Seelen der Kleinen gefunden.
»Man kann sich nicht früh genug darin üben«, bemerkte der Fürst, zutiefst verbittert, »das Leidvollste mit Haltung zu ertragen. Meine Kinder sollten und mußten sich von ihrer Mutter verabschieden. Ich denke, das war richtig so. Jetzt werde ich selbst noch einmal zu ihnen hinübergehen.«
Fürst Rainer hörte das leise, unterdrückte Schluchzen auch durch die geschlossene Tür. Behutsam klopfte er an, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Tränen fortzuwischen. Als er eintrat, brachte er ein maskenhaftes Lächeln zustande. Sie hatten beide rotgeweinte Augen, und auch jetzt noch wurde der kleine Körper Renis von unterdrücktem Schluchzen geschüttelt.
»Kommt doch zu mir«, forderte er seine Kinder auf. Gleich sprangen sie aus den Bettchen und setzten sich zu Papa auf den Boden, auf das weiße, weiche Lammfell. »Nun will ich euch ein Märchen erzählen, und dann werdet ihr schlafen, ja?«
»Ja«, sagte Ronni.
Reni nickte nur.
Der Fürst bemühte sich, aus seinem Gedächtnis das Märchen vom ›Tränenkrüglein‹ zu erzählen. Da war auch – er wandelte das Original etwas ab – einem Kind die Mutter gestorben. Das Kind weinte soviel, daß deshalb die Tote keine Ruhe finden konnte. Also kam sie und bat, man sollte um sie nicht mehr länger weinen, das Krüglein mit den Tränen wäre schon randvoll. Da weinte das Kind nicht mehr, um der toten Mutter die Ruhe nicht zu stören.
»Ihr werdet auch nicht mehr weinen«, bat Fürst Rainer. »Versprochen?«
Die beiden Kleinen versprachen es mit Kopfnicken. Dann hob der Fürst erst seinen Jungen, nachher seine kleine Tochter ins Bett. Noch ein flüchtiger Gutenachtkuß. Er war schon an der Tür, als ihn Renis leises Stimmchen zurückrief.
»Papa!« hauchte sie. »Mama wird keine Ruhe finden.«
»Warum?« fragte der Fürst und konnte sich kaum mehr beherrschen.
Ganz verzweifelt zeigte die kleine Reni auf ihn und klagte ihn an: »Du weinst ja noch, Papa!«
»Unsinn!« fuhr er auf. »Gute Nacht, ich will nichts mehr hören!«
Aber kaum hatte er die Tür hinter sich geschlossen, mußte er sich kraftlos dagegen lehnen. Es waren aber die letzten Tränen, die Fürst Rainer um seine tote Frau Vera vergoß. Von da an waren sie versiegt.
Der Fürst begab sich in sein Arbeitszimmer und suchte die Telefonnummer seines Anwalts und Freundes Dr. Bernhard Waller heraus. Die Kanzlei hatte zu dieser Stunde schon geschlossen, aber in der Wohnung erreichte er ihn. Selbstverständlich war Waller am Nachmittag bei dem Begräbnis gewesen.
»Jederzeit gern zu deinen Diensten«, versicherte der Anwalt, als sich Fürst Rainer der späten Störung wegen entschuldigte.
»Ich suche jemanden, der sich meiner beiden Kinder annimmt. Indem man ihnen Hände und Gesicht wäscht, tut man nicht genug. Bernhard, es eilt! Kommenden Montag werde ich meine Schwiegermutter in der Klinik besuchen. Auf dem Rückweg sehe ich bei dir vorbei und nehme diese Person gleich mit. Ich verlasse mich auf dich, lieber Freund. Honorarfragen spielen keine Rolle. Eine Psychologin, eine Erzieherin oder was weiß ich. Sie muß es verstehen, die Seelen der Kinder vor dem Verkümmern zu bewahren! Bernhard, noch kein Auftrag war so wichtig, noch keine meiner Bitten so inständig!«
Eine kleine Stille in der Telefonleitung. Dr. Waller wußte, welche Verantwortung ihm der Freund damit aufbürdete. Dann sagte er immerhin: »Ich will sehen, was ich in der kurzen Zeit erreichen kann. Was möglich ist, wird geschehen.«
»Danke, Bernhard. Ich weiß, daß du…« Der Fürst verstummte. Er wollte noch sagen, daß der Anwalt und die Fürstin Vera durch herzliche Freundschaft miteinander verbunden gewesen wären, aber seine Stimme versagte ihm.
*
Während der nächsten Tage zog sich der Fürst von allen Menschen zurück. Dem Verwalter, der ihn um einige Entscheidungen bat, trug er mit knappen Worten auf, nach Gutdünken zu handeln. Zu Frau Krausner, der Hausdame auf Schloß Wildberg, sagte er: »Ich werde von nun an in der kleinen Jagdstube essen.«
Frau Krausner verstand nicht gleich, weshalb sie sich vergewisserte: »Mit den Kindern?«
Unmutig wiederholte der Fürst: »Ich sagte, daß ich dort essen wollte. Die Kinder sollen von der Kinderfrau versorgt werden. Ich habe im Augenblick wirklich nicht die Nerven… Bitte, sorgen Sie dafür.«
»Sehr wohl, Durchlaucht«, bestätigte die Hausdame. Allerdings mißbilligte sie diese Entscheidung des Fürsten. Als Frau meinte sie, die Kinder hätten jetzt ihre Mutter verloren und bräuchten um so dringender die Liebe ihres Vaters. Wortlos ging sie, um die notwendigen Anweisungen zu geben.
An den Fürsten kamen nun all die qualvollen Formalitäten heran, die sich durch den Tod seiner Frau ergaben. Außerdem kaufte er telefonisch einen neuen Wagen und engagierte dazu Franz Zellmeyer, einen alterfahrenen Privatchauffeur, einen Mann von fünfzig. Die Zeit drängte, und Fürst Rainer von Wildberg-Kallau wußte, daß er sich nun keinen Fehler mehr leisten durfte.
Da war vor allem seine Schwiegermutter, die Fürstin Thea.
In der Nacht vor der Reise überlegte Rainer von Wildberg immer wieder, welche Botschaften ihm Vera an ihre Mutter aufgetragen hätte.
»Einen Strauß Rosen aus dem Garten«, murmelte der Fürst. »Ja, Vera würde mir Rosen mitgeben. Und wenigstens ein paar Grußzeilen.«
Es war heiß und schwül im Raum. Rainer spürte, wie sein Puls flog, wild und unregelmäßig. Er warf sich qualvoll von einer Seite auf die andere. Das Ringen um ein paar Minuten Schlaf, das Sichvergraben in peinigende Gedanken und das hoffnungslose Suchen nach Auswegen, die es nicht gab, erschöpfte den Fürsten beinahe mehr, als wenn er in dieser Nacht überhaupt nicht zu Bett gegangen wäre.
*
Als Fürst Rainer von Wildberg in das Sprechzimmer des Chefarztes trat, war ihm, als hätte er im Gesicht des Professors ein Erschrecken gesehen. Deshalb fragte er gleich nach einigen Begrüßungsworten: »Wie geht es der Fürstin von Vingenstein?«
Seine Stimme zitterte leise aus Angst vor einer Wahrheit, die er ohnehin kannte. Über das hagere, scharf geschnittene Gesicht von Professor Wernhoff legte sich ein Lächeln: »Ihre Durchlaucht fühlt sich wunderbar. Keine Schmerzen. Guter Dinge und überzeugt, die Klinik in etwa drei Wochen verlassen zu können.«
Nur einen Augenblick lang erlag der Fürst der Illusion, der Professor hätte sich mit seiner ersten Diagnose geirrt. Er fragte: »Die Wahrheit?«
Wunderbarerweise zitterte die Stimme des Professors nicht im geringsten: »Tut mir leid, Durchlaucht. Aber ich fürchte… noch höchstens drei Wochen. Gerade die Hochstimmung könnte das Ende ankündigen.«
Fürst Rainer verließ das Büro des Professors wie in einem schweren Alptraum. Automatisch bewegte er sich weiter und konzentrierte sich geradezu verkrampft darauf, seine Rolle während der nächsten zwei Stunden ohne Pause spielen zu können.
Fürstin Thea erwartete ihn schon. Selbst das kunstvolle Make-up konnte nicht die Totenblässe in ihrem Gesicht verheimlichen.
»Lieber, lieber Rainer!« rief sie und streckte ihm beide Hände entgegen, die er ergriff und erschüttert küßte. Wie schmal waren sie geworden, hager, beinahe durchsichtig zerbrechlich. »Wie freue ich mich! Aber stell dir vor, ich kann wieder nicht mit dir heimkommen. Sie haben an mir noch einmal herumschneiden müssen. Irgend etwas ist nicht ganz in Ordnung. Ich kann meine Beine kaum bewegen, Rainer. Mich tröstet nur, daß ich keine Schmerzen habe.«
Morphium! durchjagte es den Fürsten. Morphium schenkt ihr dieses trügerische Glücksgefühl vor dem Ende! Laut sagte er: »Liebste Mama, du mußt nur noch ein bißchen Geduld haben. Nimm es nicht zu schwer, ich bitte dich! Vielleicht ist es das nächste Mal schon soweit.«
Der Fürst verstummte entsetzt, weil er aus seinen Worten den unbeabsichtigten Doppelsinn heraushörte. Thea von Vingenstein hingegen lachte glücklich, hielt die Hand ihres Schwiegersohns fest wie eine Ertrinkende. Sie litt Angst, das hörte man! Selbst die stärksten Betäubungsmittel konnten ihr den Sinn für die Wahrheit nicht ganz nehmen. Rasch, beinahe hastig, fragte sie: »Wie kommt Vera mit den Kindern zurecht? Sie ist doch gewohnt, daß ich ihr stets in allem Schweren hilfreich zur Seite gestanden habe. Bitte, Rainer, sag Vera, daß ich sehr bald kommen will.«
»Ja, Mama, ich werde es Vera sagen«, preßte der Fürst hervor. Dann spann er seine frommen Lügen weiter: »Vera hat mir einen Brief an dich mitgegeben, und die Rosen hier hat sie eigenhändig noch heute im Morgengrauen für dich geschnitten.«
»Rosen von daheim!« freute sich die Todkranke. »Rainer, ich will heim. Bitte, frag doch den Professor, ob er mich nicht wenigstens auf meine eigene Verantwortung entlassen will! Weißt du, die Ärzte sind manchmal überängstlich, aber ich fühle mich schon so gesund…«
Gleich darauf las die Fürstin das Billet, das Rainer im Namen Veras geschrieben hatte. Plötzlich schwand das frohe Leuchten aus dem schmalen Gesicht der alten Dame. Es verfiel von einer Sekunde zur nächsten, so daß der Fürst schon heimlich zur Alarmglocke tastete. Aber Fürstin Thea murmelte nur: »Hat das wirklich Vera geschrieben? Sie muß sich ziemlich arg an der rechten Hand verletzt haben, denn ihre Schrift wirkt so fremd. Rainer! Sag mir die Wahrheit! Du schuldest mir die Wahrheit in allem, denn ich bin kein unverständiges Kind. Und mich wirft auch so schnell keine böse Nachricht um: Ist Vera ernsthaft verletzt?«
Fürst Rainer versuchte ein amüsiertes Lachen und wunderte sich, wie gut es ihm gelang; aus Liebe zu dieser wunderbaren alten Dame brachte er es zuwege. Zärtlich küßte er die nervös zuckenden Finger und rügte: »Mama, du bist so mißtrauisch. Sag: Habe ich dich schon einmal beschwindelt? Du weißt doch, wie lieb wir dich haben! Vera freut sich schon so sehr auf deine Heimkehr, und erst recht die Kinder! Niemand kann vor dem Einschlafen so wunderbar Märchen vorlesen wie Oma!«
»Ronni und Reni!« Die Fürstin schloß die Augen. Sie sah die Gesichtchen der beiden Enkel vor sich. Ein glückliches, zärtliches Lächeln machte ihre scharf gewordenen Gesichtszüge schön. Ohne die Augen zu öffnen, bat sie beinahe flehend: »Rainer, du mußt es mir versprechen. Wenn ich einmal nicht mehr sein werde, mag geschehen was immer, mag um dich die Welt untergehen: Ronni und Reni müssen für dich das Wichtigste bleiben! Sag ihnen, wie lieb ich sie habe… wie unendlich lieb… die Kinder, Vera, und dich, mein lieber Rainer.«
Die Augen der Kranken waren geschlossen. Im Gesicht vertieften sich die Schatten erschreckend schnell. Der Fürst drückte die Rufklingel, und beinahe im nächsten Augenblick kam schon die wachhabende Schwester. Sichtlich erschrak auch sie, neigte sich über die Fürstin und fühlte zugleich den Puls.
»Ist sie…?« Fürst Rainer spürte plötzlich, wie nahe er dem Ende seiner seelischen und körperlichen Kräfte schon war.
Die Schwester schüttelte den Kopf und lächelte ihm ermutigend zu.
»Durchlaucht ist eingeschlafen«, erklärte sie. »Die Operation, die vielen starken Medikamente. Jetzt noch die freudige Erregung. Erlaucht hat so sehr gewartet.«
Mit einem Kopfnicken dankte Fürst Rainer für diese Worte. Er trat leise ans Fenster, wo er regungslos stehen blieb. So verging viel Zeit. Dann kam der Oberarzt in Begleitung zweier Schwestern ins Zimmer. Er warf einen kurzen Blick auf die Schlafende und trat dann zum Fürsten, zu dem er sagte: »Ich nehme an, es wäre besser, den Besuch für heute zu beenden. Die Aufregung beanspruchte die Patientin zu sehr. Sie schläft, und es wäre gut…«
Rainer Fürst von Wildberg-Kallau verließ das Krankenzimmer. Von der Tür aus warf er einen letzten Blick auf die Frau zurück, die ihm nicht weniger bedeutete als einst seine eigene Mutter.
*
Dr. Bernhard Waller erwartete den Fürsten bereits und führte ihn in seine Privatwohnung, die der Praxis angeschlossen war. Fürst Rainer berichtete mit wenigen Worten über den Gesundheitszustand seiner Schwiegermama und schloß: »Keine Hoffnung, Bernhard. Vielleicht war das heute schon der Abschied für immer.«
Der Anwalt sprach es nicht aus, aber er blickte voll Mitgefühl auf den völlig entnervten Freund und dachte: Du würdest nicht mehr lange durchhalten. Laut sagte er: »Es ist mir gelungen, jemanden zu finden, der – wenigstens nach meiner Überzeugung – genau deinen Erwartungen entsprechen könnte. Fräulein Bonnhaus kommt aus bester Familie. Leider starben vor zwei Jahren ihre Eltern. Auch ein sehr tragischer Fall. Der Vater, ein bekannter Arzt, litt an Lungenkrebs. Die Ehefrau pflegte ihn unter Aufbietung aller Kräfte. Drei Wochen nach seinem Tod konnte und wollte sie nicht mehr leben. Lieber Freund, ich sage dir das nur, damit du erkennst, daß auch andere Menschen mit einem tragischen Schicksal fertig werden müssen.«
Aus Höflichkeit ließ der Fürst seinen Freund zu Ende sprechen. Er war in den erschütternden Erlebnissen der letzten Woche noch zu sehr befangen, als daß ihn das Leid Außenstehender hätte ergreifen können. Als Bernhard Waller schwieg, fragte der Fürst: »Ist Fräulein Bonnhaus reisefertig? Ich akzeptiere selbstverständlich deine Wahl, doch bitte ich mir aus, daß wir das Dienstverhältnis jederzeit lösen können. Wegen der finanziellen Bedingungen…«
»Du wirst sie nicht mehr weglassen«, unterbrach ihn der Anwalt. »Sie ist ein feiner, stiller und unauffälliger Mensch und wird sich bestimmt ganz für das Wohl deiner beiden Kinder aufopfern. Bei deinem Anruf dachte ich sofort… ach so, du bist in Eile. Einen Augenblick, bitte.«
Dr. Waller trug über das Haustelefon seiner Sekretärin auf, sie möge Fräulein Bonnhaus in seine Wohnung herüberbitten. Der Fürst atmete auf. Wenngleich ihn nichts zur Eile drängte, fühlte er sich doch zu erschöpft, als daß er mit irgend jemanden hätte länger sprechen wollen. Sogar die wenigen Worte, die er mit Bernhard wechselte, bereiteten ihm Mühe. Deshalb merkte er es auch gar nicht, daß sein Gespräch mit dem Anwalt erstorben war. Erst als an die Tür geklopft wurde und Dr. Waller eigenhändig öffnete, erwachte Fürst Rainer aus seiner Erschöpfung. Automatisch erhob er sich.
Dann glaubte er, seinen Augen nicht trauen zu dürfen. Er schaute in ein junges, frisches Mädchengesicht. Sehr große, graue Augen waren das erste, das ihm auffiel.
»Das ist Erika Bonnhaus«, sagte der Anwalt und beobachtete genau die Reaktion seines Freundes. »Fürst von Wildberg-Kallau. Ich habe eigentlich schon alles Wesentliche gesagt. Wenn ihr einander erst ein bißchen kennenlernen wollt… ich hätte dringend fünf Minuten in meiner Kanzlei zu tun.«
Erika Bonnhaus hob schnell die Hand, als wollte sie Dr. Waller zu ihrem Schutz zurückhalten. Sie rief: »Onkel Bernhard, ich denke…«
Um die Szene abzukürzen, unterstützte der Fürst ihre Bitte, Bernhard möge im Raum bleiben, und erklärte: »Du mußt nicht davonlaufen, Bernhard. Meine Bedenken – Verzeihung! – sind der Art, daß ich sie vor jedermann aussprechen kann. Du kennst meine Situation. Das Leben auf Schloß Wildberg wird in Zukunft vermutlich ebenso eintönig wie freudlos verlaufen. Möglicherweise wird es mich nicht lange in dem Haus leiden, in dem ich mit meiner Frau… Kurz, ich weiß nicht, ob es klug ist, einer so jungen Dame die beiden Kinder anzuvertrauen.«