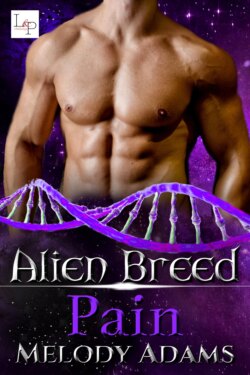Читать книгу Pain - Melody Adams - Страница 6
ОглавлениеKapitel 1
Pain
West-Colony, Eden
28 April 2033 / 03:26 p.m. Ortszeit
Die Zellentür öffnete sich und ich erstarrte. Mein von Schmerzen gepeinigter Körper machte es mir unmöglich zu schlafen und ich hatte wach gelegen seit man mich zurück gebracht hatte. Was konnten meine Peiniger jetzt schon wieder mit mir wollen? Ich hatte nicht einmal die Kraft, mich nach ihnen umzudrehen, doch ich hörte ihre Schritte näher kommen.
„Legt ihn auf das Rollbett“, befahl die mir verhasste Stimme von Dr. Müller. Sie war bei weitem die Schlimmste von denen.
Hände fassten nach meinen Schultern und Beinen und ich wurde hochgehoben. Ich schrie, als der Schmerz durch die Bewegung unerträglich wurde. Man hievte mich unsanft auf das Rollbett und ich sah Dr. Müller, wie sie sich über mich beugte, um mit einer Lampe in meine Pupillen zu leuchten.
„Freu dich, mein Junge“, sagte sie gut gelaunt. „Wir testen heute eine neue Formel und wenn sie wirkt, dann heilen deine Brüche von ganz alleine.“
Ich wollte meine Hände um ihren Hals legen und zudrücken, bis ihre Augen heraus quollen, doch meine Arme und Hände waren mehrfach gebrochen, meine linke Hand vollkommen zertrümmert. Ich war so hilflos wie ein Baby. So hilflos wie mein Sohn, der einzige Grund, weswegen ich nicht gegen meine Peiniger ankämpfte. Wenn ich nicht tat, was sie sagten, dann würden sie ihn foltern. Der Gedanke an den Jungen war das Einzige, was mich am Leben erhielt, mir die Kraft gab, durchzuhalten. Manchmal träumte ich von einem Leben mit meinem Sohn in Freiheit. Dabei hatte ich nicht einmal eine Ahnung, wie diese Freiheit aussehen würde. Was war außerhalb dieser Mauern? Wenn ich im Behandlungszimmer war, konnte ich durch das Fenster nach draußen sehen. Dort gab es mehr Gebäude und eine hohe Mauer. Was dahinter lag, konnte ich nicht sehen.
Die beiden Helfer von Dr. Müller schoben mich aus meiner Zelle. Zumindest schien Dr. Müller mir heute keine weiteren Schmerzen zufügen zu wollen. Ich hoffte, dass diese neue Formel wirklich meine Brüche heilen würde. Wenn ich nur einen Tag schmerzfrei sein könnte, dass ich ein wenig schlafen konnte. Ich war so müde. Wäre da nicht mein Sohn, ich würde am Liebsten die Augen schließen und für immer einschlafen. Der Tod war eine Versuchung, der zu widerstehen mit jedem neuen Experiment schwerer wurde.
„Ist alles in Ordnung mit dir?“, drang Sturdys Stimme an mein Ohr.
Ich wandte mich zu ihm um und begegnete seinem besorgten Blick.
„Ja – mir geht es gut“, versicherte ich. „Ich war nur ... in Gedanken.“
„Wir sollten heute Abend ein Bier zusammen trinken gehen“, schlug Sturdy vor. „Was meinst du?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Warum nicht“, stimmte ich halbherzig zu. Sturdy wollte mir helfen, wie so viele meiner Freunde, doch ich war ein Einzelgänger. Ich wusste, dass ich langsam die Vergangenheit ruhen lassen sollte. Es fiel mir schwer, das zu tun.
„Ich weiß, was dir gut tun würde“, meinte Sturdy.
Ich sah ihn nur an und wusste, dass mein Gesicht nicht gerade Begeisterung ausdrückte.
„Was du brauchst, ist eine Frau!“
Ich schüttelte entschlossen den Kopf.
„Nein, das ist nicht für mich.“
„Warum nicht?“
„Erstens bin ich kein guter Gesellschafter und zweitens will ich keine Frau mehr. Nicht nach ... Ach! Vergiss es!“
„Nicht nach was?“
Nicht nach dem Tod meiner Gefährtin. Man hatte uns zusammen gesteckt, damit wir ein Kind zeugten. Tatsächlich war meine Gefährtin schwanger geworden. Ich hatte mich für sie verantwortlich gefühlt, eine Charaktereigenschaft, die den Alien Breed angeboren ist. Auch wenn wir unter normalen Umständen niemals Gefährten geworden wären – die gemeinsame Zeit in meiner Zelle und die Schwangerschaft, hatten uns zusammen geschweißt. Und ich fühlte mich so schuldig. So schuldig für ihren Tod.
Ich erwachte, weil meine Gefährtin sich neben mir vor Schmerz krümmte. Alarmiert setzte ich mich auf.
„Was ist? Hast du Schmerzen?“
„Was denkst du?“, fuhr sie mich an und krümmte sich erneut.
Hilflos saß ich da, starrte auf sie hinab und versuchte, sie in meine Arme zu ziehen, doch sie stieß mich beiseite.
„Es ist alles deine Schuld. Du hast mir dieses verdammte Kind gemacht! Du hättest dich weigern sollen. Jetzt ... Arrrgh!“
Ich sprang auf und lief zur Zellentür, um dagegen zu hämmern.
„HEY!“, brüllte ich. „HEEEEY!“
Schritte näherten sich der Zellentür!
„Was ist, du verdammtes Tier?“, erklang die wütende Stimme eines Wärters. „Sei gefälligst still, oder wir holen Dr. Müller!“
„Meine Gefährtin! Sie hat furchtbare Schmerzen!“, rief ich verzweifelt. „Bitte“, flehte ich. „Bitte helft ihr!“
„Sieht so aus, als wenn das Vieh zu werfen anfängt“, hörte ich einen zweiten Wärter sagen, dann lachten beide und ihre Schritte entfernten sich.
Außer mir hämmerte ich gegen die Tür.
„Kommt zurück! Ihr verdammten Schweine! Kommt zurück!“
Nach einer scheinbaren Ewigkeit hörte ich Stimmen und Schritte.
„Halte durch!“, sagte ich an meine Gefährtin gewandt. Sie lag zusammengerollt auf dem Bett und stöhnte. Ihre Haut hatte eine ungesund aussehende graue Färbung angenommen.
„Bitte, halte durch!“
Die Schritte stoppten vor der Tür.
„Tritt von der Tür zurück, oder du wirst es bereuen!“, erklang die Stimme des Wärters.
„Okay!“, rief ich und trat ein paar Schritte zurück.
Die Tür wurde geöffnet und vier Wachen kamen mit einem Rollbett herein. Zwei schoben das Bett, die anderen Beiden hatten ihre Betäubungsgewehre auf mich gerichtet.
„Weiter zurück!“, sagte der eine und fuchtelte mit dem Gewehr vor meinem Gesicht herum. Ich ging rückwärts, bis ich die Wand in meinem Rücken hatte.
Meine Gefährtin wurde auf das Rollbett gehievt und aus der Zelle gefahren, dann zogen sich die anderen beiden Wachen zurück und verriegelten die Tür hinter sich. Ich war allein und voller Sorge, was mit meiner Gefährtin geschehen würde.
Drei Tage hörte ich nichts. Wachen kamen und schoben mein Essen durch die Klappe, doch sie beantworteten keine meiner Fragen. Ich war bereit einen Mord zu begehen, doch niemand öffnete die verdammte Tür. Dann, am vierten Tag hörte ich Schritte. Es war erst eine Stunde her, dass man mir Essen gebracht hatte. Was wollten sie jetzt? Würde ich endlich Neuigkeiten von meiner Gefährtin und dem Kind hören.
„Zurück von der Tür!“
„Was ist mit meiner Gefährtin?“, verlangte ich zu wissen.
„Geh zurück, oder wir töten das Kind!“
Mein Herz setzte für einen Moment aus. Das Kind? Mein Kind? Dann hatte meine Gefährtin es wirklich geschafft? Würde man sie nun nicht mehr zu mir zurück bringen, wo wir unseren Job getan hatten?
„Tritt zurück! Letzte Warnung!“
„Okay!“, rief ich. „Ich trete zurück. Tut dem Kind nichts!“
Ich zog mich bis zu meiner Schlafstätte zurück und hörte, wie die Tür geöffnet wurde. Zwei Wachen begleiteten Dr. Müller, welche ein in eine Decke gewickeltes Baby in den Händen hielt. Ich spürte, wie Tränen begannen, meine Wangen hinab zu rollen. Mein Kind. Ich wollte es in meinen Armen halten, in sein winziges Gesicht sehen. Doch ich blieb stehen, wo ich war, aus Angst, sie würden dem Kind etwas antun.
„Gratuliere“, sagte Dr. Müller. „Du hast einen Sohn. Wir sind sehr zufrieden mit dir.“
„Darf ... darf ich es halten – bitte?“, fragte ich hoffnungsvoll.
Dr. Müller schüttelte den Kopf und Ärger und Enttäuschung trieben mir erneut Tränen in die Augen. Ich wollte dieser Hexe mein Kind aus den Armen reißen und weglaufen. Doch ich würde es nicht weit schaffen, wahrscheinlich nicht einmal aus der verdammten Zelle. Ich durfte das Leben meines Sohnes nicht gefährden.
„Bitte. Ich verspreche, dass ich nichts versuchen werde“, versuchte ich es erneut.
„Das ist nicht möglich. Du hast deinen Sohn gesehen und weißt nun, dass es ihn gibt. Wenn du dich gut verhältst und uns keine Zicken machst, dann darf er leben und wir kümmern uns gut um ihn. Solltest du uns Schwierigkeiten machen, wird dein Sohn dafür büßen. – Haben wir uns verstanden?“
Wut und Rage erfasste mich und nur der Gedanke an mein Kind bewahrte mich davor, der Frau die Kehle aufzureißen. Meine Hände ballten sie zu Fäusten, doch irgendwie schaffte ich es, mich unter Kontrolle zu bringen.
„Kann ich ihn wenigstens sehen?“, knurrte ich.
Dr. Müller nickte und schob die Decke etwas zur Seite, so dass ich das rosige Gesicht sehen konnte. Mein Herz wurde eng. Es schmerzte so sehr, mein Kind nicht halten, nicht einmal berühren zu können. Es ging entgegen alle meine Instinkte, untätig stehen zu bleiben.
„Woher weiß ich, dass ihr Wort haltet und es meinem Sohn gut geht?“, fragte ich.
„Wir werden ihn einmal die Woche zu dir bringen.“
„Wo ist meine Gefährtin?“
„Sie hat die Geburt nicht überlebt!“, antwortete Dr. Müller ohne jegliche Gefühlsregung.
„Ihr verdammten Schweine!“, brüllte ich außer mir und vergaß jeden guten Vorsatz, kooperativ zu sein. Ich stürmte vorwärts und kam zu einem abrupten Halt, als einer der Wachen eine Waffe an die Schläfe meines Sohnes hielt.
„Zurück!“, brüllte die Wache mich an.
Langsam wich ich rückwärts. Schmerz, Wut und Verzweiflung nagten an mir. Und diese verdammte Hilflosigkeit. Sie hatten bekommen, was sie wollten. Ein Alien Breed Baby. Und sie hatten mich mehr als je zuvor in ihrer Gewalt. Sogar, wenn ich eine Chance zur Flucht bekommen konnte, ich konnte sie nicht nutzen ohne mein Kind in Gefahr zu bringen. Die Erkenntnis riss mir buchstäblich den Boden unter den Füßen weg und ich sank rücklings auf meine Schlafstelle.
„Morgen beginnen wir ein neues Experiment und ich erwarte, dass du kooperierst. Du weißt jetzt, was auf dem Spiel steht“, sagte Dr. Müller und verließ, gefolgt von den Wachen, das Zimmer.
„Pain?“
Ich schüttelte die Erinnerung ab und begegnete dem besorgten Blick meines Freundes.
„Ich muss ...“, begann ich und fasste mir an die Stirn. „... gehen.“
Ehe Sturdy etwas erwidern konnte, machte ich auf dem Absatz kehrt und eilte davon. Ich lief durch die Häuserreihen bis zum Ende der Siedlung. Dort bog ich auf den Pfad ab, der in den Dschungel führte. Ich wollte allein sein – niemanden sehen müssen. Schuld! Alles, was ich empfand war Schuld – Trauer und Wut.
Julia
Ich blickte von den Pflanzen auf, die ich studiert hatte, als ich Schritte auf dem Pfad hörte. Pain rauschte unweit von mir vorbei, ohne mich wahrzunehmen. Er sah aus, als wäre ein Ungeheuer hinter ihm her. Seit ich seine Geschichte kannte, musste ich immer wieder an ihn denken. Er war nicht gerade ein gesprächiger Typ, doch er hatte mir einmal süße, affenähnliche Tiere gezeigt, die man Bajakas nannte. Ich hatte mich ein wenig in Pain verliebt, doch er machte es mir nicht gerade leicht. Zwar hatten wir das eine oder andere Mal ein paar Worte gewechselt, doch er gab sich immer zurückhaltend, ja, beinahe reserviert. Ich wusste, dass er ein Einzelgänger war, noch dazu einer, der von seiner furchtbaren Vergangenheit her eine Menge seelischen Müll mit sich rumtrug. Ich täte wahrscheinlich besser daran, ihn zu vergessen, doch das war leichter gesagt, als getan.
Ohne weiter darüber nachzudenken, was ich tat, erhob ich mich und folgte Pain nach. Vielleicht brauchte er jemanden zum Reden. Es war nicht gut, seine Probleme allein bewältigen zu wollen, doch wie ich von meiner Freundin Jessie erfahren hatte, weigerte er sich, mit einem Therapeuten zu reden.
Es dauerte eine Weile, bis ich Pain eingeholt hatte. Er hatte es offenbar ziemlich eilig. Plötzlich blieb er stehen und drehte sich zu mir um.
„Was willst du hier?“, fragte er mürrisch. „Du solltest nicht allein in den Wald laufen. Es gibt viele gefährliche Tiere hier. Wenn du einen Begleiter für deine Touren brauchst, sollest du dich an Sturdy oder Steel wenden. Die führen dich sicher gern herum.“
Das waren mehr Worte als ich jemals zuvor aus seinem Mund gehört hatte. Er schien ärgerlich und aufgebracht. Seine braunen Augen blitzten mich an und sein ganzer Körper schien angespannt, als stünde er kurz vor dem Explodieren.
„Ich sah dich auf dem Pfad und dachte ...“, begann ich kläglich.
„Dachtest was? Das du dich an mich dran hängen kannst?“
„Du brauchst nicht gleich so garstig zu werden“, konterte ich aufgebracht und verletzt. „Ich sah, dass du vor etwas davon läufst und dachte, dass du jemanden zum Reden gebrauchen könntest.“
„Ich brauche niemanden!“
„Fein!“, schnappte ich und machte auf dem Absatz kehrt, ärgerlich die Tränen abwischend, die mir aus den Augen rollten.
„Ich bring dich zurück!“, murrte Pain und kam hinter mir her.
„Danke, aber ich BRAUCHE NIEMANDEN!“, stieß ich bitter und verärgert hervor.
Doch Pain ließ sich nicht abschütteln. Er folgte mir den ganzen Weg bis zur Siedlung zurück.
„Bleib in der verdammten Siedlung, wo du sicher bist oder besorge dir eine Wache“, sagte er grimmig, als der Pfad sich auf den Hauptweg hin öffnete.
Ich wandte mich zu ihm um.
„Keine Sorge! Ich werde dich ganz sicher nicht mehr belästigen!“
„Gut!“
„Arschloch!“, murmelte ich, als ich den Weg am Clubhaus vorbei marschierte. „Verdammtes Arschloch!“
Pain
Ich starrte Julia hinterher, wie sie wütend den Weg entlang stapfte. Sie war verletzt, ich hatte die Tränen in ihren Augen gesehen. Es war besser, wenn sie Abstand von mir hielt. Besser für sie und besser für mich. Es sollte mir also recht sein, dass ich ihr wehgetan hatte – das würde sie fern halten. Doch aus irgendeinem Grund wollte ich nicht, dass sie weinte und schon gar nicht meinetwegen. Sie mitten im Dschungel zu treffen hatte mich aus zwei Gründen wütend gemacht. Erstens hatte ich mit meinen Gedanken allein sein wollen und zweitens hatte sie sich in Gefahr gebracht. Der Gedanke, was ihr alles hätte zustoßen können verschaffte mir ein seltsames Gefühl in der Brust. Sie hätte den Jinggs in die Hände fallen, oder von einem wilden Tier angefallen werden können. Es war nicht sicher allein, und noch dazu als schwache Frau, in diesen Wäldern. In der Siedlung waren Wachen, die ihre Runden liefen und die Hunde, die Alarm schlugen, wenn sich jemand oder etwas näherte, und es gab hohe Zäune, die es Wildtieren erschwerten, sich ins Dorf zu schleichen.
Mit einem Seufzen wandte ich mich ab und lief zurück in den Wald. Ich hatte genug von unerwünschter Gesellschaft. Manchmal blieb ich mehrere Tage fort. Es war ein gutes Gefühl, sich frei zu bewegen. So viele Jahre hatte ich in meiner Zelle verbracht und mir vorgestellt, wie es sein würde, frei zu sein. Die einzigen Lichtblicke in meiner Gefangenschaft waren die kurzen Besuche meines Sohnes gewesen.
„Erzähl mir! Was hast du die letzte Woche gemacht?“, fragte ich meinen Sohn. Er war jetzt etwa vier Jahre alt, doch er wirkte nicht viel älter als ein zweijähriger. Die Ärzte sagten, er hätte einen Gen-Defekt und war wertlos. Sie ließen ihn nur deshalb am Leben weil sie ihn als Druckmittel benutzen konnten, um mich daran zu hindern, gegen sie zu rebellieren.
„Ich war drei Mal draußen“, erwiderte mein Sohn. Normalerweise wurde er nur ein Mal pro Woche nach draußen in den Hof gelassen. Es war kein schönes Leben, das er führte, doch es war zumindest besser, als meins. Man hatte mir sein Zimmer gezeigt, als wir einmal auf dem Weg in den OP waren. Es war groß und hatte ein Fenster, wenngleich es auch vergittert war. Er besaß einen verschlissenen Teddybär, den einer der Wärter ihm mitgebracht hatte und einen Ball, mit dem er bei seinem Freigang im Hof spielen durfte. Außer ein paar Bluttests und anderen schmerzfreie Tests, ließen sie ihn in Ruhe, doch ich hatte keine Zweifel, dass sie ihm wehtun würden, sollte ich bei ihren Versuchen nicht mitspielen. Morgen würde ein neuer Versuch gestartet werden, deswegen hatte man meinen Sohn einen Tag eher zu mir gelassen. Sie schienen nicht zu wollen, dass er mich sah, wenn ich von den Versuchen beeinträchtigt war.
„Drei Mal?“, fragte ich und strich ihm über das schüttere rote Haar. „Das ist gut, nicht wahr?“
Mein Sohn nickte.
„Und ich hab ein Eichhörnchen gesehen.“ Er beschrieb mir in allen Einzelheiten, wie das Tier ausgesehen hatte. Wie einer der Wärter das Eichhörnchen mit Nüssen angelockt hatte. Die Beschreibungen meines Sohnes, wie es außerhalb meiner Zelle aussah und was er erlebt hatte, waren meine einzige vage Vorstellung von Freiheit. Wie wenig dies mit der wirklichen Freiheit zu tun hatte, sollte ich erst Jahre später erfahren, wenn man mich nach Eden bringen würde.