Schrift, Wort und Ikone
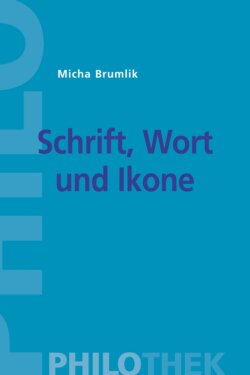
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Micha Brumlik. Schrift, Wort und Ikone
Schrift, Wort und Ikone
Inhalt
Vorbemerkung zur zweiten Auflage
Vorwort Jüdisches Denken oder Denken des Judentums?
I. Zwei Formen des Monotheismus
II. Vom theologischen Sinn des Bilderverbots
Kultzentralisation und Buchreligion
Das ungeschriebene göttliche Wort
Die Bilder des Herzens
III. Das Lächeln Gottes
Schamloses Lachen ?
Trauer, Freude und Nähe
Das Schweigen des Meeres, die Schrift und der Atem
IV. Spinozas unmittelbarer Gott
Spinozas Jesus
Spinozas Christologie
Spinoza am Anfang des deutschen Idealismus
V. Levinas’ Ethik des Antlitzes
Erinnerung an Kant
Egalitäre und paternalistische Ethiken
Asymmetrie als Charakteristikum jeder sozialen Erfahrung
Eine Theorie asymmetrischer Sprache: Eugen Rosenstock-Huessy
Antlitz, Geisel und Spur
Mitleidsethik und Theologie
Anmerkungen
Отрывок из книги
Micha Brumlik, geboren 1947 in Davos, Schweiz, lehrte Erziehungswissenschaft u.a. in Hamburg und Heidelberg. Seit 2000 ist er Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. mit dem Schwerpunkt »Theorie der Erziehung und Bildung«. Daneben leitete er in Frankfurt von 2000 bis 2005 als Direktor das Fritz Bauer Institut, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocausts.
Zahlreiche Veröffentlichungen bei Philo & Philo Fine Arts, zuletzt Aus Katastrophen lernen? (2004) und Advokatorische Ethik (2004).
.....
Das Denken des Judentums besteht in der Entfaltung des Glaubens an den einen, gestaltlosen und geschichtsmächtigen Gott, dessen Taten und Worte zum Buch wurden. Nach dieser vorläufigen Bestimmung wäre etwa Walter Benjamin mit seinen »Geschichtsphilosophischen Thesen« sehr wohl ein jüdischer Denker gewesen, obwohl und gerade weil er im Unterschied zu seinem Freund Gershom Scholem kein Zionist war, während die Heideggerschülerin Hannah Arendt, die eine Zionistin war und ein durchaus gelebtes Verhältnis zur jüdischen Tradition hatte, das prägnante Beispiel für eine Jüdin abgibt, deren aristotelisch-existentielles, aus der griechischen Philosophie gespeistes Denken sich soweit wie nur möglich vom Denken des Judentums entfernt hat. Diese These sei zunächst anhand zweier genealogischer Skizzen verdeutlicht.
Der politische Pädagoge Platon hat in seinem Werk über den Staat bekanntlich ein Erziehungswesen abgelehnt, in dem Kinder und Jünglinge in affirmativer Weise mit der Götter- und Mythenwelt des von Platon selbst so geliebten Homer vertraut gemacht werden. Dies solle sogar dann nicht geschehen, wenn diesen Mythen in irgendeinem Sinne ein höherer allegorischer Sinn zukäme. Welcher Art die prinzipiell höhere Wahrheit der Mythen sein könnte, verschweigt Platon. Daß die Geschichten, die diese Wahrheiten verhüllen, auch von Kindern geliebt werden, hat er selbst einbekannt. Das Grausame und das Unschickliche, das Abgründige und das Erschreckende – all dies möge in gewisser Weise einen höheren Sinn enthalten und sei doch zu vermeiden: »Denn der Jüngling ist nicht imstande zu unterscheiden, was dieser verborgene Sinn ist und was nicht; aber was er in diesen Jahren in seine Vorstellung aufnimmt, das pflegt schwer auszuwaschen und umzuändern zu sein.«23
.....