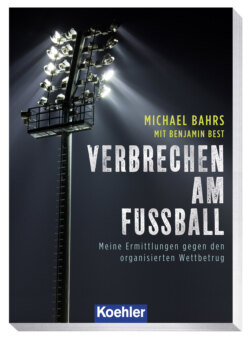Читать книгу VERBRECHEN AM FUSSBALL - Michael Bahrs - Страница 8
ES BEGANN MIT EINER LÜGE – MEIN WERDEGANG BEI DER POLIZEI
ОглавлениеBei der Polizei geht es immer ehrlich zu. Diese landläufige Meinung hatte auch ich, mehr noch: Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen, schließlich war mein Vater, ein grundanständiger Mann, Polizist. So wie er, charakterfest und ehrlich, wollte auch ich sein, von Kindesbeinen an. Ganz klar, dass ich ebenfalls Polizist werden wollte. Mit aller Macht. Als es dann so weit war, wurden meine idealistischen Vorstellungen einer harten Prüfung unterzogen, denn ich merkte gleich zu Beginn: Auch bei der Polizei ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch bei der Polizei wird gelogen.
Doch das hielt mich nicht ab. Im Gegenteil: Jetzt erst recht! – Aber der Reihe nach …
Eigentlich habe ich immer gehofft, der 28. Februar 1972 sei ein Samstag gewesen. Ich redete mir ein, dass ich an eben diesem Samstag Punkt 18 Uhr das Licht der Welt erblickt hätte: zur besten »Sportschau«-Zeit. Leider musste ich später feststellen, dass mein Geburtstag auf einen stinknormalen Montag gefallen war.
Vielleicht waren aber wenigstens am Tag meiner Geburt herausragende Ereignisse geschehen, die gemeinsam mit mir bis heute unter einem guten Stern stehen. Sepp Maier, der legendäre Nationaltorhüter, ist an einem 28. Februar geboren, zwar nicht 1972, aber immerhin
Womöglich gibt das Jahr 1972 mehr her, womit ich mich identifizieren könnte – und da kommen wir der Sache schon näher. Der Friedensnobelpreisträger Willy Brandt war Bundeskanzler – für mich ein Mann des Mutes. Mein geliebter HSV wurde nicht deutscher Fußballmeister (sondern Bayern München), aber immerhin gewannen die Glasgow Rangers den Europapokal der Pokalsieger – ein Club, mit dem den HSV eine jahrzehntelange Fanfreundschaft verbindet und der mit dem Motto »No Surrender« eine Einstellung der Hartnäckigkeit pflegt, die mir sehr gut gefällt.
Vor etlichen Jahren habe ich einen Spruch von Alexander Graham Bell gelesen, der sich mir ins Gedächtnis eingebrannt hat: »Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahinführt, wo andere bereits gegangen sind.«
Was treibt mich an? Warum lehne ich mich nicht zurück? Warum bin ich seit eh und je eine »Heißkiste«, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt? Könnte das Leben nicht einfacher sein, wenn man sich nicht immer aufreibt?
Ja, vielleicht. Vielleicht wäre es auf den ersten Blick »einfacher«.
Das Leben ist aber nicht einfach. Menschen sind nicht einfach. Der Mensch muss sich selbst wohlfühlen. Ich glaube, dass unser ureigener Antrieb eine gesunde Selbstzufriedenheit ist. Mir halten Leute oft vor, dass meine Ansprüche an mich und andere zu hoch seien. Das mag ja sein, allerdings doch wohl nur aus deren Sicht. Und wenn diese Menschen für sich selbst entscheiden, sich mit weniger zufriedenzugeben, dann ist das völlig in Ordnung.
Ich bin da tatsächlich anders. Dieses Anderssein verfolgt mich schon mein gesamtes Leben. Im Guten wie auch im Schlechten. Aber das muss ich akzeptieren, und das habe ich auch (inzwischen) akzeptiert.
Ich bin ein richtiger Dortmunder Junge, aufgewachsen in Dortmund-Kirchlinde, genauer gesagt: in der Zechensiedlung Hangeney. Der Hangeney ist für mich das Synonym einer großartigen Kindheit. Hier spielte das Leben. Dort lebten alle irgendwie zusammen. Ich durfte mit meiner Familie und meinen Freunden Teil dieser Gemeinschaft sein.
Im menschlichen Zusammenhalt ist der Hangeney vielleicht vergleichbar mit dem Viertel Little Italy in Manhattan, nur kleiner, noch familiärer – und ohne Mafia. Meine besten Freunde leben dort immer noch oder zumindest ganz in der Nähe.
Ich bin weitgehend bei meinen Großeltern väterlicherseits aufgewachsen. Meine Eltern waren beide berufstätig, und so kümmerten sich die Großeltern um mich. Irgendwann wollte ich da nicht mehr weg. Mein Opa war Bergmann, wie die meisten Männer im Hangeney. Wir wohnten in der Hangeneystraße 40, im Zentrum des Hangeney.
Wenn ich an alte Schwarz-Weiß-Fotos denke, fallen mir spontan Bilder und Szenen aus meiner Kindheit ein. Mein Vater und mein Opa trugen Rollkragenpullis und Schlaghosen und hatten meist einen Glimmstängel im Mundwinkel. Oma gab sich immer große Mühe, äußerst attraktiv in die Kamera zu lächeln. Und meine Mutter posierte mit Retro-Frisur und einem halblangen Kittel vor einer Tapete, bei deren Betrachtung einem heute schwindelig werden würde.
Meine Oma und mein Opa haben mich erzogen. Wahrscheinlich haben wir uns wie in den meisten Familien auch mal gestritten und uns böse Worte an den Kopf geschmissen, doch eines ist heute die Basis aller meiner Erinnerungen: Ich habe bedingungslose Liebe erfahren! Und bedingungslosen Rückhalt!
Bei meinen Großeltern hatte ich alle Freiheiten, viel mehr als meine Freunde. Aber ich hatte auch meine Pflichten. Eigentlich war es nur eine Pflicht. Ich sollte die Schule ernst nehmen. Nein, ich war kein besonders guter Schüler, aber ich war eben auch kein schlechter.
Schon ziemlich früh stellte ich das System Schule infrage. Weil mir die Gerechtigkeit fehlte. Auch so ein Begriff, den man kaum definieren kann. Was ist denn Gerechtigkeit? Streiten wir uns nicht täglich, weil wir uns irgendwo ungerecht behandelt fühlen?
In der Schule führte das dazu, dass eine meiner Lehrerinnen beim Elternsprechtag meiner Oma sagte: »Ich traue mich gar nicht, dem Michael eine Drei zu geben, dann kommt er sofort und möchte es mit mir ausdiskutieren.« Die Lehrerin lächelte bei dieser Aussage, meine Oma übrigens auch, und nach dem Verlassen des Klassenraums tätschelte sie mir den Kopf und zwinkerte mir zu.
Ich war wohl schon immer auf der Suche nach Gerechtigkeit. Obwohl diese Suche nie endet und ich selbst ja auch ständig ungerecht bin, treibt mich das an. In unserer Abschlusszeitung der Realschule sollten wir unseren besten Freund mit einem Gedicht von der Schule verabschieden. Ich hatte drei beste Freunde. Meinen Opa und zwei Schulkameraden, mit denen ich von 1972 an Tür an Tür lebte und zu denen ich auch heute noch einen Kontakt pflege, wie es nur Freunde können.
Einer dieser Freunde schrieb folgende Zeilen über mich »… werden möcht’ er Polizist, weil er ein Gerechter ist …« Bis heute freue ich mich über diesen kleinen kindlichen Vers, denn so haben mich meine Freunde wahrgenommen. Es macht mich stolz, als jemand gesehen zu werden, dem Gerechtigkeit wichtig ist. Wenn man diesen Weg geht, stößt man aber ganz oft an seine Grenzen.
Polizist werden! Dieser Wunsch war sehr früh da, im Prinzip schon im Kindergarten. Mein Vater und mein Onkel waren Beamte der Schutzpolizei, da wollte auch ich hin. Doch diesem Wunsch wurde gleich am Anfang ein Hindernis in den Weg gelegt, das mich wütend und traurig zugleich machte.
1988 habe ich mich nach dem Abschluss der Realschule bei der Polizei beworben. Die Aufnahmeprüfung in Münster hatte ich bestanden, der Leiter, der die Tests durchgeführt hatte, verabschiedete mich mit den Worten: »Dann sind wir ja jetzt Kollegen.« Am nächsten Tag stand nur noch eine Hürde an: die ärztliche Prüfung. Ich hatte keinerlei Zweifel, dass ich auch die meistern würde. Mein Vater war allerdings skeptisch. Er sagte, wenn bestimmte Quoten landesweit erfüllt, also alle Planstellen besetzt sind, dann wird es zum Glücksspiel …
Ich fuhr wieder nach Münster, absolvierte die Untersuchungen und dachte: Das war’s! Das war’s auch, allerdings anders, als ich gedacht hatte. Ich bekam den Bescheid, dass ich den Augentest nicht bestanden hätte, ich hätte Schwächen beim räumlichen Sehen. Dazu muss ich sagen, dass nicht Ärzte den Sehtest durchgeführt hatten, sondern Sanitäter von der Polizei. Das waren Polizisten.
Dieser Bescheid war niederschmetternd. Als ich den Raum verlassen hatte, brach für mich eine Welt zusammen. Ich rief zu Hause an, mein Vater holte mich ab. Noch am gleichen Tag fuhren wir zu einem Augenarzt. Dort machte ich die entsprechenden Tests noch einmal, sogar unter verschärften Bedingungen. Der Augenarzt bescheinigte mir, dass ich diesen Mangel, von dem die Polizeisanitäter gesprochen hatten, mit Nutzung von Kontaktlinsen oder einer Brille überhaupt nicht hatte.
Den Befund des Augenarztes schickte ich zum zuständigen Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP). Nach einigen Wochen wurde ich erneut eingeladen. Wieder der gleiche Sehtest, wieder mit Polizeisanitätern, wieder das gleiche Ergebnis: nicht bestanden. Ich wies auf die Diagnose und das Schreiben meines Augenarztes hin und bekam die Antwort: »Wir wissen ja nicht, wie gut du deinen Augenarzt kennst.« Die schickten mich also wieder eiskalt nach Hause. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, weil alles mit einer Lüge angefangen hatte.
Nachdem mein Traum von einer Laufbahn im Polizeidienst offenkundig gescheitert war, stellte sich die Frage: Was sollte ich nun machen? Ich bewarb mich wahllos für irgendwelche kaufmännischen Berufsausbildungen. Außerdem fuhr ich mit meinem Vater zur Uniklinik. Dort ließen wir uns ein kostenpflichtiges Gutachten eines Professors erstellen, Kostenpunkt: 250 Mark. Der kam zu dem Ergebnis, dass ich die Voraussetzungen für den Polizeidienst erfüllte – und zwar um Längen über den üblichen Rahmen hinaus.
Dieses Gutachten schickte ich wieder nach Münster, wurde erneut eingeladen – und mit der gleichen »Diagnose« erneut abgewiesen. Selbst das Gutachten eines Professors reichte den Sanitätern nicht aus.
Ich war am Boden zerstört. Wieder wurde ich angelogen, wieder betrogen. Ein junger Mann, der voller Idealismus steckte und Polizist werden wollte. Und den betrügen ausgerechnet seine Vorbilder, die Hüter von Recht und Gesetz.
Inzwischen hatte ich eine Lehre als Speditionskaufmann begonnen. Gleichzeitig schrieb ich mit meinem Vater einen Brief an den Innenminister von Nordrhein-Westfalen und schilderte den Sachverhalt. Meine Quintessenz lautete: Es sei sehr traurig und schade, dass in NRW offensichtlich nur Supermänner bei der Polizei angenommen werden.
Nach einiger Zeit bekam ich vom Innenministerium ein Schreiben, ich solle mich bei der Universitätsklinik Münster vorstellen. Deren Ergebnis sei für den Polizeidienst bindend.
Wieder fuhr ich nach Münster, in der Hoffnung, dass es diesmal klappte.
Der Test war sehr langwierig. Die Ärzte durchleuchteten meine Augen regelrecht – und kamen ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass die Typen von den Polizei-Sehtests offenbar selbst einen Sehtest bräuchten. Laut Uni-Klinik waren meine Augen voll polizeitauglich.
Dieses Ergebnis habe ich samt einer Kopie des Schreibens vom Innenministerium an die LAFP Münster geschickt. Und die fragten dann tatsächlich bei mir an: »Waren Sie nicht schon mal hier?«
Ich sprach mit meinem Chef bei der Spedition. Der hatte Verständnis, weil er auch mal Polizist hatte werden wollen und offenbar ähnliche Erfahrungen machen musste. Jedenfalls ließ er mich aus meinem Lehrlingsvertrag raus.
Das ganze Theater hatte etwa zwei Jahre gedauert …
Mein Dienstantritt war im Oktober 1991 in Bochum. Wieder musste ich zum Medizintest. Mir war schon richtig schlecht: Was passiert eigentlich, wenn die dich wieder ablehnen? Den Lehrlingsvertrag bei der Spedition hatte ich ja gekündigt. Ich stünde dann richtig im Regen. Doch diesmal klappte alles. Zwei Wochen später war ich in der Ausbildung zum Polizeibeamten. Dabei lernte ich 1993 meine heutige Frau kennen.
Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre. Damals war es in NRW so: Entweder musste man nach Beendigung der Ausbildung zur Rheinschiene, das heißt Sicherung von gefährdeten Objekten im Regierungssitz Bonn/Köln. Oder zum Einsatz in einer Hundertschaft. Ich habe mich für die Rheinschiene entschieden und kam zum Kölner Flughafen. Ich gab mir große Mühe und war sehr eifrig mit Überprüfungen, weil ich mehr machen wollte als nur da herumzustehen.
Also stellte ich gestohlene Fahrzeuge sicher und vollstreckte aufgrund meiner Überprüfungen Haftbefehle. Das führte dazu, dass ich auch in Zivil meinen Dienst machen konnte, außerdem stellte man mir einen konspirativen Bauwagen zur Verfügung. Der stand da, und ich hockte drinnen mit einem Fernglas und konnte Personen überwachen beziehungsweise aufspüren.
Es gab auch grenzüberschreitende Erfolge, zum Beispiel mit Holland. Dabei musste ich das erste Mal erfahren, wie es ist, bei der Polizei gegen den Strom zu schwimmen. Gewöhnlich hat man beim Objektschutz zu funktionieren. Objekt bewachen, fertig! Und wenn man Berufsanfänger war, sowieso. Mir reichte es aber nicht aus, nur zu funktionieren. Und so ein Objekt kann man so oder so überwachen: Entweder ich »überwache« es, indem ich es anstarre, oder ich überwache es und kontrolliere Personen, Fahrzeuge, Taschen usw. Ich wollte mehr. So kam es, dass ich bei den älteren Kollegen einen schweren Stand hatte. Viele der jüngeren Kollegen fanden meine Art gut, trauten sich aber nicht, das auch so anzugehen. Mir waren die anderen egal.
Das ging ein Jahr lang so, ich fuhr jeden Tag mit einer Fahrgemeinschaft von Dortmund nach Köln. Dann wurde ich nach Bochum versetzt, in den sogenannten Wach- und Wechseldienst. Mein Fernziel war es, zum zivilen Einsatztrupp zu kommen, zuständig für den Bereich der Straßenkriminalität – Drogen, Einbrecher, Räuber etc. Ich wollte lieber Verbrecher fangen, als den Verkehr zu kontrollieren. Mein Vater machte das auch. Und siehe da: Nach zweieinhalb Jahren fragte man doch tatsächlich bei mir an, ob ich nicht zum zivilen Einsatztrupp wechseln wollte.
Ich hatte also meinen Ruf als Heißkiste erfolgreich aufgebaut. Vielen Kollegen ging ich durch meine Art, immer etwas bewegen zu wollen, auf die Nerven. Manche wollten sogar nicht mehr mit mir im Streifenwagen fahren. Das war manchmal schon frustrierend, weil ich anders war als die. Und das bekam ich oft genug auch aufs Brot geschmiert.
Ich orientierte mich also an denen, die mit mir auf einer Wellenlänge waren. Zudem hatte ich das Glück, dass mein direkter Vorgesetzter mit mir auf einer Linie war. Dieser Dienstgruppenleiter hatte mein Potenzial erkannt und bestärkte und förderte mich. Ohne solche Leute hat man im Polizeidienst keine Chance. Dann ist es fast unmöglich, Arbeitszufriedenheit zu erzielen. Ich würde sogar behaupten, es macht einen ansonsten krank.
Ich war immer der Jüngste, wo ich auch hinkam. Auch in dieser zivilen Einsatztruppe musste ich mich zurechtfinden. Es war eine homogene Truppe, acht bis zehn Leute. Es ging überwiegend um Drogenkriminalität, um Raubdelikte, Straßenkriminalität, Observationen. Da war es schon wichtig, dass man einen Draht zu Ganoven aufbaut, damit man Tipps bekommt.
Das ging etwa fünf Jahre so, dann wurde eine Stelle im Bereich der Organisierten Kriminalität ausgeschrieben. Das Besondere daran war, dass es bei diesem Job nur um ein Jahr ging. Trotzdem wechselte ich, als die mir sagten, du kannst kommen.
Das war zur damaligen Zeit ein Novum. Ich war kein gelernter Kriminalpolizist, hatte nur die erste Fachprüfung absolviert (die Kollegen von der Kriminalpolizei haben fast alle die zweite Fachprüfung abgelegt) und war zudem noch sehr jung für so einen Job. Deshalb war es auch wie ein Sechser im Lotto, als ich nach diesem einen Jahr gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, länger zu bleiben. Ich hatte zu der Zeit einen herausragenden Bärenführer, wie man bei der Polizei erfahrene Beamte nennt, die sich junger Kollegen annehmen, zur Seite gestellt bekommen. Durch seine Unterstützung und Fürsprache konnte ich von nun an unbefristet bleiben.
Anfangs waren wir zwölf Leute im Kommissariat 21, wir bearbeiteten Rauschgiftdelikte. Später wurden wir zusammengelegt mit dem Kommissariat 22, das seinerzeit für deliktsübergreifende Organisierte Kriminalität – kurz OK – zuständig war. Darüber hinaus gehöre ich seit 2005 der Mordkommission an. Eine Uniform habe ich zuletzt 1996 getragen.
Mein jetziger Dienstgrad ist Kriminalhauptkommissar (KHK), mehr geht nicht. KHK ist Ende der Fahnenstange, weil ich nur die erste Fachprüfung absolviert habe. Doch ich fühle mich gut aufgehoben, ich möchte nichts anderes machen.
Dienstgrad, Beförderung, Hierarchien waren mir immer egal. Zumindest waren sie nie mein Antrieb. Selbstverständlich konnte ich manche Beförderungen nicht nachvollziehen, schon gar nicht, wenn das Leistungskriterium – sagen wir es mal vorsichtig – eine eher untergeordnete Rolle spielte. Ich erkannte schnell, dass man das ertragen muss und nur geringen Einfluss darauf hat, ob man gut beurteilt und dadurch vielleicht schneller befördert wird. Ich habe meine Leistung gebracht, und wenn man die anerkannte, war ich stolz, und wenn nicht, na, dann halt nicht.
Natürlich gab es Erlebnisse der schlimmen Art. Erlebnisse, die ich nie vergessen werde, etwa die Kopfschuss-Bande. Wir ermittelten gegen russische OK-Täter, die sieben Menschen umgebracht hatten. Der Fall aus dem Drogenbereich beschäftigte uns weit über ein Jahr. Einer von denen hatte in Holland drei Menschen umgelegt. Er geriet unmittelbar nach der Tat in eine Polizeikontrolle, weil ein Rücklicht seines Autos nicht funktionierte. Da hat quasi seine Pistole noch geraucht. Die niederländischen Kollegen haben nichts gemerkt. Das war ihr Glück. Sie haben ihm nur gesagt, er solle das Rücklicht reparieren lassen. Hätte der Typ aussteigen müssen, hätte er ohne Zweifel zur Waffe gegriffen und das Feuer auf die beiden ahnungslosen Beamten eröffnet. So aber haben sie ihr Leben ihrer Kulanz zu verdanken. Die Typen haben wir hinterher trotzdem geschnappt.
Ein Fall, der überhaupt keiner war, hat mich richtig aus der Bahn geworfen: Du kommst zu einer Familie, da liegt ein totes Kind, ein Baby, alle weinen. Und du musst deine Arbeit machen und zunächst in alle Richtungen ermitteln. Es war »nur« ein natürlicher Tod, aber für mich ein ganz schlimmes Erlebnis. Die älteren Kollegen sagen immer: »Das ist hart, aber mit der Zeit stumpft man ab.« Ich werde dann wahrscheinlich nie zu den älteren Kollegen gehören: Ich stumpfe an solchen Fällen nicht ab.
Vielleicht kommen mir meine Sprache – die Sprache des Ruhrgebiets – und meine Mentalität bei Kontakten mit Kriminellen zugute. Das sind für mich nicht Menschen zweiter Klasse. Du kommst in eine Gegend, von der du weißt, dass hier alle von der Kriminalität leben, und die wissen, dass du das weißt. Ich kann mit denen reden, die erleben bei mir menschlichen Respekt. Das ist aus meiner Sicht oft der Schlüssel.
Da siehst du einen Hartz-IV-Empfänger in einem dicken Porsche sitzen, du weißt genau, dass da was nicht stimmt. Ich rede mit dem ohne Vorwurf, ohne Vorbehalt. Da kommt man auf eine persönliche Ebene. Das hat schon dazu geführt, dass ich für manche Ganoven Bewerbungen für geregelte und vor allem legale Arbeit geschrieben habe. Ich komme denen nicht als großer Moralist.
Ja, es gibt Straftäter, zu denen ich ein kumpelhaftes Verhältnis aufgebaut habe. Manchmal bekomme ich Briefe aus dem Knast von Leuten, die ich hinter Gitter gebracht habe. Die schreiben mir, dass ich mich mal wieder blicken lassen sollte. Manche machen sogar unter Ganoven Werbung für mich, dass Leute bei mir beruhigt aussagen könnten. Ich würde niemanden reinlegen.
Einige Kollegen sagen, meine Vernehmungen von Tatverdächtigen seien klasse. Die würden sich wie eine Geschichte lesen, ohne das übliche Beamtendeutsch. So muss das aus meiner Sicht auch sein: Ein Vernehmungsprotokoll darf nicht nur eine Inhaltsangabe sein, es muss sich wie eine Geschichte lesen.
Ich mache meine Vernehmungen immer allein, was nicht üblich ist bei der Polizei. Aber so entsteht ein anderes, tieferes Verhältnis zwischen dem Vernehmenden und dem Vernommenen, das der Wahrheit vielleicht näher kommt. Ich erlaube mir dabei auch, Selbstkritik zu üben. Einmal habe ich in einem Vernehmungsprotokoll die Sichtweise des zu Vernehmenden bestätigt. Ich habe geschrieben: »Stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen …« Ich mag keine Oberflächlichkeiten, es muss bei einer Vernehmung nicht nur das nackte Protokoll herauskommen, sondern auch richtiger Inhalt.
Ohne irgendeinen Zweifel kann ich sagen, dass ich Polizist von ganzem Herzen bin, mit Leib und Seele. Ich möchte nichts anderes machen und könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Bei mir dreht sich der ganze Tagesablauf fast nur um die Polizei. Meine Frau ist ebenfalls Polizistin, auch in Bochum. Mein Bruder ist auch Polizeibeamter.
Meine Frau ist meine größte Kritikerin. Sie kennt meine Verbissenheit und kann sehr gut damit umgehen. Sie kann das entkrampfen. Manchmal streiten wir uns über Ansichten, zum Beispiel wenn ich an die Gerechtigkeit appelliere. Dann sagt sie oft: »Ja, hast du schon recht, aber du kannst nicht die ganze Welt retten, du musst auch mal runterkommen.« Zum Teil führen wir unsere Dialoge wie vor Gericht. Argumente finden, Argumente widerlegen etc. Sie ist der Ruhepol, ich bin wie gesagt die Heißkiste.
Auch unsere Tochter interessiert sich dafür, ich glaube, sie ist ziemlich stolz auf uns. Jedenfalls hat sie schon gesagt, dass sie später auch Polizistin werden will oder Staatsanwältin.
Meine andere große Leidenschaft ist neben der Rockmusik (allen voran Bruce Springsteen) der Fußball. Er begleitet mich, seit ich krabbeln konnte. Doch es ist nicht der große Verein meiner Heimatstadt Dortmund, den ich verehre. Nein, ich bin kein Fan von Borussia, sondern von klein auf Anhänger des HSV.
Das war immer meine große Liebe. Ich glaube, das kommt durch unsere Beziehung zum Norden, die Großeltern sind immer gern nach Dänemark in den Urlaub gefahren. Die nördlichste große deutsche Mannschaft war eben der HSV, so erkläre ich mir das. Mein Vater wollte mir ursprünglich den 1. FC Köln näherbringen, aber nicht mit mir. Da hatte ich schon ein Trikot des großen HSV-Stars Kevin Keegan, Rückennummer 7.
Seit über 20 Jahren bin ich HSV-Mitglied, auch nach dem Abstieg in die 2. Liga. Und wenn es nur irgendwie geht, besuche ich die Spiele des HSV im Stadion, auswärts wie zu Hause. Privat kicke ich auch noch, mit Freunden und Kollegen bei den Alten Herren. Position Mittelfeld. Da muss ich nach vorn und nach hinten ackern – mache ich auch gern.
Dass der Fußball nun seit Jahren einen Großteil meines beruflichen Lebens als Polizist bestimmt, ist für mich eine eher bittere Erfahrung. Es schmerzt wie eine große Liebe, die von anderen und von außen sabotiert und zerstört wird.