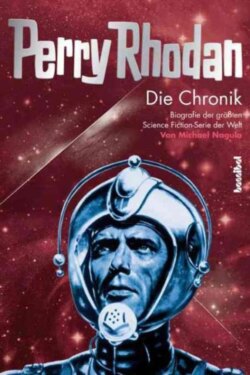Читать книгу Perry Rhodan Chronik, Band 2 - Michael Nagula - Страница 7
ОглавлениеEin Jubelband mit Überlänge
Mit 84 Seiten war der PERRY RHODAN-Jubiläumsband 700, der im Januar 1975 erschien, um ein Viertel umfangreicher als üblich. Als Serviceleistung für den Leser hatte er ein umlaufendes Titelbild und einen Leserbriefanteil von vier Seiten, also von doppelter Länge. Sie brachten einen Ausblick auf den neuen Handlungsbogen, der Aphilie-Zyklus genannt wurde, eine Würdigung der amerikanischen PERRY RHODAN-Ausgabe, die gerade mit dem fünfzigsten Taschenbuch erschienen war, eine Umfrage nach den besten Heften und Autoren der Fantasyserie DRAGON, die Meldung, dass H. J. Bruck den Deutschen Hugo 1975 verliehen bekommen hatte, und einen SF-Witz von Michael Thiesen, damals SF-Fan, inzwischen enger redaktioneller Mitarbeiter von PERRY RHODAN. (Der Leser-SF-Witz im folgenden Heft stammte übrigens von keinem Geringeren als Horst Hoffmann, der schon bald zu den fleißigsten Autoren im erweiterten Perryversum zählen sollte.)
Im Innenteil fand sich die eher unspektakuläre Risszeichnung eines interplanetarischen terranischen Verbindungsschiffes von Rudolf Zengerle, dem Risszeichner der ersten Stunde. Und am Heftende stand ein Verzeichnis »aller« bisher erschienenen Bände – allerdings erst ab Nr. 321 – sowie der erste PERRY RHODAN COMPUTER. Er hatte »Die Aphilie« zum Thema und wurde als Werbemaßnahme, ebenso wie einige weitere Folgen der neuen Einrichtung, auf die Leserseiten von TERRA ASTRA übernommen.
Der Leser konnte spüren, dass sich etwas verändert hatte. Zum ersten Mal seit Jahren vermittelte ein Jubiläumsband wieder eine Art Aufbruchstimmung …
Offizieller Führungswechsel
Es war schon eine Weile her, dass William Voltz die Exposéredaktion für die Handlung der Serie offiziell von K. H. Scheer übernommen hatte. Anfang 1974 hatte er mit dem Exposé für den Jubiläumsband 650 seinen ersten Meilenstein gesetzt, und ein Jahr später schien Cheflektor Kurt Bernhardt endgültig Klarschiff machen zu wollen.
Der Pabel Verlag stand unter der neuen Leitung von Winfried Blach, als Bernhardt am 22. Januar 1975 in einem Rundschreiben an ihn und die Serienautoren verkündete, dass ab sofort alle Kopien der Manuskripte für PERRY RHODAN und ATLAN nicht mehr an Scheer, sondern an Voltz zu schicken seien. Er fügte hinzu, dass auch immer alle Exposés und Manuskripte zu lesen seien. »Nur wenn die Autoren beide Reihen laufend lesen, ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit für beide Serien gewährleistet.«
Am 17. April schickte Bernhardt Voltz einen Verlagsvertrag in dreifacher Ausfertigung, der dessen neuen Status als verantwortlicher Exposéautor von PERRY RHODAN bestätigte und sich stark an den früheren Vertrag mit Scheer anlehnte. »Ich bin der Meinung, daß ich alle Ihre Interessen in den Vertrag aufgenommen habe«, schrieb Bernhardt, aber »ich habe ihn noch nicht unterschrieben. Wenn er in Ordnung ist, versehen Sie alle Exemplare bitte mit Ihrer Unterschrift und schicken Sie sie mir zurück.«
Eine lange Entwicklung vom Ideenlieferanten der Sechzigerjahre über die redaktionelle Tätigkeit an allen Fronten hatte damit ihren verdienten Höhepunkt erreicht. Der Wechsel in der Exposéredaktion war jetzt schwarz auf weiß bestätigt.
Abenteuer auf drei Ebenen
Im Zyklus über das Konzil der Sieben hatte die Handlung erstmals wieder einen engeren Zusammenhalt gehabt, auch wenn PERRY RHODAN 699 fast mit einem Cliffhanger endete. Die Abenteuer im Mahlstrom der Sterne und in der Provcon-Faust schienen gerade erst begonnen zu haben. Aber dessen war sich der Exposéautor bewusst.
»Mehr als jemals zuvor sind wir bei der Ausarbeitung der Handlungskonzeption auf Ihre Wünsche und Anregungen eingegangen«, schreibt William Voltz auf den Leserseiten von Band 700. »Ein Teil der Handlung spielt auf der Erde, wo eine Menschheit ohne Liebe mit besonderen Problemen zu kämpfen hat. Mit dieser neuen Thematik halten neue, bisher kaum angewandte Spannungseffekte ihren Einzug in PERRY RHODAN. Es geht um das Verhalten von Menschen auf einer Erde, auf der die Roboter menschlicher sind als die Ureinwohner dieses Planeten. Und es geht um das Schicksal einer kleinen Gruppe von Menschen unter der Führung von Roi Danton, die der Menschheit ohne Liebe helfen wollen.«
Aber das war nur einer von mehreren Schwerpunkten. »Auch auf Weltraumabenteuer brauchen Sie nicht zu verzichten. Mit der SOL, dem gewaltigsten Schiff, das jemals von Menschenhand geschaffen wurde, ist Perry Rhodan aufgebrochen, um die Heimatgalaxis zu erreichen. Auf diesem Flug durch Raum und Zeit wird er in zahlreiche Abenteuer verstrickt und gerät in Konfrontation mit jener Macht, die hinter dem Konzil der Sieben steht.«
Und es gab einen weiteren Schwerpunkt: »Um die Handlung noch abwechslungsreicher, farbiger und spannender zu gestalten, haben wir eine dritte Handlungsebene entwickelt. Dabei geht es um das Schicksal der Neuen Menschheit, die sich unter der Führung von Atlan in der Heimatgalaxis auf besondere Art mit den Problemen auseinanderzusetzen beginnt.«
Der neue Zyklus sollte ständig zwischen diesen Handlungsebenen wechseln.
Medaillon, Provcon-Faust und Balayndagar
Seit jenen schicksalhaften Tagen im Juli 3580, als Terra und Luna durch die Hilfe des Insektenvolkes der Ploohn in eine neue Umlaufbahn eingeschert waren, sind hundertzwanzig Jahre vergangen. So lange bestrahlt nun schon die Sonne Medaillon den Heimatplaneten der Menschheit – eine fremde Sonne, deren fünf- und sechsdimensionale Strahlungskomponenten auf Gene und Psyche der meisten Menschen einen entsetzlichen Einfluss ausüben. Die sogenannte Aphilie beraubt sie ihrer Gefühle.
Als man dies nach vierzig Jahren bemerkt, ist es zu spät. Perry Rhodan und seine Getreuen werden ihrer Ämter enthoben. Die von der Sonne Veränderten beginnen alle normal Gebliebenen zu verfolgen und eine Schreckensherrschaft zu errichten.
Der Jubiläumsband 700 spielt achtzig Jahre danach. Der Anführer der Aphiliker ist Reginald Bull. Er hält die Macht auf Terra in Händen und hat Perry Rhodan mit dem Raumschiff SOL verbannt. In den nächsten fünf Romanen schildern H. G. Ewers, Clark Darlton, Hans Kneifel, Ernst Vlcek und William Voltz, wie einige Immune auf Terra, die sich zu der von Roi Danton geleiteten »Organisation Guter Nachbar« zusammengefunden haben, aus dem Untergrund heraus wichtige Missionen durchführen.
Die besondere Vorliebe von Voltz für Roboter kommt dabei zum Tragen. Frei nach den Asimovschen Gesetzen erweisen sich gerade jene Roboter, deren Positronik nicht über ein Zellplasmateil verfügt, als »menschlich« und retten zahlreiche Leben.
Mit PERRY RHODAN 706 wird auf die Dunkelwolke Provcon-Faust in der Milchstraße umgeblendet, wo es Lordadmiral Atlan im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gelungen ist, ein Staatengebilde aufzubauen, das sich Neues Einsteinsches Imperium oder NEI nennt. Dort hat ein Teil der ursprünglichen Menschheit eine sichere Zuflucht gefunden.
Als das Gerücht die Runde macht, dass die Tage Leticrons, des Ersten Hetrans der Milchstraße, gezählt sind, lässt der Lordadmiral Erkundungen in die von den Laren beherrschten Gebiete der Menschheitsgalaxis durchführen. Auch der USO-Spezialist und Aktivatorträger Ronald Tekener wird aktiv, der damit dauerhaft zu PERRY RHODAN überwechselt – inhaltlich gesehen 736 Jahre nach seinem letzten Auftritt, der in ATLAN 175 erfolgte, einem Roman, der erst drei Wochen vorher im Zeitschriftenhandel gelegen hatte!
Mit Band 710 setzt die dritte Handlungsebene des Zyklus ein: Das Hantelraumschiff SOL mit Perry Rhodan und seinen Getreuen an Bord sucht seit 38 Jahren einen Weg zurück in die heimatliche Milchstraße. Endlich misst man sie an, und die SOL-Zelle 1 landet mit dem Mittelteil auf einem Planeten in der Kleingalaxis Balayndagar, um Vorräte an Bord zu nehmen. Nur: Ein Start ist nicht mehr möglich. Während die SOL-Zelle 2 allein in die Heimat aufbricht, stellt sich heraus, dass die Kelosker, ein Konzilsvolk, das Bordgehirn SENECA auf ihre Seite gebracht haben. Sie sind für das Startversagen verantwortlich.
Aber anscheinend sind die Handlungen der Kelosker von Angst geprägt. Sie bringen das Shetanmargt an Bord, ein technisches Großgerät, in dem ihre gesamte Wissenschaft, Kultur und Historie gespeichert ist – auch die für das Konzil entwickelten Strategien.
Und als SENECA, von Gewissensbissen geplagt, die Kelosker endlich ausmanövrieren kann, ist es eigentlich schon zu spät, denn jetzt zeigt sich, dass ihre Angst alles andere als unbegründet war. Die Große Schwarze Null, das Black Hole im Zentrum Balayndagars, expandiert nämlich und verschlingt ganze Sonnensysteme.
In PERRY RHODAN 717, einem Roman, der während der Apokalypse von Balayndagar spielt, beschreibt Voltz, wie Alaska Saedelaere und Icho Tolot den Rechenmeister der Kelosker, Dobrak, den Einzigen, der das Shetanmargt voll zu nutzen vermag, von einem Planeten abholen und dabei auf ein Raumschiff der Laren treffen, dessen Mannschaft die gleiche Absicht verfolgt. Aber der Rechenmeister folgt den Solanern – auf eine Art geschildert, die wundervoll seine fremde Denkungsart nahebringt.
Die Apokalypse fordert ihren Tribut. Auch die SOL kommt gegen den vernichtenden Sog der Schwerkraft nicht an. Um überhaupt eine Überlebenschance zu haben, bleibt ihr nichts anderes übrig, als mitten in das Black Hole hineinzufliegen …
Info zur Romanserie: Die Kelosker
Ihre rund 3,30 Meter großen Körper wirken monströs und plump und sind von einer grau-gelben Lederhaut überzogen. An eine Schwerkraft von etwa einem Gravo gewöhnt, stehen sie auf kurzen, dicken Laufstummeln und bedienen sich bei der Fortbewegung zusätzlich zweier stummelartiger Gliedmaßen in der Körpermitte. Als Arme besitzen sie 1,80 Meter lange Tentakel, die in jeweils zwei Greiflappen enden und außerdem zur Stützung dienen. Auf zwei Meter breiten Schultern sitzen übergangslos die einen Meter breiten und einen halben Meter hohen Köpfe, aus denen sich vier kegelförmige Knochenwülste – die sogenannten Paranormhöcker – erheben; sie sind mit dem darunter liegenden Großhirn verbunden. Zwei rund vierzig Zentimeter lange Augen ziehen sich rechts und links um den Kopf herum, ein drittes sitzt als Ellipse auf der Stirn, ein viertes unmittelbar darunter. Der vierzig Zentimeter breite Mund der Sauerstoffatmer ist mit farblosen Hautlappen verschließbar.
Als Mitgliedsvolk des Hetos der Sieben sind sie in diesem Machtverbund die rechnerischen Planer und Strategen. Sie können fünf- und sechsdimensionale Zusammenhänge erkennen und definieren und dringen mathematisch sogar in die Bereiche der siebten Dimension vor.
Gefühlsarmut und mutierte Kinder
Ausgerechnet zu Beginn des »Aphilie«-Zyklus, als bei PERRY RHODAN die Gefühlsarmut zum beherrschenden Thema der Handlung wurde, forderte der Verlag die Autoren zu verstärkter Mitarbeit auf. Nach dem Motto: Jetzt aber gefühlvoll.
»Jeder PERRY RHODAN-Autor kann ab Nr. 707 Einzelexposés schreiben. Das Thema muß nur im Rahmen des Zyklus liegen«, heißt es in einem Rundschreiben vom 6. September 1974. »Es ist zweckmäßig, sich vorher telefonisch mit Herrn Voltz in Verbindung zu setzen, um das Thema festzulegen. Die Exposés werden entsprechend honoriert. Damit ist allen Autoren – was sie sich schon seit Jahren gewünscht haben – die Möglichkeit gegeben, aktiv an der Serie mitzuarbeiten.«
Es dauerte eine Weile, bis die Autoren auf diese veränderten Umstände reagierten. Sie waren es gewohnt, den roten Faden der Handlung vorgegeben zu bekommen, und das Einbringen eigener Vorstellungen war eher eine Frage der Interpretation gewesen, nicht so sehr des Inhalts. Als Erster reagierte H. G. Ewers und baute in seinen Doppelband 714/715 sogleich zwei neue Handlungsträger ein: Ulturpf und Kjidder Emraddin, fünf Jahre alt, zwei mutierte Kinder der SOL – die eine kann als Dimensionsgängerin beliebige Existenzebenen aufsuchen, der andere als EPI-Indoktrinator kraft seines Geistes alle elektronischen, positronischen und inpotronischen Vorgänge beeinflussen.
Die Zwillinge werden dem Bordgehirn der SOL allerdings so lästig, dass sie am Ende des Doppelbandes in eine Scheintodstarre versetzt werden, aus der sie nur SENECA wieder befreien kann – beziehungsweise der Exposéautor, wenn er sie neuerlich einsetzen wollte. Was er auch tat. In PERRY RHODAN 717 sorgte er dafür, dass sie sich aus Furcht vor einer kosmischen Katastrophe in eine andere Dimension zurückzogen.
Als Nächster reichte Kurt Mahr ab Dezember 1974 ausführliche Vorschläge für den weiteren Verlauf der Handlung ein, sogar Exposés für ganze Heftumfänge, die William Voltz denn auch als Grundlage für einige Romane des Bruckmühler Autors dienten.
Das neue Verfahren brachte zwar mehr Lockerheit im Umgang mit der Handlung, griff aber nur begrenzt. Recht bald stellte sich nämlich heraus, dass der große Überbau, der rote Faden, an dem sich die Hefte entlang entwickelten, einzig von einem Exposéautor gewährleistet werden konnte, der allerdings das Talent mitbringen musste, die Handlung auf die Fähigkeiten und Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter maßzuschneidern.
Ovarons Tod
Fast sechs Realjahre vorher hatte Ovaron, ein Angehöriger der Cappins aus der Galaxis Gruelfin, in PERRY RHODAN 437 seinen Einstand gegeben. Damals hatte er im Rahmen einer Geheimaufgabe den auf einer Insel inmitten eines Asphaltsees stationierten Zeitläufer kontrollieren und Zeitreisen verhindern sollen. Er war offiziell Chef der Geheimpolizei Golamo, der Streitkräfte und der Energieversorgung der von Lasallo geleiteten Cappingruppe auf Lotron im Tranat-System, wie die Cappins die Erde und das Sol-System nannten.
In den folgenden Romanen 438 bis 449 wird Ovaron seines Postens enthoben, erfährt durch Rhodan von der Bedrohung durch den Todessatelliten, stellt sich bedingungslos auf die Seite der Terraner und kehrt mit ihnen in die Handlungsgegenwart zurück. Sie bringen im Todessatelliten eine Sextadimbombe an, durchbrechen die cappinsche Wachflotte und zünden die Bombe, woraufhin Ovaron feststellt, dass das Sextagonium unwirksam geworden ist, und aus der Vergangenheit neue Vorräte holt. Dabei wird er durch ein Zeitparadoxon gedoppelt, stößt auf Rhodans tot geglaubten Sohn Roi Danton, verändert seine psychische Individualstrahlung und löst schließlich die Explosion der Sextadimbombe aus, die den Todessatelliten zerstört, woraufhin Mausbiber Gucky ihm eigenhändig einen Zellaktivator überreicht.
Ab Band 450 verlagern sich die Abenteuer des Cappins in seine Heimat Gruelfin, die er mit Rhodan und seinem Flaggschiff aufsucht. Die Terraner wollen sich für seine Hilfe dankbar erweisen und verhelfen ihm nach vielen Erkundungen der Galaxis zur Position des Herrschers über das Reich der Cappins und Takerer. Band 460 schildert, wie eine alte Speicherbank auf einem Archivplaneten ihn als einzig rechtmäßigen und echten Ganjo bestätigt.
Bei weiteren Vorstößen entdecken die Freunde den Planeten, auf dem Ovaron vor 200.000 Jahren als Maßnahme gegen seine erbittertsten Feinde, die Takerer, automatische Pedopeilstationen produzieren ließ. Damit konnten sie Terra erst erreichen. Eine Fehlfunktion seiner Tryzom-Körperchen veranlasst ihn nun, gegen seinen Willen einige Verbündete zu übernehmen, aber Rhodan lässt ihn nicht fallen. Gemeinsam zerstören sie die Anlagen der Takerer, in denen Zentauren und Höhlenmenschen gezüchtet wurden, Ahnen der heutigen Menschheit – um die Zukunft eben dieser Menschheit zu ermöglichen.
Bis zum Ende des 400er Zyklus erlebte Ovaron noch fast jede Woche Abenteuer an der Seite Rhodans, bevor er für ein Jahr Realzeit aus der Handlung verschwand. Als er in Band 569 wieder auftauchte, brachte er zur Rettung der Menschheit vor der Verdummung und den Auswirkungen des Schwarms gleich eine ganze Gruppe seines Volkes mit.
Erst in PERRY RHODAN 722 ist wieder von Ovaron die Rede, als Atlan, der Lordverwalter des Neuen Einsteinschen Imperiums, einen Notruf an ihn absetzt. Der Freund der Terraner, dessen monströs veränderter Körper in der verbotenen Zone des Regierungspalastes in einer Nährlösung am Leben erhalten wird, sehnt schon lange den Tod herbei und stirbt nach einer letzten Großtat für sein Volk.
Vier Realmonate später, in Band 738 der Serie, erwähnt der Lordverwalter Atlan in einem Gespräch, dass die Cappins sich einfach nicht rühren und er für das Schweigen nur eine Erklärung habe. Ovaron müsse gestorben sein, weil sein Zellaktivator durch die dimensional übergeordneten Impulse bei der Pedotransferierung geschädigt worden sei.
Info zur Romanserie: Ovaron
Umgerechnet auf terranische Zeit, wurde Ovaron aus dem Volk der Cappins im Jahre 3394 n. Chr. geboren. Er ist 1,96 Meter groß, athletisch und kräftig, hat ein schmales Gesicht mit großer Nase und ein vorspringendes, breites Kinn, hellbraune Haut und bräunliche Augen sowie lange schwarze Haare, die meist von einem Konturreif zusammengehalten werden. Er ist ein vorzüglicher Pedotransferer, kann also seinen Körper mittels technischer Hilfe über weite Strecken in Nullzeit transportieren und fremde Bewusstseine übernehmen. Tryzome, atomar umgewandelte Moleküle in seinem Blut, machen ihn zu einem Tryzom-Tänzer mit der Fähigkeit, zweigleisig zu denken. Sein Körper stirbt im Jahre 3580 n. Chr., aber eine Dekade später stellt sich heraus, dass sein Bewusstsein weiterexistierte. Ein Gänger des Netzes erklärt ihm, dass er die Fehlfunktion seines Aktivators durch seine Fähigkeit der Pedotransferierung überlebte. Der letzte Kontakt zu ihm erfolgt nach weiteren neunzehn Jahren, dann verliert sich seine Spur.
Ein Aufschrei geht durch die Leserschaft
Am 2. Juli 1975 verfasste Cheflektor Kurt Bernhardt ein Rundschreiben an alle Autoren, in dem er feststellte: »Wir erhalten ununterbrochen Kritik und Beschwerden über den PERRY RHODAN-Band Nr. 722, in dem Ovaron seinen Tod findet, obwohl er Träger eines Zellaktivators ist.« Das sei ein »großer Hammer«, und als Schuldige sehe er die Exposéautoren und den Verfasser des Romans: Voltz, Scheer und Ewers. »Ich mache mir natürlich Gedanken, wie solche Fehler in Zukunft zu vermeiden sind, bzw. ich muß eine Organisationsform finden, die solche Fehler unbedingt ausschließt.«
Noch eine Woche später spricht er in einem Schreiben an K. H. Scheer davon, dass es sich um die schlimmste Resonanz der letzten Jahre bei den Lesern handele. Eine Figur, die mit dem Zellaktivator ausgestattet sei, sterben zu lassen, sei eine riesengroße Panne.
Scheer entgegnete, dass ein Aktivatorträger nur biologisch unsterblich sei, durch Unfall, Mord oder Diebstahl des Geräts aber mühelos getötet werden könne. Ewers’ Schilderung in Band 722 sei demnach völlig korrekt gewesen. Er legte eine Liste der Aktivatorträger bei, gültig ab Band 500, die alle Autoren besäßen, auch Ewers, dem man bestenfalls vorhalten könne, dass er Ovaron in dem Roman nicht als Aktivatorträger bezeichnet habe.
Auch Voltz fand in seiner Antwort vom 12. Juli, dass es sich zwar um einen Fehler gehandelt habe, der aber angesichts »des vorliegenden Datenbergs außerordentlich gering ist. Im Verhältnis zu früher ist die Koordination der Handlung besser, die Fehlermenge hat sich nachweisbar verringert. Ausschließen lassen sich solche Widersprüche aber nicht, es sei denn, wir wollten die Autoren in ein noch engeres Schema pressen.«
Zu guter Letzt befand Voltz: »Da weder Herr Schelwokat noch ich entdeckte Fehler an die große Glocke hängen, wissen Sie nicht, was alles ausgemerzt wird!« Allerdings habe er den Autor des entsprechenden Romans gebeten, den Fehler bei nächster Gelegenheit zu korrigieren. Das sei in Band 738 auch in logischer Form geschehen.
Bernhardt musste wohl oder übel einsehen, dass die Leserbeschwerden über Ovarons Tod von der Sache her falsch waren. Schon in Heft 408 waren während der Second-Genesis-Krise sämtliche Altmutanten gestorben, obwohl sie Aktivatorträger waren.
Unsterblich bedeutete eben nicht unverwundbar – diesem Trugschluss, der Kritikern der Serie immer wieder als Indiz für Allmachtsphantasien galt, waren viele Leser aufgesessen!
Essay: WER LIEST PERRY RHODAN? – von William Voltz
Ich habe mir an Hand der Leserbriefe natürlich Gedanken gemacht, wer unsere Leser sind. Es läßt sich da ein guter Querschnitt herausfinden. In erster Linie wird PERRY RHODAN von jungen Leuten gelesen, also Lesern von 15 bis 29 Jahren, die die Hauptschicht stellen. Es sind aber auch ältere Leser dabei. Ich glaube, was die Frauen angeht, so sind es zwei Drittel männliche und ein Drittel weibliche Leser. In letzter Zeit hat sich das etwas zugunsten der weiblichen Leser verschoben. Wahrscheinlich schon deshalb, weil wir uns etwas von der »Nur-Technik« abgekehrt haben und auch andere Dinge ansprechen.
PERRY RHODAN wird gelesen von Leuten, die sich Gedanken machen. Das geht einwandfrei aus allen Briefen hervor. Es wird von Leuten gelesen, die sich Gedanken darüber machen, wie geht es weiter, in welcher Welt lebe ich, wie entwickelt sich diese Welt, wo stehe ich, wohin gehen wir, was kann passieren. PERRY RHODAN wird gelesen von Lesern, die ein großes Bedürfnis haben, sich geistig in irgendeiner Form zu betätigen.
Ich glaube, daß die Möglichkeit der Entfaltung von Phantasie heute in unserer Gesellschaft zum großen Teil erstickt wird. Es ist doch so, daß kaum noch Bereiche da sind, die den Raum bieten, in dem sich gerade der jugendliche Leser entfalten kann: in seiner Phantasie. Und ich halte gerade die Phantasie und die Entfaltung der Phantasie für überaus wichtig für die Entwicklung des jugendlichen Lesers.
Ich glaube, die PERRY RHODAN-Serie bietet ein breites Feld für diese Betätigung. Das zeigt sich auch an den Briefen, in denen auf ein bestimmtes Thema eingegangen wird: Ist es möglich, daß meinetwegen die Überbevölkerung in der Galaxis Naupaum in der geschilderten Form auch auf unsere irdischen Verhältnisse übertragbar ist? Ist es möglich, daß mit diesen oder jenen technischen Belangen, wie sie in der Serie dargestellt werden, das eine oder andere Problem hier auf der Erde lösbar ist?
Es lesen also in erster Linie junge Leute PERRY RHODAN, die sich die Frage stellen, wie sieht es morgen aus, geht es morgen noch weiter, und wenn ja, wie geht es weiter und was kann der einzelne dazu beitragen, daß es weitergeht. Das wird zwar von unseren Kritikern des öfteren bestritten, aber ich bin gern bereit, jedem Einsicht zu gewähren in die vorliegenden Leserbriefe, die ganz klar belegen, daß hier eine wirkliche Kommunikation zwischen Autor und Lesern stattfindet, und das habe ich noch bei keiner anderen Romanserie und noch bei keinem anderen Roman in diesem Umfang erlebt.
(Aus einem Radio-Interview, das Jochen Maes am 25.11.1977 mit Voltz führte)
Das PERRY RHODAN-Jahrbuch
In den letzten Jahren war eine regelrechte Flut von Kalendern und Almanachen erschienen. Der Pabel Verlag hatte sich mit zwei Jahrbüchern beteiligt, die Grenzwissenschaften und UFOs behandelten, genauer: Parapsychologie und die Möglichkeit eines Besuchs Außerirdischer auf der Erde. Ihr großer Erfolg bewog den Verlag, einen Vorschlag des Literaturagenten, Übersetzers und Redakteurs Thomas Schlück aufzugreifen, der gerade Scheers ZBV-Serie bearbeitete: Warum nicht ein Jahrbuch über PERRY RHODAN herausgeben – ein attraktives Buch zu einem möglichst niedrigen Preis?
Schon im letzten Jahresdrittel 1974 begannen die Vorarbeiten, die mit Schlücks Einverständnis William Voltz übertragen wurden. Der frischgebackene Herausgeber schilderte im Juli 1975, als das Jahrbuch bereits sechs Wochen an den Verkaufsständen war, auf der Leserseite von PERRY RHODAN 726 den Werdegang des Projekts.
»Nachdem der Verlag seinen Entschluss einmal gefaßt hatte«, weiß Voltz zu berichten, »fand eine Besprechung statt, an der die Geschäftsleitung ebenso teilnahm wie die Mitarbeiter des Cheflektorats und der Redaktion. Ich war überrascht, mit welcher Intensität man an diese Sache heranging, von Anfang an war mir klar, dass die Übernahme der Jahrbuch-Redaktion kein Zuckerschlecken sein würde. Im Verlauf dieser Besprechung wurde beschlossen, jedes Jahrbuch unter ein besonderes Leitthema zu stellen. Das sollte natürlich auch bereits für das erste Jahrbuch gültig sein. Wir einigten uns auf das Thema ›Roboter‹, weil wir glauben, damit einen besonders großen Kreis unserer Leser zu interessieren.«
Voltz wandte sich im Herbst 1974 in einem Rundschreiben an das Autorenteam und setzte es von dem neuen Projekt in Kenntnis. Als eine größere Reaktion ausblieb, nahm Cheflektor Kurt Bernhardt die Sache am 23. Oktober selbst in die Hand. In einem neuerlichen Rundschreiben bezog er sich auf Voltz’ Brief, »in dem Sie davon in Kenntnis gesetzt worden sind, dass der Verlag ein PERRY RHODAN-Jahrbuch 1974/75 herausbringen wird. Die Autoren haben bisher dazu noch keine Stellung genommen. Ich bin der Auffassung, ein Story-Wettbewerb ist für alle Autoren nicht nur interessant, sondern gibt dem Jahrbuch den Pfiff, um die PERRY RHODAN-Serie mit neuen Impulsen zu versehen.«
Er rekrutierte die gewünschten Mitarbeiter: »Letzten Endes will doch jeder Autor noch in den nächsten 10 Jahren für PERRY RHODAN schreiben, und dafür muß man auch etwas tun. Ich bitte jeden Autor, seine Roboter-Story so schnell wie möglich dem Verlag zuzusenden. Natürlich soll sie aus der Welt der PERRY RHODAN-Serie sein. Der Umfang jeder Story soll ca. 7–8 Druckseiten betragen. Ich schlage ausdrücklich das Thema ›Roboter‹ vor, weil es ein sehr interessantes Thema ist. Ein Thema, das von allen Autoren behandelt wird, gibt auch jedem Autor die Möglichkeit für eine gerechte Beurteilung.«
Für populärwissenschaftliche Beiträge war Thomas Schlück angesprochen worden, auch Erich von Däniken sollte einen Beitrag leisten, was von Cheflektor Bernhardt jedoch vehement abgelehnt wurde. Außerdem wollte Voltz einige amerikanische Beiträge aufnehmen, vor allem einen Artikel des legendären SF-Autors A. E. van Vogt – was Bernhardt am 13. November 1974 sehr skeptisch stimmte: »Haben Sie die entsprechenden Übersetzer? Finden Sie es nicht besser, wenn die Übersetzung hier durch den Verlag erfolgt? Die Entscheidung als Herausgeber (!) liegt natürlich bei Ihnen.«
Das lange Warten
Voltz trommelte nicht zuletzt unter Mithilfe Clark Darltons in kürzester Zeit einige Autoren zusammen, darunter auch einen alten Freund. Er hieß Klaus Fecher und war einigen SF-Lesern noch durch Übersetzungen von Romanheften bei Pabel bekannt, die vorwiegend in den Fünfzigerjahren erschienen waren. Aber die wenigsten Leser werden gewusst haben, dass er auch einmal als professioneller Lektor tätig gewesen war.
Voltz bat ihn im Januar 1975 aufgrund der Zeitknappheit gleich um mehrere Artikel, die Fecher auch prompt verfasste. Aber Cheflektor Bernhardt wollte ein möglichst vielseitiges Produkt. Er wandte sich deshalb am 21. des Monats an den Herausgeber und verfügte – leider heute noch bei vielen Verlagen gängige Praxis –, »daß für jeden Artikel ein besonderes Pseudonym im Jahrbuch verwendet werden muß. Setzen Sie sich deshalb mit Herrn Fecher in Verbindung und vereinbaren Sie die einzelnen Pseudonyme.«
Ein solches Gespräch fand allem Anschein nach auch statt, denn Voltz notierte sich sechs Namen, die in Frage kamen: Fred Gurich, Karl A. Ritz, Garry Morgan, Martin Fölsing, Jay D. Stewart und F. Klaus. Aber ihm war wohl unbehaglich zumute, und verwendet wurde schließlich nur Karl A. Ritz für einen Artikel über die »Gespensteranalyse in der Solaren Flotte«. Ein Artikel über Quasare, dunkle Löcher und Einstein sowie eine Kurzvorstellung des SF-Autors A. E. van Vogt erschienen unter Fechers richtigem Namen. Auch eine Übersetzung fertigte Fecher an, während die anderen von Clark Darlton stammten. Es handelte sich um einen Artikel von A. E. van Vogt, der auf dessen Kurzvorstellung folgte. Leider wurde dieser Beitrag stark bearbeitet und gekürzt, worüber Fecher sich sehr ärgerte.
Kurz vor Manuskriptabgabe schickte Voltz noch eine Anfrage an Hubert Straßl alias Hugh Walker. Der Mitautor von DRAGON und Herausgeber von TERRA FANTASY hatte in seinem Wiener Bekanntenkreis zahlreiche Zeichner, die er häufig für graphische Projekte einsetzte. Am 1. Januar 1975 antwortete Walker: »Schade, daß Sie das mit den Illus nicht früher wußten. Da hätte sich eine schöne Sache machen lassen, und viele unserer Zeichner wären sicherlich an diesem Projekt interessiert gewesen. Leider ist der Termin zu kurz, um neues Material anzufertigen.«
Aber er vertröstete Voltz auf das Jahrbuch des kommenden Jahres, mit dem alle Mitarbeiter des Verlags fest rechneten: »Wenn Sie nächstes Jahr wieder so was planen, dann geben Sie mir ein bis zwei Monate früher Bescheid. Die meisten meiner Zeichner wären sicherlich interessiert, auch mal was Utopisches zu machen.«
Voltz begnügte sich für diese Ausgabe mit Material, das er kurzfristig besorgen konnte: Porträtaufnahmen der acht Serienautoren, Coverabbildungen von aktuellen Lizenzausgaben in Japan, den USA, Finnland, Holland, Belgien und Frankreich, zwei ältere Risszeichnungen von Rudolf Zengerle, die bereits in der Heftserie erschienen waren, und Illustrationen des RAUMSCHIFF PROMET-Coverzeichners Manfred Schneider, welche die Roboterstories einleiteten.
Ob das Jahrbuch wirklich erst am 27. Mai ausgeliefert wurde, wie es offiziell heißt, oder nicht doch schon am 8. Mai, ist unbekannt. Jedenfalls brillierte es mit drei Schwerpunkten: Erzählungen aus der Welt von PERRY RHODAN, Hintergrundartikel und Listen zum Perryversum sowie populärwissenschaftliche Artikel von allgemeinem Interesse.
Highlight auf die Roboter
Das Highlight des Buches waren natürlich die acht Roboter-Geschichten der Autoren, anonym verfasst und mit einer Einleitung von Bärbel Jung über die Herkunft des Begriffs »Roboter« versehen. Sie wurden mit einem Preisausschreiben gekoppelt.
»Die Stories erscheinen ohne die Namen ihrer Verfasser«, schreibt Voltz auf der LKS von PERRY RHODAN 726. »Die Aufgabe der Leser soll es nun sein, herauszufinden, welcher Autor für die jeweilige Geschichte verantwortlich zeichnet. Außerdem sollen die Leser die beste Story auswählen.« Es winkte ein Geldpreis von immerhin 1000 DM, hinzu kamen Geldpreise zu 500 und 200 DM sowie Jahresabonnements der Serie.
Es folgten Hintergrundartikel über PERRY RHODAN, zunächst Karl A. Ritz mit einem Beitrag über die Spektralapparate, mit denen ein Astrogator der Solaren Flotte seine Daten gewinnt, anschließend von Klaus Mahn, der unter dem Titel »Der Zweitausendjahrplan« über die Bevölkerungkontrolle auf Terra und die Entwicklung der Moral schrieb.
Walter Ernsting plauderte über die damals siebzig Bände der amerikanischen PERRY-RHODAN-Ausgabe und deren umfangreichen Magazinteil, während Forrest J. Ackerman sich mit dem dortigen Fandom befasste. Ein kurzer Beitrag von Wigberth Schubert deckte auf, dass PERRY RHODAN in Japan LO-TAN heißt und aus Kurt Mahr »kúlúto ma-lú« wird, während K. H. Scheer dort als »schi-ri« firmiert. Es folgten mehrere Listen, eine über Mutanten in der PERRY-RHODAN-Serie, die der Chronist erstellte und William Voltz ergänzte, sowie weitere mit den Risszeichnungen und Zyklen der Serie.
Ein weiteres Highlight war »Die akademische Science Fiction wird vergessen« – eine Abhandlung des legendären A. E. van Vogt über sein Leben als SF-Autor, eingeleitet von Klaus Fecher. Es folgten Fechers Beitrag über Quasare und dunkle Löcher, ein ausführlich begründeter Vorschlag von Fredric Ellrich, warum Jules Verne nachträglich zum Preisträger des »Club of Rome« ernannt werden sollte, ein UFO-Artikel des Präastronautik-Vertreters Peter Krassa, ein historischer Abriss von Manfred Knorr über Science Fiction im Film und eine kurze Vorstellung des Deutschen Hugo von Walter Ernsting.
Den abschließenden Höhepunkt bildete die exklusive SF-Story »Smookers Brandzeichen« von William Voltz, eine im Perryversum spielende Geschichte über die Roboter der Firma »Whistler«, bevor eine Liste aller PERRY RHODAN-Romane das Jahrbuch abschloss.
Eine Autorin für ATLAN
Seit Mitte des vorigen Jahres bemühte sich eine junge SF-Autorin, mit ihren Romanen bei TERRA ASTRA unterzukommen. Sie hatte sich mit Space Operas um Prospektoren, Sicherheitsdienstler und menschliche Unterdrückung schon ein hohes Ansehen beim Konkurrenzverlag Zauberkreis erschrieben. Aber bis auch TERRA ASTRA-Lektor Günter M. Schelwokat sich für ihre Manuskripte erwärmte, dauerte es eine Weile.
Dann gab es allerdings kein Halten mehr!
Schelwokat kaufte nicht nur den Roman »Irrwege im Weltall« an, sondern empfahl die junge Frau auch der Aufmerksamkeit des Cheflektors Kurt Bernhardt, der sich umgehend – am 2. Juli 1974 – an die Berlinerin wandte. Unter Bezugnahme auf ihren Roman fragte er an, ob sie vielleicht bei DRAGON oder ATLAN mitschreiben wolle.
Zwei Tage später schickte er William Voltz eine Kopie ihrer Antwort, in der sie ihr Interesse für ATLAN bekundete. »Ich glaube, dass Sie mich verstehen«, heißt es in Bernhardts Begleitschreiben an Voltz. »Ich möchte unbedingt den Mitarbeiterstab für die SF-Reihen erweitern. Wir müssen deshalb jeden Versuch machen, um entsprechende Mitarbeiter zu gewinnen. Natürlich werden wir viele Enttäuschungen erleben.«
Bernhardt bat Voltz, sich mit der Autorin in Verbindung zu setzen und sie vielleicht zu einem Gespräch zu sich nach Offenbach zu bitten. »Aber Sie können auch auf schriftlichem Wege versuchen, ihr einen ATLAN-Auftrag zu geben (natürlich für einen Roman, der terminlich noch nicht eilig ist). Lassen Sie sie zwanzig bis dreißig Seiten unverbindlich schreiben. Dann können Sie ja prüfen, ob sie in der Lage ist.«
Voltz rief die Autorin am 13. Juli 1974 an, und zehn Tage später kam es zu einer Begegnung. Wie sich herausstellte, war sie »in der Lage«. Ihr erster ATLAN-Roman erschien im Februar 1975 als Band 178/39 der Serie, und nur sieben Wochen später folgte ein Doppelband, der sie endgültig als ständige Autorin von ATLAN etablierte.
Der Name der jungen Frau: Marianne Sydow.
»Wie ich zum Schreiben kam, weiß ich gar nicht mehr genau«, schrieb die frischgebackene ATLAN-Autorin im April 1975 in TERRA ASTRA 192. »Ich liebte Bücher schon, als ich sie noch gar nicht lesen konnte. Wie ich ausgerechnet mit der SF bekannt gemacht wurde, kann ich dagegen genau sagen. Es lag an meinem großen Bruder, der seine ›Zukunftsromane‹ überall herumliegen ließ. Mit zehn Jahren fand ich Roboter, Raumschiffe und Atombrände viel interessanter als Rübezahl und Märchenzwerge. Es überraschte mich nicht im geringsten, als man mir umgehend mitteilte, solche Bücher wären nichts für Mädchen. Als Reaktion auf diesen Ausspruch entwickelte sich meine Vorliebe für SF zu einer Manie.«
Wie sehr die Science Fiction ihr im Blut steckt, bewies sie durch ihre mitreißenden und stimmungsvollen Romane, die bei Leserinnen und Lesern gleichermaßen gut ankamen – so gut sogar, dass Marianne Sydow schon anderthalb Jahre später, im November 1976, ganz unspektakulär ihren Einstand bei PERRY RHODAN gab. Leider sollte sie erst mit Band 875, also weitere anderthalb Jahre später, ihren zweiten Band verfassen.
Danach ging es wieder rasend schnell, denn nach fünfjähriger Erfahrung mit dem Perryversum löste sie mit Band 448 überraschend William Voltz als Exposéautor von ATLAN ab. Außer einem kurzen Intermezzo bei den Bänden 500 bis 509, die wegen des Zyklusstarts wieder von Voltz gestaltet wurden, übte sie diese Funktion bis Band 532 aus. Dann übernahm Peter Griese ihre Aufgabe, mit dem sie – nachdem sie die Bände 698 bis 707 wieder allein ausgearbeitet hatte – anschließend ein Team bildete. Mit Band 765, etwas über ein Jahr danach, trat H. G. Ewers in ihre Fußstapfen. Und mit Band 795 – der Bandnummer, unter der sie ihren ersten PERRY RHODAN geschrieben hatte – schied sie bei ATLAN auch als Autorin aus, um sich fortan ganz auf PERRY RHODAN zu konzentrieren.
Sie war eines der beliebtesten Mitglieder des Autorenteams, als sie nach fünfundzwanzig Jahren als Schriftstellerin endgültig ihren Abschied nahm – nach sechzehn Jahren des erfolgreichen Schreibens für die größte Weltraumserie der Welt!
Kurzbiografie: Marianne Sydow
Als Mariannne Bischoff wurde sie am 24. Juli 1944 in Berlin geboren. Die finanziellen Mittel ihrer Familie erlaubten es nicht, dass sie das Gymnasium mit dem Abitur abschloss. Also schlug sie sich mit einer Reihe von Jobs durch, etwa als Verkäuferin, Telefonistin und Betreuerin einer Chinchillazucht. Ihre Liebe zur SF erwachte schon früh durch die Heftsammlung des älteren Bruders. 1967 erschienen mit »Das Wesen aus der Retorte« und »Die größenwahnsinnige Elektronik« ihre ersten Romane – damals noch in der UTOPIA-Reihe des Pabel Verlags unter Garry McDunn. Fünf Jahre später heiratete sie, brachte einen Sohn zur Welt und veröffentlichte – unter demselben Pseudonym – mit »Der Zeitmörder« den ersten von dreizehn SF-Romanen bei Zauberkreis. 1975 wechselte sie zu TERRA ASTRA, wo sie unter ihrem Ehenamen Marianne Sydow in den nächsten vier Jahren neun Romane und zwei Storysammlungen herausbrachte, 1983/84 von vier Nachdrucken aus ihrer McDunn-Zeit gefolgt. Ebenfalls 1975 wurde sie ins ATLAN-Team aufgenommen und verfasste bis 1986 sechzig Romane und zeitweise auch die Exposés. Auf einen Band mehr brachte sie es bei PERRY RHODAN, wo sie 1976 einstieg. Dieser Serie blieb sie bis 1992 erhalten. Seit 1980 in zweiter Ehe mit dem SF-Sammler Heinz-Jürgen Ehrig verheiratet, der im Oktober 2003 verstarb, galt sie lange Zeit als einzige hauptberufliche SF-Autorin Deutschlands.
Frankenstein auf Hessisch
Eine Horrorserie aus der PERRY RHODAN-Redaktion? Für viele ein unvorstellbarer Gedanke, weil Horror damals noch mehr als Schundliteratur betrachtet wurde als Science Fiction. Und doch ist das einmal geplant gewesen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg wurden sogar intensive Vorarbeiten geleistet, bevor das Projekt im letzten Augenblick wieder gestrichen wurde. Die Gründe dafür sind bis heute nicht ganz bekannt.
Es begann am 30. Januar 1974, als Cheflektor Kurt Bernhardt sich begeistert an William Voltz wandte. Der SF-Autor Dirk Hess, gerade wieder bei ATLAN eingestiegen, hatte ihm ein ausführliches Exposé für die Comicserie VAMPIRELLA geschickt. »Für mich war dieses Exposé von der Handlung, den Ideen und auch von den Figuren her eine kleine Offenbarung«, schreibt Bernhardt. »Es hat mir gezeigt, was man aus Horror-, Fantasy- und SF-Elementen zusammenbrauen kann. Die Amerikaner sind uns da um 100 Jahre voraus.«
Aber es ging Bernhardt nicht so sehr um den Comic, obwohl er für VAMPIRELLA schließlich grünes Licht gab. Ihm schwebte eine neue Heftromanserie vor. »Meine Bitte ist nun«, drängte er Voltz in seinem Schreiben: »Ich möchte von Ihnen unter dem Begriff FRANKENSTEIN (das ist für die Masse der deutschen Leser der Horror-Zünder) ein ähnliches Rahmenexposé für eine neue Serie, in der jedoch Frankenstein nur eine Figur unter vielen ist.« Dabei müsse der Hintergrund für diese Serie wie bei VAMPIRELLA weltweit gespannt sein – er könne seinethalben bis ins Universum reichen.
Bernhardt lief in seiner Begeisterung sogar zu poetischer Höchstform auf: »Die Serie muß moderne Horror-, Fantasy- und SF-Elemene enthalten und ein schwefelhaltiges, giftiges, stinkendes Gebräu mit einer Pseudoweltanschauung werden.«
Noch im selben Schreiben erklärte Bernhardt, dass Voltz ihm vor der Niederschrift eines solchen Rahmenexposés telefonisch kurz eine Ideenskizze durchgeben solle. Anscheinend kam man während dieses Gesprächs überein, sich einmal persönlich zusammenzusetzen und vor allem Dirk Hess hinzuzuziehen. Voltz war kein Gegner von Horrorliteratur, aber auch nicht gerade ein begeisterter Anhänger und sah Bernhardts Wunsch, auch bei FRANKENSTEIN federführend zu sein, als das an, was es war: der Versuch, ihn wie seinerzeit bei DRAGON als Schrittmacher für die neue Serie zu gewinnen.
Ordnung und Chaos
Dirk Hess erinnert sich dreißig Jahre später in einer E-Mail an den Chronisten: »Als mich William Voltz und Kurt Bernhardt im März 1974 in Frankfurt besuchten, sprachen wir unter anderem über den außerordentlichen Erfolg von VAMPIRELLA bei den Lesern. Vor dem Hintergrund der drohenden Indizierung klagte Bernhardt sein Leid mit dem Horror-Genre im Romanheftbereich. Nicht nur die Splatterproduktionen im Film machten der Printversion zunehmend zu schaffen, auch die leidige Konkurrenz plus der Bundesprüfstelle trübten seinen ›Horror-Alltag‹. Er stellte sich eine gesoftete Fortsetzungsreihe mit feststehenden Charakteren vor. Auf keinen Fall SF, aber auch keinen harten Horror – eher einen Mix aus Crime, Fantasy und Horror. Gern hätten wir VAMPIRELLA in Romanform gebracht, aber die Lizenzkosten und die bereits erfolgte Indizierung des Comics hielten ihn davon ab.«
Eines der beiden Serienkonzepte, die Hess daraufhin entwickelte, war FRANKENSTEIN, das den Alternativtitel DAS BÖSE trug. »Das Ganze war eine krude Mixtur aus – heute würden wir sagen – ›X-Files‹ und Zombie-Splatter. Klassische Horrorfiguren wie Frankenstein, Dracula, Werwolf und Mumie sollten in der Gegenwart gemeinsam auftreten. Nicht eindeutig böse und gut, sondern getrieben, gejagt und benutzt von einem Pandämonium, das von außerhalb wirkt. Fox Mulder hätte es heute treffender formuliert: ›Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.‹ Ich hatte alles bis ins Detail ausgearbeitet: die ersten zehn Episoden, die Bedrohung durch das kosmische Ringen zwischen den Mächten der Ordnung und des Chaos – Entropie und ständiger Neubeginn. Frankenstein war von mir als positiver Held gedacht. Sein Gehirn überdauerte die Zeit in unterschiedlichen Körpern. Nur sein Unterbewusstsein kannte die kosmische Bedrohung.«
Auch Dirk Hess legte Wert darauf, dass William Voltz an der neuen Serie mitarbeitete. Cheflektor Bernhardt hatte das verabredete Rahmenexposé bereits erhalten, als Hess seinem Freund am 8. April 1975 eine Kopie zuschickte. In seinem Begleitbrief heißt es: »Was die Serie FRANKENSTEIN betrifft, so würde ich mich freuen, wenn Du Dir unabhängig von mir ein paar Gedanken machen würdest. Sobald ich die ersten vier Exposés abgeschlossen habe – das ist diese Woche –, denke ich mir die nächsten vier Handlungsabläufe aus. Dazu sollten wir uns kurz treffen. Ich brauche jetzt noch Deine Regie – beziehungsweise Dein ordnendes ›Seriengewissen‹. Danach könnte ich dann diese Exposés schreiben.«
Anscheinend war die Begeisterung auf beiden Seiten groß, denn jetzt ging es Schlag auf Schlag. E-Mail-Originalton Hess: »William Voltz schrieb unter dem Pseudonym Thor Caplon den ersten Roman ›Apokalypse der Untoten‹. Unter meinem Alias Derek Chess verfasste ich den Folgeband ›Pilgerzug der Hexenmeister‹.« Nicht einmal zwei Monate später, am 5. Juni 1975, fertigte der Verlag die Verträge für die ersten beiden Romane aus.
Kurt Bernhardt blieb weiter am Ball. Postwendend hatte er Voltz schon einen Tag vor der Vertragsunterzeichnung in diesem vordigitalen Zeitalter aufgefordert: »Ich möchte, dass Sie die beiden FRANKENSTEIN-Romane sechsmal kopieren, damit wir sie an die entsprechenden Autoren weiterleiten können. Mir schicken Sie bitte auch eine Kopie der beiden Romane zu.« Dieses Verfahren entsprach dem bei PERRY RHODAN, das ebenfalls mit einem Autorenteam arbeitete – dem Erfolgsgaranten schlechthin!
Das FRANKENSTEIN-Autorenteam
Wer sollte aber nun zum Autorenteam gehören? Neben Voltz und Hess, die als Thor Caplon und Derek Chess firmierten, war zunächst von Earl Warren alias Walter Appel die Rede, der nicht nur Krimis und Western schrieb, sondern seit Anfang 1974 auch für die Horrorreihe VAMPIR tätig war und vermutlich im Juli oder August des Jahres zum ständigen Autor bei DÄMONENKILLER geworden war, einer von Ernst Vlcek und Kurt Luif ins Leben gerufenen Serie, mit denen gemeinsam er schließlich die meisten Folgen schreiben sollte. Appel ist heute noch ein sehr fleißiger und vielseitiger Verfasser von Heftromanen.
Am 29. September 1974 schickte er William Voltz das durchgesehene Rahmenexposé wieder zurück – mit dem Kommentar, das Ganze sei sehr schön in einen kosmischen Rahmen eingepasst, und die ersten drei Exposés bildeten einen Block. Mit dem vierten könne man Jason Crotor vielleicht durch und durch menschlich erscheinen lassen, um sich ein Hintertürchen offen zu lassen, falls die Opal die Hauptträgerrolle der Serie nicht schaffe …
Zwischen den Zeilen drückte sich deutlich seine Skepsis über die neue Serie aus.
Im März 1975 hatte auch Hans Kneifel seine Mitarbeit angeboten und als weiteren Autor seinen Freund Konrad Schaef alias Conrad Shepherd vorgeschlagen, der einige Jahre zuvor drei Romane für PERRY RHODAN geschrieben hatte. Und drei Monate darauf, kurz vor dem ersten Treffen aller Beteiligten, der ersten und einzigen FRANKENSTEIN-Autorenkonferenz, forderte Voltz noch drei Autoren zur Mitarbeit auf, die gerade vor ihrem Einstieg bei ATLAN standen: Peter Terrid, Marianne Sydow und Hans Peschke alias Harvey Patton. Von Terrid sind leider keine Reaktionen auf diese Anfrage bekannt. Und während die Autorin Sydow, die damals regelmäßig bei ZAUBERKREIS-SF unter dem Pseudonym Garry McDunn veröffentlichte, sich sehr über dieses Angebot freute und die Einladung zu einer Mitarbeit annahm, reichte der RAUMSCHIFF PROMET-Autor Peschke die Entwürfe zu der Horrorserie mit den Worten zurück, dass ihm diese Thematik überhaupt nicht liege.
Auch Kurt Bernhardt war nicht mehr uneingeschränkt von dem Projekt begeistert. Deutlich stand ihm die Indizierung eines DÄMONENKILLER-Romans vor Augen, die vielleicht auch der Grund dafür gewesen ist, dass Ernst Vlcek nie auf eine Mitarbeit angesprochen worden war; dieser erklärte im Februar 2004 auf eine Anfrage des Chronisten: »Von der FRANKENSTEIN-Serie höre ich heute zum ersten Mal. Davon wusste ich nix, schon gar nicht, dass Voltz daran beteiligt war – ich aber ganz sicher nicht.« Vielleicht wollte man auch nur die Fahrwasser der beiden Serien strikt trennen, und außerdem war Vlcek mit PERRY RHODAN und ATLAN stark ausgelastet.
Jedenfalls begann sich Skepsis über die Machbarkeit des Projekts auszubreiten. »Auf Wunsch von Bernhardt«, erinnert sich Hess in einer E-Mail an den Chronisten, »sollte wegen der Indizierung eines Romans nicht die bewährte VAMPIR-Lektorin Sabine Illfeld das Projekt übernehmen, sondern PERRY RHODAN-Lektor Günter M. Schelwokat. Diesem waren nach eigener Aussage Horrorromane zuwider, auch wünschte er keine Beteiligung von William Voltz an der Serie, damit dessen guter Name keinen Schaden nahm. Er gab ein Gutachten zu meiner Arbeit in Auftrag, das er auf dem Treffen mit den vorgesehenen Autoren Marianne Sydow, Peter Terrid und William Voltz präsentierte. Und was für ein Gutachten das war – einfach hanebüchen!«
Alles hatte ein enormes Tempo angenommen. Erst vierzehn Tage waren seit dem Ankauf der ersten beiden FRANKENSTEIN-Romane vergangen, und das Gutachten, das auf diesem Treffen am 16. Juni vorgestellt wurde, war Dynamit.
Hess erinnert sich noch wie heute: »Dämonendiener sollten danach wegen ihrer übersinnlichen Fähigkeiten als Psikonen bezeichnet werden, man dürfe dem Leser keine Pseudo-Philosophie aufschwätzen und man müsse auf Rückblendeerzählungen wegen ihres spannungsmindernden Effekts verzichten. Die Kritik gipfelte jedoch in der Feststellung, dass die Aktivitäten des Pandämoniums nicht in Einklang mit dem öffentlichen Bewusstsein der Ordnungsbehörden zu bringen sei: ›Die Polizei überall auf der Erde glaubt nicht an Geister, Dämonen und Zauberei, wie es ja auch im Exposé steht. Die Serie würde sich selbst lächerlich machen.‹ Es war ein Graus!«
Allen klang in den Ohren, dass sie es nur mit »ekelerregender Horror-Kolportage« zu tun hätten. Dieses Urteil verunsicherte die Anwesenden. Das Projekt war aus dem Ruder gelaufen. Von einer Horrorserie der geplanten Art konnte nicht mehr die Rede sein.
Jubel unter den Lesern
Das PERRY RHODAN-Jahrbuch war so schnell entstanden, dass sogar die Mitarbeiter von seinem Erscheinen überrumpelt wurden. William Voltz war seinem Freund Clark Darlton sehr dankbar dafür, ihn hinter den Kulissen unterstützt zu haben, und Klaus Fecher schrieb Voltz verwundert, dass er das Jahrbuch bereits in Händen halte, obwohl es doch erst im Herbst herauskommen sollte. Aber dem Verlag – allen voran Kurt Bernhardt – war das schnelle Erscheinen natürlich nur recht. Der Cheflektor schickte es auch sofort dem Veranstalter des ersten amerikanischen PERRY RHODAN-Cons, der Anfang Januar 1976 stattfinden würde – mit der Bitte, sich beim Verlag Ace Books für eine Lizenznahme einzusetzen.
Bei den Lesern fand das Jahrbuch begeisterte Aufnahme. Wie Voltz in Heft 734 mitteilte, gab es niemals zuvor für ein Projekt aus seiner Redaktion so viele Zuschriften, in denen ausnahmslos Lob gespendet wurde. Zu den Gratulanten, die sich auf der LKS dieses Romans zu Wort meldeten, gehörten auch der damals auf Science Fiction spezialisierte Literaturagent Thomas Schlück und der spätere PERRY RHODAN-Autor Horst Hoffmann.
Voltz teilte mit, dass zu dem Zeitpunkt, da diese Informationen zusammengetragen wurden, erst ein einziger Leser das Preisausschreiben richtig gelöst habe. »Die Chance, mit der richtigen Aufteilung der Robotstories unter den PR-Autoren eintausend, fünfhundert und zweihundert Mark zu gewinnen, ist also noch riesengroß, ganz zu schweigen von siebzehn Jahresabonnements der PERRY RHODAN-Serie, die zu gewinnen sind.«
Mehrere Leser äußerten die Hoffnung, dass das Jahrbuch eine ständige Einrichtung werde. Die Redaktion sah das nicht anders. In einem Kommentar zu einer Leserzuschrift erklärte Voltz noch auf derselben LKS, die im September 1975 erschien: »Schon jetzt sei darauf hingewiesen, daß wir im PR-Jahrbuch 1977 drei große PERRY RHODAN-Kreuzworträtsel unserer Leser bringen wollen.« Sie sollten auch prämiert werden. »Daneben wollen wir im Jahrbuch 1977 sechs SF-Stories über das Thema PSI veröffentlichen. Auch dazu bitten wir um Einsendungen. Die Stories, die veröffentlicht werden, bringen den Autoren je 200,- DM Honorar! Außerdem haben die Verfasser eine einmalige Chance, sich einen Namen zu machen. Wenn Sie eine Story einschicken möchten, denken Sie daran, daß sie nicht weniger als 20.000 und nicht mehr als 30.000 Anschläge haben sollte. Das sind 6 bis 10 DIN-A 4-Seiten, eineinhalbzeilig beschrieben.« Angaben aus einer Zeit vor dem PC.
Im Oktober 1975 wurde in Heft 738 der Aufruf wiederholt. Es seien Mitarbeiter unter den Lesern gesucht, hieß es da. »Wir haben uns das Ganze als Wettbewerb vorgestellt und hoffen, daß sich möglichst viele von ihnen daran beteiligen. Wir wissen, daß unter unseren Lesern viele Talente verborgen sind. Auf diesem Weg möchten wir ihnen eine Chance geben.« Als Einsendeschluss für Rätsel und Storys wurde der 15. Dezember 1975 festgelegt.
Die Auswertung des Preisausschreibens erfolgte ein halbes Jahr nach Erscheinen des Jahrbuchs, am 8. Dezember. »Der siebenjährige Stephen Voltz zog die Gewinnlose mit den Namen jener Leser, die die richtige Lösung eingeschickt hatten, aus dem Topf«, schrieb Voltz in einer Benachrichtung der zwanzig Gewinner. »Die Redaktion bittet die drei Hauptgewinner um eine Autobiographie (wie kamen sie zu PERRY RHODAN, wie haben sie die richtige Lösung gefunden, sind sie vom Gewinn überrascht etc.) und um ein Foto.«
Schon einen Tag zuvor hatte Voltz dem Verlag und allen Serienautoren mitgeteilt, welches Bild die Auswertung ergeben hatte. Aber zur juristischen Absicherung ließ sich der Verlag noch einmal sämtliche Unterlagen und Einsendungen zuschicken. Wie erwartet kam die Jury aus Kurt Bernhardt, Werner Müller-Reymann und Joachim Bulla zu dem gleichen Ergebnis, das sie den beteiligten Autoren am 17. Dezember 1975 ihrerseits mitteilte.
Lieber Herr Bernhardt,
nachdem ich alle Zuschriften, die mir vom Verlag zum Preisausschreiben im PERRY RHODAN-Jahrbuch 1976 übergeben wurden, ausgewertet habe, ergibt sich folgendes Bild:
Es gingen 341 gültige Zuschriften ein, 333 davon wurden ausgewertet (8 Einsender gaben die beste Geschichte ihrer Wahl nicht an. Für die Kurzgeschichten Pardon, Sir! und Standpunkte gingen von jeweils einer Person 40 bzw. 20 Wertungskarten ein. Es ist klar, dass davon nur je eine Karte zur Auswertung kam.
Und hier das Ergebnis:
1. Platz: Standpunkte von William Voltz – 74 Stimmen
2. Platz: Ultimatum von H. G. Franciskowski – 55 Stimmen
3. Platz: Mein Freund Dummy von Ernst Vlcek – 54 Stimmen
4. Platz: Das Erbe von Walter Ernsting – 46 Stimmen
5. Platz: Adam und Eva von Horst Gehrmann – 36 Stimmen
6. Platz: Pardon, Sir! von K. H. Scheer – 35 Stimmen
7. Platz: Flucht von Hans Kneifel – 24 Stimmen
8. Platz: Autonomy-Eins von Klaus Mahn – 9 Stimmen
Zwischen Platz 2 und 3, sowohl 5 und 6 nur eine Stimme Unterschied.
Es sind nur wenige Leser dabei, die alle Autoren richtig geraten haben, ungefähr 20–25. Unter diesen werden die Preise ausgelost.
Die Einsendung aus Brasilien kommt aus der größten Entfernung, das noch als Kuriosum.
Kopien dieses Schreibens gehen an alle PERRY RHODAN-Autoren und an G. M. Schelwokat.
Für die Korrektheit der Auswertung verbürgt sich mit freundlichen Grüßen
William Voltz
ATLAN feiert Jubiläum
Immer mehr etablierte sich ATLAN neben seinem großen Bruder PERRY RHODAN zu einer Serie mit eigenem Charakter. Die Umstellung auf wöchentliches Erscheinen hatte den Anfang gemacht. Der nächste Schritt war die Entscheidung gewesen, künftig nur noch Jugendabenteuer des Arkoniden zu veröffentlichen, die zehntausend Jahre vor der aktuellen Handlungszeit in PERRY RHODAN angesiedelt waren und eine Mischung aus Fantasy und Abenteuer pur waren.
Man marschierte jetzt auf den zweiten großen Jubiläumsband zu, den man nach alter Tradition gebührend feiern wollte. »Ich kann den Band 200 übernehmen und rechtzeitig liefern«, meldete sich H. G. Ewers bereits am 3. Januar 1975 zu Wort. Aber dieser Roman war Chefsache. William Voltz ließ es sich nicht nehmen, ihn selber zu schreiben. Es sollte sein erster Beitrag für ATLAN seit ziemlich genau zwei Jahren werden.
Auch im Verlag liefen die Vorarbeiten an. In einer Aktennotiz von Cheflektor Kurt Bernhardt, die am 29. Januar 1975 in den redaktionellen Verteiler ging, wurde die Ausstattung des Romans festgehalten. Außerdem hieß es darin: »Für diesen Jubiläumsband wird mit Anzeigen geworben, und zwar bereits in den beiden davor liegenden Bänden aller SF-Reihen. Ebenso muß unbedingt auf den Leser-Kontaktseiten und in den Vorschautexten aller SF-Reihen das Erscheinen von ATLAN-Exklusiv 200 angekündigt werden.«
Als Voltz einige Monate später die LKS zusammenstellte, setzte er an den Anfang die ehrlich empfundenen Worte: »Mit dem vorliegenden Jubiläumsband möchten wir uns für die Treue bedanken, die Sie der ATLAN-Serie nun schon seit ein paar Jahren entgegenbringen. Wir hoffen, daß wir Ihnen mit dem erweiterten Umfang, dem umlaufenden Titelbild, vier Kontaktseiten und einer Rißzeichnung Freude bereiten können.«
Außerdem konnte er mit einer neuen Information aufwarten: »Etwa zur gleichen Zeit, da Sie diesen Jubiläumsband in den Händen halten, erscheint bei Ace Books in den USA die erste Übersetzung eines ATLAN-Romans, also ein Erfolg in doppelter Hinsicht.«
Der Service für diesen Band entsprach den Standards, die man von PERRY RHODAN gewohnt war. Das Titelbild von Johnny Bruck war enorm ausdrucksstark, und auf den vier Leserseiten fanden sich auch Schreiben von Klaus Mahn alias Kurt Mahr und Clark Darlton sowie eine köstliche Karikatur von Horst Hoffmann. Die Risszeichnung – ein ungewohntes Extra bei ATLAN – zeigte einen Aufriss der Vollprothese von Major Sinclair M. Kennon, gezeichnet von Rudolf Zengerle, und an den auf achtzig Seiten erweiterten Romanumfang schloss ein Bestellschein mit kompletter ATLAN-Titelliste an.
Voltz nutzte die Gelegenheit, die Unterschiede der Serie gegenüber PERRY RHODAN zu betonen. »Viele Leser, die uns schreiben, sind von den ATLAN-Romanen begeistert«, führte er auf der LKS aus, »aber es gibt auch Zuschriften, in denen kritisch gefragt wird, warum wir ATLAN nicht nach dem Prinzip der PERRY RHODAN-Serie aufbauen. Dazu wäre zu sagen, daß ATLAN ja kein zweiter PERRY RHODAN, sondern eine eigenständige Serie mit einer eigenen Aussage und einem völlig unterschiedlichen Anspruch sein soll.« Und auch das Autorenteam spiele eine Rolle. Es setze sich ja »zum größten Teil aus Autoren zusammen, die nicht für die PERRY RHODAN-Serie schreiben. Mit ATLAN wollen wir unsere Leser in möglichst spannender und phantasievoller Form unterhalten, wir laden sie mit jedem Band zu einer neuen abenteuerlichen Reise in die phantastischen Bereiche der Science Fiction ein.«
Selten wurde so deutlich gemacht, wodurch sich die beiden wöchentlichen Heftserien eigentlich unterschieden. PERRY RHODAN und ATLAN waren wie Brüder – aber der eine führte die Menschheit ihrer Bestimmung im All entgegen, während der andere knallharte Abenteuer in einer Umgebung erlebte, die möglichst phantastisch gehalten war.
Präastronautik und Science Fiction
Niemand ahnte, als im März 1968 das erste Buch Erich von Dänikens, »Erinnerungen an die Zukunft«, erschien, dass eine der Inspirationsquellen des Präastronautikers die SF-Romane Clark Darltons waren. Nur Darlton selbst fiel auf, dass der Titel des Buches verdächtig einer Formulierung glich, die er 1962 in einem PERRY RHODAN-Roman verwendet hatte. Er griff zum Telefonhörer – und lernte einen charismatischen Schweizer kennen, der aus seiner Begeisterung für Science Fiction im Allgemeinen und das Werk von Clark Darlton im Besonderen keinen Hehl machte.
Schon 1970 lag die Bibel der Präastronautiker unter dem Titel »Chariots of the Gods: Unsolved Mysteries of the Past« auf Englisch vor und sorgte auch in den USA für Furore. Der amerikanische Rechtsanwalt Dr. Gene M. Phillips war so begeistert von den Thesen, dass er drei Jahre später eine Gesellschaft gründete, die sich zum Ziel setzte, einen anerkannten Beweis für ehemalige Besuche von Außerirdischen auf der Erde zu erbringen.
Die Ancient Astronauts Society war geboren, die noch heute, mehr als vierzig Jahre später, den gleichen Werten verpflichtet ist. Heute steht AAS allerdings für »Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI«, schließt den rechnergestützten Kontaktversuch mit außerirdischem Leben ein und hat ihren Sitz im schweizerischen Beatenberg.
Jazz, Dixie und wüster Boogie
Wenn er nicht gerade fleißig schrieb, amüsierte Darlton sich nach Kräften. Am 27. und 28. Februar traf er Däniken in Wien, wo der Besitzer des Szene-Lokals »Jazzland«, Axel Melhardt, einen Abend mit der Original Storyville Jazzband arrangiert hatte, in der Däniken mitspielte. Auch Peter Krassa war anwesend. Nach der Jam-Session hatten Däniken und Krassa Signierstunde, und als einige Jugendliche PERRY RHODAN-Hefte vorlegten und sie von Däniken signiert haben wollten, tat er ihnen grinsend den Gefallen.
Am 12. März fand in Wien ein Jazzball statt. Däniken war auch diesmal wieder dabei und spielte im Stil der Original Storyville Jazzband, also traditionell Jazz, Dixie und auf dem Klavier einen wüsten Boogie. Eine Zeitung bezeichnete ihn als SF-Autor. Der damalige Zeitgeist machte sichtlich keinen Unterschied zur Präastronautik.
Auch für Moewig-Verlagsleiter Winfried Blach und Cheflektor Kurt Bernhardt waren die »Götter aus dem All« wohl eher Science Fiction, aber von der lukrativen Art. Däniken hatte Briefe mit einer Einladung nach Zürich nicht nur an die Autoren von PERRY RHODAN geschickt, sondern auch an sie beide. Bernhardt lehnte die Teilnahme erst dankend ab, aber Blachs Geschäftssinn war geweckt, und so schickte er Bernhardt dennoch hin. Fast wäre eine Krankheit des Cheflektors dazwischengekommen, und auch William Voltz verspürte keine rechte Lust, aber schließlich flogen sie doch gemeinsam zu dem Kongress.
Darlton kam mit dem Auto aus dem heimischen Salzburg, zusammen mit Peter Krassa, der tags zuvor bei ihm eingetroffen war. Sie erreichten Zürich – wie Voltz und Bernhardt – am späten Nachmittag des 28. Mai, einen Tag vor dem offiziellen Beginn, weil am Abend ein gemütliches Abendessen und Treffen geplant war, eine Gelegenheit, in Ruhe zu reden, die sich sonst während der Tagung wohl nicht mehr ergeben würde. Die Veranstaltung selbst fand vom 29. bis 31. Mai im Mövenpick-Hotel Holiday Inn statt, direkt am Züricher Flugplatz – und wie erhofft begegnete Darlton dort vielen alten Bekannten aus Chicago.
Nach vollzogener Tagung, am 1. bis 4. Juni, folgte eine Exkursion mit fünf Autos nach Zürich und Umgebung, von Däniken organisiert, inklusive einer Übernachtung in einer Berghütte. Fünfzehn bis zwanzig Personen nahmen daran teil, lauter persönliche Freunde des Schweizers. Voltz war ausdrücklich eingeladen, konnte das Angebot aber aus Zeitgründen nicht wahrnehmen. Darlton ließ sich allerdings auch diesen Spaß nicht nehmen.
Das begeisterte Engagement Darltons für die AAS sollte noch lange anhalten. Sechs Jahre später kam es zu einem Kongress in Wien, an dem auch sein Freund Jürgen Grasmück alias Dan Shocker teilnahm, der in den Sechzigerjahren das Genre des Horrorheftromans begründet hatte, sowie dessen Frau Karin. Jürgen Grasmück erinnert sich im Juni 2004: »Ich war damals schon einige Jahre lang Mitglied in der AAS und hatte mich intensiv mit der Thematik beschäftigt. Aber ich engagierte mich nicht sonderlich. Das Interesse war eher aus Bekanntschaften und Freundschaften heraus entstanden. Wir hatten damals engen Kontakt mit Walter und seiner Frau Bibs, einer ganz, ganz süßen Frau, und genossen die wunderbaren Vorträge der international bekannten Autoren. Alles war richtig seriös, und schließlich gab es einen herrlichen Abschlussabend mit einem putzmunteren Walter.«
Das Thema Präastronautik war salonfähig geworden, auch und erst recht für den Moewig Verlag, der mittlerweile schon Bücher über diese Thematik herausgebracht hatte, vor allem »Die Manna-Maschine« von George Sassoon und Rodney Dale, einem Techniker und einem Linguisten, die 1979 am Beispiel der Kabbala aufzuzeigen versuchten, dass es auf der Erde Artefakte einer fremden Intelligenz gegeben haben muss.
Vorbei die Zeiten, als Dänikens Beitrag für das PERRY RHODAN JAHRBUCH 1976 an Cheflektor Bernhardt gescheitert war, auch wenn die Leser mit einem Artikel von Peter Krassa entschädigt wurden, in dem er über vermehrt auftretende UFO-Sichtungen spekulierte.
Kehraus bei PERRY RHODAN
Am 13. Juni 1975 fand erneut eine Autorenkonferenz statt. Cheflektor Kurt Bernhardt hatte dafür neben K. H. Scheer und Clark Darlton auch William Voltz, Kurt Mahr und Günter M. Schelwokat, den Lektor der SF-Reihen des Pabel Verlags, geladen.
Er bat die Genannten, schon am Vortag anzureisen und am Nachmittag oder spätestens um 20 Uhr in München einzutreffen. Zimmer im Hotel Eden-Wolff gegenüber dem Starnberger Bahnhof seien bereits reserviert. Am nächsten Morgen gebe es »eine PERRY RHODAN- und ATLAN-Besprechung. In dieser Sitzung wird die Weiterentwicklung der beiden Reihen festgelegt.« Am frühen Abend könne man dann wieder abreisen.
Das Besondere an dieser Konferenz war, dass zeitweise auch Leser anwesend waren. Deshalb bezeichnete Bernhardt sie als »Gruppendiskussion über die Reihen bzw. Serien PERRY RHODAN, ATLAN, TERRA ASTRA und PERRY RHODAN-Taschenbuch«. In dem Rundschreiben, das er am 2. Juni an die Autoren und den Lektor verschickte, heißt es: »Ich bitte Sie, sich entsprechend vorzubereiten, damit die Diskussion über die Weiterentwicklung der Serien schnell vonstatten geht. Ich empfehle daher jedem von Ihnen, ein entsprechendes Exposé auszuarbeiten. Wir haben bereits entsprechende Fragen für die Gruppendiskussion vorbereitet und schicken Ihnen hiervon die Texte zu. Bitte legen Sie dafür entsprechende weitere Fragen zu den einzelnen Serien und Reihen vor.«
Auch wenn einige Beteiligte nicht so recht wussten, was diese Gruppendiskussion eigentlich bezwecken sollte, tröstete man sich doch einstweilen damit, dass sie mit dem Wiedersehen von Freunden und geschätzten Kollegen einherging.
Auf den Tag vier Wochen später, am 2. Juli, verschickte Bernhardt die Auswertung der Autorenkonferenz. Er nannte sein Rundschreiben einen »Bericht über diejenigen Punkte der Gruppendiskussion PERRY RHODAN 1975, die unbedingt von den Autoren und Exposéschreibern beachtet werden müssen.« Dieser ging auch an die anderen Autoren der Serie, die nicht anwesend gewesen waren – Francis, Ewers, Kneifel und Vlcek.
In dem Rundschreiben wurde festgestellt, dass die Risszeichnungen an Beliebtheit verloren hätten, so dass sie vielleicht nicht mehr jeden Monat erscheinen sollten. Voltz antwortete zehn Tage später nach der Rückkehr aus einem Urlaub: »Es stimmt nicht, daß die Risszeichnungen nicht mehr so beliebt sind wie früher – lesen Sie bitte die Leserbriefe, was für eine Aufregung losbricht, wenn in der 2. Auflage einmal eine RZ ausgelassen wird. In dieser Hinsicht waren die Leser bei der Diskussion nicht repräsentativ.«
Voltz erklärte sich gern bereit, Leserbriefe auf der Kontaktseite künftig ausführlicher zu beantworten. Es war ihm aber anscheinend nicht möglich, in Zukunft gelungenere SF-Witze für die LKS auszuwählen – auf sie wurde ganz verzichtet.
Auch die Handlung von PERRY RHODAN wurde angesprochen. Hin und wieder, folgerte Bernhardt, solle wieder einmal ein Roman in Ich-Form erzählt werden, weil das bei den Lesern sehr beliebt sei. Auch Einzelabenteuer sollten wieder innerhalb der Serie erscheinen, »ganz besonders mit charakteristischen, gut ausgeführten Nebenfiguren«.
Dem Zeitgeist gemäß schlug er auch vor, dass Serienfiguren, die schon lange gemeinsame Abenteuer erlebten, sich nicht mehr mit »Sie« ansprechen dürften. Die Exposé-Redaktion möge diesbezüglich die Rangordnung überprüfen. Voltz entgegnete, dass K. H. Scheer im Daten-Exposé von Band 750 sicher gern regeln werde, »wer lebt, wer wie alt ist, wer sich siezt und wer sich duzt.« Aber dieses Thema war damit nicht vom Tisch. Es sollte in den nächsten fünf Jahren immer wieder aufkommen, bis Voltz anlässlich Band 1000 die Entscheidung traf, dass die Menschen der Zukunft sich alle nur noch duzten.
Das war eine Entscheidung, die einer politischen Aussage gleichkam. In seinem »Bericht« hatte Bernhardt noch erklärt, man solle von soziologischen Themen ablassen und sie nicht veröffentlichen, da sie ein heißes Eisen seien. Nicht nur die Leser hätten diese Meinung zum Ausdruck gebracht, auch die Redaktion vertrete diese Auffassung.
Im selben Bericht fand sich aber auch Bernhardts Forderung, die Frauenfiguren in der Serie »menschlicher und wärmer« zu gestalten. »Das vermissen die Leser bei sämtlichen Frauenfiguren, die bisher bei PERRY RHODAN agiert haben.«
Alle Jahre wieder
Am 27. Mai 1975 war das erste Jahrbuch erschienen, und stolz hatte der Herausgeber William Voltz im Vorwort verkündet: »Fortan soll alljährlich ein PERRY-RHODAN-Jahrbuch erscheinen, jedesmal mit einem anderen Zentralthema.« Er hatte auch schon mit den Vorarbeiten begonnen und wertvolle Mitarbeiter gewinnen können, und bereits zehn Tage nach Erscheinen leitete Cheflektor Kurt Bernhardt einen Leserbrief mit Vorschlägen für das nächste Jahrbuch an Voltz weiter, das als Reaktion auf die Veröffentlichung entstanden war. Voltz sollte vor allem den Vorschlag prüfen, für das Jahr 1976 – also im Zeitrahmen des nächsten Jahrbuchs – einen PERRY RHODAN-Wandkalender herauszubringen. Er könne beispielsweise die Porträts von Hauptpersonen der Serie enthalten, die auf der Blattrückseite beschrieben würden, hieß es. Aber auch andere Motive wurden in dem Leserbrief erwogen, etwa die Flaggschiffe des Großadministrators oder sonstige wichtige Schiffe der Handlung, ebenfalls umseitig beschreibbar. Wenn die Monatsangaben so angebracht wären, hieß es, dass man sie am Ende des Monats ohne Beschädigung des Bildes abschneiden könnte, würden die Bilder eine imposante Postersammlung ergeben.
Bernhardt musste dieser Vorschlag gefallen. Er hatte Voltz bereits in einem Schreiben vom 13. Januar ähnliche Ideen mit auf den Weg gegeben. »Wieweit Sie die Vorschläge für das Jahrbuch 76 verwenden können, überlasse ich natürlich Ihnen. In jedem Fall bitte ich Sie, sich baldigst Gedanken darüber zu machen, damit ein Kalender 1976/77 spätestens im November/Dezember für die Herstellung zusammengetragen wäre.«
Der Herausgeber trieb die Arbeit an dem zweiten Jahrbuch denn auch vehement voran, wie sich aus einem Schreiben am 1. Juli 1975 ergibt, das Thomas Schlück an ihn richtete. Darin erklärt der Literaturagent, beim nächsten Band »etwas stärker mitzumischen«. Er habe sich wegen des kommenden Jahrbuchs über PSI bereits mit jemandem in Verbindung gesetzt, der Voltz kein Unbekannter sei. Er kenne ihn aus dem SF-Fandom – es sei der Diplompsychologe Jürgen vom Scheidt. Schlück erwähnte nicht, dass sein Klient auch schon drei SF-Romane und mehrere Anthologien veröffentlicht hatte. Das wusste Voltz ohnehin. Er verwies auf seine Veröffentlichungen im psychologischen Bereich und versicherte, er sehe durchaus die Möglichkeit, dass vom Scheidt als Experte an dem Jahrbuch mitarbeiten werde. Sollte Interesse bestehen, wolle Schlück sich mit ihm in Verbindung setzen.
Voltz nahm persönlich mit ihm Kontakt auf, und vom Scheidt erklärte sich am 14. Juli 1975 gern bereit, für das nächste Jahrbuch einen Artikel über PSI zu schreiben. »Ich arbeite in einer – allerdings privaten – Arbeitsgruppe über Parapsychologie mit, die einige Wissenschaftler bei Messerschmidt-Bölkow-Blohm gegründet haben und bei der auch der geheimnisumwitterte Physiker Burkhard Heim am Rande mitmacht«, führte er aus. »Du bekommst das Manuskript Anfang September, jedenfalls termingerecht.«
Auch die Serienautoren sollten wieder Beiträge zu dem Zentralthema leisten und im Verlag sich erneut Werner Müller-Reymann um das Projekt kümmern – Krimimüller, wie er wegen seiner Lektoratstätigkeit für KOMMISSAR X oft genannt wurde. Aber als Monate vergingen, in denen unklar blieb, ob es ein zweites Jahrbuch denn wirklich geben würde, erkundigte sich Voltz am 20. September 1975 bei Bernhardt nach dem Stand der Dinge. Der Cheflektor antwortete postwendend: »Ich habe mit Herrn Blach darüber ein Gespräch gehabt, und er konnte bisher noch keine Entscheidung treffen. Wir müssen abwarten.«
Der Verlagsleiter konnte sich nicht entscheiden. Lohnte sich ein weiterer Band? Erst am 12. Dezember, fast ein Vierteljahr später, als der Einsendeschluss für das neue Jahrbuch schon verstrichen war, erklärte Bernhardt gegenüber Voltz: »Nach meiner Besprechung in Rastatt kann ich Ihnen mitteilen, daß wir vorerst kein PERRY RHODAN-Jahrbuch bzw. -Almanach herausbringen. Der Verkaufserfolg des letzten Jahrbuchs war sehr gering.«
Damit war das Projekt gestorben, und erst siebzehn Jahre später sollte sich die Fanszene an dieses Konzept erinnern und 1992 mit Unterstützung von Florian F. Marzin, dem damaligen Cheflektor von PERRY RHODAN, ein Jahrbuch herausbringen, das zehn Jahre lang in ständig verbesserter Austattung erschien. Es startete als Sonderpublikation des SF-Club »Universum« und erschien von 1998 bis 2002 in der PERRY RHODAN-Fanzentrale. 1998 trat auch Klaus Bollhöfener als Mitherausgeber an die Stelle von Hans-Dieter Schabacker. Der zweite Herausgeber aller Bände war Michael Thiesen. Als die Auflage drastisch zurückging und die Produktion für die PERRY RHODAN-Fanzentrale mit ihren beschränkten finanziellen Mitteln nicht mehr erschwinglich war, sprang erneut der SF-Club »Universum« ein und publiziert seit 2005 das PERRY RHODAN JAHRBUCH wieder regelmäßig, seitdem herausgegeben von Frank Zeiger und Andreas Schweitzer.
Das einzige offizielle Jahrbuch ist und bleibt allerdings die Ausgabe, die am 27. Mai 1975 mit Silbereinband, rotem Zackenkreis und PERRY RHODAN-Konterfei auf den Markt kam: das PERRY RHODAN-Jahrbuch 1976 – 160 Seiten für 6 DM. Wegen der schlechten Bindung zerfällt es heute in der Hand, so dass es nur noch wenige erhaltene Exemplare gibt. Heiß begehrt ist in Sammlerkreisen ein Fehldruck mit unbedrucktem Cover.
Auch von dem PERRY RHODAN-Kalender, den man unabhängig davon hätte herausbringen können, war lange keine Rede mehr. Erst 1982 brachte die Verlagsgruppe Pabel-Moewig einen solchen Kalender für 1983 heraus, den der PERRY RHODAN-Illustrator Johnny Bruck gestaltete. Die ersten zwölf Cover der Silberbände finden sich darin auf Hochglanzpapier in attraktiver Ausstattung.
Hausputz hinter den Kulissen
Cheflektor Kurt Bernhardt war ein Meister im Versenden von Briefen. Er legte stets viel Wert darauf, dass alle Autoren immer auf dem gleichen Kenntnisstand waren. Am 24. Juni 1975 verschickte er ein Rundschreiben, in dem es heißt: »Ich bitte Sie, unter allen Umständen die Computer-Texte zu lesen, sowie auch alle Exposés von PERRY RHODAN, die Herr Voltz schreibt – nicht nur die Exposés, nach denen Sie einen Auftrag zum Schreiben eines PERRY RHODAN-Romans bekommen haben.« Die von Kurt Mahr verfasste Rubrik PERRY RHODAN COMPUTER im Anhang der Romane war nicht nur bei den Lesern sehr beliebt. Bernhardt betrachtete sie aufgrund der zahlreichen handlungsbezogenen Spekulationen im Rahmen von Physik und Soziologie auch für alle Autoren als besonders wichtig.
Selbst die Leserbriefschreiber band er in seine Neugestaltung der Serie ein, allen voran einen Wiener namens Franz Dolenc, der sich durch umfangreiche und kenntnisreiche Kritiken hervorgetan hatte. Am 2. Juli 1975 schickte er Voltz dessen umfangreiches Exposé, das dieser auf jeden Fall beantworten solle, »denn hier liegt schon eine kleine Doktorarbeit vor«. Wegen seiner grundsätzlichen Überlegungen ging es auch an alle anderen Autoren.
Ebenso lag ihm die schriftstellerische Qualität der Romane am Herzen. Schon auf der Autorenkonferenz Mitte 1975 hatte er erklärt, die einzelnen Werke jeweils von den Teamkollegen gegenlesen und beurteilen lassen zu wollen. Am 18. August des Jahres verschickte Verlagsredakteur Müller-Reymann in einem Rundschreiben an alle Autoren und Günter M. Schelwokat erste Vordrucke, »Lektoratsbögen« genannt, mit denen die Exposés und Romane beurteilt werden konnten. Ernst Vlcek schlug drei Wochen später vor, die Kritiken der Autoren den Kollegen doch auf jeden Fall namentlich zuzustellen.
Auch die Exposéarbeit nahm Bernhardt nun eingehender unter die Lupe. Am 12. September führte er in einem Schreiben an Voltz eine Neuerung ein, die bis heute Bestand hat. Er erklärte, dass in den PERRY RHODAN-Romanen die Beschreibung der Personen zu kurz komme, ihre Kleidung und was sie – wenn es sich um Angehörige einer anderen Rasse handelt – von den Menschen unterscheidet. »Es ist das ABC eines jeden Schriftstellers, um lebendig und phantasievoll zu schreiben, daß diese Fakten jeweils in seinen Romanen herausgearbeitet werden.« Seine Arznei: »Ich bitte Sie daher, die Personenbeschreibung jeweils in Ihren Exposés extra, nicht in der Handlungsentwicklung, darzustellen.«
Erst am 27. Januar 1976 legten sich die Wogen des Großreinemachens wieder etwas. In einem Rundschreiben an alle Autoren und Lektor Schelwokat griff er ein Versprechen auf, dass der Verlag ebenfalls auf der letzten Autorenbesprechung gegeben hatte. Er verkündete, »daß die PERRY RHODAN-Autoren, die ein Thema von der Spannung und vom Inhalt her besonders gut gestalten, eine Prämie erhalten, wenn der Lektor, Herr Schelwokat, Romane in die Hand bekommt, die einer solchen Auszeichnung würdig sind.«
In jedem Zehnerblock sollte es zwei Preisträger geben. Die ersten mit dem Sonderhonorar ausgezeichneten Romane waren »Ein Freund der Posbis«, erschienen als Band 750, der erste Jubiläumsband von H. G. Francis, gefolgt von »Welt ohne Menschen«, den Voltz unter der Bandnummer 757 verfasste. Am 5. Februar wurden die nächsten beiden Preisträger gekürt, die Bände 766 und 768, »Der Herr der Welt« von Mahr und »Terra-Patrouille« von Voltz. Am 28. April erfüllten mit Band 778 und 779 von Voltz und Vlcek die Bände »Duell der Außerirdischen« und »Gucky und der Grauvater« die Anforderungen für die Verleihung der Prämie. Fast eineinhalb Jahre lang wurde dieses Sonderhonorar vergeben, das laut Bernhardt den Autoren ein Ansporn sein sollte, beim Schreiben ihr Bestes zu geben.
Der PERRY RHODAN-Autor, den es nie gab
Die Tätigkeit von William Voltz als Herausgeber des ersten und einzigen offiziellen Jahrbuchs hatte einen faszinierenden Nebeneffekt. Es kam zur Zusammenarbeit mit Klaus Fecher, einem altgedienten SF-Profi. Als ehemaliger Lektor des Pabel Verlags, da dieser noch die UTOPIA-Reihen herausbrachte und ein Konkurrenzunternehmen zu Moewig darstellte, hatte er schon Mitte der Fünfzigerjahre, teilweise unter dem Pseudonym F. Klaus, namhafte SF-Autoren wie Cyril M. Kornbluth, Henry Kuttner und Eric Frank Russell übersetzt, zu einer Zeit also, als auch die späteren PERRY RHODAN-Autoren Clark Darlton, Kurt Mahr und Conrad Shepherd ihre ersten literarischen Gehversuche machten.
Anscheinend bekundete Fecher jetzt Interesse an einer Mitarbeit als Serienautor.
Und das Erstaunliche war: Cheflektor Bernhardt gab grünes Licht für einen Versuch, woraufhin der Veteran Fecher einige Ideen einreichte. Der Exposéautor entwickelte daraus einen Handlungsentwurf, der möglichst eigenständigen Charakter besitzen sollte.
In der ersten Aprilwoche 1975 lieferte Fecher sein PERRY RHODAN-Manuskript ab, erst an William Voltz, dann an Günter M. Schelwokat, den ständigen Lektor des Perryversums. Es handelte sich um ein Planetenabenteuer mit den Multycyborgs, bei denen eine Hauptfigur aus einem Gefängnis ausbrach und als blinder Passagier an Bord eines Raumschiffs gelangte. Es war Fechers erster Roman überhaupt, ein Erstlingswerk, in dem er den Lesern Gelegenheit geben wollte, sich über die darin vorkommenden Figuren ausgiebig lustig zu machen, während die Ziele und Zusammenhänge mit der Hauptgeschichte durchaus ernsthaft behandelt wurden. Dabei gab es auch Anklänge schwarzen Humors.
Bernhard beschied per Brief vom 17. April, dass der Roman nicht erscheinen solle. Die Handlung sei zu hochgestochen, und der Leser könne sich durch den Humor im Roman veralbert fühlen. Immerhin bewilligte er ein Ausfallhonorar für die Ideenvorgaben und das Manuskript. Der Autor nahm es ihm nicht übel, scheint aber keinen weiteren Roman mehr geschrieben zu haben und wurde auch sonst nicht mehr für Pabel tätig. Bei Gefallen wäre sein Werk vermutlich um den Jubiläumsband 750 herum erschienen.
Klaus Fecher ist damit der »heimliche« PERRY RHODAN-Autor, ein früher Gastautor in der Geschichte der Serie, dessen Roman allerdings nicht zur Veröffentlichung gelangte.
ATLAN-Zeitabenteuer – die zweite!
Während der gesamten bisherigen Laufzeit war den Autoren der PLANETENROMANE nicht nur die Handlung, sondern auch die Zeit der Handlung freigestellt worden. Als Ergebnis der Gruppendiskussion sollte sich das nun ebenfalls ändern.
»Die PERRY RHODAN-Taschenbücher müssen unbedingt Themen bringen«, verkündete Bernhardt in seinem Schreiben vom 2. Juli, »die in der Serie besonders akut geworden sind und in ihrer Ausführung und Darstellung nicht den Platz eingeräumt erhielten, der für diese Themen wichtig wäre. Man soll diese Thematik in die PERRY RHODAN-Taschenbücher aufnehmen. Eine entsprechende Werbung muss dann vom Verlag erfolgen.«
Voltz stimmte am 12. Juli zu, dass die Taschenbücher besser eingegliedert werden müssten, fügte aber hinzu, dass man bisher weder Günter M. Schelwokat noch ihm die Möglichkeit geboten habe, die Koordination zu übernehmen. Unkommentiert ließ er Bernhardts Feststellung: »Die PERRY RHODAN-Taschenbücher mit den historischen ATLAN-Themen sind sehr beliebt, und man müßte diese Thematik besser pflegen als bisher.«
Am 16. Juli, zwei Wochen nach seinem Rundschreiben, nahm Bernhardt in einem Brief an Schelwokat noch einmal auf die Gruppendiskussion Bezug und wiederholte, dass die Taschenbücher nicht die erforderliche Resonanz fänden. »Weiter wurde festgestellt, daß die Zeitromane von Hans Kneifel sehr beliebt sind.«
Der Cheflektor wollte nun beide Fakten zusammenführen: »Herr Kneifel muß eine Thematik zusammenstellen, nach der er diese ›utopischen Geschichtsromane‹ schreiben wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß Herr Kneifel jeden zweiten oder dritten Monat einen ›Tunnel‹-Roman schreibt, und daß die anderen Romane die Themen behandeln, die in der PERRY RHODAN-Serie durch den Raummangel vernachlässigt werden. Herr Voltz sowie auch Sie müssen die Hinweise geben, welche Themen hierfür besonders aktuell sind. Eine Koordination zwischen Ihnen und Herrn Voltz muß in dieser Angelegenheit unbedingt erfolgen. Sie kann jeweils telefonisch durchgeführt werden.«
Die Gespräche wurden geführt, und Kneifel machte sich ans Werk. Am 12. August, also keine vier Wochen später, stand der Titel des ersten neuen Zeitabenteuers fest, und Verlagsredakteur Joachim Bulla schickte den Text einer Werbeseite an William Voltz: »Ich informiere Sie davon, damit Sie die Leser-Kontaktseite entsprechend abstimmen können.« Was Voltz auch umgehend tat.
Die Werbeseite selbst erschien zweimal nacheinander in allen drei Auflagen von PERRY RHODAN, in ATLAN und TERRA ASTRA sowie in je einer Ausgabe der Taschenbuchreihen TERRA, TERRA FANTASY, ZBV und DOC SAVAGE, nicht zu vergessen in den beiden Auflagen der PLANETENROMANE – nur wenige Wochen vor Erscheinen des Romans im November 1975.
»Nun kam ein Abenteuer nach dem anderen ans Tageslicht«, schrieb Hans Kneifel elf Jahre später rückblickend im PERRY RHODAN WERKSTATTBAND. »Die Lücken in der Chronik, die den weißen Flecken in Atlans Gedächtnis entsprachen, konnten gefüllt werden. Eine Anzahl neuer Bände wurde hergestellt.« Diese Anzahl sollte sich schließlich auf 23 Romane belaufen, die anfangs auch wirklich alle zwei bis vier Monate erschienen.
Kneifel hatte einen Königsweg beschritten. Er hatte die Haupthandlung abermals in die Frühzeit von Atlans Exil auf der Erde verlegt und arbeitete sich langsam durch die Jahrtausende vor, die Rahmenhandlung aber – die schildert, wie der Arkonide dem Tode nahe in einem Koma liegt – war Bernhards Wunsch gemäß zur aktuellen Handlungszeit der Heftserie auf Gäa in der Provcon-Faust angesiedelt, der neuen Heimatwelt der Terraner.
Der Effekt von »Tunnel-Romanen« sollte sich wegen der bereits geschriebenen Manuskripte allerdings erst mit Band 154 einstellen, als schon drei neue Zeitabenteuer erschienen waren. Von da an waren durch einen »Erlass« des Lektors auch die Romane der anderen Autoren im 36. Jahrhundert angesiedelt und handelten von einer Expedition der Laren, den Abenteuern eines auf Gäa auftauchenden Unbekannten und den Eskapaden Galto Quohlfahrts, Dalaimoc Rorvics und Tatcher a Hainus, bis die neue Regel schon mit Band 161 ausgerechnet durch William Voltz’ letzten PLANETENROMAN wieder gebrochen wurde. Die folgenden Taschenbücher spielten zwar teilweise noch zur Zeit des Neuen Einsteinschen Imperiums, aber auch wieder in früheren Handlungszeiten.
Die Innenillustrationen werden entsorgt
Kurt Bernhardt beschäftigte sich damals intensiv mit einer Neugestaltung von PERRY RHODAN. Nachdem er am 2. Juli seinen Bericht an alle Autoren verschickt hatte, erklärte er sechs Tage später in einem Schreiben an William Voltz: »Aufgrund der Gruppendiskussion, die Sie selbst erlebt haben, wurde veranlaßt, daß Herr Bruck keine Illustrationen für PERRY RHODAN (1. Auflage) mehr macht. Ich bin der Auffassung, daß wir hierüber eine Information auf der Kontaktseite bringen müssen, denn ich gehe davon aus, daß ungefähr die Hälfte der PERRY RHODAN-Leser nach wie vor mit den Bruck-Illustrationen rechnet. Die Information muß daher ganz sachlich sein und auch begründen, warum wir diese Illustrationen nicht mehr bringen.«
Bernhardt machte gleich einen Vorschlag, wie das geschehen könnte. »Ein sehr guter Weg wäre, wenn Sie die Kontaktseiten ab sofort nicht mit zwei Druckseiten Umfang herausbringen, sondern mit drei Seiten. Die Kontaktseiten haben ja nach wie vor eine sehr gute Resonanz, und ich habe den Eindruck, daß Sie bisher viel zu wenig Raum hatten für das Material, das Ihnen hierfür zur Verfügung steht.«
Abschließend bat Bernhardt darum, dass Voltz ihn nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub umgehend anrufe, damit sie die Einzelheiten besprechen könnten. Voltz antwortete am 12. Juni zum Thema Innenillustrationen knapp: »Bitte teilen Sie mir mit, wann diese nicht mehr erscheinen.« Außerdem bat er um den baldmöglichen Abdruck eines Textes in dieser Sache, den er im selben Schreiben an Bernhard formulierte: »Einem vielfach geäußerten Wunsch unserer Leser entsprechend, bringen wir anstelle der Innenillustrationen ab sofort eine zusätzliche LKS in PERRY RHODAN, so daß nun insgesamt drei Kontaktseiten erscheinen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, noch mehr auf Ihre Briefe einzugehen und längere Kurzgeschichten und Beiträge zu veröffentlichen.«
Voltz wollte sichtlich eine Entschädigung für die Leser durchsetzen, sie hatten tatsächlich oft um eine dritte Leserkontaktseite gebeten, aber er wusste auch um das Machbare, denn er schloss mit den Worten: »Übrigens müssen die drei Seiten in allen drei Auflagen gebracht werden – sonst entsteht Durcheinander!!!«
Anscheinend wurde zur Vermeidung des Durcheinanders ein einfacher Ausweg gewählt: Die dritte Leserseite ließ noch Jahre auf sich warten. Dafür wurden mit Band 727 die Innenillustrationen von Johnny Bruck abgesetzt, ohne dass eine Begründung oder ein Hinweis in eigener Sache auf der LKS erschienen wäre.
Das war im Juli 1975. Erst viereinhalb Jahre später wurde diese lieb gewonnene Einrichtung fortgeführt, von Themistokles Kannellakis, einem jungen Künstler aus München, der bald auch als Coverzeichner für SF und Fantasy immer erfolgreicher werden sollte.
Schützenhilfe vom Sternenmädchen
Die Autorenkonferenz für FRANKENSTEIN am 16. Juni 1975 war ein Fiasko gewesen. Aber Dirk Hess, der den größten Teil des Konzepts entwickelt hatte, gab nicht so schnell auf. Zwei Tage später richtete er ein Schreiben an Cheflektor Kurt Bernhardt, in dem er seinem Unbehagen darüber Ausdruck verlieh, dass das geplante Projekt zerredet worden sei.
Es dürfe nicht vergessen werden, erklärte er, »dass FRANKENSTEIN primär ein Horror-Objekt ist. Wir hatten zwar vor, Science Fiction-Elemente in die Serie einfließen zu lassen, sollten uns aber davor hüten, dieselben Erkenntnisse und Grundsätze wie bei der RHODAN-Serie zu übernehmen.« Außerdem schlug er vor, die Serie in vierzehntägigem Rhythmus innerhalb der VAMPIR-Reihe des Hauses zu veröffentlichen. »Dies mindert erhebliche Risiken, wie sie beim Start einer neuen Reihe immer auftreten und entbindet uns davon, kostspielige Werbekampagnen zu starten.«
Hess schlug ein möglichst kleines Team aus Horror-Spezialisten vor, die sich zu regelmäßigen Arbeitsgesprächen treffen sollten, ergänzt um vierwöchentliche Arbeitsgespräche zwischen ihm und William Voltz. Außerdem erbat er eine Lektorierung seines Romans durch Sabine Illfeld von der VAMPIR-Redaktion und ihre Stellungnahme, ob seine derzeitige Schreibweise den Anforderungen genüge, die an Romane dieser Reihe gestellt würden.
Wenige Tage nach seinem Schreiben nahm Kurt Bernhardt an einer Züricher Tagung der Ancient Astronauts Society teil, bei der er zwei langjährige Freunde des PERRY RHODAN-Mitbegründers Clark Darlton kennen lernte, die Präastronautik-Schriftsteller Erich von Däniken und Peter Krassa, deren Theorien zum Teil in die Serie eingegangen waren. Und auf derselben Veranstaltung hatte Bernhardt auch seine erste Begegnung mit der Esoterik. Er lernte eine Kölner Gruppe kennen, die sich mit Weissagung und Kartenlegen befasste. Und der begeisterungsfähige Cheflektor, immer auf der Suche nach neuen Projekten und neuen Einflüssen für bestehende Projekte, sah sogleich eine große Chance …
Am 24. Juli 1975 legte er einem Schreiben an William Voltz Unterlagen bei, die ihm für das stagnierende Horror-Projekt FRANKENSTEIN nützlich erschienen. Sie handelten vom »Sternenmädchen, der Tarot-Magierin«, die auf diese Welt gekommen sei, um allen Freude zu bringen. Weissagung und Kartenlegen sollte die Menschen durch die Jahrtausende alten Pharaonen-Mysterien der Ägypter zu einem Leben in wahrer Liebe führen. »Wir leben in einer schnellen Zeit«, hieß es auf den fotokopierten Handzetteln der Kölner Esoterik-Gruppe. »Wir sind nicht mehr isoliert auf dem Planeten Erde. Wir schauen staunend in das WELTALL. Fliegt mit. Wir fliegen im Live-Jet zu den Planeten. Wir transmittieren mit Psi-Sonden in die Abenteuer einer neuen Welt. Wir erleben die Neue Zeit. Fliegt mit.«
In seinem Begleitbrief an William Voltz erläuterte Bernhardt seine Idee: »Diese Leute waren auch auf der Züricher Tagung, und ich glaube, dass hier eine Kombination zwischen unserer neuen Serie FRANKENSTEIN und dem ›Sternenmädchen mit den Tarot-Karten‹ gemacht werden könnte. Ich habe mit den Leuten in Köln gesprochen und vereinbart, dass ich nach meinem Urlaub mit Ihnen und mit Herrn Gehrmann über diese Sache spreche, bzw. wird Herr Kaiser von dieser Firma auch dort sein. Ich habe den wahnwitzigen Plan, dieses ›Sternenmädchen‹ redaktionell in unsere Romanserie mit einzubauen.«
Anscheinend wurde kein weiteres Wort mehr darüber verloren. Bernhardt ließ das Horror-Projekt stillschweigend sterben, und Dirk Hess verzichtete auf den Versuch, vielleicht doch noch zu retten, was zu retten war. »Die Zeit war noch nicht reif für ein solches Projekt, über das Kids von heute nur müde lächeln würden«, resümiert er im Februar 2004.
Und doch blickt Hess auch etwas wehmütig auf das große Potenzial der Serie zurück, die sich nicht zuletzt durch die äußere Gestaltung Ausdruck verschafft hätte. »Der Originalcover-Entwurf für FRANKENSTEIN war vom späteren Bundesfilmpreisträger Klaus Dill gestaltet worden. Ob die Arbeit noch im Verlagsarchiv existiert, weiß ich nicht. Das Cover bildete den phantastisch verschlungenen Rahmen eines Zauberspiegels ab. Im Spiegel erschien großflächig das jeweilige Romanthema, während der Spiegelrahmen aus versteinert, hölzern wirkenden Körper- und Tierelementen, also einem phantastischen Bestiarium, bestand.«
Klaus Dill, der als Gestalter von Kinoplakaten bekannt wurde, malte Anfang der Neunzigerjahre auch Titelbilder für Haffmans, einen damals hoch angesehenen Literaturverlag. Die FRANKENSTEIN-Serie war mit großen Ambitionen verbunden gewesen, und es ist ein Jammer, dass sie letztlich aus Angst vor einer Indizierung gar nicht erst auf den Markt kam.
Getrennte Wege
Jahrelang hatte es bei ATLAN, dem kleinen Bruder von PERRY RHODAN, der am 6. Oktober 1969 ebenfalls von K. H. Scheer gestartet und inzwischen von William Voltz exposémäßig geleitet wurde, immer dieselben Hauptfiguren gegeben. Bis zur Einführung der EXCLUSIV-Romane am 11. Juni 1973 war das Psycho-Team aus Ronald Tekener und Sinclair Marout Kennon die treibende Kraft gewesen – der Smiler mit den Lashat-Pocken, smarter Herzensbrecher und Waffensammler, und das Gehirn eines verwachsenen Zwergs im Robotkörper, der es hasst, in einer Vollprothese durchs Leben zu gehen.
Im letzten Krimi-Zyklus der Serie änderte sich das. Die Bände erschienen nun alternierend mit der EXCLUSIV-Reihe, und Exposéautor Voltz nutzte die Gelegenheit für die »Querschaltung« eines Protagonisten, den er fast elftausend Handlungsjahre überwinden ließ. Der Wechsel der Zeiten erfolgte in ATLAN 173, in dem Ronald Tekener sich als Hobbyarchäologe auf einem fremden Planeten aufhält, während Kennon in seiner Abwesenheit das USO-Hauptquartier Quinto-Center leitet. Als dort neue Informationen über den verschollenen Atlan eintreffen, macht das Team sich gemeinsam auf die Suche und entdeckt die Traummaschine, die Atlans Geist in der Vergangenheit festhält.
Tekener und Kennon retten den Lordadmiral, aber in dem Robotermenschen erwacht eine eigenartige Sehnsucht: Nun will er an die Traummaschine angeschlossen werden. Atlan gewährt ihm zwei Stunden, in denen Kennons Bewusstsein sich in seinem ursprünglichen, verwachsenen Körper befindet und im Jahre 10.498 arkonidischer Zeitrechnung. Die kurze Erfahrung zeigt Kennon, wie wichtig ihm der Besitz seines Originalkörpers ist. Er lässt sein Gehirn im Roboterleib mit einem Lebenserhaltungssystem verbinden und an die Traummaschine anschließen. Dann wechselt er endgültig die Epoche.
Die Leser brauchten nicht lange auf ein Wiedersehen mit Kennon zu warten. Schon in ATLAN EXCLUSIV 176/37, also drei Realwochen später, erfuhren sie, dass der Plan des Kosmokriminalisten aufgegangen war. Er war wieder in seinem schwächlichen Körper zu der Zeit gelandet, in der Orbanaschol III. den jungen Kristallprinzen Atlan erbittert verfolgte. Damit begann Kennons Vergangenheitszyklus, der die gesamte Laufzeit der EXCLUSIV-Serie andauerte. Er wurde fast ausschließlich von H. G. Francis geschrieben, der Voltz bei mindestens zwei Bänden auch mit Exposé-Vorschlägen versah.
Handlungsmäßig fällt es Kennon nicht schwer, sich in der Gesellschaft des Großen Imperiums zurechtzufinden – immerhin hat er ausführliche Studien über die galaktischen Altvölker getrieben. Er baut sich einen Roboter namens Gentleman Kelly, der ihm als Transportmittel dient, nimmt den Namen Lebo Axton an und beschließt, auf Arkon II eine Position zu erlangen, durch die er den Kristallprinzen heimlich unterstützen kann.
Immer wieder taucht Axton in der Serie auf, firmiert in ATLAN 183 als Mutantenjäger für den arkonidischen Geheimdienst, tritt in ATLAN 195 endgültig in Orbanaschols Dienste, wird in ATLAN 204 auf seine Loyalität geprüft und plant in ATLAN 211 den Sturz des Usurpators, der neun Romane später auch erfolgt. In ATLAN 231 versucht er den flüchtigen Ex-Regenten aufzuspüren und wird in ATLAN 239 beinahe als Kämpfer für Atlan enttarnt.
Es folgen fünf Doppelromane, bis Lebo Axton im letzten Band von ATLAN EXCLUSIV wieder in die Zukunft gerissen wird, weil die Traummaschine versagt. Er kann sie reparieren, aber nach einem neuerlichen Ausfall stirbt sein Gehirn im Roboterkörper ab. Axton ist in der Vergangenheit gefangen – als erste »virtuelle« Hauptfigur des PERRY RHODAN-Universums.
Sinclair Marout Kennons Geschichte endete damit nicht. Der Atlantis-Zyklus, der mit ATLAN 300 startete, sah noch mehrere Auftritte mit ihm, darunter eine Begegnung mit dem Lordadmiral der USO, bevor sich seine Spur endgültig in der Zeit verlor.
Der Smiler wechselt die Serie
Aber nicht nur der Robotmensch wurde aus der klassischen ATLAN-Serie in eine neue Handlung hinübergerettet, auch Ronald Tekener sollte den Lesern des Perryversums erhalten bleiben, wenngleich er im EXCLUSIV-Zyklus keine Rolle mehr spielte.
Seinen letzten ATLAN-Auftritt hatte Tekener in Band 175, mit dem die Ära der SF-Krimis innerhalb der Serie endete. Er hatte seinen Psychopartner Kennon noch darin unterstützt, sich an die Traummaschine anschließen zu lassen. Nun lauscht er dem Bericht von Atlans Sohn, eines Wanderers durch Raum und Zeit, der den Lordadmiral auffordert, mit Hilfe eines speziellen Geräts in die Vergangenheit zu reisen, um seine Mutter Ischtar zu unterstützen. Atlan weigert sich, weil er seiner einstigen Geliebten nicht mehr traut.
In der abschließenden Szene versichert der Smiler ihm, richtig gehandelt zu haben. Und das alles auch nicht geträumt zu haben. »Ich persönlich bin sicher«, sagt Tekener, »dass sowohl Sinclair Marout Kennon, der in der Traummaschine liegt, als auch Chapat, Ihr Sohn, zumindest Ihren Weg kreuzen werden. Denken Sie daran, dass es in Ihren Träumen und in Chapats Seelenwanderung keine Grenzen von Raum und Zeit gab.«
Unerwähnt blieb Tekeners weiteres Schicksal. Aber der treue Leser wusste Bescheid. Seinen ersten Auftritt bei PERRY RHODAN hatte der Smiler schon in Band 680 gehabt, der fünf Realmonate zuvor – im September 1974 – erschienen war, chronologisch gesehen 616 Jahre nach den in ATLAN 175 geschilderten Ereignissen!
Damals provozierten Tekener und zwei weitere USO-Agenten auf dem Mars ihre Verhaftung durch die Überschweren, um eine Revolte in einem Gefangenenlager anzuzetteln. Drei Monate später fungiert Tekener in PERRY RHODAN 697 als Atlans Stellvertreter, und gemeinsam schmieden sie einen Plan gegen Leticron, den Anführer der Überschweren, der die Herrschaft über die Milchstraße angetreten hat.
Nach seinem letzten Auftritt in der ATLAN-Serie vergingen lediglich drei Realwochen, bis Tekener voll bei PERRY RHODAN einstieg. H. G. Ewers schildert in Band 707, dass der Smiler zu den von Atlan ausgesandten Beobachtern der galaktischen Szene gehört. Sein Einsatzgebiet ist der Mars, wo er seit Jahren als terranischer Sklave lebt – unter dem Namen Kalteen Marquanteur. Da er zu unbequem und gefährlich geworden ist, wird er von den Überschweren zum Saturn deportiert und dort mit Leticrons Plan konfrontiert, die Unsterblichkeit zu erlangen – ein Plan, der scheitert.
Drei Romane in Folge wurden für diese Handlung aufgewendet, mit der Tekener sich eindrucksvoll einen Platz in der PERRY RHODAN-Serie erkämpfte. Francis, Darlton und Voltz beteiligten sich an der Etablierung dieses Charakters.
1978, drei Realjahre später, als die Handlung mit Lebo Axton in ATLAN EXCLUSIV abgeschlossen war, zeigte H. G. Francis noch einmal, dass er eine besondere Vorliebe für das Psycho-Team hatte. Er setzte Sinclair Marout Kennon und Ronald Tekener auch in den Taschenbüchern ein – einzeln und im Team, sage und schreibe zehn Mal.
Der Smiler, der die Serie heute noch begleitet, gehört mittlerweile zu den langlebigsten und wichtigsten Charakteren von PERRY RHODAN.
Der Horror des Serienkarussells
Als ATLAN-Autor Dirk Hess Anfang 1974 den Auftrag erhielt, sich eine Unterhaltungsserie auszudenken, die Frankenstein in den Mittelpunkt stellte, aber eigentlich eine Mischung aller phantastischen Spielarten bildete, war das Ergebnis eine Serie, die er DAS BÖSE nannte. Sie hatte auch stark metaphysische Anklänge. Es ging um den Kampf der ordnenden Mächte in einem chaotischen Universum, darin als Spielball ausgeliefert der positive Held, dessen Unterbewusstsein die kosmische Bedrohung kennt – erste Vorboten der legendären Ordnungshüter namens Kosmokraten und ihrer mysteriösen Abgesandten, die bei PERRY RHODAN einige Jahre später Einzug halten sollten.
Hess verließ sich nicht darauf, dass Cheflektor Kurt Bernhardt seine Serie annehmen würde. Als Alternative entwickelte er ein zweites Konzept, das er MONKO nannte. Wie der Autor dem Chronisten im April 2004 erklärte, ging es darin »um das Gehirn eines Dämonenjägers im Körper eines riesigen Gorillas. Hintergrund ist die periodische Bedrohung der Erde durch ein Dimensionstor auf einer verwunschenen Insel mit merkwürdigen Zeitflecken.«
Leider wurde tatsächlich nichts aus der FRANKENSTEIN-Serie, wie Bernhardt das erste Projekt gewöhnlich nannte. Jedenfalls nicht als deutsche Produktion. Der Cheflektor nutzte die Zugkraft des klassischen Horrornamens und kaufte eine Serie des Amerikaners Donald F. Glut ein, die 1975 startete und es in VAMPIR auf zehn Bände bringen sollte.
In der Folge stieg Hess als Autor bei ATLAN aus, wurde aber auch in das Team von DÄMONENKILLER übernommen, wo er 1976 sein produktivstes Jahr überhaupt erlebte. Er verfasste seinen ersten Roman für VAMPIR und fünf Romane für Ernst Vlceks Serie unter dem Pseudonym Derek Chess, das er früher einmal für einen SF-Roman bei Zauberkreis verwendet hatte, und es entstand sein einziger Roman für TERRA ASTRA. Unter dem Pseudonym Derek van Cleef veröffentlichte er 1977 bei der Konkurrenzreihe GEMINI des Kelter Verlags, die gerade angelaufen war, noch den Roman »Apokalypse 2000«.
Sage und schreibe 27 Jahre vergingen, bis Dirk Hess – nach seiner Pensionierung – fast noch einmal ins Perryversum eingetaucht wäre. Er sollte im Juli 2004 den neunten Band der zwölfteiligen Miniserie »Obsidian« vorlegen und damit einen Gastauftritt als ATLAN-Autor haben, aber leider kam er mit dem sehr aufwendigen Exposé nicht zurecht.
Es hat den Anschein, als habe Kurt Bernhardt damals, nach der Einstellung von DÄMONENKILLER im Mai 1977, eine neue Serie starten wollen, die sich wie Vlceks Erfolgsserie erst in VAMPIR bewähren sollte. Dabei griff er auch auf das zweite Serienkonzept von Hess zurück, denn als Band 255 erschien »Die Rache des Monko«, der erste Roman von dessen alternativer Horrorreihe. Es gab jedoch keine Fortsetzungen, erklärt Hess, »da ich mich bei Erscheinen des Romans bereits von Pabel getrennt hatte.«
Die Serienprojekte von Dirk Hess bei Pabel waren gescheitert, aber mit diesem Schicksal stand er nicht allein. Auch andere Autoren hatten offenbar den Auftrag erhalten, neue Konzepte für eine Horrorserie zu entwerfen. 1977 erschienen neben der amerikanischen Übernahme »Barnabas der Vampir« von Marilyn Ross, die es im Laufe der Jahre auf insgesamt elf Bände brachte, die ersten Romane von Georges Gauthier um den gleichnamigen Geisterjäger in VAMPIR. Der Autor Walter Mauckner ließ – quasi als Versuchsballons – noch weitere Mehrteiler um Louis Morell und Roger Mansfeld folgen.
Vermutlich war auch die 1977 in Wochenabständen erschienene Horror-Trilogie von Lafcadio Varennes, die in Ichform die Abenteuer eines Dämons schilderte, eine Auftragsarbeit für Bernhardt. Hinter dem Pseudonym verbarg sich Susanne Wiemer, eine äußerst produktive Autorin, die für Bastei schon PROFESSOR ZAMORRA entwickelt hatte und dort 1979 gemeinsam mit ihrem Mann Udo als S. U. Wiemer auch die monatliche SF-Taschenbuchserie SÖHNE DER ERDE ins Leben rief, die es immerhin auf sechsundzwanzig Romane aus ihrer beider Feder bringen sollte.
Den Zuschlag bei VAMPIR erhielt allerdings wieder ein Horrorkonzept des Wiener PERRY RHODAN-Autors Ernst Vlcek. Das war kein Zufall, denn immerhin hatte dessen erste Horrorserie DÄMONENKILLER zu Spitzenzeiten die gleiche enorme Auflagenhöhe wie die SF-Serie erreicht. »Hexenhammer« startete im März 1978 mit Romanen des Erfolgsteams Paul Wolf und Neal Davenport alias Vlcek und Luif, die ab Band acht aber nicht mehr als Autoren in Erscheinung traten. Unter den ersten zehn Bänden finden sich als Autoren auch Earl Warren, Cedric Balmore und Damion Danger, hinter dem sich kein Geringerer als Helmut Rellergerd verbarg, der im Juli 1973 mit dem ersten Band der Reihe GESPENSTER-KRIMI im Bastei Verlag gleichzeitig seine heute noch erscheinende Serie um John Sinclair gestartet hatte. Dass Rellergerd nicht mehr Ausgaben schrieb, liegt sicher daran, dass JOHN SINCLAIR im Januar 1978 als eigene wöchentliche Serie ausgegliedert wurde, was den Autor vollkommen auslastete. Earl Warren war noch viermal vertreten, und mit Band zwölf stieß Georges Gauthier alias Walter Mauckner hinzu, der ab Band vier als Waldo Marek schrieb und die vier letzten Hefte der Serie verfasste.
Zwanzig Ausgaben des »Hexenhammer« waren erschienen, der als Nachfolger von DÄMONENKILLER gedacht gewesen war, jeweils zweiwöchentlich innerhalb von VAMPIR. Aber sie konnten die Erwartungen, die Kurt Bernhardt an die Serie knüpfte, nicht einmal ansatzweise erfüllen, so dass sie im Januar 1979 eingestellt wurde. Nur drei Monate später erschien als VAMPIR 316/317 ein Zweiteiler von Roy Kent, der einen weiteren Versuch darstellte und den Auftakt zu einer neuen Serie hätte bilden können. Hinter diesem Pseudonym verbarg sich Walter Appel, der als Earl Warren schon bei DÄMONENKILLER und »Hexenhammer« dabei gewesen war, den Voltz möglicherweise auf Bernhardts Vorschlag hin für FRANKENSTEIN angefragt hatte und der auch viele Jahre lang für die erfolgreiche Westernserie RONCO DER GEÄCHTETE tätig gewesen war.
Vier Wochen danach erschien ein dritter Roman von Kent, hinter dem sich diesmal der frühere PERRY RHODAN-Autor Kurt Brand verbarg. Er hatte bereits vorher unter Cora Shapiro zwei VAMPIR-Romane verfasst. Beide Pseudonyme tauchten nie mehr auf.
Freie Liebe im Mikrokosmos
Bei ATLAN ging es mittlerweile um Abenteuer im Mikrokosmos, die bei den Lesern bereits zur Legende geworden sind. In Band 187, dem ersten EXCLUSIV-Heft ohne Doppelnummerierung, gab der Kristallprinz seinen Einstand in dieser unwirklichen Welt. Zwar gelang ihm schon nach wenigen Heften wieder die Rückkehr, aber jetzt wollte er sich in den Besitz des Molekularverdichters der Maahks bringen, »Zwergenmacher« genannt, der den Schrumpfungsprozess hervorgerufen hatte.
Das wäre doch die ideale Waffe gegen Orbanaschol, der statt seiner auf dem Thron saß!
Das Schicksal – oder der Exposéautor – hatten anderes vor. Als Atlan seine Geliebte Ischtar bittet, den Stützpunkt der Maahks anzufliegen, damit sie sich in den Besitz der Waffe bringen, spielt Ra der Barbar ihm aus Eifersucht einen Streich. Der Kristallprinz gerät erneut in die Gewalt der Methanatmer, die ihn auch diesmal wieder in den Mikrokosmos versetzen – gemeinsam mit Crysalgira, einer arkonidischen Prinzessin, die ihrem Geliebten Chergost gefolgt war, einem Sonnenträger, der von Orbanaschol in den Kampf gegen die Maahks geschickt wurde, um dessen Affäre mit Crysalgira zu beenden.
Im Mikrokosmos erfahren Atlan und die Prinzessin, dass sie von jenseits der Gefühlsbasen und jenseits von Yarden kämen und nur dort wieder nach Hause zurückfinden könnten. Der Jubiläumsband 200 erzählt die Geschichte der Herrscher des Mikrokosmos, der Varganen, und ihrer Abspaltung von degenerierten Unsterblichen des Makrokosmos, die Gefühlsbasen errichteten, von denen aus sie ganze Völker in ihrem Sinne beeinflussten.
Die folgenden sechzehn Hefte schildern die Abenteuer des Kristallprinzen und Crysalgiras, die sich ihm ohne echte Liebe hingibt, und die Bemühungen der Varganin Ischtar, Atlan aus dem Mikrokosmos zurückzuholen. Ra gerät auf seinen Entdeckungsflügen, die er vor Ungeduld unternimmt, an einen Widerstandskämpfer gegen Orbanaschol namens Bel Etir Baj, mit dem er Arkon II aufsucht, wo er zur Sensation in der Arena wird.
Atlan und Crysalgira stoßen unterdessen auf die Ingenieure der Vernichtung, werden in den Konflikt zweier Sternenvölker verwickelt und bedienen sich einer ganzen Flotte, um den Weg nach Yarden zu finden – während Ischtars Hoffnung erlischt, in der Nähe des Maahk-Stützpunktes etwas für Atlans Rückkehr tun zu können.
Die Goldene Göttin fliegt mit ihrem Doppelpyramidenschiff nach Kraumon, wo sie Atlans Gefährten Fartuloon, Corpkor und Eiskralle an Bord nimmt, und zieht mit ihnen von einer ehemaligen Siedlungswelt der Varganen zur nächsten. In ATLAN 212 erreicht sie schließlich den Planet Yarden, die Drehscheibe zwischen Makro- und Mikrokosmos.
Auch Atlan und Crysalgira sind inzwischen dort eingetroffen, in Begleitung von Atlans Sohn Chapat. Beim Kampf um ihre Freiheit erleben der Kristallprinz und seine Gefährten das Ende von Yarden – und Prinzessin Crysalgira findet den Tod.
Was anschließend mit dem kleinen Chapat geschieht, ist unbekannt. Er verschwindet unter geheimnisvollen Umständen. Die älteren Leser der Serie wissen, dass er ein Realjahr zuvor in den Bänden 160 bis 175, die in der Gegenwart des Solaren Imperiums spielen, als Zeitnomade wieder auftauchte. Das Schicksal seiner Mutter Ischtar bleibt unbekannt.
Damit waren die Mikrokosmos-Abenteuer im Varganen-Zyklus abgeschlossen. Harvey Patton blieb es in ATLAN 217 überlassen, die Entscheidung der Gefährten mitzuteilen, den Untergrundkampf gegen Orbanaschol persönlich weiterzuführen.
Atlan und seine Gefährten sind gestrandet, der Makrokosmos hat sie wieder. Als ein arkonidisches Schlachtschiff auf ihren Notruf reagiert und sie an Bord nimmt, kommt es zur Meuterei – in einem bravourösen Abenteuer, der ersten ATLAN-Folge von Kurt Mahr seit einem Jahr. Der Weg zu einem neuen Handlungsabschnitt war geebnet.
Die Alten sterben nicht
Nicht immer hat man bei PERRY RHODAN das volle Potenzial der Phantasie nutzen können. Gelegentlich musste die Schere im Kopf herhalten – immerhin hatte die Bundesprüfstelle bereits die Einstellung von Ernst Vlceks beliebter Romanserie DÄMONENKILLER und des Comics VAMPIRELLA erzwungen.
Das war letzten Endes auch der Grund, warum die von Dirk Hess konzipierte FRANKENSTEIN-Serie nie das Licht der Welt erblickte. Diese geradezu traumatischen Erfahrungen wollte der Verlag unter keinen Umständen noch einmal durchmachen.
Wenn so etwas PERRY RHODAN widerführe … nicht auszudenken!
Wie ernst diese Gefahr genommen wurde, zeigt ein Vorfall im September 1974, als Voltz die ersten Exposés des neuen Aphilie-Zyklus an die Mitarbeiter verschickte. Das Exposé von PERRY RHODAN 702 sah eigentlich vor, dass auf der von Gefühlserkaltung befallenen Erde die alten Menschen in sogenannten Stummhäusern getötet werden.
Kaum hatte Cheflektor Bernhardt diese Handlungsvorgabe in die Hände bekommen, erklärte er am 6. September in einem Rundschreiben: »Das Ende dieses Exposés kann nicht so gestaltet werden, wie es an die Autoren geschickt wurde. Mit Herrn Voltz wurde bereits hierüber gesprochen und er wird darüber mit Herrn Ernsting, der der Autor dieses Romans sein wird, eine entsprechende Änderung vornehmen. Nur zu Ihrer Information: In den Stummhäusern können die alten Leute nicht getötet werden. Ein solches Thema kann man eventuell in einer literarischen Buchausgabe bringen, aber nicht in einer Unterhaltungsheftreihe. Wenn die Autoren daher dieses Exposé lesen, dürfen sie keinen falschen Eindruck gewinnen. Die alten Leute werden in einem frustrierten Zustand in diesen Stummhäusern leben, ganz auf sich angewiesen und in vollständiger Einsamkeit.«
Eine literarische Buchausgabe mit dieser Thematik gab es sogar schon. Der amerikanische Autor Harry Harrison, ein enger Freund von Clark Darlton, hatte 1966 in dem SF-Magazin SF Impulse seinen Roman »Make Room! Make Room!« veröffentlicht, der sieben Jahre später mit Charlton Heston und Edward G. Robinson in den Hauptrollen verfilmt wurde. In »Soylent Green« (dt. »Jahr 2022 … die überleben wollen …«) wird Harrisons großartiger Roman um eine übervölkerte Welt, in der Hunger und Mangelerscheinungen der Hauptantrieb für die zahlreichen Verbrechen sind, um eine zusätzliche Dimension erweitert: Es stellt sich heraus, dass das einzige Nahrungsmittel, das auf der Erde noch reichlich hergestellt werden kann, Soylent Green, aus dem Fleisch der Menschen besteht, die sich aus Überdruss angesichts dieser Welt in Selbstmordkliniken zurückgezogen haben.
Auch hier griff übrigens schon die Schere im Kopf. Der kannibalistische Aspekt, der dem Film zusätzliche Tiefe verleiht und ihn in bleibender Erinnerung hält, war dem Romanautor Harry Harrison zu harter Tobak – er distanzierte sich von »Soylent Green«.
Altmutanten und Multicyborgs
Der Aphilie-Zyklus handelte im Wesentlichen von einer Erde im Mahlstrom der Sterne, die von der fremden Sonne Medaillon bestrahlt wird, wodurch es bei den Terranern zu einem Schwund der Gefühle kommt. Als nach den ersten sechs Heften zur einstigen Menschheit umgeschaltet wurde, erfuhr der Leser, dass diese sich in die Provcon-Faust zurückgezogen hatte, wo Atlan nun Herrscher des Neuen Einsteinschen Imperiums war.
Schon in Band 706 von H. G. Francis wurde deutlich, dass sich auch hier manches verändert hatte. So waren als Geheimwaffe gegen die Laren sogenannte Multicyborgs oder Mucys geschaffen worden. Drei von ihnen, die Überschweren gleichen, will Atlan im Sol-System einsetzen, wo seit Jahren Ronald Tekener als Beobachter für das NEI arbeitet.
Im Folgeband, den H. G. Ewers verfasste, fliegen sie mit einem Passagierschiff zum Mars. Das Besondere: Sie beherbergen die Bewusstseinsinhalte der Altmutanten Wuriu Sengu, Tako Kakuta und Betty Toufry. Als sie erfahren, dass Tekener nach einem schweren Kampf zum Verhör in die Stahlfestung Leticrons auf dem Saturnmond Titan gebracht wurde, beschließen sie, ihm zu folgen. Clark Darlton beschreibt, wie die drei Mucys auf Tekener stoßen und gemeinsam verhaftet werden, woraufhin sie allesamt zum Titan gebracht werden.
Aber Leticron, der Erste Hetran der Milchstraße, durchschaut Tekeners Maske und erkennt die Bewusstseinsinhalte der Altmutanten in den Mucys. William Voltz beschreibt im abschließenden Heft des Vierteilers, wie Leticron mit Hilfe des PEW-Metalls, das einer der Mucys besitzt, seinem Geist Zugang zur Stahlfestung und damit eine ewige Existenz verschaffen will. Als er den Mucy töten lässt, kann Betty Toufrys Bewusstseinsinhalt sich in den Körper eines anderen Mucys retten. Der dritte Mucy tötet den Hetran, worauf dessen Geist in das PEW-Metall wechselt. Aber ein Übergang in die Stahlfestung ist nicht möglich, so dass er für immer in dem faustgroßen Metallklumpen gefangen bleibt.
Die weitere Beschäftigung mit Leticron musste neun lange Jahre warten. Erst 1984 nahm sich Arndt Ellmer in der Erzählung »Der Geist der Festung« seines makabren Schicksals an. Sie erschien im fünften PERRY RHODAN JUBILÄUMSBAND, der anlässlich einer Gesamtauflage der Serie von 900 Millionen Exemplaren herauskam. Weitere Informationen über die Klone des Ersten Hetran gab Ernst Vlcek schon in Heft 846 der Serie.
Die Multicyborgs sollten noch in weiteren Romanen eine Rolle spielen, ja, sie waren sogar eines der schillerndsten Themen von 1976. Konsequent zu Ende gedacht erwiesen sie sich für die Serie allerdings als nicht sonderlich tragfähig. Cyborgs, die sich äußerlich und ihrem Selbstverständnis nach nicht von Menschen unterscheiden, waren auf Gefühle von Minderwertigkeit und Selbstzweifel reduziert, und die besonderen Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz der nichtorganischen Körperteile ergaben, konnten sich bei PERRY RHODAN nicht recht entfalten – zu stark war die »Konkurrenz« der Mutanten.
Schließlich begingen sie im Rahmen der Serie aus Verzweiflung kollektiv Selbstmord – und es waren mehrere Milliarden Mucys. Horst Gehrmann alias H. G. Ewers hatte diesbezüglich moralische Bedenken. Am 26. November 1975 schrieb er an William Voltz: »Sicher wird eine entsprechende Kritik über die Massenvernichtung der Mucys kommen. Mir hat das auch nicht gefallen. Warum müssen wir die meisten Probleme durch Massenvernichtungen lösen? Meiner Meinung nach sollte schon bei der Erschaffung neuer Themen und neuer Figuren (z.B. der Mucys) konkret festgehalten werden, wie diese Themen beendet bzw. diese Figuren aus dem Spiel gebracht werden. Über die Mucys hat man sich zu wenig Gedanken gemacht, wie weit man damit gehen kann – und dann: Rübe runter!«
Info zur Romanserie: Multicyborgs
Die auch Mucys genannten Wesen sind eine künstlich erzeugte Lebensform, aber denkende und fühlende Geschöpfe, deren Intelligenz sie befähigt, jeden Auftrag durch eigenständiges und folgerichtiges Handeln zu bewältigen. Ihre Gehirne sind mit einer sehr leistungsfähigen Mikropositronik siganesischer Fertigung angereichert oder auch – bei Entdeckungsgefahr – mit Plasmazusätzen von der Hundertsonnenwelt. Sie sind sorgsam erzogen und in die menschliche Gesellschaft integriert, wo sie die gleichen Rechte und Pflichte wie alle anderen Menschen genießen. Je nach Einsatzzweck werden sie halb- oder vollorganisch hergestellt; Kunstteile sind in jedem Fall zur Tarnung von lebendem Gewebe umgeben. Sie können die Gestalt von Menschen erhalten, eines Überschweren oder exotischer Wesen; unterschiedliche Stoffwechselmechanismen können sie auf nahezu jeder Extremwelt bestehen lassen.
Der Traum der Cyborgs
In PERRY RHODAN 706 hatten sie ihren Einstand gefeiert, aber es sollte nur ein Jahr dauern, bis sie wieder von der Bildfläche verschwanden: die Multicyborgs.
Nach einer Einführung in Form eines Vierteilers, die den ganzen März 1975 währte, tauchten sie erst in Band 721 wieder auf, von Ernst Vlcek geschildert. Allerdings besaß der Multicyborg in diesem Roman nicht die Gestalt eines Terraners oder Überschweren, sondern eines Maahks und hatte das Gehirn von Grek-24, des einzigen Methanatmers, der nach der Invasion der Laren noch in der Milchstraße geblieben war.
Schon zwei Romane später begann die »Entsorgung« der künstlichen Geschöpfe. Clark Darlton eröffnet damit, dass sechzehn Handlungsjahre zuvor neunhundert Mucys auf Wonderfalg als Kolonisten ausgesetzt wurden, ohne Hilfsmittel, nur auf die Materialien des Planeten angewiesen. Als Tifflor den Erfolg des Experiments begutachten will, wird er von den Mucys vertrieben, die sich als Wonderfalger betrachten. Aber nach dem Auftauchen einer Raumflotte der Überschweren werden sie nach Gäa evakuiert, der neuen Erde.
Noch in PERRY RHODAN 736 macht Clark Darlton deutlich, dass Atlan einer Befreiung der Milchstraße durch Rhodan skeptisch gegenübersteht und stattdessen auf die Entwicklung des Multicyborg-Projekts setzt. Und vier Romane später scheint sich das durch Kolonial-Mucys zu bestätigen, die auf ihrem Planeten durch Hochenergie-Kontrastbildprojektoren beim Herannahen von Feinden ein von Menschen bewohntes Sonnensystem simulieren. Aber dann erkennen die Laren die Täuschung und vernichten das System.
Ihren Höhepunkt findet die Mucy-Problematik im abschließenden Vierteiler, der mit PERRY RHODAN 761 einsetzt. Hans Kneifel schildert, wie der Mucy Smolk das Gefühl entwickelt, ein menschliches Wesen zu sein. Als Rhodan seiner Forderung, die Existenz seiner Seele zu bestätigen, mit Zurückhaltung begegnet, tötet er sich. Anschließend lässt H. G. Ewers die Wissenschaftler der SOL rätseln, an welcher Emotio-Krankheit die Mucys leiden, die anderenorts einen Aufstand anzetteln. Als die Laren ein weiteres getarntes System der künstlichen Menschen anfliegen, vernichten die Mucys ihre Planeten aus Enttäuschung und Verzweiflung selbst. Zwei Hefte später grassiert auch auf Gäa eine Selbstmordwelle.
Kurt Mahr bietet im PERRY RHODAN COMPUTER von Band 762 eine Erklärung dafür an, warum die Mucys untergehen müssen: »Über einen Zug der menschlichen Existenz gab es bisher nur verwaschene Theorien – hypothetische Hypothesen sozusagen: Das war der schwache Funke Hyperenergie, der dem menschlichen Bewusstsein innewohnt. Man wusste, dass er da war, aber seine Funktion kannte man nicht. Das Bewusstsein des Mucy besitzt kein einziges Quant Hyperenergie. Die Mucy-Konstrukteure wussten nicht, wie sie ihre Produkte damit hätten ausstatten sollen. War das der Konstruktionsfehler?«
Ein geschickter Schachzug, um zu erklären, dass keine Menschlichkeit in ihnen war, weshalb man sie alle umbringen durfte. Es war wohl die Faszination des Augenblicks, die William Voltz veranlasst hatte, die Mucys überhaupt in die Serie einzuführen. Kurz zuvor waren die ersten REN DHARK-Taschenbücher erschienen, die ihn daran erinnert haben dürften, dass Cyborgs in Brands Serie den Stellenwert von Mutanten einnehmen.
Von diesem Konzept muss ein großer Reiz ausgegangen sein …
Anderthalb Jahre später kam Hans Kneifel in einem PLANETENROMAN noch einmal auf die Multicyborgs zurück. Atlan ist in »Der purpurne Drache« gezwungen, den Siedlern von Karthago II, die sich für echte Menschen halten, die Wahrheit über ihre Herkunft mitzuteilen. In dem Folgeband »Der brennende Arkonide«, der fast zwei Jahre auf sich warten ließ, bricht ein Aufstand auf diesem Planeten aus, und Atlan kehrt schwer verletzt nach Gäa zurück, wo ihn fortan seine Erinnerungen an die Frühzeit der Erde heimsuchen.
Obwohl thematisch in sich abgeschlossen, geht dieser Zweiteiler damit den »Zeitabenteuern« handlungsmäßig voraus und bildet eine Art Prequel oder Nullausgabe. Er erschien Anfang 2003 übrigens auch als PERRY RHODAN PLANETEN-ROMAN im Rahmen einer Sammler-Edition des Weltbild Verlags – erstmals als Hardcover, mit einem ausführlichen Vorwort und in neuer Bearbeitung.
Lizenzen, wohin das Auge blickt
Auf der Leserseite von PERRY RHODAN 700 hatte William Voltz noch stolz erklärt, dass die Taschenbuchausgabe der Serie bei Ace Books inzwischen Band 50 erreicht habe und die Fan-Clubs in den USA wie Pilze aus dem Boden schössen. Nun bemühte sich Cheflektor Kurt Bernhardt, das Interesse an weiteren ausländischen Ausgaben zu wecken.
PERRY RHODAN war das absolute Zugpferd für Lizenzverkäufe des Verlags. Die größte Weltraumserie der Welt erschien schon seit längerem auch in Holland, Frankreich und Japan, und unmittelbar nach der Frankfurter Buchmesse 1974 konnte Bernhardt in einem Rundschreiben vom 23. Oktober an alle Autoren verkünden: »Wir haben auf der letzten Messe Erfolge mit den ausländischen Lizenzen der PERRY RHODAN-Serie gehabt. Wir stehen zur Zeit in Vertragsverhandlungen mit Spanien, Finnland und Brasilien. Ace Books bringt im Frühjahr die PERRY RHODAN-Taschenbücher 3wöchentlich.«
Dabei handelte es sich allerdings um jeweils zwei Originalhefte in einem Taschenbuch, die PLANETENROMANE waren nur gegen Ende der Laufzeit mit einem einzigen Titel vertreten: »Im Zentrum der Galaxis« von Clark Darlton. Aber die Verhandlungen verliefen so erfolgreich, dass Bernhardt seinem Lieblingsautor Voltz am 17. Dezember 1974 mit stolzer Stimme mitteilte, »im PERRY RHODAN JAHRBUCH kann auch gleichzeitig angekündigt werden, dass die finnische PERRY RHODAN-Ausgabe der Heftserie in Vorbereitung ist. Dann können Sie weiterhin ankündigen, dass Atlan im Frühjahr nächsten Jahres bei Ace Books monatlich erscheinen wird – und zwar mit der Serie ATLAN EXCLUSIV.«
Und auf der Leserseite von Band 728 konnte Voltz schließlich sogar verkünden, dass der erste neue Lizenznehmer von PERRY RHODAN im Ausland, Finnland, seine Produktion gestartet hatte. Nicht ohne Stolz bildete er auch gleich das Titelbild des ersten Bandes ab. Es war ein Motiv von Johnny Bruck – wenngleich dieses Cover auf Deutsch das Heyne-Taschenbuch »Der Sternenschöpfer« von Olaf Stapledon geziert hatte. Damit orientierte sich die finnische an der dänischen Ausgabe, die kurz vorher gelaufen war.
Kustanuus Oy hieß der Verlag, der PERRY RHODAN am 17. Juni 1975 mit dem Roman »Kauhun hetkiä kuussa« in Finnland einführte. Leider sollten es insgesamt nur sechzehn Ausgaben werden, die alle in der zweiten Jahreshälfte erschienen. Die Hauptübersetzer waren M.-L. Vuorjoki und ein gewisser R.N., dann übernahm für Band zwölf und dreizehn P. Synimaa, bevor R. Halonen und Raili Niemelä die letzten beiden Folgen übertrugen; nummernmäßig orientierte sich die Lizenzausgabe an der deutschen Serie.
Praktisch im fliegenden Wechsel startete zum Zeitpunkt der Einstellung der finnischen die erste brasilianische Übersetzung von PERRY RHODAN. Am 22. Oktober 1975 war dort »Missão Stardust« an den Verkaufsstellen zu finden, und dieser Übernahme war ein erheblich längeres Leben beschieden. Ediouro Coquetel hieß der in Rio de Janeiro ansässige Verlag, der die Heftserie in der Editora Tecnoprint sechzehn Jahre lang wöchentlich herausbringen sollte – alle von Richard Paul Neto übersetzt und unter Einhaltung der Originalreihenfolge.
Erst im Jahre 1991 wurde die Serie mit Band 536 »Crepúsculo dos Ídolos« von Ernst Vlcek eingestellt. Bis ein neuer Verlag gefunden war, Star Sistema e Projetos Limitida in Belo Horizonte, sollten zehn Jahre vergehen. Dann startete PERRY RHODAN erneut – allerdings mit Band 650, dem Beginn des Zyklus »Hetos der Sieben«. Die Ausgabe läuft nach wie vor sehr erfolgreich. Damit ist die brasilianische Ausgabe heute eine der am längsten laufenden Lizenznahmen – nur noch übertroffen von Holland, Frankreich und Japan.
Auch Clark Darlton setzte sich für Auslandsverkäufe ein. Am 4. Januar 1975 machte er William Voltz ein verspätetes Neujahrsgeschenk. »Im übrigen sagte mir Ace zu, DRAGON eventuell ab Herbst zu bringen, aber das kann auch noch bis 1976 dauern. Wenn alles klappt, können wir im November mit dem Vice President von Ace Books, Waxman, sprechen. Und ich bin froh, dass er meinen Vorschlag akzeptierte, nur EXCLUSIV zu bringen.«
Am 28. Februar setzte Darlton noch eins drauf, als er Voltz mitteilte, dass ein italienischer Verlag PERRY RHODAN haben wolle. Am 3. Juli bot Kurt Bernhardt das PERRY RHODAN JAHRBUCH in den USA an, und am 22. Dezember 1975 beantwortete Bernhardt eine Anfrage von Voltz nach dem italienischen Lizenznehmer. Außerdem startete in diesem Jahr eine französische Lizenzausgabe der Comicserie »PERRY – Unser Mann im All«, von der bis 1976 zweiundzwanzig Ausgaben erschienen.
Nie wieder sollte man bei PERRY RHODAN so viele Auslandsgeschäfte gleichzeitig tätigen …
COMMANDER SCOTT
Acht Jahre war es mittlerweile her, seit der Bastei Verlag mit seiner SF-Serie REX CORDA nach nur 38 Heften mit dem Versuch scheiterte, eine Konkurrenz zu PERRY RHODAN aufzubauen. Jetzt setzte der frischgebackene Redakteur Michael Kubiak auf ein anderes Konzept, das den Titel COMMANDER SCOTT tragen sollte.
Als Grundlage diente die Taschenbuchreihe CAP KENNEDY, die der Brite E. C. Tubb von 1973 bis 1975 unter dem Pseudonym Gregory Kern für den amerikanischen Markt verfasste – als Konkurrenz für die Lizenzausgabe von PERRY RHODAN. Zwar konnte sie sich nicht behaupten und wurde nach nur sechzehn Bänden wieder eingestellt, aber in Deutschland dienten diese Bände und ein zusätzlicher Roman, der in den USA erst 1983 herauskommen sollte, als Ausgangsmaterial für eine SF-Heftserie, die von deutschen Autoren unter demselben Pseudonym weitergeführt wurde.
Es war ein bunter Reigen, der sich als deutsche Inkarnation von Gregory Kern versammelte. Den Anfang machte der beliebte SF-Übersetzer und linke PERRY RHODAN-Kritiker Horst Pukallus mit Band 9, unmittelbar gefolgt von dem SF-Veteran aus Leihbuchzeiten Manfred Wegener, der bei Moewig gerade seine Piratenserie SEEWÖLFE unterzubringen versuchte. Band 12 sah – frisch von Kurt Brands SF-Serie RAUMSCHIFF PROMET – Ronald Maria Hahn als Autor. Alle drei ließen noch jeweils vier Romane folgen.
Mario Werder, der hauptsächlich Gruselromane schrieb, verfasste mit Band 13 und 18 die gleiche Anzahl von Romanen für COMMANDER SCOTT wie für die im Marken Verlag erschienene SF-Reihe ZEIT-KUGEL. Band 37 stammte von Hans Joachim Alpers, der für TERRA ASTRA schon mehrere Romane als Mischa Morrison geschrieben hatte. Sie waren dem Lektor Günter M. Schelwokat durch einen Mittelsmann angeboten worden, weil Alpers selbst bei ihm aufgrund seiner harten linken Kritik nicht sehr beliebt war. Ironie des Schicksals, dass Alpers später – nach entsprechenden Erfahrungen bei Fischer und Knaur – selbst eine umfangreiche SF-Taschenbuchproduktion bei Moewig herausgeben sollte und 2007 mit dem bei Heyne erschienenen ARA TOXIN-Roman »Necrogenesis« außerdem noch einen Beitrag zum PERRY RHODAN-Universum leistete.
Pikanterweise schrieben auch zwei Autoren aus dem Perryversum an der Serie mit. Neben Hans Peschke, der parallel zu seinen ersten ATLAN-Romanen die Bände 23, 35, 39 und 41 verfasste, war kein Geringerer als Horst Gehrmann alias H. G. Ewers vertreten, ein Stammautor von PERRY RHODAN. Er verfasste die Bände 20, 33 und 40.
Die Übersetzer der siebzehn Originalromane wechselten. Thomas Schlück, der als SF-Literaturagent die Serie an Bastei vermittelt hatte, übertrug mit »Galaxis der Verlorenen« auch Band eins – er trug übrigens ein Titelbild des TERRA ASTRA-Künstlers Eddie Jones, der ebenfalls über die Agentur Schlück lief. Danach ging die Aufgabe des Übersetzens an Leni Sobez und Bodo Baumann, die gleichzeitig für Moewig arbeiteten, Letzterer auch als Autor. Bei Frank N. Stein, der mit Band 38 die letzte amerikanische Folge ins Deutsche brachte, handelte es sich um das humorige Pseudonym des Redakteurs.
Ein wesentlicher Grund für den Tod von COMMANDER SCOTT, der plötzlich, aber für viele keineswegs unerwartet mit Band 42 das Zeitliche segnete, war die unterschiedliche Darstellung des Charakters, die so weit auseinanderlief, dass er bei manchen Leser geradezu als »schizophren« galt. Im englischen Original war er Richter, Ankläger und Henker in einer Person gewesen – die deutschen Autoren legten ihn deutlich softer an.
Ein neues Testfeld für Autoren
Die Leserseite in PERRY RHODAN gab es nun schon geraume Zeit. Seit ihrer Einführung am 1. Juli 1967 in Band 302 war sie zu einer festen Einrichtung geworden und umfasste bald sogar zwei Seiten. Anfangs hatten sich die Beiträge auf Lobhudeleien und Clubgründungen der Leser beschränkt, und natürlich war sie von jeher ein Podium für Verlagsmitteilungen gewesen. In den Siebzigerjahren waren auch immer mehr Sachartikel zu den Themenbereichen UFOs, Parapsychologie, Kosmologie und Physik erschienen, und im November 1974 verstärkte sich der Magazincharakter noch …
Auf der Leserseite von PERRY RHODAN 691 schreibt William Voltz: »Wir werden diesmal einem unserer Grundsätze untreu und veröffentlichen die SF-Story eines Lesers. Es handelt sich sozusagen um einen Testfall. Wenn diese Veröffentlichung Anklang findet, werden wir jeden Monat eine (sofern vorhanden) gute Leserstory abdrucken.«
Ob es nun eine unbewusste Vorahnung war oder einfach nur vom guten Geschmack des Redakteurs zeugte, der Autor dieser ersten Story, die den Titel »Blockierte Seelen« trug, war niemand anders als H. Hoffmann – H für Horst. Ein Jahr später veröffentlichte er als Neil Kenwood seinen ersten SF-Roman bei Kelter und begann kurz darauf, für TERRA ASTRA zu schreiben. Im Fandom hatte er das satirische Magazin WATCHTOWER herausgegeben, das im damals sehr teuren Offset-Verfahren daherkam. Den Lesern war er schon seit einiger Zeit als Briefeschreiber, Zeichner und Witzeautor bekannt, aber niemand konnte wissen, dass er 1982 ins Autorenteam von PERRY RHODAN aufgenommen werden würde.
Voltz ahnte zu diesem Zeitpunkt sicher auch nicht, dass er mit seiner Ankündigung, künftig Lesergeschichten bringen zu wollen, eine Lawine lostrat. Zwar hielt er niemals den von ihm verkündeten monatlichen Erscheinungsrhythmus bei, aber die Einsendungen der Leser rissen nicht mehr ab. Weitere Storys wurden ab Band 706 veröffentlicht, und kurz darauf ging Voltz dazu über, die meisten eingesandten Beiträge auf der Leserseite von ATLAN unterzubringen, damit der vielseitige Charakter der LKS von PERRY RHODAN gewahrt bleiben konnte.
Wie sich herausstellte, war diese Veröffentlichungsmöglichkeit ein ideales Testfeld. Sofort meldeten sich hochtalentierte Autoren der damaligen Fanszene wie Manfred Borchard und Jens Ehlers zu Wort, und im ersten Jahr dieser Einrichtung erschienen – abgesehen von Hoffmanns Erzählung – noch weitere literarische Kostproben künftiger Profis.
So stammte die Leserstory in PERRY RHODAN 717, der dritte Erzählbeitrag überhaupt, mit dem Titel »Selbstmord?«, von Peter Griese, der in Band 748 gleich mit einer zweiten Story nachlegte. Band 739 enthielt Andreas Eschbachs erste veröffentlichte Kurzgeschichte »Welt des Unheils«. Und Band 715 brachte zwar keine Erzählung, dafür aber eine Aufstellung der Mutanten in PERRY RHODAN, zusammengetragen von einem gewissen J. (für den Mittelnamen Josef) Nagula. Seine Erzählung »Bevölkerungsimplosion« wurde kurz darauf auf der Leserseite der zweiten Auflage von ATLAN 25 nachgereicht.
Was diese Autoren verbindet? Sie alle schrieben später für PERRY RHODAN!
Auch in der zweiten Auflage der Serie sollten mit der Zeit immer mehr Leserstorys erscheinen, bis sie Jahre später sogar zu einer festen Einrichtung in jedem PERRY RHODAN-Heft wurden. Redakteur Voltz ließ der Kreativität der Leser freien Lauf und würzte die Stories oft mit gezeichneten und geschriebenen Witzen, wobei die veröffentlichten Einsendungen immerhin mit stolzen 30,- DM honoriert wurden.
Die SF-Witze erscheinen schon lange nicht mehr, aber die Zeichnungen der Leser finden sich in Form von Cartoons und Illustrationen noch immer gelegentlich auf der LKS der Erstauflage von PERRY RHODAN.
SF-Witze der Woche
Aus dem Veranstaltungskalender einer Lokalzeitung: »Die nächste Tagung der Gesellschaft für Außersinnliche Wahrnehmung findet am 3. Dezember statt – wo, werden Sie ja wissen!«
(Eingesandt von G. Horstmann aus Waldshut)
Ein Arkonide betritt ein Restaurant, geht zum Versorgungsautomaten und bedient einige Tasten. Der Automat reagiert aber nicht. Ein zweiter Arkonide betritt den Raum, drückt einige Tasten, und wieder geschieht nichts. Sie beraten, ob sie einen Reparaturrobot rufen oder ein anderes Lokal aufsuchen sollen. Da kommt ein Terraner herein. Er drückt auf die KAFFEE-Taste, und nichts geschieht. Der Terraner blickt kurz hinter die Maschine, grinst und steckt den Stecker in den Netzanschluss. Der Becher füllt sich mit Kaffee. – »Siehst du«, sagt da der eine Arkonide zu seinem Genossen, »deshalb kann ich die Terraner nicht leiden!«
(Eingesandt von Fred Ohnewald aus Aalen)
Warum haben die Arkoniden so wenig Erfindungsgabe? – Weil sie sich nichts aus den Rippen schneiden können.
(Eingesandt von M. Poersch aus Waldeck)
Wer ist der klügste Terraner? – Zweifellos Erich von Däniken, der erinnert sich sogar an die Zukunft!
(Eingesandt von Horst Heilke aus Minden)
Ein Siganese läuft im Schatten eines Ertrusers durch die sonnendurchglühte Wüste einer Ödwelt. Sagt der Siganese zu dem Ertruser: »Wenn es dir zu warm wird, tauschen wir.«
(Eingesandt von J. Schwab aus Rötenberg)
Alle Witze stammen von Leserkontaktseiten der Jahre 1974/1975.
In der Dakkarzone
William Voltz hatte in PERRY RHODAN 717 eine gewaltige Zäsur gesetzt. Auf der Suche nach der heimatlichen Milchstraße war die SOL Zeuge des Untergangs einer Galaxis geworden und in ein Schwarzes Loch geflüchtet. War die Flucht gelungen? Lebte die Besatzung noch? Der Exposéautor wusste die Spannung zu nutzen.
Es wurde umgeblendet …
Eine Figur aus PERRY RHODAN 703 kam wieder zu ihrem Recht: Jocelyn der Specht, ein gewissenloser Aphiliker, der seinen Beinamen der Gewohnheit verdankt, bei starker Anspannung mit dem rechten Zeigefinger zu trommeln. Diese Kneifelsche Eigenentwicklung hilft in Band 718 einer Anzahl Frauen, auf deren Welt alle männlichen Kinder gestorben sind, terranische Männer für ihr Gemeinwesen zu rekrutieren.
Aber erst im Folgeheft von H. G. Francis gelingt es dieser Gruppe mit Hilfe von Roi Danton und Reginald Bull, der die Aphilie abschütteln konnte, ihre Welt wirklich vor dem Aussterben zu bewahren. Jocelyn der Specht sollte noch einmal in Band 733 auftauchen.
Erneut wurde umgeblendet …
In der Heimatgalaxis der Menschheit sucht Atlan Hilfe gegen die Unterdrücker. Er leitet ein Todeskommando auf Last Hope und schickt Ronald Tekener nach Andromeda, versucht mit Ovaron Verbindung aufzunehmen, dem alten Freund der Menschheit, aber trotz der Hilfe durch die Bewusstseinsinhalte der Altmutanten André Noir, Tama Yokida, Betty Toufry, Wuriu Sengu und Tako Kakuta scheitern alle Versuche.
Auch eine Kolonie der Multicyborgs kann Atlan nicht weiterhelfen. Also besinnt sich die Menschheit im Kampf gegen die Laren und Überschweren auf sich selbst und beruft eine Geheimkonferenz der Rebellen ein. Die Unterdrücker vernichten den Tagungsort, ohne zu ahnen, dass es sich um einen Bluff handelt. Die wahre Konferenz findet nämlich ganz woanders unter Julian Tifflors und Tekeners Leitung statt.
Und endlich schließt sich die Klammer …
In PERRY RHODAN 726 löst William Voltz über die Hauptfigur Alaska Saedelaere die Spannung auf: Rhodan konnte an Bord der SOL dem Untergang der Galaxis entkommen. Der Sturz durch einen Dimensionstunnel führte in eine Zwischenwelt voller Geheimnisse und Gefahren – die Dakkarzone. Die Folgebände berichten von der Begegnung mit den Spezialisten der Nacht und dem Volk der Zgmahkonen, die keine Fremden in ihrem Machtbereich dulden, weil sie als Nullbewahrer eine Aufgabe zu erfüllen haben.
In einem Doppelband von Voltz, der diesen Handlungsabschnitt beendet, entbrennt die Auseinandersetzung in voller Stärke. Nur mit knapper Not gelingt es den Terranern, die aus der Dakkarzone führenden Dimensionstunnel zu erkunden, ein Tunnelschiff zu kapern und sich mit der SOL zu retten – allerdings zu einem schrecklichen Preis: Der Haluter Icho Tolot, wie alle Vertreter seines Volkes eingeschlechtlich, verliert dabei sein Kind!
Nach der Flucht aus der Dakkarzone verlassen die Spezialisten der Nacht die SOL. Sie erzeugen in einem Hangar des Schiffes ein Schwarzes Loch von zehn Meter Durchmesser, durch das sie einer nach dem anderen für immer verschwinden.
Info zur Romanserie: Spezialisten der Nacht
Die sechs weiblichen und sechs männlichen Echsenwesen wissen nicht, dass sie vor langer Zeit im Auftrag der Koltonen – des ausgestorbenen siebten Konzilsvolks – gezüchtet wurden, um deren Wissen und Macht über Schwarze Löcher zu bewahren. Äußerlich ähneln sie den Zgmahkonen, einem Mitgliedsvolk des Hetos der Sieben, das als eigentlicher Begründer des Konzils gilt. Die Haut glänzt silbrig und zeigt manchmal blaue Reflexe. Die Augen berühren sich fast oberhalb der Nasenschlitze. Sie besitzen zwei Arme und zwei Beine, sind humanoid, schlank und muskulös, allerdings »nur« zweieinhalb Meter groß und zierlicher gebaut als Zgmahkonen. Dafür ist ihr Kopf durch die per Züchtung überstark entwickelten Gehirnzentren um die Hälfte größer. Sie haben die Gabe des Wesenspürens für fünf- und sechsdimensionale Energien, was sie befähigt, das große Schwarze Loch in der Dakkarzone zu »verstehen«. Außerdem sind sie besonders langlebig.
Kurt Brand schreibt Taschenbücher
Er war einer der ersten Autoren von PERRY RHODAN und hatte als Verfasser von Leihbüchern begonnen – gebundenen Büchern, die bis weit in die Sechzigerjahre hinein eigens zum Ausleihen in Volksbüchereien, später auch Zeitschriftenläden und Antiquariaten, hergestellt wurden. Der Siegeszug des Taschenbuchs zwang viele Autoren, von dieser Produktionsform Abschied zu nehmen – so auch Kurt Brand.
Die vorhandenen Leihbücher wurden anschließend oft als Hefttroman in gekürzter Form wiederverwertet, etwa K. H. Scheers ZBV-Serie oder Arbeiten von Clark Darlton und auch Brand, aber neue Leihbücher wurden nicht mehr in Auftrag gegeben – und der Wechsel zum Taschenbuch fiel schwer. In den meisten Fällen mussten die Autoren für den wachsenden Markt der Heftromane tätig werden.
Kurt Brand konnte davon ein Lied singen. Obwohl er sich unablässig bemühte, auf dem Taschenbuchsektor Fuß zu fassen, fruchteten seine Bemühungen nie lange. Das erste Taschenbuch aus seiner Feder war ein PERRY RHODAN PLANETENROMAN, schon 1962 erschienen. Ein zweiter PLANETENROMAN wurde Jahre später zum ersten REN DHARK-Taschenbuch umgeschrieben, dem bis 1976 noch fünf weitere folgen sollten.
REN DHARK sollte Brands größter Taschenbucherfolg bleiben. Es war der Gipfelpunkt einer Entwicklung, die nach der Einstellung der gleichnamigen Heftserie begonnen hatte.
In diesem Zusammenhang verdient eine Anekdote Erwähnung, die mit der Serie und ihrem Erfinder in Zusammenhang steht: Schon Mitte 1967 hatte es bei REN DHARK einen tragischen Unfalltod gegeben. Hans-Joachim Freiberg war mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Er hatte drei Romane zur Serie beigesteuert – der offizielle vierte »Rettung naht, die Giants kommen!«, im Oktober des Jahres erschienen, war bei Freibergs Tod erst halb fertig gewesen und wurde von Kurt Brand anonym zu Ende geschrieben.
Und Brand erwies Freiberg noch einen Freundschaftsdienst. Wie Werner Kurt Giesa, sein Vertrauter der späten Jahre, sich im Mai 2004 erinnert, gelang es Brand kurz darauf, »postum dessen SF-Roman ›Erfolgsaussichten 11%‹ zu lancieren, der in der Krimi-Reihe unter den Namen ›John Fryberg‹ und ›H. J. Fryberg‹ erschien – der eine Name auf dem Buchrücken, der andere im Buchinneren, und der richtige im Titelverzeichnis. Er ist ein grausiges Machwerk und handelt von einem Abwehrkampf der Menschheit gegen feindliche Invasoren à la E. E. Smith, im großen galaxienumfassenden Rahmen gehalten, inhaltlich trivial, lediglich interessant durch Freibergs sehr vom ›Science‹-Anteil geprägten Stil.«
Der Roman trug die Bandnummer 790, und nur fünf Ausgaben später erschien Brands erstes Krimi-Taschenbuch, was vermuten lässt, dass er es unmittelbar im Anschluss daran verfasste – zu einer Zeit, als REN DHARK gerade eingestellt worden war. Es sollte der erste von drei Krimis sein, die ab 1969 in jährlichen Abständen als Band 795, 803 und 814 in der Reihe der Kelter-Taschenbücher unter dem Pseudonym Philipp Mortimer erschienen – mit einem Helden namens Phlipp Mortimer. »Phlipp pfeift Mord«, »Phlipp jagt ›Adria‹« und »Phlipp schießt scharf« lauten die Titel der heute sehr gesuchten Romane.
Laut Giesa hatte der Autor damals bei Kelter noch einigen Einfluss, was sich auch daran zeigt, dass schon Mitte 1970 innerhalb der Heftreihe KELTER KRIMI seine »Checkpart 2000«-Serie über die internationale Polizeiorganisation Special Globe Guard startete, die insgesamt 54 Abenteuer erlebte. Nach ihrer Einstellung im Oktober 1972 veröffentlichte auch Torsten Reschke zwei Krimis im KELTER TASCHENBUCH. Er hatte zuvor – anonym wie alle anderen Autoren – acht Romane zu »Checkpart 2000« beigetragen.
MONSTRULA
Kurt Brand ist zeit seines Lebens ein Stehaufmännchen gewesen. Als in der Krimi-Heftreihe, in der »Checkpart 2000« erschienen war, ein knappes Jahr nach Einstellung dieser Unterserie alle vier Wochen ein sogenannter »Geister-Krimi« erschien, war er schon beim dritten Band wieder mit dabei – diesmal unter dem ungarischen Pseudonym Jànos Véreb. Die Reihe wurde 1974 mit Band vier ausgegliedert, und er verfasste in diesem Jahr nicht nur sechs weitere Véreb-Hefte, sondern konzipierte auch eine neue Romanreihe.
MONSTRULA hieß das Projekt, das er parallel zu den REN DHARK-Taschenbüchern unter dem Pseudonym Ted Scout startete. Es sollte eine Horrorserie werden, doch brachte sie es im KELTER TASCHENBUCH nur auf drei Bände. Nach den ersten beiden Romanen mit dem Helden Mart Wayne kam vom Verlag das Aus – obwohl noch ein Roman von Edgar Tarbot alias Friedrich Tenkrat mit anderem Thema und anderen Figuren folgte.
Brands Konzept wurde auf Eis gelegt, der Name MONSTRULA aber gleich im Anschluss für eine Heftserie mit dem Helden Jack Callum verwendet, einem Reporter, der durch den Fluch seiner verstorbenen Verlobten zum Geisterseher wird. Die insgesamt 46 Romane schrieben M. R. Heinze und Richard Wunderer gemeinsam unter dem Pseudonym M. R. Richards. Ersterer verfasste die Exposés, Letzterer die Romane, wobei Heinze gelegentlich auch einzelne Kapitel beisteuerte. Mit dieser im August 1974 gestarteten Heftserie versuchte Kelter sich an den Erfolg von DÄMONENKILLER anzuhängen, der Horrorserie von Ernst Vlcek und Neal Davenport, die sehr erfolgreich im Erich Pabel Verlag lief.
Kurt Brand blieb bei alledem wieder außen vor. Er verfasste noch vier REN DHARK-Taschenbücher und ein Heftmanuskript für die SF-Reihe GEMINI, das der zuständige Kelter-Redakteur jedoch ablehnte.
Neue Anläufe – und Abgesänge
Schon vor der Einstellung von REN DHARK im Taschenbuch hatten sich die Stimmen gemehrt, die eine Neuauflage und Fortführung der Heftserie wünschten.
Ende 1977 wurde die Romanreihe GEMINI eingestellt; es war nicht gelungen, ein breites Publikum für diese SF-Reihe mit vorwiegend jungen deutschen Autoren zu finden. An ihre Stelle trat jetzt tatsächlich eine von vielen ersehnte zweite Auflage von REN DHARK. Aber die Hefte wurden einfach unbearbeitet noch einmal herausgebracht, zum Teil sogar mit den alten Druckvorlagen – lediglich die Titelbildgestaltung wurde modifiziert …
Zehn Jahre später sollte sogar eine dritte Auflage erscheinen, aber in beiden Fällen wurden die Hoffnungen der Leser auf eine Fortführung enttäuscht. Und das, obwohl während der dritten Laufzeit Heike und Werner Kurt Giesa ein weiterführendes Konzept bis Band 150 vorgelegt hatten. Es war einfach nicht möglich gewesen, beim Verlag ein Engagement für die Serie zu wecken, das ihrem wahren Potenzial gerecht wurde. Science Fiction wurde bei Kelter wie jede beliebige Trivialliteratur behandelt – als verwurstbare Billigware.
Schon Kurt Brand hatte ähnliche Erfahrungen gemacht.
»Er deutete ein- oder zweimal an«, erinnerte sich Werner Kurt Giesa in einem E-Mail-Wechsel mit dem Chronisten, »der alte Otto Melchert, dem die Kelter-Gruppe gehöre, habe sich immer gegen SF gesträubt und der junge – Gerhard – habe ›Ren Dhark‹ damals gegen den Willen seines Vaters durchgezogen. Otto Melchert hatte ja auch später, als er den Verlag längst an den Junior abgegeben hatte, immer noch seinen dicken Daumen drauf. Bis einschließlich der dritten Heftauflage, die Gerhard Melchert glaubhaft und ernsthaft weiterführen wollte und immerhin sogar bereit war, sich mit Kurt und mir in Frankfurt am Main zu treffen – wo gibt’s das sonst schon, dass der Verleger zum Autor kommt, statt den Autor zu sich zu zitieren? Jedenfalls wäre Frankfurt sowohl für Kurt als auch für Melchert junior der jeweils halbe Weg gewesen. Aber ein paar Tage vor Terminabsprache wurde dann doch wieder alles gekippt.«
Statt einer Fortführung wurden die Taschenbücher erneut gestartet. Noch zu Zeiten der dritten Heftauflage druckte der zur Kelter-Gruppe gehörende Deutsche Literatur-Verlag, den Otto Melchert leitete, die ersten drei Ausgaben nach. Es war wieder eine typische Billigproduktion. »Wie bei den Heften wurde der damalige Taschenbuchsatz verwendet und nur Verlagslogo und Impressum ausgetauscht – und natürlich die Titelbilder.«
Ein echtes Interesse an der Serie hatte der Verlag aber nach wie vor nicht. Giesa wusste zu berichten: »In den Kelter-Taschenbüchern war Band 3 verheftet worden, das heißt zwei Druckbögen in ihrer Reihenfolge vertauscht. Und obgleich Kurt den Verlag eigens darauf hinwies und einforderte, es diesmal richtig zu machen, wurde auch der Nachdruck genauso verheftet wie das Original! Da war jemand nicht ganz zu Unrecht ziemlich sauer.«
Aber schließlich sollte Kelter von seinem ungeliebten Kind befreit werden. Anfang der Neunzigerjahre kaufte Kurt Brands »Witwe« die Rechte an der Serie vom Verlag zurück. Maria Steinmetz, geborene Wallau, war zwar nicht mit Brand verheiratet gewesen, sondern »nur« seine Lebensgefährtin, ließ sich aber immer mit »Brand« anreden und meldete sich so auch am Telefon. Und der Rückkauf war eine kluge Entscheidung gewesen …
Es folgte eine Buchausgabe der Heftserie, die 1994 im Hans Joachim Bernt Verlag startete. Der Bearbeiter Manfred Weinland schob zwischen Heft 49 und 50 weitere Romanepisoden ein, den dreibändigen G’Loorn-Zyklus. Während Buch sechs von ihm mit Unterstützung Werner Kurt Giesas geschrieben wurde, zog er für Buch sieben und acht zusätzlich noch Manfred Wegener, Conrad Shepherd und Hubert Haensel hinzu. Bald darauf musste Weinland die Bearbeitung aus Zeitgründen an Gerd Rottenecker und Heinz Mohlberg abgeben. Inzwischen liegt die Buchausgabe der ursprünglich 98 Heftromane geschlossen vor und wurde von einem neuen Autorenteam durch neue Abenteuer ergänzt. So entstanden mehrere Dutzend weitere Bücher – teilweise mit sehr angesehenen und guten Autoren.
Einer der fleißigsten neuen REN DHARK-Mitarbeiter war Werner Kurt Giesa, der von Kurt Brand im Falle einer Fortsetzung als neuer Hauptautor der Serie vorgesehen gewesen war. Einige Zeit vor seinem viel zu frühen Tod am 8. Februar 2008 kam es zu Streitigkeiten mit dem Verlag. Giesa war nicht mehr bereit gewesen, die politische Linie der Macher mitzutragen, und schied aus eigenem Wunsch aus dem Autorenteam aus.
Ein Abstecher zu Bastei
Im Jahre 1977 startete bei Bastei-Lübbe die Taschenbuchreihe MONDSTATION 1999 mit Romanen zu einer Fernsehserie, die damals im ZDF unter dem Titel »Mondbasis Alpha 1« lief. Genau wie bei der Heftserie COMMANDER SCOTT setzte der zuständige Redakteur Michael Kubiak wieder amerikanische und deutsche Autoren gemeinsam ein. Auf die ersten sechs Romane von Michael Butterworth folgten sechs Eigenproduktionen. Dabei machte H. W. Springer alias Hans Wolf Sommer mit vier Bänden den Anfang, ein sehr unterhaltsamer Autor von Krimi, Horror und Science Fiction, der unter diesem Pseudonym auch lange für die SF-Reihe des Zauberkreis Verlags tätig war. Den elften Band von MONDSTATION 1999 verfasste der ehemalige PERRY RHODAN-Autor Kurt Brand, doch zu einer ständigen Mitarbeit kam es nicht mehr. Der folgende Titel von M. S. Thomas schloss die Reihe ab.
Erst vier Jahre später sollte Brand noch einmal eine Taschenbuchveröffentlichung erleben, als der Bastei Lübbe Verlag 1982 begann, in der Reihe SCIENCE FICTION ABENTEUER seinen zehnbändigen Heftromanzyklus über den Weltraumreporter Yal neu herauszubringen, den Brand ab 1963 parallel zu seiner Arbeit an PERRY RHODAN herausgebracht hatte. Allerdings wurden nur die ersten sechs Hefte der Serie nachgedruckt, die in der von Günter M. Schelwokat betreuten TERRA-Reihe erschienen waren.
Brands Taschenbuchprojekte standen nie unter einem guten Stern. Aber inzwischen hat der Autor späte Genugtuung erfahren. Viele seiner serienunabhängigen SF-Einzelromane wurden mittlerweile nachgedruckt, vorwiegend beim Verlag Heinz Mohlberg.
Leben auf dem Mars
»Im Herbst 1975 starteten zwei Planetensonden von Kap Kennedy, die technisch und finanziell das bisher wichtigste und ehrgeizigste Weltraumexperiment darstellen und die Chance bieten, eine der aufregendsten Entdeckungen aller Zeiten zu machen: Leben auf dem Mars.«
So pries ein farbiger Beihefter in PERRY RHODAN 741 und 742 auf vier Seiten ein neues NASA-Projekt an, wobei die Daten der Trägerraketen und der Viking-Lander sowie die genauen Flugdaten ebenso enthalten waren wie Stellungnahmen von Wissenschaftlern und ein Verweis auf ein Hörspiel von Orson Welles, das auf der Grundlage des Romans »Krieg der Welten« von H. G. Wells entstanden war; es hatte 1938 in New York eine Massenhysterie ausgelöst, weil Tausende von Zuhörern an eine echte Invasion vom Roten Planeten glaubten.
Anlass für diese Werbung war ein ungarischer Briefmarkensatz mit Ringbinder gewesen, den man für 29,50 DM erwerben konnte. Gekoppelt mit der Bestellung war ein Abonnement über neue und ältere Marken und Blocks zum Thema »Die Erforschung des Mars im Spiegel der Briefmarke«.
Ein beachtlicher Aufwand für den Kundenfang, den in dieser durchaus lehrreichen Weise bei heutigen Angeboten bestenfalls noch Wissenschaftsmagazine leisten.
Die Peschke-Invasion
Die letzten Neuzugänge bei ATLAN waren noch nicht lange her. Erst im Dezember 1974 war Conrad Shepherd ins Team aufgenommen worden, zwei Monate später gefolgt von Marianne Sydow. Schon eine Woche nach ihr – im April 1975 – erschien der erste ATLAN-Roman von Harvey Patton, einem, wie es schien, völligen Neuling. Er hatte vorher in TERRA ASTRA in größeren Abständen fünf Einzelromane veröffentlicht … aber sonst?
Einen Monat nach seinem ATLAN-Debüt erschien in TERRA ASTRA ein Autorenporträt, das diesen Irrtum aufklärte. Des Rätsels Lösung war, dass der Autor sich eigens für Moewig ein neues Pseudonym zugelegt hatte. Ältere Fans kannten ihn noch als Leihbuchautor W. Brown, ein Name, unter dem auch andere Autoren firmiert hatten – und jüngere Fans kannten ihn unter seinem bürgerlichen Namen Hans Peschke, unter dem er einer der Stammautoren von Kurt Brands zweiter großen SF-Serie RAUMSCHIFF PROMET gewesen war!
»Ehrlich gesagt, ich habe es direkt genossen, letzthin in einer Leserkritik als Jungautor bezeichnet zu werden«, heißt es in seinem Porträt. »Schön wäre es ja, aber leider bin ich schon ein ›alter Hase‹, der sich im Laufe von 51 Jahren so manchen Zahn ausgebissen hat.« Und der Chronist genießt es, an dieser Stelle erstmals preiszugeben, dass er diesem Irrtum aufgesessen war und Peschke in einer Rezension so bezeichnet hatte!
Harvey Patton schildert in TERRA ASTRA, wie er Mitte der Fünfzigerjahre der SF verfallen war: »Das fing ganz harmlos mit JIM PARKER, W. D. Rohr, Clark Darlton und K. H. Scheer an, doch es artete aus, als ich 1960 zum Fandom stieß. Stories und Artikel für Fanzines wurden verbrochen, dann redigierte ich zwei Jahre lang selbst ein Blatt.« Er hatte sich schon früher am Schreiben von Krimis versucht, aber der Erfolg war mäßig gewesen. Jetzt sattelte er um und verfasste 1964 den SF-Roman »Besuch von Terra«, der aber vorerst unveröffentlicht blieb. Im selben Jahr erschien allerdings »Irrgarten Kosmos« im Leihbuchverlag Bewin unter dem Pseudonym W. Brown. »Drei Leihbücher im Jahr schaffte ich im Durchschnitt, und das zum fürstlichen Honorar von 400.- DM. Doch mein Hobby blühte weiter, wenn auch vorerst mehr als Gänseblümchen.«
Der Name Hans Peschke prangte erstmals 1967 auf dem UTOPIA-ZUKUNFTSROMAN 542, »Gefahr von Antares III«, der zugleich als Leihbuch unter W. Brown erschien. Im Jahr darauf erschienen zwei weitere UTOPIA-Hefte, von denen das eine zwei Jahre später als Leihbuch und das andere 1974 unter dem Namen Peter Hansen in der SF-Reihe des Andromeda-Verlags nachgedruckt wurde. 1968 erschien auch der bisher unveröffentlichte Erstling im Leihbuch, gefolgt von drei weiteren, bis Peschke – der UTOPIA-ZUKUNFTSROMAN war eingestellt worden – mit »Jagd auf Star King« seinen Einstand in der Heftreihe ZAUBERKREIS-SF gab. Ein zweites Abenteuer der Interstellar Detective Agency erschien 1972 als »Detektiv der Sterne« im Andromeda-Verlag.
»Einige Nelken in Form von Heftromanen erwuchsen mir zwischendurch«, schrieb Peschke hierzu, »aber ein Beet wurde erst daraus, als ich dann 1972 bei RAUMSCHIFF PROMET als Kadett angeheuert wurde. Doch dessen Höhenflug dauerte nicht sehr lange. Mit Band 65, der sehr treffend ›Katastrophe auf Bankor‹ hieß, erlitt es endgültig Schiffbruch.« Vierzehn Romane für die Serie waren es bis 1974 geworden, ein fünfzehnter wurde erst 1988 in Ausgabe 121 des Fanzines ANDROMEDA veröffentlicht. Wohin sollte der Autor jetzt ausweichen? Der Leihbuchmarkt war mittlerweile völlig zusammengebrochen.
Zum Glück hatte Peschke vorgebaut und schon während seiner Zeit bei RAUMSCHIFF PROMET zwei Einzelromane verfasst, »Welten in Not« und »Die Sklaven von Mura«, die beide 1973 in TERRA ASTRA erschienen waren – unter einem Pseudonym, das den Autor einmal bekannter machen sollte, als er es je zuvor war: Harvey Patton.
Und im gleichen Jahr war bei Bastei-Lübbe als Konkurrenz zu PERRY RHODAN auch die SF-Serie COMMANDER SCOTT gestartet, in der unter dem Sammelpseudonym Gregory Kern deutsche Autoren ein amerikanisches Konzept fortsetzten. Dort fand Peschke nach dem finanziellen Fiasko bei RAUMSCHIFF PROMET eine neue Heuer. Er steuerte fünf Romane bei, bis auch COMMANDER SCOTT eingestellt wurde. Auf Anregung des Redakteurs Michael Kubiak verfasste er noch einen Horrorroman, »Im Schloss der Verdammten«, der 1975 als GESPENSTER-KRIMI 244 unter dem Pseudonym Harvey Pearson erschien. Vielleicht hatte diese Erfahrung den Autor dazu gebracht, das Angebot einer Mitarbeit an der FRANKENSTEIN-Serie, das William Voltz ihm machte, kategorisch abzulehnen.
Weitere Frondienste waren nicht erforderlich. Noch während seiner Tätigkeit für Bastei-Lübbe hatte Peschke die Weichen für den endgültigen Neustart seiner Karriere gestellt. Er schrieb sein erstes Leihbuch zu einem Heftroman um, der 1974 in TERRA ASTRA erschien, und ließ die Bearbeitung eines Leihbuchs von 1968 folgen. Im Anschluss daran erfolgte eine wahre Peschke-Invasion auf die SF-Reihen des Moewig Verlags.
Unter Harvey Patton erschien mit »Das Erbe der Varrym« ein neuer Roman für TERRA ASTRA, dem ein Jahr später im zweiwöchentlichen Abstand die sogenannte Garal-Trilogie folgte. Zuvor war schon Pattons Einstieg bei ATLAN erfolgt, und auch seine Mitarbeit bei PERRY RHODAN war mittlerweile beschlossene Sache …
Harvey Patton bei ATLAN
Sein schneller Einstieg im Perryversum verdankte sich einer konzertierten Aktion der SF-Lektoren Günter M. Schelwokat und Kurt Bernhardt, die zu dieser Zeit händeringend auf der Suche nach neuen Autoren für ATLAN waren. Peschke hatte gerade sein erstes Leihbuch für TERRA ASTRA umgeschrieben, gefolgt von einer weiteren Bearbeitung.
In einem Schreiben vom 2. Juli 1974 bezog sich Cheflektor Bernhardt auf den jüngsten Vertragsabschluss. »Das gibt uns den Anlass, Sie besonders auf unser großes Science-Fiction-Programm aufmerksam zu machen. Wir bringen PERRY RHODAN, ATLAN, DRAGON usw. heraus. Wir sind sehr interessiert an ständigen Mitarbeitern für diese Serien. Besteht die Möglichkeit, dass Sie z.B. für ATLAN oder DRAGON arbeiten? Wir lassen Ihnen mit gleicher Post verschiedene ATLAN-Hefte zugehen. Wenn Sie Zeit haben, lesen Sie diese Hefte und schreiben Sie mir, ob Sie an einer Mitarbeit als Autor interessiert sind. Sollte das der Fall sein, dann werde ich Ihnen die Adresse des Redakteurs und Exposéschreibers Voltz, Offenbach, mitteilen. Dann wäre es zweckmäßig, wenn Sie nach Offenbach kommen würden und mit ihm über die Einzelheiten der Zusammenarbeit sprechen könnten.«
Bernhardt war eindeutig von Peschke überzeugt. »Die ATLAN- sowie die DRAGON-Romane, von denen wir auch je drei Exemplare beilegen«, heißt es weiter, »werden nach Exposés geschrieben, die Sie dann jeweils geliefert bekommen. Die Honorare liegen erheblich höher als üblich, aber wir sind nur daran interessiert, wenn Sie regelmäßig an den Serien mitarbeiten, wobei genaue Termine für Ablieferung der Manuskripte gegeben werden. Ich würde mich freuen, wenn es zu einer ständigen Zusammenarbeit käme.«
In einem Beitrag für den PERRY RHODAN WERKSTATTBAND, den Horst Hoffmann 1986 herausgab, schrieb Peschke, dass sich damals alles noch im Rahmen eines Hobbys bewegte, weitergehende Ambitionen habe er zu dieser Zeit nicht gehabt. Aber dieser Brief änderte alles. Er riss »mich abrupt aus meiner beschaulichen Ruhe, obwohl er im üblichen dürren Verkehrsdeutsch abgefasst war. Teilte mir darin doch Cheflektor Bernhardt mit, dass der Verlag mich ausersehen hätte, an der ATLAN-Serie mitzuwirken!«
Es sollte zu einer ständigen Zusammenarbeit kommen, wenn auch nicht mehr bei DRAGON, das kurz darauf überraschend eingestellt wurde. »Aufgeregt wartete ich auf das erste Exposé«, fährt Peschke in seinen Erinnerungen fort. »Es kam für ATLAN 179, und Willi Voltz warf mich, seinen eigenen Worten nach, mitten ins kalte Wasser.« In diesem vierzigsten EXCLUSIV-Roman wird der Kristallprinz von seinem ungeborenen Sohn Chapat aufgefordert, über sein Leben zu berichten. Atlan erzählt daraufhin, was er von dem Bauchaufschneider Fartuloon über den gewaltsamen Tod seines Vaters erfahren hat.
Elf Wochen später, gleich nach einem großartigen Mikrokosmos-Zweiteiler, mit dem Conrad Shepherd wieder aus ATLAN ausstieg, erschien der nächste Patton. »Man billigte mir weitere Romane zu«, erinnerte sich der Autor, »die ersten Autogrammwünsche von Lesern erreichten mich, und meine Nase hob sich noch um ein paar Millimeter. Bis zu den Wolken reichte sie aber längst noch nicht, ein paar Anrufe von Schelwokat sorgten dafür, dass ich auch wieder nach unten sah und schön auf dem Teppich blieb.«
Seine gesamte weitere Schriftstellerkarriere sollte Harvey Patton in den Dienst von Moewig stellen. Allein für ATLAN schrieb er dreißig Romane, wenn auch mit einer Unterbrechung von sieben Jahren, und selbst bei PERRY RHODAN sollte er eingesetzt werden – leider nur ein einziges Mal, weil er das Exposé zu freizügig ausgelegt hatte.
Kurzbiografie: Harvey Patton
Am 24. Juni 1923 in Breslau geboren, arbeitete Hans Peschke – wie der Autor mit bürgerlichem Namen hieß – bis 1941 als gräflicher Diener und ging dann zur Luftwaffe. Nach dreieinhalb Jahren Krieg und einem halben Jahr Kriegsgefangenschaft landete er als überzeugter Pazifist im Schwabenland, wo er als Bahnarbeiter, Krempler und Speisewagenkellner jobbte. Schließlich wurde er im Rheinland für eine Textilfirma tätig, heiratete und wurde Vater von fünf Kindern. Mitte der Fünfzigerjahre entdeckte er seine Liebe zur Science Fiction, wurde im Fandom aktiv und veröffentlichte 1964 sein erstes Leihbuch, dem noch vierzehn weitere folgten. Nach SF-Heftromanen für Pabel und Zauberkreis wurde er von Kurt Brand zur Mitarbeit an RAUMSCHIFF PROMET eingeladen, für das er fünfzehn Beiträge leistete. 1975 schrieb er für die Bastei-Lübbe-Serie COMMANDER SCOTT, verfasste seinen ersten ATLAN-Roman und stellte den traurigen Rekord auf, nach einem einzigen Roman die PERRY RHODAN-Serie wieder verlassen zu müssen. Ab 1976 entstanden sechs PLANETENROMANE, und von 1977 bis 1983 gehörte er zum Autorenteam der ORION-Serie, die von der gleichnamigen Fernsehserie inspiriert war. ATLANS Einstellung bedeutete auch für ihn das Aus. Nach einer schweren Krebsoperation lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 1994 als Frührentner von der Krebsrente.
Neue Risszeichnungsbände
Im Oktober 1966 hatte der Verlag erstmals Risszeichnungen in besonderer Ausstattung herausgebracht, zwölf dreifarbig bedruckte Bögen in DIN A3. Im Januar 1969 und Oktober 1970 kamen jeweils sechs weitere in doppelter Heftgröße hinzu, bevor ein Jahr später der erste Sonderband mit farbigem Einband erschien. Er hatte einen Leinenrücken und enthielt fünfzig Risszeichnungen aus den ersten fünfhundert PERRY-RHODAN-Romanen.
Drei Jahre vergingen, bis Cheflektor Kurt Bernhardt dem Wunsch zahlreicher Leser folgte, den Risszeichnungsband erneut herauszubringen. Allerdings verlangte er eine gründliche Bearbeitung der ersten Ausgabe. Am 17. Dezember 1974 wandte er sich diesbezüglich an William Voltz: »Es sieht so aus: Ich werde in den nächsten Tagen Bescheid erhalten. Sie können praktisch mit den redaktionellen Vorbereitungen beginnen.«
Anfang des folgenden Jahres wurde der erste Risszeichnungsband wieder angeboten. Aber der große Erfolg bei den Lesern blieb dem Cheflektor anfangs offenbar verborgen. »Es stimmt nicht, dass die Risszeichnungen nicht mehr so beliebt sind wie früher«, schrieb Voltz am 12. Juli 1975 an Bernhardt. »Lesen Sie bitte die Leserbriefe, was für eine Aufregung losbricht, wenn in der 2. Auflage einmal eine Risszeichnung ausgelassen wird.«
Bernhardts Reaktion ließ nicht lange auf sich warten – wie so oft, äußerte sie sich in gehöriger Mehrarbeit für den Risszeichnungs-Redakteur. Auf Band 1 folgte im Mai 1978 im gleichen DIN-A3-Format und in der gleichen Ausführung ein zweiter Band mit Risszeichnungen aus der Serie bis Band 710. Im Mai 1980 erschien ein dritter, der fünfzig Motive aus den Bänden 711 bis 935 enthielt, drei Jahre später im September ein weiterer, der erstmals auch zwei noch nie in den Romanen erschienene Zeichnungen brachte.
Erst 1991 wurde die Tradition der Risszeichnungsbände wieder aufgegriffen und 1996 ein abschließender Band herausgebracht. Schon im selben Jahr erschienen die ersten Risszeichnungen auf CD-ROM – eine zeitgemäße Veröffentlichungsweise, die mittlerweile mit allen Finessen die interaktiven Möglichkeiten des Mediums nutzt.
Brennpunkte im All
William Voltz trieb die Handlung von PERRY RHODAN auf drei wechselnden Ebenen weiter voran – ein Konzept, das schon sehr früh in der Serie unter der Exposé-Redaktion von K. H. Scheer eingesetzt worden war. Es sorgte für Vielseitigkeit und ließ den Leser nach der Auflösung des jeweiligen Cliffhangers geradezu fiebern.
Auf der Handlungsebene Terra befassten sich ab PERRY RHODAN 732 zwei Doppelromane mit dem Aufstand der Immunen, die der gefühlsverarmenden Strahlung der Sonne Medaillon im Mahlstrom der Sterne nicht erlegen waren. Hans Kneifel und Kurt Mahr schildern darin, wie der hohe Flottenoffizier Trevor Casalle sich in der Welt der Aphiliker durchzusetzen beginnt, seine Konkurrenten ausschaltet und sich nach Reginald Bulls Genesung von der Aphilie zum Alleinherrscher über die Erde aufschwingt. Um seine Macht zu festigen, versucht er durch eine Gehirnwäsche die Geschichte der Menschheit auslöschen. Gleichzeitig will er Roi Dantons Untergrundorganisation zerschlagen und greift vergebens nach Bulls Zellaktivator, um die Unsterblichkeit zu erlangen.
Mit PERRY RHODAN 736 von Clark Darlton wechselte die Handlung zur Milchstraße, in der überraschend die SZ-2 auftaucht, eine der beiden Kugelzellen des Hantelraumers SOL. Nachdem sie kosmische Distanzen zurückgelegt hat, sind ihre Energievorräte beinahe erschöpft. Es kommt zu ersten Einsätzen gegen die neue Herrschermacht der Laren, die mit Hilfe eines Täuschungsmanövers das Versteck der Menschheit zu finden versucht. Aber auch durch den Einsatz eines Doppelgängers von Rhodan und ein falsches terranisches Flaggschiff gelingt es den Laren nicht, das Neue Einsteinsche Imperium unter Atlan auszuheben.
Das Thema Dakkarraum griff Darlton in PERRY RHODAN 742 wieder auf. Die Terraner und Weltraumgeborenen der SOL müssen sich zusammen mit den Keloskern und Spezialisten der Nacht in dieser fremden Umgebung behaupten. Es gelingt ihnen, einen Rechenverbund an Bord zu holen, mit dem sie diese Zone verlassen können, als das Volk der Koltonen angreift, das seinerzeit die zwölf Spezialisten der Nacht züchtete. Unter dem ebenfalls vom Untergang bedrohten Volk der Zgmahkonen, den eigentlichen Begründern des Hetos der Sieben, bricht das Chaos aus. Durch ihre unbegreiflichen hyperphysikalischen Kräfte sorgen die Spezialisten der Nacht dafür, dass nach dem Verlassen des Dakkarraums alle Dimensionstunnel ins Reich der Zgmahkonen zusammenbrechen.
In PERRY RHODAN 746 schilderte William Voltz, wie die SOL in den freien Weltraum hinausfliegt und die Spezialisten einem inneren Ruf nachgeben, der ihr weiteres Schicksal bestimmt. Alaska Saedelaere folgt ihnen durch ein Tor in die Unendlichkeit, und während Rhodan im folgenden Band vergeblich auf dessen Rückkehr wartet, empfängt der Mausbiber Gucky seltsame Impulse, die ihn zu einer Expedition veranlassen. Gemeinsam mit Fellmer Lloyd fliegt er in einem Beiboot in den Machtbereich unsichtbarer Götter, wo er auf einen Artgenossen trifft. Nach diesem kosmischen Intermezzo setzt die SOL ihren Flug zur Milchstraße fort.
Zwei Bände blieben noch bis zum Abschluss des Zyklus. Sie sollten ein besonderes Highlight bieten. Kurt Mahr schilderte, wie Immune und Aphiliker ein Zweckbündnis zur Evakuierung des Planeten Erde schließen. Dabei schaltet sich der lunare Riesenrechner NATHAN ein, ohne dessen Mitwirkung praktisch keine technischen Abläufe auf Terra mehr möglich sind. Dank seiner und der Hilfe seines Geschöpfes Raphael kommt es zum »Plan der Vollendung«: Zusammen mit der Sonne Medaillon, dem Planeten Goshmos-Castle und dem Mond verschwindet die Erde in der flammenden Öffnung des Schlunds.
Was geschieht dabei mit den zwanzig Milliarden Bewohnern Terras? Die Männer und Frauen von Roi Dantons Untergrundorganisation wissen es nicht. Außer ihnen konnte vor dem Verschwinden der Erde niemand den freien Raum des Mahlstroms erreichen.
Info zur Romanserie: SOL-Geborene
Nach dem Aufbruch des Fernraumschiffs SOL im Jahr 3540, als es mit Perry Rhodan und seinen Getreuen an Bord die von der Aphilie beherrschte Erde verließ, kamen immer mehr Menschen zur Welt, denen die gefühlsmäßige Bindung an das Leben auf einem Planeten fehlte. Sie fühlten sich nicht mehr als Terraner, sondern als Solaner und begannen sich mit wachsendem Selbstbewusstsein zu organisieren. Als die SOL im Jahr 3581 die Milchstraße erreichte und sich gleich wieder auf die Suche nach der Erde machte, wurden immer mehr Forderungen der Solaner laut, darunter: die SOL, ihre Heimat, solle nicht mehr unter Führung von Perry Rhodan und seiner Gruppe Gefahren ausgesetzt werden. So kam es im Jahre 3586 zur Übergabe des Schiffes an die Solaner. Die folgenden zwei Jahrhunderte waren vom allmählichen Zerfall der Ordnung an Bord und dem Auftreten elitärer Gruppen gekennzeichnet, bis die ständig wachsende Zahl der Solaner unter einer Diktatur lebte. Sie führte ein Kastensystem ein, das ihre Mitglieder in sechs Wertigkeiten untergliederte. Die Diktatur konnte erst abgeschafft werden, als im Jahre 3791 der Arkonide Atlan von Buhrlos – einfachen Solanern ohne alle Rechte – treibend im Raum aufgefunden wurde. Damit begann für die SOL – zu dieser Zeit befanden sich 100.000 Wesen an Bord – eine zwanzigjährige Odyssee zurück zur Erde. Seitdem stieß das Schiff immer wieder in Weltraumtiefen vor.
Ein einsamer Rekord
Der Aphilie-Zyklus war ein Höhepunkt von PERRY RHODAN. Nicht nur die Leser, auch die Autoren waren begeistert bei der Sache. Harvey Patton schrieb in TERRA ASTRA 194 über den Zyklus: »Ist er nicht im Grunde eine logische Weiterentwicklung der bereits heute erkennbaren Tendenzen innerhalb aller irdischen Gesellschaftsformen? Ich fürchte fast, dass es nicht erst der Strahlenkomponente einer fremden Sonne bedarf – die Lieblosigkeit greift auch so immer weiter um sich. Wenn es nun Romanen dieser Art mit ihren abschreckenden Beispielen gelänge, wenigstens einen Teil der Menschen aus ihrer Gleichgültigkeit und Ichsucht aufzurütteln, wäre schon viel erreicht!«
Als Patton diese Worte schrieb, die im April 1975 erschienen, hatte er gerade erfahren, dass er selber einen Roman zum Aphilie-Zyklus beitragen würde. »WiVo meldete sich bei mir und verkündete trocken, er hätte eben ein PERRY RHODAN-Exposé für mich zur Post gegeben! Ein Blitzschlag also, der mich unter Hochspannung setzte, und wirklich kam das Ding am nächsten Tag bei mir an«, schreibt er elf Jahre später im PERRY RHODAN WERKSTATTBAND. »Fast andächtig las ich es vor und zurück und freute mich besonders, dass der Mausbiber Gucky darin eine der Hauptpersonen war.«
In dem Roman mit der Bandnummer 747 fliegen Gucky und Fellmer Lloyd einen Planeten an und landen bei einem Tempel, unter dem ein Raumschiff verborgen ist. Dabei werden ihre Parafähigkeiten neutralisiert. Sie entdecken einen Artgenossen von Gucky – den stark geschwächten Lowis, der in Trance künstlich am Leben gehalten wird.
Der Ilt erwacht und berichtet, dass er vor vierhundert Jahren als Einziger den Absturz des Beibootes eines mit Mausbibern bemannten Raumschiffes auf dem Planeten der echsenhaften Cgh-Ring überlebte und von diesen aufgenommen wurde. Verbrecherische Wissenschaftler, die durch Experimente ihre Körper verloren, entführten ihn bei ihrer Flucht und missbrauchen ihn seit ihrer Bruchlandung auf Grosocht als Verstärker ihrer Paragaben. Durch einen Parablock können die beiden Mausbiber und Lloyd die Körperlosen abwehren. Aber dabei stirbt Lowis. Gucky und Fellmer Lloyd verlassen den Planeten.
Unmittelbar nach Erhalt des Exposés rief Harvey Patton bei Voltz an und brachte enthusiastisch einige Änderungswünsche vor. Tags darauf, am 28. Januar 1975, trug er sie in einem Schreiben an ihn zusammen. »Was mir an dem Exposé nicht gefiel«, bekannte er später im WERKSTATTBAND, »war der Umstand, dass der Mausbiber Lowis am Ende des Romans so jämmerlich sterben sollte. Hier hatte Gucky nach langer Einsamkeit endlich wieder einmal einen anderen Ilt getroffen, und ich hätte den beiden gern ein Happy-End gegönnt. Also legte ich mir eine Alternative zurecht, die Lowis überleben ließ, und als Kurt Bernhardt mich einige Tage später anrief, trug ich sie ihm vor.«
Auch der Cheflektor reagierte auf die Änderungswünsche eher ungehalten, zumal der Mausbiber schon ein ständiges Streitthema bei K. H. Scheer und Clark Darlton gewesen war. Die beiden Gründerväter von PERRY RHODAN waren schließlich übereingekommen, dass die Historie des Ilts den Taschenbüchern vorbehalten bleiben sollte, während er in der Serie als Einzelphänomen lediglich seine umfassenden Psi-Fähigkeiten einbrachte. Dabei sollte es auch bleiben – an eine Wiederauferstehung des Volkes der Ilts und seine Rückkehr im Rahmen der Heftserie war nicht zu denken.
Die Auseinandersetzung zog sich geraume Zeit hin, und der Roman wurde zuletzt noch einmal umgearbeitet. »So kam ich zu meinem einsamen Negativ-Rekord«, schrieb Patton im besagten WERKSTATTBAND, aber zum Ausgleich bot man ihm an, einige Taschenbücher zu verfassen – »nach meinen eigenen Exposés, wohlbemerkt …«
Den Abenteuern des Kristallprinzen blieb der Autor allerdings auch weiterhin verbunden, und am 12. Juli 1975 setzte Voltz sich in einem Schreiben an Bernhardt dafür ein, dass Patton in dieser Serie verstärkt eingesetzt werden sollte. Tatsächlich blieb er ATLAN noch lange Zeit erhalten und wurde 1977 auf Vorschlag seines Lektors Günter M. Schelwokat außerdem ins Autorenteam der neuen Heftserie ORION berufen.
Freuden und Leiden
Sechs PLANETENROMANE sollte Harvey Patton insgesamt schreiben, angefangen im März 1976 mit dem Band »Angriff der Phantome«, in dem es um ein Kadettenschulschiff des Solaren Imperiums geht. Ab 1977 lenkte er sechs Jahre lang gemeinsam mit Hans Kneifel, H. G. Ewers und Horst Hoffmann die Geschicke von Commander Cliff McLane und seiner Besatzung. Acht Romane erschienen in ORION, das ein Jahr zuvor als eigene wöchentliche Heftserie gestartet war, bevor diese auf Grund mangelnden Erfolges wieder in TERRA ASTRA integriert wurde. Dort verfasste Patton bis 1983 weitere zwölf Romane.
Bei ATLAN war der Autor schon 1978 mit Band 338 wieder ausgestiegen, woraufhin er in den beiden Folgejahren, als ORION nur noch vierwöchentlich erschien, einen Zweiteiler und einen Einzelband in TERRA ASTRA folgen ließ. 1982 brachte er beim Konkurrenzverlag Zauberkreis unter dem Titel »Kampf um Ergon II« einen Nachdruck von »Detektiv der Sterne« sowie mit »Verwehte Spuren« ein neu verfasstes Abenteuer der Interstellar Detective Agency unter. Im Jahr darauf, als ORION eingestellt wurde, erschienen zwei weitere Romane bei Zauberkreis-SF, denen 1984 noch ein Roman für TERRA ASTRA folgte.
Dann schien die schlechte finanzielle Situation für Patton, durch schwere Krankheiten und Operationen verstärkt, sich endlich zu bessern. Sein 1967 zugleich als UTOPIA-Heft und Leihbuch erschienener Roman wurde in TERRA ASTRA nachgedruckt, und Patton verfasste nach vier Jahren Pause seinen sechsten und letzten PLANETENROMAN. Außerdem stieg er wieder bei ATLAN ein. Auf Band 702 folgten noch dreizehn weitere Hefte, bis diese Serie – für alle Beteiligten überraschend – zu Beginnn des Jahres 1988 eingestellt wurde.
Jetzt stand Patton endgültig vor dem Aus. Seine doch sehr an den Sechzigerjahren orientierte Vorstellung von Science Fiction und sein etwas antiquierter Schreibstil hatten ihm zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Kurz vor dem Tod seines Lektors Günter M. Schelwokat im April 1992 hatte er noch ein Manuskript für einen PLANETENROMAN abgeliefert, das aus Qualitätsgründen abgelehnt worden war. Auch die monatliche SF-Reihe bei Zauberkreis, die an Moewig gefallen war, hatte man eingestellt. Peschke konnte nirgends mehr Fuß fassen. 1994 starb er im Alter von einundsiebzig Jahren.
William Voltz, Comic-Fan
Wer kennt sie nicht, die Superhelden des Marvel-Universums? Ob Spider-Man, die Fantastischen Vier oder Hulk, ihre Erfolgsgeschichte reicht mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Aber wer ahnt schon, dass es eine Verbindung zu PERRY RHODAN gibt?
William Voltz, der seit dem Jubiläumsband 500 zunehmend die Handlung der Serie gestaltete, hatte von jeher eine Schwäche für Comics gehabt. Er hatte sich in Wort und Tat für Verbesserungen an PERRY RHODAN IM BILD eingesetzt und eine ganze Anzahl PERRY-Comics getextet. Auch als Autor der Bastei-Comicserie BUFFALO BILL war er tätig gewesen, allerdings wie damals üblich anonym. Da er hierüber keine Aufzeichnungen führte, ist leider auch nicht mehr nachvollziehbar, welche Beiträge von ihm stammen.
Jedenfalls war Voltz ein Kenner, der hinsichtlich seiner Lieblingszeichner hervorragenden Geschmack bewies. Der deutsche Williams Verlag veröffentlichte gerade handgeletterte Übersetzungen der wichtigsten und besten klassischen Marvel-Comics, als Voltz sich im August 1975 an einen Leser namens Roland Schnepel wandte. Er bestellte bei ihm mehrere Comics, die ein Jahr zuvor in den USA erschienen waren, nämlich die ersten beiden MARVEL TREASURY EDITIONS, die einen Nachdruck des ersten Comics, den Jack Kirby für Marvel gezeichnet hatte, und seine Trilogie aus THE FANTASTIC FOUR über den Silver Surfer und Galactus enthielten. Auf seiner Wunschliste stand auch das erste SPECIAL der Reihe mit einem Nachdruck der ersten Konfrontation zwischen dem Hulk und dem Ding sowie ein FOUR GODS-Poster, ebenfalls von Kirby geschaffen.
Schnepel legte Voltz gratis noch die klassischen Hefte CAPTAIN MARVEL 33 und STRANGE TALES 178 bei, mit der Entstehungsgeschichte von Thanos und dem ersten Warlock-Abenteuer von Jim Starlin. Er wies auch auf die Film-Adaption von Stanley Kubricks »2001 – Odyssee im Weltraum« hin, für die Kirby einige seine besten Zeichnungen geliefert hatte.
Voltz gehörte damit zur ersten Generation der Verehrer anspruchsvoller Superhelden-Comics in Deutschland, die Mythos und Action miteinander verbanden.
Invasoren aus dem Mikrokosmos
In Band 142/20 von ATLAN war erstmals von den Varganen die Rede gewesen, einem rätselhaften Volk, das in der arkonidischen Mythologie breiten Raum einnimmt. Seinen ersten Auftritt hat es in Gestalt der Göttin Ischtar, die schon in der terranischen Frühzeit enge Kontakte zu den Arkoniden unterhielt. ATLAN 150/24 von Dirk Hess enthält den Bericht des jungen Barbaren Ra über seine Erinnerungen an eine Frau dieses Namens, die ihn auf der Erde an Bord ihres Raumschiffs nahm und per Hypnoschulung ausbildete. Sie erklärte, eine der letzten lebenden Varganen zu sein und seit Äonen die Galaxien zu durchqueren.
Sechzehn Hefte später beschreibt H. G. Ewers die erste Begegnung Atlans mit Ischtar auf dem Planeten Frossargon. Von ihr verführt, zeugt Atlan mit der Varganin den später Chapat genannten Sohn. Als er in ATLAN 174/36 von Chapat erfährt, liegt sein Sohn in einer viereckigen Überlebenskapsel und verständigt sich telepathisch mit seiner Umwelt.
Parallel zu diesen Erlebnissen kommt es außerhalb der Handlungsebene von ATLAN EXCLUSIV im alternierend erscheinenden Memory-Zyklus rund zehntausend Jahre später zu einer Begegnung des Zeitwanderers Chapat mit seinem Vater. Der Lordadmiral lehnt die dringende Bitte seines Sohnes allerdings ab. Er will nicht mit Chapat in die Vergangenheit reisen, um Ischtar zu helfen, die Atlan immer noch liebt. Ein Grund wird nicht genannt. Der SF-erfahrene Leser kann nur vermuten, dass kein Zeit-Paradoxon ausgelöst werden soll.
Mit Band 175 endete die alternierende Handlungsführung der USO-Romane und der Jugendabenteuer des Kristallprinzen. Vier Hefte später wurde Chapat in das Reich der Varganen im Mikrokosmos entführt. Sein Vater lässt sich mit Hilfe eines Apparates der Maahks verkleinern und macht sich auf die Suche nach ihm. Dabei wird Atlans Jugendliebe Farnathia entführt, die wie sein Freund Ra sehr eifersüchtig auf die jüngsten Entwicklungen reagiert. Im Kampf gegen Ischtar stirbt sie, aber auch Atlan erleidet tödliche Verletzungen. Nur dank der überlegenen varganischen Medotechnik wird er gerettet.
Im August 1975, genau fünfzig Wochen nach dem ersten Auftritt Ischtars in ATLAN 150/24, wurde das Rätsel um ihr Volk endgültig gelüftet. Wegen der anfangs alternierenden Erscheinungsweise der EXCLUSIV-Serie entsprach diese Zeitspanne 37 Romanen. ATLAN 200, der zweite große Jubiläumsband der Serie, den diesmal nicht K. H. Scheer, sondern William Voltz verfasste, bot einen geschichtlichen Rückblick darauf, weshalb die Varganen überhaupt den Mikrokosmos verließen und welches Schicksal sie erwartete, wirft aber auch ein erhellendes Licht auf die Entwicklung ihres Volkes nach der Rückkehr.
Vorausgegangen waren etliche Romane, in denen die Hauptfiguren eine Welt nach der anderen aufsuchten und dort ihre Abenteuer erlebten. Fast ein halbes Jahr lang hielt dieses Planeten-Hopping an. Dabei waren neun Autoren am Werk. Der Neuzugang Hess und der Veteran Ewers waren mit jeweils sechs Beiträgen am fleißigsten, gefolgt von Clark Darlton, Peter Terrid und Marianne Sydow mit jeweils vier. Shepherd, Patton, Kneifel und Francis beteiligten sich mit jeweils drei Romanen, wobei Letzterer seinen eigenen Zyklus mit den Abenteuern von Lebo Axton schrieb, den in die Vergangenheit des Kristallreichs verschlagenen USO-Agenten Sinclair Marout Kennon.
Neunzehn Romane dieser Autoren sollten noch folgen, bevor der Varganen-Zyklus endgültig abgeschlossen war und der jugendliche Kristallprinz Atlan sich neuen Abenteuern zuwenden konnte. In den Daten-Exposés für die ATLAN-Miniserien OMEGA CENTAURI und OBSIDIAN, die 2003 und 2004 herauskamen, trug Rainer Castor später historische Einzelheiten nach. Sein zuvor erschienener PERRY RHODAN PLANETENROMAN 411 schildert einen Atlan, der die feste Überzeugung vertritt, dass die technischen Artefakte und manipulierten Sonnensysteme der Varganen, deren Alter auf 900.000 Arkonjahre geschätzt wurde, auf die Aktivitäten der mysteriösen Oldtimer der galaktischen Frühzeit zurückgehen.
Eine Buchausgabe des Varganen-Zyklus, bearbeitet von Castor, startete im Juni 2004. Er umfasst die Bände 24 bis 31 der ATLAN-Blaubände und liegt inzwischen vollständig vor.
Info zur Romanserie: Die Varganen
So nennt sich ein Teil des Volkes der Tropoyther, das rund 675.000 Arkonjahre vor der Handlungszeit an einer Expedition in den Makrokosmos teilnimmt, um die Milchstraße zu erforschen. Unter dem Einfluss des Drugun-Umsetzers, der ihnen den Transfer ermöglichte, entwickelt sich bei einigen Größenwahn. Sie beginnen Sonnensysteme zu manipulieren und errichten ein gewaltiges Sternenreich. Aber dann stellen sie fest, dass sie zwar körperlich unsterblich, aber auch unfruchtbar geworden sind. Um der um sich greifenden Lethargie und Depression zu entgehen, versetzen Tausende sich in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in biologischen Tiefschlaf. Der Rest rebelliert gegen den größenwahnsinnigen Expeditionsleiter Mamrohn und kehrt in den Mikrokosmos zurück. Im Laufe der nächsten Jahrhunderttausende zerfällt das Reich der Varganen, und die letzten Vertreter ziehen sich auf die Versunkenen Welten zurück. Einige kleinere Gruppen von Rebellen bleiben im Makrokosmos – unter der Führung Ischtars, die als letzte Königin des Reiches gilt.
Eifrige Autoren
Die Umstellung von ATLAN auf wöchentliches Erscheinen hatte es erforderlich gemacht, neue Autoren für die Serie zu gewinnen. Die meisten – Hess, Terrid, Sydow und Patton – sollten ihr auch für längere Zeit erhalten bleiben. Cheflektor Kurt Bernhardt spornte seine Schäfchen stets zu verstärkter Mitarbeit an. Beim Varganen-Zyklus wirkte sich das in bisher nicht gekanntem Ausmaß auch auf die Exposé-Arbeit aus.
Am eifrigsten beteiligte sich wohl Peter Terrid an der Gestaltung dieses Zyklus. In einem Brief vom 6. Januar 1975 spricht er von sage und schreibe sieben Exposés, die er William Voltz auf einen Schlag zur Ansicht beilege. Die Absicht war, sie in die laufende Handlung einzubauen, um den vielseitig beschäftigten Exposéredakteur zu entlasten. Das dürfte in der Handlung nach Band 200 in weiten Teilen geschehen sein, wobei der Autor, der die Entwürfe einreichte, auch jeweils die endgültige Fassung zur Romanausarbeitung bekam.
H. G. Francis schrieb zwei Exposé-Vorschläge, die sich auf das Schicksal von Lebo Axton alias S. M. Kennon bezogen, und Dirk Hess schickte Voltz am 8. April 1975 einen Handlungsabriss für die Serie mit den Worten: »Ich würde mich freuen, wenn sich daraus ein paar Abenteuer verwenden ließen. Wie ich Dich kenne, drehst Du das Ganze geschickt durch deine Ganglien und produzierst serienträchtige Zyklen!«
Am 9. Juli 1975 wandte Terrid sich, als er gerade an ATLAN 222 saß, »zur weiteren Gestaltung und zum Fortgang der Serie« mit ein paar Vorschlägen an Kurt Bernhardt, die darauf hinausliefen, dass die Romane künftig wieder stärker miteinander verzahnt und verschränkt werden sollten. Er schlug vor, ausgewählte Leser oder Clubs mit der Aufgabe zu betrauen, alle Völker, Gruppen, Tiere, Raumschiffe und Planeten zu katalogisieren. Die so entstandene Liste sollte der Redaktion als Arbeitsunterlage dienen, die künftig eine einheitlichere Gestaltung und Handlungsführung ermöglichte.
Am 18. Juli 1975 erklärte Bernhardt in einem Schreiben an den Exposéredakteur, dem Terrid einen Durchschlag geschickt hatte: »Ich finde es gut, dass Herr Ritter an den Projekten, an denen er arbeitet, so großes Interesse hat. Sicher sind viele Vorschläge nicht verwendbar. Ich möchte mich aber trotzdem mit Ihnen darüber unterhalten.«
Bernhardt hatte stets zahlreiche Pläne im Hinterkopf und bereits am 14. Mai ein Schreiben an Voltz geschickt, in dem es heißt: »Ich schicke Ihnen eine Karte zu. Sammeln Sie diese unter dem Thema ›Bearbeitung der Neuauflage des PERRY RHODAN-Lexikons‹. Diese Sache wird in absehbarer Zeit auf uns zukommen.«
Vielleicht wurde bei dem Gespräch Mitte Juli auch der Plan geboren, das PERRY RHODAN-Lexikon neu herauszubringen. Auf jeden Fall erfolgte daraufhin eine stärkere Einbindung von Lesern, die künftig bei der Neuverwertung älterer Romane auf inhaltliche Stimmigkeit achteten. Als einige Jahre später die Reihe der PERRY RHODAN-Silberbände startete, übernahm Franz Dolenc diese Aufgabe.
Ein Marineoffizier im All
Im August 1975 startete im Pabel Verlag mit dem Band »Seiner Majestät Lieutenant« die Romanserie SEEWÖLFE. Sie bildete eine Besonderheit, erschien sie doch in dem damals völlig neuen Format des Taschenhefts, das Ende der Neunzigerjahre von Bastei-Lübbe für Serien wie DIE UFO-AKTEN und VAMPIRA wieder aufgegriffen wurde.
Bei SEEWÖLFE handelte es sich um gekürzte Übersetzungen der englischen Seefahrer-Serie FOX eines gewissen Adam Hardy. Die Hauptfigur war der Brite George Abercrombie Fox, der seine Abenteuer während der Napoleonischen Kriege erlebt.
Hierzulande ahnte unter den Lesern niemand, dass der Autor als Arthur Frazier und Neil Langholm mit WOLFHEAD und THE VIKINGS auch zwei Wikinger-Serien verfasst hatte. Sie sind nie ins Deutsche übersetzt worden. Und es ahnte auch niemand, dass sich hinter Adam Hardy ein SF-Autor verbarg!
In Wahrheit hieß Hardy nämlich H. Kenneth Bulmer und war ein 1921 in London geborener Profischriftsteller, der seit 1952 schon mehr als sechzig SF-Romane veröffentlicht hatte. Und nicht nur das: Seit Jahrzehnten unterhielt er Verbindungen zu diversen deutschen SF-Spezialisten im Umfeld von PERRY RHODAN. Seine ersten Lektoren hierzulande waren Clark Darlton und Günter M. Schelwokat.
Darlton hatte ihn nicht nur 1954 in seine legendäre Heftreihe UTOPIA-GROSSBAND aufgenommen, sondern auch drei seiner Romane selbst ins Deutsche übersetzt, Schelwokat veröffentlichte ihn in den verschiedenen TERRA-Heftreihen und brachte ihn außerdem zu Taschenbuchehren – zuletzt in UTOPIA CLASSICS.
Auch bei Goldmann und Bastei-Lübbe erschienen damals Romane aus Bulmers Feder, aber Anfang der Siebzigerjahre kannte man ihn am ehesten als Verfasser eines sechsteiligen Zyklus über Weltentore, die von einer mächtigen und skrupellosen Organisation beherrscht und kontrolliert werden. Der »Dimensionszyklus« erschien zwischen 1972 und 1974 in TERRA ASTRA und wurde ab 1984 in dieser Reihe sogar nachgedruckt, was Bulmer veranlasste, eigens für Schelwokat einen neuen siebten Roman zu schreiben, der aber wegen der Einstellung der deutschen Heftreihe nicht mehr erscheinen konnte.
In England und Amerika erschienen Bulmers Romane unter einer Vielzahl von Pseudonymen, während er in Deutschland für seine SF fast immer – außer bei Philip Kent und Tully Zetford – seinen richtigen Namen verwendete. Allerdings hatte er 1972 noch eine Science Fantasy-Serie gestartet, die zu seinem größten Erfolg überhaupt werden sollte. Für sie hatte er sich ein brandneues Pseudonym ausgedacht: Alan Burt Akers.
Der erste Band seiner Saga von Dray Prescott, »Transit nach Scorpio«, enthält bereits alles, was die Serie auszeichnen sollte. In der Tradition von TARZAN-Autor Edgar Rice Burroughs schildert Bulmer darin einen Marineoffizier, der gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts von einer rätselhaften Macht, deren Symbol der Skorpion ist, nach Kregen versetzt wird, auf eine wilde, barbarische Welt, auf der es von unterschiedlichen Rassen wimmelt. In einem Hexenkessel aus Intrigen und Verrat greift er dort im Auftrag seiner unbekannten Herren, die allein ihn wieder in die Heimat versetzen können, in die Geschehnisse ein.
In Deutschland sollte diese Serie noch erfolgreicher werden als in Großbritannien und den USA. Nach siebenunddreißig Bänden erschienen die weiteren Romane als Originalausgaben, in halbjährlichen Abständen exklusiv geschrieben für den deutschen Markt. Erst 1997 beendete Bulmer mit Band 53 seine Serie aus Alters- und Krankheitsgründen.
Der erste Band im Heyne Verlag war zeitgleich mit dem Start der SEEWÖLFE erschienen, übersetzt von seinem literarischen Agenten Thomas Schlück, der den Grundstock seiner erfolgreichen Agentur einige Jahre zuvor Clark Darlton abgekauft hatte.
Piraten und Science Fiction
Nach vierzehn Ausgaben erfolgte eine Umstellung bei den SEEWÖLFEN. Die Abenteuer von George Abercrombie Fox waren abgeschlossen, und so trat im August 1975 eine andere Hauptfigur an deren Stelle: Oliver Lancelot Killigrew, Kaperfahrer und Blockadebrecher, Entdecker und Eroberer zur Zeit des berühmten Weltumseglers Francis Drake. Auch seine Abenteuer erschienen vorerst noch zweiwöchentlich und im Taschenheftformat.
Cheflektor Kurt Bernhardt hatte die Idee gehabt, die erfolgreiche FOX-Serie durch eine deutsche Serie fortzusetzen, die nach dem Vorbild von PERRY RHODAN aufgebaut war. Das hieß, es gab ein festes Autorenteam, und die Romane wurde nach Exposés verfasst. Außerdem gab es eine Leserseite, die sinnigerweise »Schatztruhe« genannt wurde.
Bernhardt fand auch die richtigen Mitarbeiter: Wilhelm Kopp, der als Davis J. Harbord schrieb, verfügte über ein großes nautisches Archiv, und seine Kollegen Manfred Wegener und Hermann Werner Peters hatten beide viel Serienerfahrung vorzuweisen.
Wundert es noch jemanden, dass sie die auf SF-Gebiet gesammelt hatten? Wegener hatte schon bei MARK POWERS mitgeschrieben und nach einem Intermezzo bei REN DHARK mit H. G. Francis zusammen die leider recht kurzlebige SF-Serie REX CORDA gegründet, und Peters, schon bei REN DHARK mit zwölf Romanen vertreten, hatte anschließend als Bert Stranger und Staff Caine auch bei Kurt Brands pazifistischer SF-Serie RAUMSCHIFF PROMET mitgewirkt. Nach Brands Weggang hatte er sogar die Leitung übernommen. Später war er als Redakteur und Autor zu JERRY COTTON gewechselt. Jetzt arbeitete er in beiden Funktionen für Pabel und verantwortete unter anderem die verlagsinterne Betreuung des PERRY RHODAN REPORTs.
Wegener, der bei den SEEWÖLFEN als Fred McMason schrieb, konnte bei der Exposéarbeit für diese Serie hervorragend seine Kenntnisse als Steuermann nutzen. Nach dem Vorbild des PERRY RHODAN COMPUTERs brachte er unter der Überschrift »Klabautermann« sein seemännisches Wissen noch in einhundertsechzig zusätzlichen Beiträgen an den Leser. Und auch Titelbildzeichner Firuz Askin, der Jahrzehnte später als Karl May-Illustrator für den Weltbild Verlag von sich reden machen sollte, profitierte von seiner Sachkundigkeit.
Schon kurz nach Einführung der neuen Heftromanserie wurde nach dem Vorbild der PLANETENROMANE zudem eine Taschenbuchreihe mit den SEEWÖLFEN gestartet, für die Wegener den Großteil der Bände selber verfasste. Hier stand jedoch nicht der Freibeuter Killigrew, sondern ein Schiffsjunge im Mittelpunkt der Handlung.
Die Arbeit für die SEEWÖLFE nahm Wegener voll in Beschlag. Wie intensiv er sich in die Thematik vertiefte, zeigt sich darin, dass er 1987 im Franz Schneider Verlag ein nautisches Lexikon vorlegte. Es trägt den Titel »Seefahrt A–Z. Schiffe, Seefahrer, Seemannschaft, Tips für die Praxis«. Wilhelm Kopp trug dazu eine Fülle an Hintergrundmaterial bei.
Wegener bedauerte es, dass die Arbeit an den SEEWÖLFEN ihm keine Zeit mehr ließ, Science Fiction zu schreiben, und so nahm er 1989 den Jubiläumsband 700 zum Anlass, die Galeone Killigrews kurzfristig ins Jahr 1943 zu befördern. Er erfand einfach eine neue Handlung um das Philadelphia-Experiment, ein Zeitreise-Experiment der amerikanischen Marine. Danach geriet Killigrews Crew wieder in historisches Fahrwasser.
Kurzbiografie: Manfred Wegener
Der Autor wurde am 6. Oktober 1935 in Danzig geboren. Seine Familie floh kurz vor Kriegsende nach Kopenhagen. Nach der mittleren Reife in Heiligenhafen an der Ostsee wurde er Seemann und befuhr acht Jahre lang die Weltmeere, bevor er zur Binnenschifffahrt auf dem Rhein wechselte. Aus der 1957 geschlossenen Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Anfang der Sechzigerjahre wurde er Schleusenwärter am Neckar. Sein Debüt als Schriftsteller gab er 1963 in der SF-Serie MARK POWERS, gefolgt von Beiträgen für KOMMISSAR X und FLEDERMAUS sowie REN DHARK. Nach der Einstellung der zusammen mit H. G. Francis geschaffenen SF-Serie REX CORDA verfasste er zwischen 1966 und 1970 zehn Beiträge für ZAUBERKREIS-SF, teils als Calvin F. Mac Roy. Anschließend schrieb er für COMMANDER SCOTT, GEMINI, KOJAK, JOHN CAMERON, RONCO, SEEWÖLFE und PLUTONIUM POLICE. Rund fünfhundert Hefte und Taschenbücher von KOMMISSAR X und SEEWÖLFE betreute er auch als Redakteur und Lektor. Nach der Einstellung dieser beiden Reihen schrieb er bis 1996 für die Westernserie LASSITER sowie Kurzkrimis für Zeitschriften. Es folgten zwei SF-Hardcover für den Blitz-Verlag, die Mitarbeit am neuen RAUMSCHIFF PROMET und ein Abstecher zur Gruselserie MARK HELLMANN. Er starb 1999 überraschend in einem Krankenhaus bei der Überprüfung seines Herzschrittmachers, den er nach einer Reanimation eingepflanzt bekommen hatte.
Ein ideenreicher Cheflektor
Alle Schriftsteller, auch die Macher von PERRY RHODAN, werden manchmal gefragt, woher sie eigentlich ihre Ideen nehmen. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, Ideen können buchstäblich überall geboren werden – auch in der Phantasie eines Cheflektors.
Am 11. September 1975 schrieb Kurt Bernhardt, der die Serie seit ihrer Entstehung fünfzehn Jahre zuvor im Verlagshaus betreute, einen Brief an Exposéautor Voltz. Er forderte ihn darin auf, an seinen Hinweis zu denken, »daß die gesamte Tierwelt ein menschliches Gehirn eingepflanzt bekommt, so daß die Tiere den Menschen, von der Intelligenz und vom Verstand her, gleich sind. Da könnte man meines Erachtens ganz schöne Handlungsfäden ziehen, und wir hätten wieder eine neue Sache für PERRY RHODAN.«
Bernhardt brachte noch viele andere Vorschläge ein, die von Voltz umgesetzt wurden – aber dieser war nicht darunter. Sicher eine weise Entscheidung …
PERRY RHODAN goes to Washington
Schon im Laufe des Jahres 1974 hatte sich ein reger Austausch zwischen Clark Darlton und dem neuen Leiter des Erich Pabel Verlags, Winfried Blach, entwickelt. Außerdem korrespondierte der Mitbegründer von PERRY RHODAN ausführlich mit Rolf Meibeicker von der Werbeabteilung, der sich sehr für die Serie engagierte und über neue Entwicklungen im Haus stets auf dem Laufenden war. Die beiden waren auch Darltons Ansprechpartner, als es Anfang 1975 um den Weltcon der Ancient Astronauts Society in Zürich ging und er seinem Verlag eine Verbindung mit Erich von Däniken schmackhaft zu machen versuchte.
Etwa um diese Zeit hatte Darlton erfahren, dass ein PERRY RHODAN-Con in den USA stattfinden sollte. Ace Books sollte ihn veranstalten, der von Donald A. Wollheim geleitete amerikanische Verlag von PERRY RHODAN. Die dortige Lizenzausgabe war sehr erfolgreich, und die Leser wünschten sich einen Con, wie sie auch für Trekkies und SF-Fans allgemein stattfanden. Ursprünglich war von Florida die Rede gewesen, aber nun sollte es Washington werden, und als Datum wurde der 16. bis 18. April 1976 gehandelt.
Im Erich Pabel Verlag, wo man diese Entwicklung aufmerksam verfolgte, herrschte beträchtliches Interesse. Der US-Markt bot gewaltige Möglichkeiten, und so kam es zu einer Besprechung zwischen Cheflektor Kurt Bernhardt und Winfried Blach, ob der Verlag nicht an dem Con teilnehmen sollte. Ein großer Ausstellungsraum war schon in Aussicht gestellt. Man überlegte, ob man William Voltz nicht als Abgesandten schicken könne.
Als der Exposéredakteur Ende Januar 1975 von diesen Neuigkeiten erfuhr, reagierte er zurückhaltend. Er befürchtete, vielleicht auf Englisch eine Rede halten zu müssen, wurde aber beruhigt, dass es lediglich um die eine oder andere Diskussion gehe. Vielleicht brauche er auch bloß den Ausstellungsraum zu hüten, wobei Darlton ihm helfen könne. Der hatte schon einen Flug erster Klasse zugesichert bekommen, aber da er seine Ehefrau Bibs mitnehmen wollte, zog er die Touristenklasse vor. Er brauchte dann nur noch die Differenz zu bezahlen, damit sie gemeinsam fliegen konnten. Sein Plan sah vor, sich anschließend zu zweit den Wilden Westen anzuschauen. Immerhin war er auch Western-Autor!
Mittlerweile stand Darlton auch mit dem amerikanischen Veranstalter des Cons, Tim Whalen, in Verbindung. Der teilte ihm mit, dass der RHOCON I in Washington schon am 2. Januar 1976 stattfinden werde. Heller Wahnsinn!, fand Darlton. An Silvester! Er setzte sich bei Whalen dafür ein, den Con auf den April oder Mai zu verlegen. Lektor Müller-Reymann, der im Verlag die Krimis und das PERRY RHODAN-JAHRBUCH betreute, riet er mündlich, in dem Buch einen vorläufigen Termin – Anfang oder Frühjahr 1976 – zu nennen.
Vierzehn Tage später erhielt Voltz von einem entsetzten Darlton ein Programmheft mit allen Con-Daten und die Info, dass es bei dem neuen Termin bleibe. Darlton überlegte sich nun ernsthaft, ob er fliegen sollte, seine Frau werde jedenfalls nicht mitkommen. Er wolle einfach nur hinüberrauschen und drei Tage im kalten Winter von Washington seine Pflicht tun, bevor er schnellstens wieder nach Hause zurückkehrte.
Seine Pflicht tun – das hieß, dort den Ehrengast zu geben!
Die Whalen-Korrespondenz
Kurz darauf, im April 1975, kamen die Vorbereitungen für den RHOCON I offiziell in Gang. Tim Whalen, der Chairman der Veranstaltung, wandte sich auf Deutsch in einem umfangreichen Brief an Cheflektor Bernhardt. Er teilte ihm mit, dass seine Organisation ihm gratis einen Raum mit 44 Quadratmetern »auf der Hauptetage der Versammlung« zur Verfügung stelle, der von allen Teilen des Hotels Sheraton Park leicht zu erreichen sei.
»Ich werde einige Mitglieder von RHOCON beauftragen, sich für den Erich Pabel Verlag um die Führung dieses Raumes zu kümmern. Dann bliebe William Voltz mehr Zeit, seine Funktionen bei RHOCON I wahrzunehmen und Ihre Firma zu repräsentieren.«
Weiter schreibt Whalen, dass er in seinem Fanzine RHOCONZINE von dem Material berichtet habe, das beim Leserservice erhältlich war. Außerdem habe er die deutschen Heftpreise genannt und die Adresse von Mr. Meibeicker bekannt gegeben.
»Das könnte zur Folge haben, daß aus Amerika Anfragen an den PERRY RHODAN Dienst kommen.«
Whalen wies auch darauf hin, dass viele Fans sich beim Con mit deutschem Material eindecken wollten, so dass der Verlag besser einiges mitbringen sollte. Ausgehend von rund 2500 Besuchern schlug er 2000 Hefte von PERRY RHODAN vor, korrigierte sich dann aber: »Das scheint etwas zu wenig. Ich könnte mir vorstellen, dass 90% der Fans eines, um die 40% zwei und 10% mehr als zwei Exemplare haben wollen.«
Bei ATLAN, das in den USA im Juli des Jahres als Sonderreihe im Taschenbuch starten sollte, setzte er einen voraussichtlichen Bedarf von 300 bis 500 Heften an, um die 300 bei DRAGON, das trotz großer Hoffnungen des Verlags nie nach Amerika verkauft wurde; die Comics und das Lexikon sollten mit jeweils rund 100 Exemplaren vertreten sein. Er sprach sich auch für andere Science Fiction des Verlags aus, »die man nicht an die PERRY RHODAN-Fans, sondern an Leute verkaufen könnte, die deutsch lesen können.« Und zu guter Letzt schlug er vor: »Eine kleinere Auswahl von anderem Material wird vielleicht von einigen Fans gekauft werden, die alles besitzen müssen.«
Bernhardt antwortete Whalen, dass er das Schreiben an William Voltz und Rolf Meibeicker weiterleite, »who probably will represent in Washington our publishing house, i.e. the German edition of PERRY RHODAN [die in Washington vermutlich unser Verlagshaus, d.h. die deutsche Ausgabe von PERRY RHODAN repräsentieren werden].«
Auf diese Ankündigung hin nahm der Chairman des Cons am 6. Mai 1975 mit Voltz persönlich Kontakt auf, dessen Adresse er von Darlton erhalten hatte, und erklärte auf Englisch: »Auch wenn in den Vereinigten Staaten bisher erst ein Buch von Ihnen erschienen ist, bin ich sicher, dass wir viel Freude an Ihren Romanen haben werden.«
Und vier Tage, nachdem Voltz ihm am 27. Mai geantwortet hatte, schrieb er dem Mann, der mittlerweile die Handlungsvorgaben der gesamten Serie verfasste: »Ihr erster Roman gefiel mir. Und ich kenne mehrere Leute, die ebenfalls den Eindruck haben, dass sie im Laufe der Zeit zum beliebtesten Autor der Serie werden könnten. In Deutschland liegt diese Entwicklung natürlich schon fünfzehn Jahre zurück.«
Eine Woche später wandte Whalen sich in einem Schreiben auf Deutsch auch an Kurt Bernhardt und versicherte ihm, dass die amerikanischen Leser sich besonders auf den Erwerb der Risszeichnungen und des Lexikons freuten. Besonders auf Letzteres, das der Chairman gern in seinem Fanzine vorstellen würde. »Ich spreche selbst noch wenig Deutsch – ich lerne die Sprache erst seit diesem Jahr – fühle mich aber doch dazu imstande, die Grundideen zu übersetzen. Es vermittelt einen großartigen Einblick in die Serie.«
Noch einmal versichert er, »daß diese Dinge sowie weiteres PR Service Material wie auch die Exemplare von PERRY RHODAN, ATLAN, DRAGON, PLANET Novels und PERRY Comics gut aufgenommen werden und sich vermutlich gut verkaufen. An einem guten Verkauf bin ich schon deshalb interessiert, weil dadurch vielleicht Ace Books ermutigt wird, auch diese Bücher zu übersetzen und sie neben PERRY RHODAN erscheinen zu lassen«. Damit trat er beim Verlag offene Türen ein und erhielt natürlich die Erlaubnis, einige Risszeichnungen in seinem Fanzine abzudrucken. Er regte auch den Verkauf von Titelbildern der Serie aus der Feder von Johnny Bruck an und bat um die Zusendung eines Exemplars des Jahrbuchs, von dem er schon so viel gehört habe.
Am 17. Juni bedankte Whalen sich bei William Voltz für das Jahrbuch und erklärte auf Englisch: »Ich muss zugeben, dass Sie jünger sind, als ich erwartet hätte. Aber das ist wohl nicht weiter ungewöhnlich. Ich bin zum Beispiel erst sechzehn.« Und danach briefte er den Autor über die Flugzeiten der Maschine, wenn er unmittelbar nach seinem Besuch der Ancient Astronauts Society in Zürich mit der Swissair starte.
Vier bis fünf Stunden, versicherte Whalen, würden ihn nach New York bringen, wo er umsteigen müsse und um dreizehn Uhr Ortszeit in Washington eintreffe. Spätestens zwei Stunden danach sei er auf seinem Hotelzimmer und könne sich etwas Schlaf genehmigen, bis gegen achtzehn Uhr in der Convention Suite eine Privatparty beginne. Sie werde bis zehn oder elf Uhr dauern, wobei er aber nicht von Anfang an dabei sein müsse.
Der zweite Januar werde nicht so schlimm werden. Erst um vierzehn Uhr eröffneten Forry Ackerman und seine Freunde den Con, woraufhin der PERRY RHODAN-Film »SOS aus dem Weltraum« in englischer Fassung vorgeführt werde. Es stehe ihm frei, eine Einführung zu sprechen oder nur mit Einzelpersonen zu reden, je nachdem, was er seinem Englisch zutraue. Wichtig sei ihm aber die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Thema »Deutsche SF und ihr Fandom« mit Clark Darlton. Er habe sie beide nicht zu sehr mit Terminen vollgepackt, die meisten Abende ab achtzehn Uhr stünden zu ihrer freien Verfügung.
Ein wenig reumütig erwähnte er, dass ein deutscher Fan namens Klaus Mahn sich bei ihm gemeldet und er ihn eher beiläufig behandelt habe, bevor ihm klar geworden sei, dass es sich um Kurt Mahr handelte. Er wolle vielleicht auch zu dem Con kommen. Und abschließend eröffnete er Voltz, dass er seinen Club RHOCON zu einem weltweiten Fanklub ausbauen wolle und sich geehrt fühlen würde, wenn er Ehrenmitglied werde und ihm Rat und Beistand leisten könne. Eine entsprechende Mitgliedskarte liege bei.
Am 3. Juli bedankte sich Cheflektor Bernhardt für Whalens Schreiben vom 8. Juni und erteilte ihm die Erlaubnis zum Abdruck von Risszeichnungen und Texten aus dem Lexikon in seinem Fanzine, bat ihn aber auch, sich für eine Übernahme des beiliegenden Jahrbuchs durch Ace Books einzusetzen. Gleichzeitig bedauerte er, dass auf den US-Ausgaben von PERRY RHODAN nicht die Cover von Johnny Bruck Verwendung fanden. Die Übersendung oder Mitnahme der Vorlagen sei nicht möglich, da es sich um unverkäufliche Einzelstücke handele, von denen keine Kunstdrucke hergestellt würden.
»Bitte seien Sie jedoch versichert«, erklärte Bernhardt dem jungen Fan abschließend auf Englisch, »daß ich Ihren Wünschen stets so weit wie möglich nachkommen werde, um Ihnen die Arbeit für PERRY RHODAN zu erleichtern.«
Und noch einmal griff der Cheflektor in Sachen des ersten amerikanischen Cons ein. Mitte August setzte er sich mit der in Karlsruhe ansässigen SWS Iata-Agentur in Verbindung, einem Reisebüro, dessen Geschäftsführer Karl Zimmermann ein PERRY RHODAN-Fan der ersten Stunde war. Am 19. des Monats telefonierte dieser mit William Voltz, dann schrieb er Bernhardt ein Angebot, in dem er sich gegen eine kurze Veröffentlichung des Vorhabens auf der LKS der Serie bereit erklärte, die Reise mit Flug, Übernachtung und Frühstück vom 1. bis 5. Januar für unter 1000,- DM zu organisieren.
Er schloss mit den Worten: »Wir danken Ihnen für Ihre tätige Hilfe, die einem größeren Kreis von amerikanischen und deutschen SF-Freunden fruchtbaren Kontakt ermöglichen soll, und wünschen dem ersten US-Con vollen Erfolg.«
Ein denkwürdiges Event
Im Dezember 1975 erschien auf der Leserseite von PERRY RHODAN 746 ein kurzer Text, in dem Tim Whalen und sein Kollege Avery Goodman die IPRA vorstellten, die International Perry Rhodan Association, eine Art Korrespondenzklub des übergeordneten RHOCOM, der den Con in Amerika veranstaltete. Whalen bat darin alle Interessierten, sich an ihn zu wenden. Name und Anschrift würden dann in den amerikanischen Romanausgaben veröffentlicht werden – später auch in anderssprachigen Ausgaben.
Beinahe ein halbes Jahr verging, bis im Mai 1976 in TERRA ASTRA 246 bis 248 ein dreiteiliger Bericht über den RHOCON in Washington erschien, den niemand anderer als der ebenfalls anwesende Kurt Mahr verfasst hatte.
Er erzählt darin herrliche Anekdoten: »Auf dem Weg zum ›huckster room‹, der um 10.00 Uhr aufmacht, in der Cocktail Bar hängen geblieben, die auf dem Weg liegt. Grund: van Vogt, Dickson, Ackerman, Darlton sitzen dort. Getränke. Später stößt Voltz zu uns und berichtet sein erstaunliches Erlebnis: In seinem Zimmer kommt beim Aufdrehen des Kaltwasserhahns folgerichtig kaltes Wasser. Da Voltz am 2. Januar nicht kalt baden möchte, öffnet er auch den Warmwasserhahn. Dort kommt … eine Horde von Ameisen.«
Bei der Eröffungsrede von Ackerman sitzen die deutschen Autoren zwischen den Besuchern. Ackerman deutet sie aus, und tosender Applaus brandet auf. Von amerikanischer Verlagsseite ist niemand anwesend. Wohl, weil statt der versprochenen drei doch nur zwei US-Ausgaben pro Monat erscheinen. Als die Fans frustriert erfahren, dass in Deutschland schon 750 Romane vorliegen, rechnet jemand aus, dass dieser Band in den USA erst in 27 Jahren erscheinen wird. Eine bittere Pille für alle amerikanischen Fans.
Kaum wieder in Deutschland, verewigte Clark Darlton den Organisator Tim Whalen in seinem nächsten PERRY RHODAN-Roman als einen an Liebeskummer leidenden Geologen. Mausbiber Gucky teleportiert mit ihm auf einen Kleinplaneten, wo sie gestrandeten Aliens begegnen, die Aktionen gegen die SOL durchführen. Sie verzichten darauf, als Whalen sich freiwillig für seinen Verbleib auf dem Asteroiden ausspricht.
Ein würdiges Denkmal für einen erst sechzehnjährigen jungen Mann, der durch seine Entschlossenheit und Begeisterung den ersten PERRY RHODAN-Con in den USA auf die Beine stellte.
Sehr viel später, am 22. März 2006, feierten die deutschen Fans in einer YahooGroup das dreißigjährige Jubiläum des RHOCON. Der Leser Arnold W. Winter wies den Chronisten dankenswerterweise darauf hin, dass sich dort Tim Whalen überraschend zu Wort gemeldet hatte. Er schrieb in seinem Eintrag: »Mehrere hundert Fans kamen, weniger, als wir erhofft hatten, aber wie sich herausstellte, fand in diesem Jahr gleichzeitig eine Stark Trek Convention in D.C. statt. Nicht dass die Anwesenden sich beschwerten – alle hatten reichlich Gelegenheit, mit den Gästen zu reden, und die VIP-Räume blieben fast die ganze Zeit lang geöffnet. Der Con dauerte drei Tage.«
Und wie so oft bei PERRY RHODAN gab es für manche noch einen Zuschlag. Whalen berichtet weiter: »Zu meiner großen Freunde konnten Walter und seiner Frau Rosie anschließend eine Woche bei mir zu Hause in Florida wohnen, und sie genossen alles – vom Strand bis zum Anblick der Alligatoren, Pelikane und Schmuckreiher. Ich hielt mit Walter Kontakt – bis zu seinem Tod 2005. Unser letzter Briefwechsel erfolgte ein halbes Jahr vor seinem Tod. Es war wundervoll, mit Rosie und Walter zusammen zu sein.«
Geplant gewesen war noch ein zweiter PERRY RHODAN-Con in den USA, der gemeinsam mit einem »Star Trek«-Con am 8. bis 15. Dezember 1976 in Orlando, Florida, stattfinden sollte. Aber dazu kam es nicht mehr, weil vorher die amerikanische Ausgabe von PERRY RHODAN eingestellt wurde. Es gab noch ein paar Versuche, die Serie in den USA wieder zu etablieren, im Taschenbuch wie als Heft – doch bis heute vergeblich.
Der Schatten des ersten Gastautors
Der Einfluss von PERRY RHODAN ist gewaltig, und zwar vor allem durch die Wirkung, die das humanistische Gedankengut der Serie auf seine Leser hat. Unter diesen Lesern befanden sich Politiker wie Kurt Beck, Projektplaner der NASA wie Jesco von Puttkamer und Wissenschaftsjournalisten wie Rüdiger Vaas.
Auch Autoren von moderner deutscher Science Fiction sind durch PERRY RHODAN geprägt. Das prominenteste Beispiel dafür ist Andreas Eschbach, der Verfasser des zu Recht berühmten und verfilmten SF-Romans »Das Jesus Video«. Als bekennender ehemaliger Leser der Serie eröffnete er im September 1998 sogar ein neues Konzept des Verlags und verfasste den ersten sogenannten Gastroman, bei dem Autoren von außerhalb der Serie nach Exposé ihre Phantasie im Rahmen des Perryversums schweifen lassen dürfen.
Das Ergebnis war PERRY RHODAN 1935 mit dem Titel »Der Gesang der Stille«. Die Geschichte von der einsamen Mission des Reginald Bull wurde zu einem der beliebtesten Romane der Serie überhaupt und später in einer Sonderauflage für Sammler nachgedruckt. Aufgrund seines großen Erfolgs ließ Eschbach 2005 und 2009 noch zwei weitere Romane für die Serie folgen, die seinen Beliebtheitsstatus weiter gefestigt haben.
Aber wer glaubt, dass der »Der Gesang der Stille« seine erste Veröffentlichung im Rahmen der Serie war, der irrt.
Bereits im Oktober 1975 war in Band 739 seine Kurzgeschichte »Welt des Unheils« erschienen. Vorangestellt war damals ein Leserbrief, in dem es heißt: »Ich bin ein fünfzehnjähriger Gymnasiast, lese PERRY RHODAN seit fünf Jahren und besitze ca. 400 Bände. Mein Hobby ist die Weltraumfahrt, und manchmal träume ich davon, später einmal an der Serie mitzuschreiben.«
Es ist ihm gelungen – und noch vieles mehr …
Eine kaum beachtete technische Revolution
Heute, im Zeitalter der Computer und E-Mails, ist der Datenaustausch meist nur noch eine Frage weniger Minuten. Bei PERRY RHODAN machen sich Exposés, Manuskripte und sonstige Beiträge jetzt immer gleich nach Fertigstellung digital auf den Weg. Dass es einmal anders war, wird einem inzwischen kaum mehr bewusst.
Ein Schreiben des Pabel Verlags vom 12. Mai 1975 erinnert an Zeiten, als die bloße Vervielfältigung von Texten noch logistischer Vorarbeiten bedurfte. Das damalige Sekretariat unter Frau Wollenschneider wandte sich darin mit den Worten an William Voltz: »Sehr geehrter Herr Voltz, wir nehmen an, dass das Fotokopiergerät inzwischen bei Ihnen eingetroffen ist und Sie schon fleißig am Kopieren sind. Das Gerät ging in Ihren leihweisen Besitz über und wird in unserer Inventarliste geführt. Dürfen wir Sie bitten, auf der beiliegenden Karte unter ›Benutzer‹ zu unterzeichnen, und wenn möglich die Maschinen-Nummer, die irgendwo zu finden sein wird, einzufügen.«
Der Fotokopierer sollte die Benutzung der etlichen Lagen Kohlepapier bei der Niederschrift der Manuskripte überflüssig machen, und gerade für den Exposéautor mit seinem großen Verteiler war er natürlich eine enorme Hilfe. Ein solches Gerät war noch sehr teuer, aber es handelte sich um die unbemerkten Anfänge einer technischen Revolution …
Arbeitsalltag eines Science-Fiction-Autors in den Siebzigerjahren!