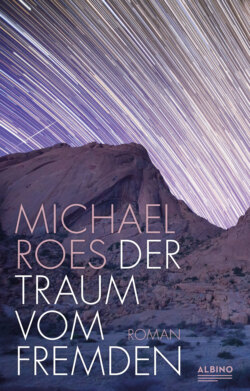Читать книгу Der Traum vom Fremden - Michael Roes - Страница 7
CAHIER I
ОглавлениеMITTWOCH, DEN 3. OKTOBER 1883, EINE HALBE TAGESREISE SÜDÖSTLICH VON HARAR
Aufbruch um sechs Uhr morgens. Wir verlassen Harar durch das südöstliche Stadttor, das Bab as-Salam (das Friedenstor). Neunundneunzig Moscheen, neun mal neunundneunzig Heiligenschreine (Qubbas), fünf Stadttore, eine fast viertausend Schritte lange Mauer, unser Kontor am zentralen Platz, dem Pferdemarkt (Faraz Megala): als ich vor drei Jahren herkam, war ich der einzige Franzose in Harar, und viele Hararis hielten mich gewiß für einen Spion, zumal ich sofort begann, mit Djamis Hilfe die lokalen Sprachen Amhari und Oromo zu erlernen. Mit dem Arabischen war ich bereits von Aden her vertraut.
In Harar gibt es keinen Konsul, keine Post, keine gepflasterten Straßen; man reist mit dem Maultier oder Kamel dorthin und hat fast ausschließlich Umgang mit Einheimischen. Aber hier fühle ich mich unerwartet frei, und das Klima ist im Vergleich mit Aden das eines Luftkurortes.
Unsere erste Etappe ist nach Landessitte eine nur kurze: Wenn jemand hier eine Reise beginnt, will er die Gunst des Himmels nicht schon mit einem zu forschen Aufbruch herausfordern. Es muß die Möglichkeit geben, es sich doch noch mal anders zu überlegen und umkehren zu können; obgleich wir diese Wahl nicht haben! – Al-Hamdulillah, Gott sei Preis und Dank, wir erreichen Kereyu ohne irgendwelche Zwischenfälle zu al-Fikr, dem Nachmittagsgebet, nach etwa vierstündigem Ritt: so bleibt noch ausreichend Restlicht für den Beginn meines Reisejournals.
Laufe Gefahr, mein Wort zu brechen und mich selbst zu verraten. Hatte ich nicht geschworen: Keine leeren Worte mehr! Überhaupt keine Worte mehr! Am besten verstummen; Taubstummensprache für die notwendigen Mitteilungen, Gesten, Gebärden – wie jeder Laut Übelkeit in mir hervorruft, ein ganzer Satz mich zum Erbrechen bringt und ein Gedicht – ein Gedicht ist der Tod! Warum schweigst du dann nicht? Ein anderer schreibt, denkt, murmelt vor sich hin; in sich hinein – laß ihn doch, wen kümmert’s: unverständliches Zeug, es hört doch ohnehin niemand zu! – Außerdem, wer spricht hier schon meine Sprache, spricht mein Schweigen – niemand kennt mich hier; niemand weiß, wer oder woher ich bin; ich könnte jeder sein. Ist das nicht die Freiheit, die Hölle, die ich gesucht habe? jeder und niemand, ohne Familie, ohne Heimat oder Herkunft, ein Vagabund, Brigant, ein Wegelagerer, Halsabschneider, Meuchelmörder – Ach, übertreib nicht, Junge! Das Wort kennt mich nicht und liebt mich nicht. Schau dich doch an, Engel, Dämon, Unsterblicher, es hat keinen Körper; und nur er ist wahr!
Als Kind leide ich jahrelang unter furchtbaren Kopfschmerzen. Man glaubt mir nicht; unterstellt, ich wolle mich nur vor der Arbeit drücken: bis Doktor Z. mir schließlich den Kopf aufsägt und unter meinem Schädeldach die Föten meiner ungeborenen Geschwister findet. Doktor Z. operiert mich ohne Betäubung; versichert mir, das Gehirn selbst empfinde keinen Schmerz – ich solle während der ganzen Prozedur meine Augen geschlossen halten: weil der Anblick von Messer und Säge schrecklicher sei als das, was sie in Wirklichkeit anrichteten – aber natürlich luge ich durch die nur halbgeschlossenen Lider. Ich wundere mich, wie wenig Blut fließt.
Als Doktor Z. meinen nun von den mumifizierten Föten gereinigten Schädel wieder zusammengeflickt hat, kann ich mich nicht bewegen; nicht einmal die Augenlider. Von der Welt sehe ich nur noch einen schmalen, gräulichen Streifen bei Tage; doch mein Gehör ist um so empfindsamer – das Weinen meiner Schwestern will mir nicht mehr aus dem Kopf. Da ist wohl nichts mehr zu machen: sagt Doktor Z. nach einigen Tagen – oder sind es Wochen, Monate: Ich befürchte, Ihr Sohn wird nicht mehr erwachen; sein Gehirn ist bereits tot, wir sollten auch sein Herz erlösen. – Noch sträubt sich die Päpstin, ich schreie in meinem Körper, schlage mit meinen Fäusten gegen seine tauben Wände – mag sein, die Päpstin spürt etwas davon, auch wenn nichts durch die dicken Mauern der Paralyse nach außen dringt: Am Ende aber muß sie dem Arzt recht geben: Hier quält sich ein Herz vergeblich, zweifellos ist es besser, es endlich zur Ruhe kommen zu lassen.
Bevor Doktor Z. meinen Leib zur Bestattung freigibt, will er noch einen wissenschaftlichen Blick in ihn hineinwerfen: Er schneidet ihn von der Kehle bis zur Scham der Länge nach auf, dann zieht er das Messer von der linken bis zur rechten Schulter, damit er die großen Hautlappen über Brust und Bauch bequem aufklappen kann; daraufhin sägt er das Brustbein auf und reißt die Rippen mit zwei kräftigen Zangen auseinander – mit blutigen Händen schneidet er mir ein Organ nach dem anderen aus dem Leib: Leber Magen Nieren Milz, wiegt sie sorgfältig, untersucht ihren Inhalt, lächelt oder seufzt gelegentlich, hantiert überwiegend aber mit großem dokumentarischen Ernst. Und spart sich das noch zuckende und doch so vergeblich schlagende Herz bis zum Schluß auf: Das sieht doch alles verdammt gesund aus, murmelt er; es muß wohl allein der Kopf sein, der hier versagt hat! Dann stopft er – eher achtlos – die Innereien wieder in ihre Körperhöhlen, vernäht die Hautlappen mit einigen groben Stichen, damit der Leib wenigstens bis zur Grablegung einigermaßen zusammenhält, und denkt dabei schon über den Artikel für das medizinische Fachblatt nach, den er noch heute abend beginnen wird. Im übrigen ist der Friedhof meines Heimatstädtchens ja so feucht und reich an Ungeziefer, daß ein frischer Kadaver kaum zwei Wochen braucht, um bis auf die Knochen und ein paar nutzloser Zähne verwest zu sein: Im Grunde könne er da ja schreiben, was er wolle.
Die Fernen in Charleville wollen, da sie mich nun im Besitz eines photographischen Apparates wissen, ein Bild von mir. Doch ich scheue nicht nur den Aufwand und die unnötigen Kosten: Ich bin hier in den Augen der wenigen Europäer wohl schlecht gekleidet, trage immer nur leichtes Baumwollzeug, das man andernorts für die Lumpen eines Vagabunden halten könnte. Die Kälte eines Ardennenwinters könnte ich wohl kaum noch ertragen. Aber würde ich denn überhaupt noch, und sei es auch nur für einen Besuch, in jenes kalte Land zurückkehren wollen?
Auch hier in den Bergen um Harar ist es in den Wintermonaten regnerisch und kalt; trotzdem trage ich aus Gewohnheit nur eine einfache Tuchhose und das hier übliche weite Hemd: daher vielleicht die arthritischen Beschwerden; manchmal trifft es mich wie ein Hammerschlag unter der rechten Kniescheibe, dann fällt das Gehen mir schwer, als sei das Gelenk vollkommen ausgetrocknet und statt mit einem gleitenden Mittel mit Sand geschmiert. Alles geht nunmehr ein wenig langsamer voran, ich hoffe, Sotiro wird es mir verzeihen. Aber das muß ja nicht zum Schaden dieses Unternehmens sein, meist ist es in diesem Land ja die Ungeduld, die den Eiligen ins Verderben stürzt!
Ich komme bereits krank in Aden an. Dubar stellt mich fürs erste als Werkstattleiter ein. So dankbar ich ihm auch bin, die Aufgabe ist nicht gerade erfüllend: die Entgegennahme der Kaffeebohnen, die Megjee Chapsee und Almass von den Arabern in den Bergen um Mokka angekauft haben und die in unseren Handelsräumen von den Frauen der Soldaten aus dem indischen Eingeborenenregiment sortiert und gereinigt werden – aber bald macht sie mir, für mich selbst überraschend, große Freude. Ich muß wenig denken, und die Firmenchefs scheinen mit mir zufrieden, und bald schon spreche ich genügend Arabisch, daß ich meine Anweisungen in dieser Sprache erteilen kann, was mir sogleich eine gewisse Achtung unter den Arbeiterinnen verschafft, auch wenn sie mich fortan Karani nennen, den Bösen: aber ich mache mir nichts daraus, diesen Namen geben sie jedem leitenden Angestellten, mag er sie auch wie seinesgleichen behandeln.
DONNERSTAG, DEN 4. OKTOBER 1883
Der Abstieg von Ober-Egon nach Ballaoua gestaltet sich äußerst schwierig für die Träger, die bei jedem Stein hinschlagen. Ein Teil der Holzkisten ist schon halb auseinandergebrochen, kaum daß wir unterwegs sind, und die Leute sind vollkommen erledigt. Ich versuche, eine Weile zu Fuß zu gehen, wie ich es gewohnt bin, doch bald schmerzt mein Bein derart, daß ich auf mein Maultier steigen muß.
Ein Mann von bescheidenen Ansprüchen wäre mit einem einzigen Dromedar aufgebrochen und hätte seinen Leibdiener oder Treiber hinter sich gehen lassen. Aber ich will auch Djami beritten, obgleich der Junge sich zunächst sträubt; nur so sind wir jedoch zu Gewaltmärschen fähig, sofern die Lage uns dazu zwingt. Und wer weiß, in welchem Zustand wir Sotiro antreffen!
Der Gouverneur will uns zunächst nicht ziehen lassen, ehe wir nicht einige Papiere unterzeichnet haben, daß wir die Rettung Sotiros auf eigene Verantwortung unternehmen und im Falle einer Notlage nicht auf die Unterstützung der ägyptischen Behörden rechnen dürfen. Daß wir darüber hinaus (sozusagen im Vorübergehen) einige Forschungen hinsichtlich der Natur des Ogaden unternehmen wollen, lasse ich unerwähnt. Nachdem der Gouverneur sich derart abgesichert, bietet er uns eine kleine militärische Eskorte an, wohl kaum nur aus Großzügigkeit, sondern zweifellos, um uns zu überwachen und selbst dafür noch zahlen zu lassen. Da vertraue ich doch eher meinem guten Freund Omar Hussein, der mit einigen wehrbereiten Männern am Erer-Fluß zu uns stoßen will. Im übrigen fühle ich mich ohne martialischen Geleitschutz fast sicherer; daß unsere kleine Expedition durch die uns aufgedrängten Gefährten bereits zu einer veritablen Karawane angeschwollen ist und unserem raschen Fortkommen nur hinderlich sein wird, stößt mir bereits gallenbitter auf.
Die angebliche Straße ins Innere ist ungangbar, zumindest für eine größere Karawane. Am besten käme man wohl zu Fuß voran. Die Siedlungen liegen zerstreut und in weiter Entfernung voneinander. Es scheint: als gehöre alles Land hier noch den wilden Tieren.
Was wollen die beiden Stellvertreter Christi nur in dieser Wildnis? Noch haben sie sich ihre Rotwangigkeit bewahrt, aber die wird ihnen die Wüste, das Wechselfieber und die Dysenterie bald nehmen! – und der Rotwein und die Heilige Kommunion werden sie nur noch traurig stimmen.
Ist es wahr, frage ich den jungen Franziskaner, der sich zwischen Djami und mich gedrängt hat, daß der Priester, wenn er die Hostie austeilt, in dem Moment, wo er sie hochhebt und dem Gläubigen in die Augen schaut, seine Gedanken lesen kann?
Pater Maurice schaut einen Augenblick verdutzt, doch dann erwidert er lächelnd: Es kann zumindest nicht schaden, den Gläubigen in diesem Glauben zu lassen.
Natürlich, selig die Einfältigen, denn ihrer ist das Himmelreich!
Seien Sie herzlich zu unserem kleinen Gottesdienst heute abend eingeladen, Monsieur Rimbaud.
Verzeihen Sie, Vater, Sie sollten sich mit derlei Zeremonien zurückhalten, sie gelten den Menschen hier als heidnisch.
Er nickt und reitet eine Weile still und in Gedanken versunken weiter. Er tut mir ein wenig leid: bei soviel Zuversicht, die er ausstrahlt, bin ich mir fast sicher, daß er in diesen Landen nicht alt wird. Er sieht alles hier verkehrt herum: vom Himmel aus betrachtet; die Flüsse fließen hinauf, die Berge tragen Hosen, die Wolken sind von Öllachen überzogen. Aber wenn man über die nötige Technik verfügt, kann man das alles auf- und wegsprengen: ja, er kommt mir wie einer jener Sprengmeister vor, die ich in den Steinbrüchen auf Zypern kennengelernt habe. Man muß nur wissen, wo man das Dynamit zu deponieren hat; und den Leichengeruch aushalten.
Übrigens ist er stark kurzsichtig, wie alle seine Brüder im Geiste, kurzsichtig zumindest, was das Göttliche betrifft.
Offenbar hat Bischof Taurin meinen Rat, Missionare allenfalls nach Bubassa zu entsenden, als Empfehlung und nicht vielmehr als Warnung aufgefaßt: in Bubassa besteht wenigstens die Hoffnung, daß die Patres lebend zurückkehren werden, wenn sie dort auch wohl so wenig wie im übrigen Ogaden irgendjemanden bekehren werden. Ich wüßte auch keinen Sinn darin zu erkennen: entspricht der Islam nicht vielmehr den Sitten und Lebensgewohnheiten der hiesigen Bewohner; darüber hinaus war das Christentum ja nie fern: gibt es in direkter Nachbarschaft doch christliche Königreiche, um Jahrhunderte älter als die abendländischen.
Aber da ich selbst es war, der Bubassa ins Spiel gebracht hat, kann ich die beiden Franziskanermönche nun nicht als einstweilige Reisegefährten zurückweisen, auch wenn Djami, Hadsch Afi und ich in Eile sind. Hadsch Afi kennt den Weg nach Bubassa, kennt die Noblen der Stadt, unsere Firma unterhält dort bereits eine kleine, von Sotiro und mir ins Leben gerufene Niederlassung, die Bewohner sind mit fremden Besuchern einigermaßen vertraut, alles weitere müssen meine Brüder in Christo mit den Bubassarun selbst aushandeln.
Seit fast drei Jahren teile ich die Wohnung über unserem Kontor mit Constantin Sotiro. Fast könnte ich ihn einen Freund nennen, auch wenn er ein äußerst schweigsamer Mensch ist und wir außerhalb unserer Arbeit kaum Zeit miteinander verbringen. Doch ist er mit den Einheimischen zusammen, taut er sogleich auf und palavert mit ihnen ohne Ende: er hockt oder sitzt in ihrer Runde, und nach einer Weile scheint es, als gehöre er dazu, eingebunden in ihr Gelächter, ihren Streit, ihre Berührungen. Verläßt er sie, fällt er rasch in sein gewöhnliches Brüten zurück, als läge ein naher Verwandter von ihm in unserer Wohnung im Sterben.
Ich hingegen, obgleich ich einige ihrer Sprachen inzwischen fast fließend spreche, weiche ihren Zusammenkünften und Geselligkeiten eher aus und verfalle in ihrer Gegenwart in Schweigen; weniger aus Scheu denn aus tiefer Abneigung gegen jede Art belanglosen Geschwätzes. So baut man natürlich kein Vertrauen auf. Bin ich hauptsächlich für die Rechnungsbücher zuständig, so liegt Sotiros Aufgabe im Aufbau und in der Pflege der menschlichen Kontakte.
Mit der Ankunft des katholischen Bischofs bin ich nicht mehr der einzige Franzose in Harar. Die wenigen anderen Kaufleute hier sind vor allem Armenier oder, wie Sotiro, Griechen. Harar gilt als eine der heiligsten Städte des Islam. Erst seit der Besetzung durch die Ägypter ist der Zutritt Ungläubigen, wie ich einer bin, erlaubt, und die Herrschaft Rauf Paschas hat zu weiteren zweifelhaften Freiheiten geführt: Kaffeehäuser, Alkohol und ersten Missionsstationen. Sicher werden andere Kaufleute und Missionare bald folgen. Doch nur der Teufel weiß, was geschehen wird, wenn die ungeliebten Ägypter eines Tages Harar wieder verlassen müssen!
Bischof Taurin Cahagne gibt sich indessen unbesorgt. Er geht wohl schon auf die Sechzig zu, und sein Haar war sicher schon vom Alter gebleicht, zumal er, soweit es eben möglich, die unbarmherzig brennende Äquatorsonne meidet: sein Gesicht ist fast ebenso weiß wie sein Haar, da er tagsüber kaum je sein Haus verläßt und sich auf der Straße stets im Schatten bewegt. Warum ist er, fast am Ende seines Lebens, hierher gekommen, wo es, nicht einmal unter den wenigen Europäern, auch nur einen einzigen Christen gibt und seine Bemühungen, den einen oder anderen doch noch zu bekehren oder in den Schoß der Kirche zurückzuholen, auf alles andere als Gegenliebe stoßen? (Wie wenig verlockend dieser verdorrte Schoß doch ist!) Glaubenseifer kann nicht der Grund gewesen sein: auch wenn er kein geistreicher Mensch ist, besitzt er doch ausreichend Alltagsklugheit, niemandem mit irgendeiner Art von Bekehrungsseifer vor den Kopf zu stoßen. So sind denn auch unsere Gespräche eher von den Schwierigkeiten des alltäglichen Überlebens als von gelehrten Disputen bestimmt und durchaus angenehm; soweit Gespräche mit Landsleuten – gerade in der Fremde – überhaupt je anregend und genußvoll sein können.
Als ich Bischof Taurin frage: wie viele Hararis er schon bekehrt habe, entgegnet er lächelnd: keinen einzigen.
Und was machen Sie den ganzen Tag?
Ich bete und versuche, meinen Glauben nicht zu verlieren.
Gesegnetes Dasein! Rom scheint es wohl nur wichtig, einen weiteren schwarzen Flecken auf der Erdenkarte mit einem apostolischen Vikariat versehen zu haben, mag es auch allein aus dem Herrn Vikar bestehen.
Es gibt Schneider, Sticker und Weber in Harar, Waffen- und Silberschmiede und eine bedeutende Buchbinderei, die das gesamte Land mit dem Koran versorgt.
Mit den Schmieden ist es allerdings eine merkwürdige Sache: Ihnen ist, da sie mit Feuer arbeiten, der Zugang zur Stadt verwehrt. Also verwandeln sie sich des Nachts in Hyänen und dringen, während die fünf Stadttore vom Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung geschlossen sind, durch die weraba nudul, die Abwasserkanäle, in die Stadt ein. Ihre nächtlichen Streifzüge durch die Gassen werden von den Bewohnern geduldet, da sie nicht nur den dortigen Unrat, sondern auch den zurückgelassenen Seelendreck fressen.
Seit einiger Zeit ergänzt indes ein weiterer Europäer unsere abendländische Gemeinschaft: Z., ein Schweizer Ingenieur, der die Bahnlinie von Harar nach Djibouti plant. Mehr noch als die ägyptische Besatzung wird sie dieses Land verändern (falls sie denn je gebaut werden sollte).
Und vor dreißig Jahren soll es einmal einem englischen Abenteurer gelungen sein, als Araber verkleidet in die Stadt zu gelangen. Natürlich wurde er rasch entlarvt und gefangengesetzt. Die älteren Hararis erinnern sich noch gut an dieses denkwürdige Ereignis. Was aus dem leichtsinnigen Mr. Burton geworden ist, wollen sie hingegen vergessen haben oder mir wenigstens nicht mitteilen, vermutlich: um mich nicht unnötig zu beunruhigen. Wahrscheinlich ist sein Kopf wie der so vieler anderer Aufrührer und Eindringlinge auf den Zinnen der Stadtmauer, allen furchtlosen Nachahmern zur Warnung, ausgestellt worden.
Es regnet, als wir endlich in Ballaoua eintreffen, und die ganze Nacht wütet ein scharfer kalter Wind.
FREITAG, DEN 5. OKTOBER 1883
M. Brémonds Kamele weigern sich, die Last aufzunehmen. Er gerät in Streit mit den Treibern, womöglich haben sie sich mit ihren Tieren abgesprochen: Sie verlangen ein höheres Handgeld, da die Waren, die M. Brémond durch den Ogaden schleppen läßt, weit mehr wiegen als abgesprochen. Unmöglich, vor elf Uhr aufzubrechen.
Ich laufe neben meinem Tier. Der Schmerz hält sich in Grenzen.
Jenseits der Gipfel, wo nicht schroffe Granitplatten und steile Felshänge jede Vegetation ausschließen, ist das Gelände zumeist mit Mimosen, Kakteen, Euphorbien und wilden Olivenbäumen schütter bewaldet. Die niederen Böden bilden teils eine mit dicken dornigen Büschen bewachsene sandige Steppe, andere zeigen einen fruchtbaren Grund und werden von den Bewohnern mit Durha und Seifenkraut bebaut. Immer wieder wird das wilde Land von gewaltigen Schluchten aufgerissen, die von den seltenen, dann aber sintflutartigen Regenfällen in die nachgiebige Erde gegraben wurden. Hat ein Fluß nicht seine eigene Quelle, liegt sein Bett in der Dürrezeit trocken.
Pater Maurice erzählt mir, ganz ungefragt, von einem verstörenden Traum, aus dem er am frühen Morgen aufgeschreckt ist: Er habe in einem trüben, nur knietiefen Gewässer eine Schar Kinder – im Traum blieb unklar, ob er nicht selbst gar Erzeuger dieser Schar war – taufen wollen und untergetaucht: und eins nach dem anderen blieb unter Wasser und wurde trotz seiner panischen Suche nicht wiedergefunden. Was dieser Traum wohl besagen wolle? fragt mich der Mönch allen Ernstes. Ich erwidere spöttisch: womöglich habe er von mir und meinesgleichen geträumt.
Wovor sind sie davongelaufen, diese Fremdenlegionäre Gottes? Unter ihnen gibt es zweifellos ebenso viele Schlitzohren, Tagediebe und Bankrotteure wie unter den irdischen Söldnern, mögen meine beiden kuttenbekleideten Gefährten auch eine Ausnahme darstellen und jener Kompanie der wahrhaft Kampfbeseelten angehören; aber ein Kampf so fern der Heimat und ganz und gar ohne Hoffnung auf einen Sieg?
Pater Maurice sprießt gerade erst der Bart: ich ertappe ihn dabei, wie er immer wieder seine zarte Wange und sein beflaumtes Kinn an den Hals seines Maultiers drückt und sie am borstigen Fell des Tieres reibt und mit einer dünnen, düsteren Gespensterstimme seine Psalmen summt. Dann lacht er plötzlich auf, fast lautlos und ein wenig irre. Sein Kopf ist wohlgeformt, doch sein eichelhelles Haar weicht an der Stirn bereits zurück, so daß sie besonders hoch und klug und dem Wahnsinn nah erscheint. Als er meinen Blick bemerkt, gibt er seinem Maultier von nun an einen leichten Schlag, wann immer er es eigentlich liebkosen will: seine Scham ist größer als seine Zärtlichkeit, wie es sich für einen gehorsamen Söldner Gottes gehört.
Ich hocke mich ein wenig abseits des Pfades ins Gras, um meine Notdurft zu verrichten, einer der wenigen Augenblicke des Tages, an denen ich für mich bin und in wirkliche Verbindung mit der Natur, mit dieser Erde komme. Die anderen, das heißt: die anderen Europäer machen sich darüber lustig, daß ich mich selbst zum Urinieren wie die Eingeborenen hinhocke. Die Einheimischen indessen finden (durchaus zu recht), daß nur Hunde im Stehen pinkeln.
Ich studiere den Boden, nur eine Armlänge von meinen Augen entfernt. Zwischen den Halmen rötlicher Sand: eine Karawane großer roter Ameisen bereits im Anmarsch, in Erwartung des frischen Kots, Käfer, Spinnen, Skorpione, Sechs- und Achtbeiner, Geflügelte und Ungeflügelte, Borstige und Fühlerlose, deren Namen ich nicht kenne: was für eine gottverdammte Anmaßung, mich für einen ernstzunehmenden Forscher zu halten! Mag sein, daß noch kein Europäer vor mir auf diesem Flecken Erde seinen Scheißhaufen hinterlassen hat, das aber macht mich noch lange nicht zu einem Magellan oder Cook.
Denken Sie nie an den Tod? – Pater Maurice, zwei Jahre jünger als ich, ist zweifellos die Seele dieses unsinnigen Unternehmens. Er besitzt einige Sprachkenntnisse im Arabischen, die er sich bereits in Frankreich angeeignet hat, und ist darüber hinaus auch in anderen Wissenschaften bewandert, die ihn zu einem förderlichen Ratgeber unserer Expedition hätten machen können, wenn diese Wissenschaften denn das eigentliche Ziel seiner Reise gewesen wären. Im übrigen aber ist er sich nicht zu schade, mit Hand anzulegen, wenn unser beschwerlicher Weg es verlangt.
Indes leidet er seit seiner Ankunft in Harar unter einer sich Tag für Tag verschlimmernden Dysenterie und gehörte eigentlich zur Genesung in die Heimat zurückgesandt. Nur seine kräftige Konstitution und sein Fanatismus halten ihn noch aufrecht.
Ich denke jeden Tag an den Tod! erwidere ich mit unüberhörbarem Spott.
Und diese Gedanken, fährt er mit großem Ernst fort, führen Sie nicht unweigerlich zu Gott?
Diese Gedanken sind rein körperlicher Natur.
Glauben Sie nicht an Gott?
Als Kind habe ich geglaubt, mit Inbrunst, ja Verzweiflung. Aber mit der Kindheit habe ich diesen fast wahnhaften Glauben und jeden anderen abgelegt.
In meinem Leben verhält es sich gerade umgekehrt.
Außer der Angst vor dem Ertrinken scheint der junge Missionsbruder keine Furcht zu kennen. Und in der Tat, so weiß ich inzwischen, ist die Gefahr, der plötzlichen Überflutung eines ausgetrockneten Flußtals in dieser Weltengegend zum Opfer zu fallen, weitaus größer, als von den Zähnen eines Löwen oder Krokodils zerrissen zu werden.
Meine Kindheit war arm, erzählt er weiter: arm vor allem an geistiger Nahrung. Doch das Erwachsenwerden bedeutet auch ein Reifen der Erkenntnis, daß, so reich uns das Leben auch immer beschenken mag, wir doch arm sterben werden, wenn uns nichts als das kalte Grab erwartet.
So wird es am Ende wohl sein.
Erschreckt es Sie nicht?
Natürlich erschreckt es mich. Aber ich lasse mich von diesem Schrecken nicht zurück in die erstickenden Arme der Kirche treiben. Sie weiß von diesen Dingen ebenso wenig wie ich, auch wenn sie etwas anderes behauptet. Ja, ich denke: die Menschen hier wissen mehr vom Leben und Sterben als wir, und anstatt sie bekehren zu wollen, sollten wir ihnen erst einmal zuhören.
Beide Patres reisen, wie es sich dem Gelübde der Armut ziemt, ohne Dienerschaft und haben nur je einen Eselstreiber für einen so überhöhten Lohn gemietet, der zukünftigen Reisenden nicht wenig Verhandlungsgeschick abverlangen wird.
Beleidigt es denn nicht Ihren gesunden Menschenverstand, daß die Eingeborenen hier ihrem Bekenntnis zu dem einen Gott zum Trotz immer noch ihre Fetische, Masken und Rasseln anbeten?
Es beleidigt mich nicht mehr als das Holz, das Rauschgold, die Knochensplitter der Märtyrer und die unzähligen Vorhäute unseres Herrn, vor denen Christen in unseren Kathedralen sich niederwerfen.
Monsieur Brémond hingegen hat sich um so reicher mit allem zu einer beweglichen Haushaltung Nötigem versehen, vom Kissen bis zur Nähnadel, denn alle Bedürfnisse müssen bedacht werden, will man hernach nicht empfindlichen Mangel leiden. Er trägt einen schwarzen Rock und eine lange schwarze Hose aus schwerem Tuch, dazu ein Paar schwarzer, blankpolierter Stiefel. Und neben dem Eigenen an Kleidern, Eßwaren, Arzneien und Waffen führt er nicht weniger als fünf Lastkamele mit Handelsgütern bei sich, haushoch beladen mit Äxten, Sägen, Hämmern und Nägeln, Schußwaffen und Patronen (die hier auch als allgemeines Zahlungsmittel gelten), Stoffe, Perlen und Gewürze, Branntwein und Tabak und vermutlich auch eine Menge Dinge, derer hier niemand bedarf, aber einen geschäftstüchtigen Mann wie ihn zu raschem Reichtum zu führen versprechen.
Eine solchermaßen umfangreiche Karawane dient womöglich dem Schutze des Einzelnen, aber ist der Erforschung der Völkerschaften, ihrer Sitten und Gebräuche und ihrer Lebensumstände gewiß nicht förderlich, diktiert doch die Gemeinschaft und nicht wissenschaftliche Notwendigkeit den Rhythmus der Reise. So marschiere ich nun dahin, Haut an Haut mit Unbekannten, fast schon gelangweilt, wäre der Schmerz in meinem rechten Bein nicht, die ledrigen, leicht säuerlichen Gerüche, die sehnigen Bewegungen der Träger, nackt, barfuß, schweißglänzend, während mir das schweißnasse Hemd am mageren Leibe klebt und mein Schuhwerk im Dreck versinkt. Das Einerlei der Landschaft (was gibt es hier zu erforschen?); als wären wir beständig in einen Nebel aus Staub gehüllt. Vielleicht wäre es anders: wenn sie mich zurückließen, oder ich sie; dann könnten sich meine Augen an das trübe Licht gewöhnen und sehen, wohin ich den Fuß setze. Vielleicht könnte ich dann sogar wie sie, die Träger und Treiber, barfuß gehen und nackt und würde weniger schwitzen und weniger hinken; das mich plagende Knie wäre nur ein Schmerz unter anderen. Stattdessen verfluche ich diese Wildnis: Kein Wort bringt sie mir näher, kein Name, die rote Erde stinkt so sehr nach Pisse und Verwesung, daß ich mich selbst nicht mehr rieche. Ich schreie den armen Djami an, gebe einige unsinnige Befehle, damit mir der Zweck dieser Reise nicht abhanden kommt: die Rettung Sotiros; der Bericht für die Geographische Gesellschaft.
Natürlich sollte auch Sotiro die Augen offenhalten und soviel wie möglich über dieses noch unbekannte Gebiet in Erfahrung bringen. Aber vor allem sollte er seine eigentliche Aufgabe nicht aus den Augen verlieren: die Erschließung neuer Handelsquellen, Gummi, Elfenbein, Moschus, und neuer, gewinnbringender Handelsniederlassungen für die Gebrüder Bardey. Er reist, wie auch zuvor schon, in der landesüblichen Tracht unter dem Namen Hadsch Abdallah und nur in Begleitung seines Dieners, Hadsch Afi; er kennt sich mit den hiesigen Gebräuchen aus und ist sogar mit dem Koran vertraut, so daß man ihn gemeinhin für einen wodad, einen islamischen Gelehrten hält.
Aber im Ogaden gibt es nicht nur Stämme, die mit den Bewohnern der heiligen Stadt Harar den Glauben an Allah teilen, sondern auch noch jene, die Bäume, Berge oder Fabelwesen anbeten und in den Mohammedanern nur Besatzer und Sklavenjäger erkennen wollen. Sie sind Fremden so feindlich gesinnt, daß sie auch Perlen, Porzellan oder anderer abendländischer Flitter nicht verführt. Womöglich ist der infame Mkuënda einer von ihnen. Seine Götter mögen ihm gnädig sein, sollte er Sotiro etwas angetan haben!
SAMSTAG, DEN 6. OKTOBER 1883
Nächtliches Gewitter. Wir können den Fluß nicht überqueren. Es regnet sechzehn Stunden, ich verbringe die Zeit in meinem Zelt, fürchte um die Apparate. Nicht alle Kisten finden im Trockenen Platz. – Das Essen bleibt heute kalt.
Ich hätte nicht zulassen dürfen, daß sich M. Brémond mit seinen überladenen Kamelen unserer Karawane anschließt, um seine zweifelhaften Waren in den Dörfern des Ogaden zu verhökern oder gegen Felle und Elfenbein zu tauschen. Er hat ein Dutzend Träger angeheuert, die unsere Reise nicht nur schrecklich verlangsamen, sondern auch allenthalben für Schwierigkeiten sorgen, denn Brémond ist kein Dienstherr, wie man sich ihn wünscht, sondern ein wahrer Menschenschinder. Im Grunde betreibt er nur dasselbe Geschäft wie Bardey & Co., indessen ohne den Mut oder den Ehrgeiz, feste Niederlassungen zu gründen. Er sucht allein den raschen Gewinn, ehe die Einheimischen bemerken, daß dieser Hausierer sie mit ihren Glasperlen übers Ohr gehauen hat.
Aus schierer Langeweile (vielleicht auch Mordlust) will M. Brémond sich offenbar auf Hyänenjagd begeben, obgleich unter den Einheimischen ihr Fleisch als ungenießbar gilt. In Harar läßt man sie in Frieden, nicht nur, weil sie die Stadt von Aas und Unrat reinhalten, sondern weil viele Hararis – ihres Glaubens an den einen Gott und seinen Propheten ungeachtet – die Hyänen für verwandelte Menschen, für Zauberer oder Marabus halten. Solche Hexenmeister, so ihre Überzeugung, könnten allein durch ihren bösen Blick das Blut in den Adern eines Angreifers gefrieren, das Herz ihrer Feinde stillstehen und seine Eingeweide austrocknen lassen.
M. Brémond gibt nichts auf diesen Aberglauben, doch keiner seiner Bedienten oder Sklaven will ihn auf seiner Pirsch begleiten. Selbst Djami schaut beunruhigt
Indessen hält es M. Brémonds edles Reitkamel für angemessen, mit seinem gewichtigen Reiter durchzugehen und ihn in einem eine Viertelmeile entfernten Kakteenfeld abzuwerfen.
Nun sucht er Zuflucht in meinem Zelt und jammert mir die Ohren voll: Daß man bei all der Niedertracht und dem Ärger nicht auseinanderfällt! Eine Rotte aufsässiger, nichtsnutziger und nur auf ihren Vorteil bedachter Hunde sind diese Träger und Treiber! Scheuen kein Mittel, ihren Herrn und Brotgeber zu übervorteilen! Jedes freundliche Wort, das man ihnen gönnt, wird benutzt, um neue Forderungen zu stellen, jedes Lächeln als ein Zeichen von Schwäche angesehen. Mir scheint, dieses Gesindel ist zu keiner höheren Regung fähig. Nie Zufriedenheit, nie Arbeitseifer, nur Streitlust und Faulheit …
Djami sitzt an meiner Seite, läßt sich aber nichts anmerken von dem, was Antoine Brémonds Tirade in ihm auslöst. Was erwartet Brémond von seinen Trägern und Treibern: Männer, manche Knaben noch, die allein aus Zwang oder durch ihre Angehörigen gedrängt ihrer Heimat entrissen sind und diese schwere Arbeit zu leisten haben; die in unbekannte, furchterregende Regionen geführt werden und unsere Ziele und Zwecke nicht verstehen können, da wir uns nicht einmal die Mühe geben, sie ihnen erklären zu wollen?
Doch nicht nur ihr inneres Gleichgewicht ist gestört und ihre Gesundheit zerrüttet, auch Brémonds Kräfte schwinden, sein Haß gegen dieses Land und seine Bewohner nimmt ein unglaubliches Maß an: Sie trügen an allen Unfällen und Mißerfolgen die Schuld, als ob der reisende Kaufmann alles so behaglich und geebnet für seine Handelsreise vorfinden müsse wie daheim in der Bretagne. Ist es diese Art von Geschäft, die einen Ehrenmann am Ende zu einem Geschäftsmann macht? Möge Djami mich in Ketten legen und in die Sklaverei verkaufen, sollte ich je ein weiterer Brémond werden!
Brémond bekennt, daß ihm einige, längst verheilt geglaubte Geschwüre an delikater Stelle durch den langen, ungewohnten Aufenthalt im Sattel erneut zu peinigen begonnen hätten, außerdem mache ihn das unerwartet kalte und feuchte Klima hier in den Bergen zu schaffen: und tatsächlich wirkt sein Gesicht ein wenig fiebrig. Das erklärt allerdings, daß ihm jeder Zank und Lärm zum Aufruhr wird, der seine herausgeforderte Gesundheit noch mehr reizt.
Tatsächlich ist es wohl so: nicht nur Antoine Brémond, sondern alle in Abessinien ansässigen Europäer, so gering ihre Zahl auch sein mag, und selbst viele Ägypter und Osmanen hegen gemeinhin recht abfällige Ansichten über die Afrikaner. Wo immer ein ägyptischer Söldner zu Schaden kommt, ist die Rache der Besatzer schrecklich: der Ort des Geschehens – ganz gleich, ob die Bewohner unmittelbar beteiligt waren – wird mit Feuer und Pulver dem Erdboden gleichgemacht, und allen, die vor der Strafexpedition nicht rechtzeitig fliehen konnten (vornehmlich die zurückgelassenen Säuglinge, Schwangeren und Greise) werden niedergemacht und die geschändeten Leichen zur Warnung auf der blutgetränkten Erde liegengelassen. Das ist der Boden, auf dem wir unsere Geschäfte tätigen.
Vor allem verhärtet sind die Händlerseelen, und ich selbst spüre ja nicht selten die Ungeduld und den Ärger angesichts der Trägheit und Bequemlichkeit vornehmlich der Männer hier. Aber niemals würde ich einem Angestellten oder Hausdiener, der ein wenig Tabak oder Baumwollstoff gestohlen hat, die Ohren abschneiden, wie ich es gelegentlich an der Küste bei den Händlern gesehen, oder einen jungen Mann eigenhändig kastrieren, weil er eine europäische Frau (von denen es in Harar indessen noch keine gibt) zu lange angesehen, wie es hier unter Ägyptern und Osmanen durchaus üblich ist. Der Stock und die Peitsche fehlen in keinem Herrenhaushalt. Und auf der Überfahrt – ich habe es mit eigenen Augen beobachtet – wurden gefangengenommene Piraten einfach mit gefesselten Händen über Bord geworfen. Schon in Aden hieß es, wenn auch nicht aus dem Munde Bardeys oder seines Bruders, daß die Neger Güte am allerwenigsten verstünden. Was wäre mein Alltag in Harar ohne Djami?
Ein großer Teil der Bevölkerung Harars ist sehr arm, und die Bedingungen haben sich durch die ägyptische Besatzung noch verschärft, da der Handel mit verschiedenen Regionen des Hinterlandes abgebrochen ist. Die neuen Freiheiten bedeuten noch keinen Zugewinn an Wohlstand: so sind denn nicht nur die Armen unzufrieden mit den neuen Herren aus dem Norden.
Schon wenige Tage nach meiner Ankunft fällt mir der Junge ins Auge, schwarz wie poliertes Ebenholz, vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahre alt, den alle Welt Djami ruft. Hin und wieder kommt er in unser Kontor, um Sotiro im Lager zu helfen, und ist schon dankbar, dafür nur mit uns speisen zu dürfen. Er sieht recht verhungert aus und trägt an seinen Beinen und womöglich auch an anderen Körperstellen, die durch sein langes Hemd verborgen, viele Narben und frische Wunden des Sambok, der langschwänzigen Peitsche aus Flußpferdhaut. Sotiro hat über ihn bereits in Erfahrung gebracht, daß er von seinem Stamme weit im Westen entführt wurde, noch bevor die Ägypter das Land besetzten und den Sklavenhandel verboten. Eigentlich sei er, den neuen Gesetzen nach, ein freier Mann. Aber die Witwe seines ehemaligen Herrn, unsere Nachbarsfrau, die Sotiro anfänglich für Djamis Mutter gehalten, erweise sich als noch grausamer als ihr Gatte und betrachte den Jungen nach wie vor als ihr Eigentum. Für sie sei er vor allem ein unnötiger Esser, und wären die Ägypter nicht, hätte sie ihn längst verkauft.
Ich gehe hinüber zu dem mürrischen Weib und sage ihr: Du hast da diesen Jungen, Djami, der uns des öfteren zur Hand geht. Er hat sich als recht anstellig erwiesen. Würdest du gestatten, daß er in meinen Dienst tritt? Ich könnte einen verständigen Burschen wie ihn gut in unserem Kontor gebrauchen.
Er ist ein fauler und verschlagener Kerl, Sahib, und er hat mich in den vergangenen Jahren unzählige Mahlzeiten gekostet.
Ich brauche durchaus einen schlauen Burschen; und die Faulheit werde ich ihm schon austreiben, uchti.
Meinetwegen nimm ihn, wenn du mir das eine oder andere Geschenk gibst. Der Junge hat mir ja nur Unkosten bereitet.
Ich bringe ihr zwei Baumwolltücher, eine Schere, Nadeln und Zwirn, und da sie noch immer ein mißmutiges Gesicht zeigt, lege ich zwei Schnüre mit Glasperlen dazu.
Gut, sagt sie endlich: aber bring mir den Knaben nicht zurück, wenn er sich als Nichtsnutz und Schmarotzer erweist.
So ist Djami zu mir gekommen. Abgesehen von der Meidung gewisser Wörter darf man diesen Tausch durchaus als Menschenhandel begreifen.
Auch wenn Djami sich nur noch an wenige Dinge vor seinem Raub erinnert, so entstammt er doch einer noblen Familie, beherrscht vielerlei Sprachen und die Jagd- und Kriegskunst. Nur im Rechnen braucht er einige Nachhilfe, die ich ihm gerne gewähre. Dabei zeigt er eine Ergebenheit, die am Anfang wohl vor allem der Dankbarkeit geschuldet ist, ihn von der unwirschen Witwe fortgenommen zu haben.
Ich weise ihn an, seine Sachen aus dem Nachbarhaus zu holen und in die Kammer zu bringen, die er nun in unserer Wohnung beziehen soll. Er erwidert: daß er nichts besitze als jene Fetzen, die er am Leibe trage. Ich gebe ihm einstweilen einige Kleidung von mir, die ihm auf Anhieb paßt, da er groß gewachsen, bis er sich von seinem ersten Lohn nach eigenem Geschmack und Vermögen selbst einzukleiden vermag.
Nach der Arbeit verbringt jeder seine Zeit, wie er will. Aber in Harar gibt es wenig zu tun außer zu lesen und zu träumen. Im Sommer ist die Hitze ungeheuer groß, selbst in der Nacht kühlt es dann kaum ab. Sicher, Aden war noch unerträglicher: Nicht einen Tropfen sauberes Wasser findet man auf diesem kargen Felsen, man trinkt dort destilliertes Meerwasser; kein einziger Baum, kein Strauch, kein Grashalm wächst in diesem Vulkankrater. Wer nicht dort war, kann sich diesen Ort nicht vorstellen: die dunklen, schroffen Kraterwände lassen keine frische Luft hinein – so brennen die Bewohner auf dem Grund dieses Schlunds wie in einem Ziegelofen.
Doch am Ende mochte ich dieses höllische Klima fast: Regen, Morast und Kälte und das satte Grün der Ardennen waren mir immer ein Greuel. Täglich verliere ich den Geschmack an den Lebensweisen und Umgangsformen, ja selbst den Sprachen Europas ein wenig mehr. Hier geht es mir gut, auch wenn man hier schneller altert als unter der milderen Sonne des Nordens. Mit jedem Augenblick wird mir ein Haar weiß. Da es nun schon so lange geht, fürchte ich, bald einen Kopf wie eine gepuderte Perücke zu haben. Dieser Verrat meiner Kopfhaut ist in der Tat sehr betrüblich, aber was kann ich dagegen tun?
Nachdem M. Brémond endlich gegangen ist, versuche ich mich an einigen ersten Notizen für den Rapport: Große Expeditionen benötigen sehr viel Gepäck. Und viel Gepäck bedeutet viele Lasttiere oder Träger, die wiederum unterwegs versorgt werden müssen. Oftmals stehen die genaue Route und das Ziel der Expedition nicht fest, und kein Träger oder Treiber verpflichtet sich gerne für ein unbekanntes Ziel oder eine unbestimmte Zeit. Viele Reisende haben dabei nicht nur ihren Weg und ihr Hab und Gut, sondern auch ihr Leben verloren.
Wir versuchen, mit möglichst wenig Gepäck und in einer kleinen Gruppe vertrauenswürdiger Gefährten zu reisen. Das mag bei Überfällen nicht der beste Schutz sein, aber erfahrungsgemäß beginnt die Zersetzung einer Expedition von Innen her.
Die Häuptlinge und Scheichs sind es inzwischen gewohnt, daß man ihnen Geschenke macht, Stoffe, Perlen, Gewehre, Pulver und Blei, aber das größte Geschenk, daß man ihnen machen kann, ist die Achtung, die man ihnen entgegenbringt. Sie wiegt leicht und ist doch ungleich kostbarer als alle Perlen und alles Blei.
Obgleich die Ägypter und die Engländer den Überseehandel mit Sklaven weitgehend unterbunden haben, ist die Sklaverei und der Menschenhandel unter den afrikanischen Stämmen immer noch weit verbreitet, daß man fast annehmen muß, sie seien ein unausrottbarer Teil ihrer Kultur. Indessen gäbe es keinerlei Karawane, weder von einheimischen noch von europäischen Händlern, wenn die überwiegende Zahl von Trägern nicht zu diesem Dienst gezwungen würde, denn der Lohn ist gering und die Arbeit außerordentlich schwer. Wäre die Sklaverei tatsächlich ausgemerzt, würde kein Kaufmann mehr genügend Träger anwerben können, und jeglicher Handel käme zum Erliegen.
Die Nacht ist so hell, daß ich mein Gedanken- und Forschungsjournal allein im Licht des Mondes schreiben kann. Die Gefährten sitzen in verschiedenen Gruppen um ihre Feuer herum, rauchen ihre Tschibuks (Pfeifen) oder kauen – wie die Somalier – ihren Tabak. Djami, Hadsch Afi und ich bilden eine Gruppe für uns. Hadsch Afi ist der einzige, der ein waches Auge und Ohr auf unsere Reit- und Lasttiere wahrt.
Obgleich wir so weit wie möglich von Brémonds Kamelen entfernt lagern, hindert es die Zecken nicht daran, in langer Karawane zu uns zu marschieren und vom Grund der Zehen an den Aufstieg in weniger verhornte Regionen zu wagen, dort ihre Kiefer in unsere vom Schweiße aufgeweichte Haut zu schlagen, so tief, bis sie auf die subkutanen Ströme unseres schwergewordenen Blutes treffen, sich daran laben und mit ihm aufblähen, ehe wir ihnen den prallgefüllten Leib vom Kopfe drehen und letzteren mit unseren schmutzigen Fingernägeln aus unserem Fleisch zu pulen versuchen. Normalerweise gehen Kamelzecken nicht auf Menschen, aber M. Brémond läßt seine Tiere so sehr darben, daß es selbst für Zecken kaum noch etwas zu saugen gibt. Die Einheimischen versichern uns, daß es außer den schmerzhaften Bissen und den noch lange sichtbaren Blutergüssen von den Bissen der Kamelzecke nichts weiter zu fürchten gebe. Vor den Menschenzecken indessen sollten wir uns hüten. Aber dieser besonderen Warnung hätte es nicht bedurft: hat doch jeder Abendländer unter uns seine eigenen Erfahrungen mit vielerlei Ungeziefer gemacht, welche das nahe Zusammenleben unweigerlich mit sich bringt. – Bei manchen tritt das Menschliche erst Tieren gegenüber in Erscheinung.
SONNTAG, DEN 7. OKTOBER 1883
Ein klarer Quell tritt zwischen den riesigen Granitblöcken zu Tage, ein fast undurchsichtiges Dickicht säumt das Bachbett, hohe Bäume: namentlich Sykomoren, verleihen ihm Schatten und lassen nur wenige Sonnenstrahlen auf sein Wasser treffen. Das Licht blitzt und glitzert in den Baumkronen, Tausende von Vogelstimmen untermalen das Lichterspiel, die Rufe der Glanzdrossel und des Würgers, das dumpfe Heulen der Helmvögel, das Girren und Gurren der Wildtauben: hier, in dieses schattige Dunkel haben Djami und ich uns zurückgezogen.
Einer der merkwürdigen Umstände in der Fremde ist, daß Landsleuten, die man in der Heimat nicht zu kennen wünschte, geschweige denn mit ihnen das Lager teilen wollte, hier plötzlich in einer unnatürlichen Nähe zueinander stehen. In der Wüste oder im menschenleeren Dschungel ergreift man selbst vor den gräßlichsten Zeit- und Sprachgenossen nicht die Flucht, sondern rückt gar eng zusammen.
Wissen Sie, was das Geheimnis eines guten Geschäftsmannes ist, mein Guter? versucht Brémond mich ins Gespräch zu ziehen: Man darf das Geschäftemachen nicht als Kunst betrachten; man darf nicht glauben, eine Idee sei nur für eine bestimmte Form geschaffen und könne nicht zweierlei Zwecken dienen. Wenn man Erfolg haben will, muß der Geschäftsfreund glauben, er allein sei der Herr dieses Erfolgs; er muß die Verhandlungen vorausahnen und annehmen können und glauben, er habe sie selbst in genau diese Richtung gelenkt.
Ist das nicht große Kunst?
Das ist Menschenkenntnis, das ist strategisches Geschick! ruft er mit hervorquellenden Augen aus, die Arme zu einer theatralischen Umarmung erhoben, auch wenn es außer meiner skeptischen Zuhörerschaft kein weiteres Publikum zu umarmen gibt.
Wenn ich irgendetwas wirklich verabscheue in dieser Weltgegend, fährt er vertraulich fort, dann ist es der Umstand, fast ständig nur unter Männern zu sein. Haben Sie die Dorfmädchen gesehen? Diese leuchtenden Augen, die gleich Licht und Wärme in diese kalte, dunkle Schwärze bringen! Ein Zauber, eine Schönheit, eine Morgenröte! Man möchte wieder an Engel glauben.
Da ich schweige, rückt er noch näher, als könne ich ihn nur nicht richtig verstanden haben: Eine reife Frau mag ihre Vorzüge haben, aber mit der himmlischen Unschuld eines jungen Mädchens ist nichts vergleichbar, finden Sie nicht auch? – Ich höre seine Stimme nicht nur, ich beginne sie zu riechen.
Ich habe da eine aus vielfältiger Erfahrung gewonnene Theorie und würde gerne, so von Mann zu Mann und unter uns, von Ihnen wissen, was Sie davon halten: Meiner Ansicht nach kann ein Mann nur wahre Lust mit einer Frau empfinden, die tief unter ihm steht. Denn mit einer schicklichen Frau, vor allem mit der eigenen, bleibt doch immer eine gehörige Portion Scham, die ihn vom Äußersten abhält, nicht wahr?
Ist das der eigentliche Grund, warum Sie hier im tiefsten Afrika Ihren Geschäften nachgehen?
Es wäre nicht der übelste, mein Guter, wenn unsereins denn die Wahl hätte, über die Nischen selbst zu befinden, die noch einigermaßen Erfolg versprechen. Aber wenn sich das Notwendige mit dem Amüsanten verbinden läßt, wäre ich der Letzte, der dieses glückliche Zusammentreffen ausschlüge. Hier muß man sich in der Tat nicht genieren: hier kann man sich den Liebesakten hingeben, wie man daheim in der prüden Provinz Holz spaltet.
Ich werfe einen verzweifelten Blick auf Djami, auf daß er mich aus diesem Gespräche rette, aber Djami gibt vor, von meiner Verzweiflung nichts zu bemerken (Landsleute unter sich! da darf man nicht stören, mögen die Gegenstände auch jeder Vernunft entbehren), also fährt Brémond ungerührt fort: Übrigens, werter Kollege, nehmen Sie es mir nicht übel, aber nach meinem Dafürhalten – und hier spricht jemand, der nach Jahren ja durchaus fast Ihr Vater sein könnte – scheint mir Ihre Liaison mit ihrem Domestiken für die hiesigen Verhältnisse unangemessen vertraulich. Das korrumpiert die Einheimischen nur und führt zu falschen Schlüssen und am Ende nur allzu rasch zu Aufsässigkeit und Eigensinn.
Ich bin zu verblüfft, um M. Brémonds Unverschämtheit gleich in aller Schärfe zurückzuweisen, und erwidere nach einem längeren schuldbewußten Zögern nur: Mir scheint das Wort Liaison in diesem Zusammenhang vollkommen unangebracht, Monsieur Brémond.
Wie dem auch sei: Sie sind zu gut; Sie lassen sich zu rasch erweichen, zu rasch täuschen; doch mit diesen Menschen darf man nicht zu gütig sein, sie legen es ihrem Herrn als Schwäche aus. Schauen Sie sich den Burschen an! schleicht jetzt schon gekrümmt wie unter der Furcht von Hieben daher, mit humpelnden Schritten, denen man das Gewicht der Sträflingskugel bereits anmerkt, immer im Schatten sich drückend, auf der Seite der Nacht.
Wer weiß, was er in seinen jungen Jahren schon hat erleben müssen!
Einem guten Wesen können die Schläge des Daseins nichts anhaben, sowenig wie Wohlwollen und Zuwendung den niedrigen Instinkten eines Galgenvogels Einhalt gebieten.
Das sind die Vorurteile eines Mannes, der seine Gesundheit allein mit Völlerei und Unzucht ruiniert hat. Aber Brémond hat Unrecht: ich bin kein gütiger Herr, bin nicht blind für die Schwächen und Abgründe anderer, lasse mich nicht leicht täuschen, ja bin meinem Wesen nach ein zutiefst argwöhnischer Mensch, der hinter allem Guten, das ihm widerfährt, stets eine opportunistische, wenn nicht gar böswillige Absicht wittert.
Wie habe ich mit Sotiro über Djamis Häßlichkeit, Dummheit und fehlende Anmut gespottet: Mir selbst gegenüber hätte ich mißtrauisch sein sollen. Er kennt alle meine Gewohnheiten; ist mir unwohl, bin ich krank, weiß er das Heilmittel oder findet zumindest die richtigen Worte. Er ist bereits jetzt ein fast unentbehrlicher Teil meines Lebens, voller Zärtlichkeit, Ergebenheit, aber auch Wachsamkeit und Stolz. Letzteres ist der einzige Grund, warum ich ihm nicht alles sage, nicht alles anvertraue. Sein Stolz ist mir ein Vorbild. Djami ist eines jener raren Geschöpfe, von denen man hofft, daß sie einem einmal am Ende des Weges die Hand halten und die Augen zudrücken werden.
Aber ich will Ihnen auf gar keinen Fall zu nahetreten! – Selbst ein Antoine Brémond spürt, daß er die Grenze des Schicklichen übertreten hat: Wer ohne Sünde ist, der – ach, Sie wissen schon, mein Guter!
Kann man einem derartigen Schmierenkomödianten wirklich böse sein? Ich erwidere sein versöhnliches Lächeln mit einem nicht weniger schmalzigen und wundere mich, wie leicht sich nach all den Jahren der Askese mein Gesicht noch diesbezüglich verformen läßt.
Feist, rotwangig, wohlgenährt wie die Zoten Rabelais’, bei näherem Hinsehen aber blutleer wie die Prosa de Sades: obgleich einige Jahre jünger, erinnert mich M. Brémonds Gesicht an das der Päpstin; aber damit endet die verwandtschaftliche Nähe auch schon: eine Landfrau, die in die Stadt eingeheiratet hat, sich städtisch kleidet und urban gibt, doch ihren bäuerlichen Argwohn und Geiz nie abgelegt hat. Von ihr habe ich den nüchternen Verstand, die Menschenverachtung, die Kränkbarkeit und die Habgier.
Ihre größte Angst war: ich könnte so enden wie ihre Brüder: der eine, der Afrikaner, ging mit siebzehn nach Algerien, wo er nach einem unsteten und glücklosen Leben kaum dreißigjährig starb; der andere war ein Prasser und Säufer, der am Ende als Vagabund auf der Straße landete. Indes waren alle ihre Ängste begründet, und die Gewalt, mit der sie mich den Tugenden der Provinz zu unterwerfen versuchte, war wohl vergeblich. Hier bin ich nun: auf dem Weg in mein Afrika.
Nur daß ich noch als Gymnasiast einen Mädchenhaarschnitt trug, hat sie nicht gestört. Wieviel Trotz und Spott hätte sie mir ersparen können, hätte sie die Männer nicht derart gehaßt! Dieser dunkle Mund der Pflicht, steif und blau vor Stolz, die Seele der Seele ihres Sohnes, der schon ganz verschimmelt war vor lauter Heuchelei und unterdrückten Tränen; der sich in die Frische der Latrinen flüchtet, wo er hingehört mit weit geöffneten Nüstern: hängt den Eingeweiden, den Seelendüften nach, leckt sich die gelben und braunen Schlammfinger ab, die ungehorsamen, wie ihre strengen blauen Augen doch lügen: der Vater tot! gestorben vor fünf Jahren in einer fernen Garnisonsstadt!
Und endlich klappt die Päpstin das Schuld- und Sündenbuch zu, unzufrieden mit dem verstockten Sohn, unter dessen pockennarbiger Stirn Ekel und Auflehnung rumoren; sie weiß es, sie sieht es: hat er nicht ihre kalten blauen Augen?
Hier träumt er von Schwärze, Sonnenglut, träumt von schwarzer Liebe und Savannenflaum.
Ist es der Tod ihres Vaters oder der Abschied vom Hauptmann, der die Päpstin fortan nur noch Schwarz tragen läßt, als sei sie bereits Witwe? Das Grab ihres Vaters ist kaum zugeschüttet, da zerrt sie mich allein auf den Friedhof, auch ich ganz in Schwarz gekleidet. Sie hat nicht nur ein Grab für den Großvater gekauft, sondern (vielleicht weil es billiger war) eine ganze Familiengruft. Immerhin schien ihr diese Ausgabe so verschwenderisch, daß sie unsere schöne Wohnung in der Grand Rue aufgab und uns alle in eine nur halb so große Unterkunft ins Arbeiterquartier von C. umzuziehen zwingt. Das hätte für mich und meine Geschwister auch ein Glück sein können: hätten wir nur mit den armen Nachbarskindern spielen dürfen!
Sie bittet den Totengräber, neben Großvaters Ruheplatz ein weiteres Grab auszuheben: Hilf mir hinein! fordert sie mich auf. Ich fürchte mich, hier auf dem Friedhof, nicht vor den Toten, ich fürchte mich allein vor ihr, der Päpstin. Du wirst dich schmutzig machen, sage ich zaghaft.
Mag sein, mein Sohn, aber es wird die Seele reinigen.
Es gibt zwei kleine Mäuerchen aus Backsteinen, auf die ihr Sarg gestellt werden soll. Sie schickt mich nach dem Totengräber und zeigt ihm genau, wo sie liegen möchte. Bevor man den Stein, der Tür genannt wird, am Eingang zumauert – er ist gerade fünfzig Zentimeter lang, so daß man den Sarg eben hineinschieben kann –, will sie alles noch einmal ganz genau betrachten. Der stumme Totengräber läßt sie ganz vorsichtig bis ans Ende der Grabkammer kriechen.
Nun komm auch hinab, Junge! höre ich dumpf ihre Stimme aus der Grube: leg dich zu mir! Hier werden wir dereinst alle ruhen, ich zwischen meinem Vater und meinen Söhnen.
MONTAG, DEN 8. OKTOBER 1883
Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir zunächst geblendet, weil wir zuviel sehen. Wir müssen lernen, die Augen zu schließen und weniger zu sehen, um überhaupt etwas zu sehen. Ja, sehen lernen heißt im Grunde: immer mehr aus unserem Sichtfeld auszublenden und nicht zu sehen. Unterstellen wir nicht deshalb den Blinden, mehr zu sehen als alle Sehenden zusammen?
Vielleicht gilt das auch für das Sprechen: um sprechen zu lernen, muß man alle anderen Sprachen vergessen, die ein Neugeborenes noch zu sprechen in der Lage ist.
Nach dem Erwachen (ist das gestrige Gespräch mit Brémond schuld?) plötzlich das zweifelhafte Verlangen, mit einer Frau zusammenzusein, nicht der Erfüllung eines geheimen Begehrens, sondern einfach ihrer Gesellschaft wegen. Das Leben in Harar (und um wieviel mehr auf dieser Reise) entbehrt nun doch zu sehr aller Weiblichkeit. Vor allem spüre ich den Trübsinn und das enttäuschte Verlangen der anderen.
Ich selbst versuche hier womöglich das Hauptübel meiner Kindheit zu heilen: Nie hat die Päpstin mich mit Knaben meines Alters verkehren lassen; fast wäre ich zu einem großen Duckmäuser geworden, denn selbst in den Schulpausen blieb ich allein oder in Gesellschaft meiner Schwestern. Indes las ich bereits den Don Quichotte, während meine Kameraden noch Mühe mit dem Entziffern der ABC-Fibel hatten. Wenn es etwas zu lachen gab, so habe ich es für mich behalten. Die Päpstin hätte mir den Cervantes – zu Recht einigen gottlosen Unrat witternd – sofort aus den Händen gerissen. Im Grunde habe ich, seit der Hauptmann uns verließ, nicht mehr gelacht.
Nie haben wir ein Nachbarskind zu uns nach Hause eingeladen; nie durfte ich einen Klassenkameraden zu Hause besuchen. Verständlicherweise blieben die Einladungen bald gänzlich aus. Hier im Ogaden kann der Reisende nicht überleben, wenn ihn die Bewohner nicht gelegentlich an ihren Herd laden. Von den ersten Fußmärschen an war mein Reisen wohl immer auch eine Suche nach Gastfreundschaft.
Die tote Schwester steigt die Treppe hinab, dann geht sie den Bahnsteig entlang, die Bremsen der Lokomotive kreischen, hat man sie nicht aufrecht in der Friedhofsmauer beigesetzt? Der Hauptmann ist im Süden geblieben und zur Totenfeier nicht gekommen. Seitdem er fortgegangen ist, hat die Uhr im Speisezimmer nicht mehr geschlagen. Er hat den Schlüssel mitgenommen. Immer ist es jener, den man liebt, der einen am Ende davonjagt.
Ich habe keinen von ihnen geliebt; weiß nicht, warum ich mir die schönen Mädchenlocken, die alle so verachtet haben, abrasiere; stehe fröstelnd am Straßenrand, wollte, ein Fuhrwerk hielte an und der fremde Mann hieße mich einsteigen. Der Weg ist lang, die Luft im Innern der Kalesche steht, der Fremde mustert mich, wie man eine Dirne mustert, ich grinse wie ein Idiot: wann öffnet er endlich den Gürtel, wann zückt er das blitzende Messer? Die Reise ist endlos. Monströse Nacht.
Von einem Pfad kann keine Rede mehr sein; es ist: als kletterten wir auf allen vieren zum Paß hinauf. Jeder Kameltreiber hält sich dicht bei seinem Tier und beruhigt und ermutigt es mit einem jeweils eigentümlichen Gesang. Und die Tiere lauschen und lassen sich von der Melodie und dem Rhythmus seiner sanftmütigen Sirene lenken. Sie scheinen die im Gesang verborgenen Befehle genau zu verstehen und setzen, selbst wenn sie mit eigenen Augen den Steig nicht sehen können, ihren Fuß dorthin, wo ihr Treiber einen sicheren Halt vermutet. Mögen diese wundersamen Tiere auch für das Durchqueren heißer sandiger Ebenen hervorragend gerüstet sein: für das Erklettern von steilen steinigen Pfaden mit nachgebendem Geröll sind sie nicht geschaffen. Und wir – weder dem einen noch dem anderen angepaßt – was haben wir in dieser rauhen Gebirgswelt zu suchen? Verletzlich sind wir und allein im Schweigen der Berge.
Wir reiten durch unbewohnte Erde, eine Totenlandschaft, aber die Toten schlafen noch. Sie zeigen sich erst, wenn die Sonne im Mittag steht.
Hin und wieder stoßen wir auf die verlassenen Hütten der Hirten, vom Licht ausgelaugt, das umliegende Gras verdorrt, das Gebüsch laublos. Also sind sie mit ihrem Vieh weitergezogen. Manchmal wohnen sie mit ihren Schafen und Ziegen zusammen auch in Höhlen: außer dem Licht muß man sich in dieser Jahreszeit auch vor dem Regen schützen. Der Wind weht unregelmäßig, aber gelegentlich heftig, ein eigensinniger, mal kalter, dann wieder heißer und staubiger Wind aus dem Innern des Kontinents. Mit seinen haarfeinen Geißeln peitscht er die Menschen wie die Tiere.
Pater Etienne, des jungen Mauricens Confrater, ist ein weitaus älterer, ungemein zarter und zerbrechlicher Landsmann aus Lyon. Seine Kutte hängt wie ein Sack um seine ausgezehrte Gestalt. Er hat ein stilles und gleichermaßen asketisches Gesicht. Unter der trotz der sengenden Sonne fahlen, pergamentnen Haut zeichnen sich die dunklen Linien der Adern, Sehnen und Knochen ab wie eine verwitterte Keilschrift. Ich kann nicht behaupten, ich hätte es vorhergesehen; aber es wundert mich nicht: als Pater Etienne während des unsicheren, suchenden Gangs seines Maultiers auf dem unebenen Pfad plötzlich aus dem Sattel kippt und unabgestützt auf den steinigen Boden stürzt. Von Anbeginn wirkte er wie einer, der bereits vom Tod in die Arme geschlossen ward und die letzte Ölung erhalten hatte, dann aber noch einmal, womöglich gegen seinen Willen, ins Leben zurückgeschickt wurde: Hier ficht er nun einen andauernden nervösen Kampf gegen seine Hinfälligkeit aus, der seinem verhärmten Antlitz eine angespannte Schönheit verleiht.
Es ist ein heißer Tag: Ich benetze das Gesicht des Gestürzten mit Wasser aus meinem Ledersack und untersuche den Schädel, dann die weiteren Knochen, ob irgendeiner gebrochen. Pater Maurice steht betend neben uns. Seitdem wir unterwegs sind, und vermutlich schon Tage davor, hat der alte Kapuzinermönch kaum Nahrung zu sich genommen und sich vom Morgen bis zum Abend gerade einmal mit ausreichend Wasser begnügt, um noch nicht verdurstet zu sein. Nur nach mohammedanischem Kalender, doch durchaus nicht nach christlichem, befinden wir uns gerade in der Fastenzeit: und als ich Pater Maurice auf dieses unnötige, ja gefährliche Exerzitium seines gebrechlichen Confraters anspreche, gibt er bloß Auskunft: es handle sich um ein ganz persönliches Gelübde, eine unverbrüchliche Abmachung zwischen Etienne und Gott. Was für eine unverzeihliche Tat kann der Grund sein, hier in der Einöde unter Lebensgefahr dafür Buße zu tun?
Ich fordere Pater Etienne auf: seine Glieder zu bewegen, eines nach dem anderen. Noch sind seine Bewegungen hilflos wie die eines Gefangenen, den man vom Streckbett befreit. Gebt mir einen Augenblick Zeit: flüstert er. Auch zuvor klang in seiner Stimme – wenn er überhaupt einmal sprach – immer schon das unausweichliche Märtyrertum mit. Dann wurden seine dunkelbraunen Augen schwarz, als falle bereits (und diesmal endgültig) der Schatten des Todesengels auf sein Antlitz. (Werfen Engel denn Schatten?) Sei’s drum, ihm gegenüber fühlt sich ein jeder schmutzig und schämt sich seiner brennenden Augen. Denn alles an ihm – selbst hier im Dreck – ist äußerst reinlich, seine Hände sind makellos wie die des Herrn, der den Kelch mit seinem eigenen Blute seinem unbarmherzigen Vater entgegenstreckt und dann den töricht dreinblickenden Aposteln reicht: Wie sollen diese einfältigen Fischer und Ziegenhirten auch verstehen, was jetzt gerade geschieht?
Ich bestimme, daß wir hier, mitten auf dem Pfad und während der größten Tageshitze, Rast machen. M. Brémond folgt nur mürrisch meinen Anweisungen; sieht aber ein, daß jeder laut vorgebrachte Protest ihn nur als Unmensch erscheinen ließe. Djami und ich spannen ein Tuch über den gestürzten Mann Gottes, damit er im Schatten liege und sich nicht bewegen muß. Dann entzündet Djami ein Feuer, um Pater Etienne eine warme Mahlzeit zu kochen. Wenn der ausgezehrte Mönch nicht wieder ein wenig zu Kräften kommt, können wir unseren Weg nicht fortsetzen; zumindest nicht gemeinsam.
Nur langsam kehrt das Leben in seine müden Augen zurück. Djami füttert ihn wie ein Kind. Alle (selbst Pater Maurice) sind verärgert über diese Unvernunft und die daraus resultierende Verzögerung. Wir werden eine Weile hier rasten müssen und mindestens einen halben Tag verlieren. Brémonds Leute sollen die Tiere von ihrer Last befreien und sie hinunter zum Fluß zu einer Wasserstelle führen. Dann bereiten wir Pater Etienne ein frühes Nachtlager: und die wechselnden Krankenwärter sorgen dafür, daß der Geschwächte in jedem wachen Augenblick ein wenig esse oder zumindest ausreichend trinke.
Als die Wache wieder an mir ist und ich ihm etwas von meinem Dörrfleisch in den Mund zwinge, laufen ihm Tränen über das vom Sturz geschwollene Gesicht. Laßt mich einfach hier liegen, und Gottes Wille geschehe: jammert er. Gottes Wille? Die Hyänen werden Sie holen; werden über Sie herfallen, noch ehe Sie überhaupt tot sind!
Gott wird mich schützen.
Gott hat Sie ja nicht mal auf Ihrem verdammten Maultier halten können! Sind Sie nur deshalb in dieses gottverlassene Land gekommen, um anderen Leuten Scherereien zu bereiten? Sich geißeln und Buße tun hätten Sie doch auch in Frankreich können.
Sie verstehen nicht.
Das ist wahr. Reißen Sie sich zusammen, wenigstens so lange, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Dann schaffen wir es in zwei Tagen nach Bubassa.
Nach diesen durchaus ernstgemeinten Grobheiten gieße ich ein wenig Wasser aus dem Fellsack über mein Halstuch und wische dem zerknirschten Mönch das Elend und die Tränen aus dem hungerblassen Gesicht.
Nun sitze ich in meinem Zelt – im Licht der Petroleumlampe –, vor mir das aufgeschlagene Feldtagebuch, die leere Seite, das Datum, der genaue Ort (unbekannt), und nichts vom heutigen Tag, das mir im Gedächtnis geblieben, scheint mir wert, aufgezeichnet zu werden: kein unvergessliches Ereignis, keine Heldentat, kein Abenteuer, nur dieser Unfall, nur ein ermüdeter Mönch, nur diese notgedrungene Unterbrechung. Wann will ich mit meinem Bericht beginnen? Ich beobachte: wie die Moskitos und andere Nachtschwärmer ihren Weg in den Glaszylinder finden und in der gelbblauen Flamme verglühen; ich beobachte es mit unleugbarer Genugtuung. Ach, die Wildnis in mir; das Barbarentum; und der fatale Mangel an überraschenden Gedanken Einsichten Verzauberungen Räuschen (das abendliche Opium zaubert mich schon lange nicht mehr fort).
Bin ich denn immer noch oder schon wieder ein Zögling: ein Zögling des seiltänzerischen Daseins, ein Akrobat, der den Absturz liebt, ein Leben lang nichts anderes geübt hat? Die Wildnis, dachte ich wohl, werde mich retten (habe ich denn auf Java nichts gelernt?), und nun sitze ich inmitten dieser verdorbenen Natur, gefangen wie einer, dem man die Kleider fortgenommen hat und der sich nun nicht traut, nackt nach Hause zurückzukehren. Doch die Wildnis schert sich einen Dreck um meine Nacktheit! Was war es noch einmal, das Bardey mich zu erforschen bat? Immerhin ist es seine Reputation, die hier auf dem Spiel steht. Noch habe ich keines meiner Instrumente und Bücher ausgepackt.
Ach, die Dichtkunst: was ist sie wert, wenn sie nicht in Wissenschaft mündet! einer universellen, praktischen Wissenschaft, die den Menschen zu überleben hilft; einer klaren, nüchternen Sprache, die nicht nur der Träumer versteht?
Hier ist mein Versuchsfeld, mein Laboratorium, hier: wo die Menschheit begann; wo das Paradies und die Hölle so nah beieinander liegen. Bin ich nicht gut gerüstet mit meinen Büchern und Geräten: der Leitfaden der Metallverarbeitung, die Hydraulische Technik für Stadt und Land, das Taschenbuch des Zimmermanns und die Anleitung zur Errichtung von Sägewerken sind mir schon vor geraumer Zeit ins Adener Bureau geschickt und in den unzähligen zähen Mußestunden durchgearbeitet worden; und endlich hat der gute Delahaye mir auch den Reise-Theodolit, das Taschen-Aneroidbarometer, den Sextanten, das Jahrbuch des Bureau des Longitudes für 1882 und die Topographie und Geodäsie von Commandant Salneuve zugesandt; und das alles befindet sich mit dem photographischen Apparat, dem modernsten seiner Art, und den Gerätschaften für die naturkundlichen Präparationen wohlverstaut in den festen, mit Holzwolle ausgepolsterten und weitestgehend wasserdichten Kisten, die wir auf einem Packesel mit uns führen. Meine Studien über den Harar und die Gallas werden nicht nur die Geographische Gesellschaft überraschen, es wird auch ein Werk mit einer ganz neuen Sprache, einer ganz neuen Art der Poesie daraus entstehen!
Und doch: wenn wir verstanden werden wollen, müssen wir uns wiederholen, die Wörter der anderen wiederholen, aus dem gemeinsamen Sprachschatz. Erfundene Wörter mögen originell sein, dienen aber nicht der Verständigung. Welchen anderen Sinn und Zweck hat Sprache als zu dienen? Ein verständliches Sprechen ist ein ständiges Zitieren.
Nun sollte ich endlich den Anfang wagen: RAPPORT 1. Es gibt zwei Wege von Harar in den Ogaden: einen Richtung Osten durch War-Ali, auf dem drei Handelsstationen bis zur Grenze des Ogaden liegen. Diesen Weg hat unser Agent, M. Constantin Sotiro, bereits einigermaßen erkundet. Es ist der am wenigsten gefährliche und der wasserreichere.
Der zweite Weg führt südöstlich von Harar über den Erer-Fluß, die Märkte in Babili und Wara-Heban bis in die Stammesgebiete der Hawïa.
Hier sind die Erkenntnisse, die M. Sotiros und meine Expeditionen über den Ogaden bereits erbracht haben: Ogaden ist der Name einer Gruppe von Stämmen somalischer Herkunft und zugleich der Name der Region, die sie besiedeln. Im Westen grenzt der Ogaden an das Hirtenvolk der Gallas und entlang des Wabi-Flusses, der ihn vom großen Oromo-Stamm der Oroussis trennt, im Norden an die somalischen Stämme der Habr-Gerhadjis, im Osten an jene der Doulbohantes und der Midgertines und im Süden an die Hawïa.
Der Name Hawïa scheint insbesondere jene Stämme zu bezeichnen, die sich aus einer Vermischung von Gallas und Somalis gebildet haben, von denen ein geringer Teil im Nordwesten Harars, ein größerer Teil südlich von Harar an der Straße in den Ogaden und schließlich der bedeutendste Teil im Südosten des Ogaden in Richtung des Sahel siedelt. Die drei Stammesglieder leben völlig unabhängig voneinander.
Wie bitter ist es indes, daß die Geographische Gesellschaft sich mit keinem einzigen Centime an der Ausrüstung dieser Forschungsreise beteiligt. Allein die Früchte gedenken sie zu ernten. Sei’s drum: ich bin hier in Abessinien ja vor allem um meiner selbst willen.
Manchmal träume ich: ich würde erwachen, und alle Gesetze und Sitten hätten sich geändert. Schon als Heranwachsender träumte ich von Entdeckungsreisen in Länder, über die noch keiner je berichtet hatte, Gebiete ohne Geschichte, ohne Glaubenskriege, ohne menschenfresserische Sitten. Ich glaubte an Zauber und Magie, an Rausch und Taumel – und hier bin ich nun, finde Flinten und Glasperlen statt der nackten kriegerischen Engel.
Ich habe die Wüsten geliebt, ohne sie zu kennen; stattdessen habe ich mich durch kotige Straßen geschleppt und mich bereits in einem Dschungel gewähnt. Doch die Fliegen auf den Scheißhaufen von London oder Paris sind nicht dieselben, die hier im Ogaden ihre Eier in unseren Augenwinkeln ablegen.
Aber selbst zu Hause, ja gerade zu Hause lauerte der Tod; mußte reisen, um ihm zu entkommen. Natürlich weiß ich, wußte schon immer, daß man ihm am Ende nicht entkommt. Wie dumm der Stolz darauf, keine Heimat zu besitzen, keine Freunde, keine Sprache! wie töricht die Verachtung für alle, die es nicht besser wußten, besser wissen konnten – was suche ich hier in der Wüste?
Auch die Wissenschaft wird mich nicht retten. Gebete wirken schneller. Arbeit zehrt rascher auf. Träume machen uns zu Heiligen. Lieben zu Verbrechern. Schluß mit dem Gejammer!
DIENSTAG, DEN 9. OKTOBER 1883
Die Giftflaschen zum Töten der Insekten, der Leibgürtel mit dem zu erwartenden Wegezoll und die Notizbücher sind in meiner Obhut, während ich die Verantwortung für meine Leibwäsche, unseren Proviant und unsere Wasserschläuche Djami anvertraut habe, der auf seinem Maultier beständig an meiner Seite oder, wenn es das Gelände nicht erlaubt, direkt hinter mir reitet. Einen gesonderten Träger oder einen Treiber für unseren Packesel haben wir nicht gemietet. In den Augen der Träger müssen wir schwierige und unbegreifliche Fremdlinge sein, um wieviel mehr erst in den Augen der wilden und freien Ogadenkrieger! Anstatt, wie es in dieser mit jedem Schritt ins Tiefland heißer werdenden Region üblich ist, des Nachts zu reisen, sind wir vor allem am Tage, also auch während der allergrößten Hitze unterwegs, und das nicht der Ignoranz der europäischen Reisegefährten, sondern meines zweiten, womöglich eigentlichen Reiseziels wegen: zu beobachten, zu sammeln, aufzuzeichnen und zu kartographieren.
Indes versuchen wir, einander mit Freundlichkeit zu begegnen, da ja einer ohne den anderen hier nicht überleben kann. Die Krieger der Ogadeni haben es niemals gelernt zu gehorchen, und Fremden gegenüber, die allem Anschein nach keinem Gott oder zumindest nicht dem ihren dienen, können sie erst einmal keinerlei Achtung entgegenbringen. In dieser Hinsicht unterscheiden die Völker sich nur wenig voneinander. Also ist es an uns, ihre Achtung zu verdienen.
Ein heftiger Wortwechsel reißt mich aus meinen Gedanken. Offenbar ist der ehrenwerte M. Brémond mit dem friedfertigen Pater Maurice in einen heftigen Streit geraten (was durchaus keine geringe Kunst ist): Mit dem Auftauchen eures warmen Bruders Jesu und seiner weibischen Lehre endet unsere seelische Gesundheit! höre ich seinen dröhnenden Baß. Von Gethsemane und Golgatha stammen alle unsere sündhaften Ausschweifungen und Verirrungen. Wären wir doch Heiden geblieben!
In Paris wäre ein Mann wie Brémond ganz und gar belanglos. Man müßte diesen Sack erst ordentlich mit Scheiten vollstopfen, damit er ein wenig Ecken und Kanten zeigt. Aber damit sind wir schon wieder bei der Effektsucht der Skribenten.
Doch was in Paris allenfalls – zumindest in gewissen Kreisen – zu amüsieren vermag, erregt nicht nur bei den Missionsbrüdern, sondern auch bei den strenggläubigen Mohammedanern in unserer Karawane zunehmenden Unmut. Wenn sie auch nicht die Worte des Pariser Kaufmanns verstehen, so hören sie durchaus die Angriffslust heraus: den Spott und die Verachtung für alles, was ihnen heilig ist. Spürt Brémond die Gefahr nicht? Sucht er sie gar?
Brémond – etwas klingt an, eine Erinnerung steigt auf, die wohl zehn Jahre zurückliegt: der Vater Kaufmann; Heeresausstatter; Brémond & Fils; ein ungeheurer Skandal; im Grunde ein ganzer Reigen von Skandalen: Nach der Gefangennahme des Kaisers in Sedan und der Ausrufung der Republik wird Brémond der Veruntreuung von Staatsgeldern angeklagt; der Sohn (Antoine?), Chefbuchhalter und Miteigentümer der Firma, erklärt sich zur Aussage gegen den Vater bereit, wenn ihm Straferlaß gewehrt wird. Der Vater läßt ihn gewaltsam in die Salpêtrière einweisen, entmündigen und für verrückt erklären; er wird (wenn ich mich recht erinnere) erst aus der Anstalt entlassen, als sein Vater verurteilt wird und ins Gefängnis muß. Das Geschäft ist bankrott, der gute Ruf ruiniert, also verlässt der junge Brémond (Antoine Brémond? ich frage nicht) Frankreich.
Die Luft über dem kargen Boden zittert und flirrt, das Fernliegende wirkt verschwommen und zugleich wie durch ein Brennglas vergrößert: hartlaubiges Gesträuch wird zu einem Hain verkrüppelter Bäume, die den steinigen Grund nach ihren verlorenen Brillen absuchen, eine einsame Hyäne verwandelt sich in den porphyrglänzenden Gott Anubis, wehe, wenn unsere Seele schwerer als das Herz ist!
Ich sehe sie noch vor mir: die sumpfigen Wälder und Wiesen, die Flußauen Gräben und Tümpel voll faulendem Wasser, auf deren Grund heute die Stadt steht, solange ist es noch gar nicht her. Im Waggon Dritter Klasse finde ich unter meiner Holzbank zwei frische lidlose Augäpfel. Die Faust in meiner rechten Hosentasche erinnert mich daran, daß ich ohne Geld und Fahrkarte unterwegs bin: Ich werde mir mein Essen rauben müssen. (Der Schiffsbauch ist voller Vorräte, während ich an der Reling stehe und kotze.)
Die Lokomotive qualmt wie die Esse des Hephaistos, die Luft stinkt nach Schwefel, und ich denke: ist es der Teufel, der sich auf den Weg nach Paris gemacht hat? Die Scheiben sind von einer fettigen Rußschicht bedeckt, ich bin müde und zugleich erregt, das dampfende und zischende Ungeheuer pfeift wie irrsinnig.
Auf der Fahrt hierher, zum Parnass, fliegen sie noch leichten Sinns am Abteilfenster vorbei: die Schaubuden, Riesenräder, Kettenkarussells, die glänzendroten Aug- und Liebesäpfel, die fliegenden Blätter, das Küchenlatein, die pornographischen Schriften, ohne Bindung, ohne Punkt und Komma, die Groschenromane unserer Mütter und ihre täppischen Kinderreime.
Dann der Gare du Nord: als würden Salpeter oder Guano hier verladen; ein Uniformierter fragt nach meiner Fahrkarte. Ich könnte unter seinen Beinen hindurchschlüpfen, könnte ihm ins Gesicht spucken oder in die Eier treten oder ihm den Schlagstock aus dem Gürtel reißen und ihm mit dem eigenen Knüppel einen überziehen, aber noch bin ich nur ein argloser fünfzehnjähriger Schwarzfahrer aus der Provinz.
Die Amtsstube riecht nach Stempelblau, verschwitztem Drillich, nach Angst, Mißtrauen und Gewalt. Der Wachmann Cerbère notiert Namen und Wohnort und führt mich in den Zellentrakt, Cerbère, Zerberus, der Vielköpfige, Schwarzgeschuppte, der jeden hineinläßt, doch keinen jemals wieder hinaus.
Vielleicht war es falsch, mich zwei Jahre älter zu machen: muß mich bis auf die nackte Haut ausziehen, werde geschoren, vermessen, entlaust, als sei ich eine Weihnachtsgans, die man für das bevorstehemde Fest rupft und ausnimmt.
Und nun hier, in dieser Zelle: sie besteht aus einer Gaslampe, einer Eisenpritsche, einer Wasserflasche, einem Koteimer und einer zwielichtigen Gestalt, mit der ich das Lager zu teilen habe, will ich nicht auf dem nackten Estrich ruhen.
Der zerlumpte Dichter, noch weiß er nicht, daß er vierzehn lange Tage und noch längere Nächte hier verbringen wird, das nasse, schimmlige Brot, der erste Rausch, das erste Blut und der langanhaltende Schmerz, der Zellengenosse, der ihn in seine leprösen Arme preßt, das Haar und die Achselhöhlen voller Läuse, Läuse zwischen den Beinen und im Herzen, und er, an die Bank genagelt, ohne Alter, ohne Gefühl, fast wäre ich im Rausch gestorben, fast auferstanden.
Die Hände des Gefängniskaplans mögen sanfter sein, doch bitte ich meinen Zellengenossen, ihn nicht hereinzulassen. Sein lieblicher Gestank kann mich nicht täuschen: ich rieche den Schwefelgeruch seiner Scham.
Während in der Ferne schon die preußische Artillerie explodiert: sie wird mich aus diesem Kerker herausschießen, die uringetränkte Strohmatratze in Brand setzen und den kotbeschmierten Korridor rot färben!
War ich denn bisher nicht folgsam und sanft: die Fingernägel sauber, die Hefte fleckenlos, die Schulnoten herausragend? Bis gestern kam die Päpstin noch am Samstagabend in die Küche, wo die Zinkwanne stand, in die ich nach meinem Bruder und meinen Schwestern stieg, um mir mit der Scheuerbürste den Rücken, den Hals, den Kopf, die Ohren und den Hintern zu waschen – an Schwanz und Sack wagte sie sich schon nicht mehr, doch drückte mir mit einem grausamen Zug in ihrem Gesicht die Bürste in die Hand, damit ich selbst all den Dreck, die Krusten und das Ungeziefer (welches Ungeziefer außer dem in ihrem Kopf?) aus meinem Schamhaar scheure.
Da es in Charleville nichts zu erleben, nichts zu lieben gibt, beginnt meine Schwester Vitalie (sie trägt denselben Namen wie die Päpstin), Straßenbäume zu zählen: hundertundelf Kastanienbäume auf der Allee, dreiundsechzig rings um die Bahnhofspromenade: damit füllt sie ihr Tagebuch. Es ist wohl Schwindsucht, an der sie am Ende (mit siebzehn Jahren) stirbt.
Frédéric, mein älterer Bruder, ist der hübschere von uns beiden, wenngleich genauso still und einsam wie ich. Auf dem Schulhof bleiben wir unter uns. Selbst dort müssen wir still sein. Schweigend stopfen wir einander Schnee ins Maul. Nur die Raucher unter uns finden das kindisch. Sobald es läutet, stehen wir in Reih und Glied und wagen nicht einmal mehr: auszuspucken. Wie kommt es, daß ich ein so guter Schüler bin? Ist es der Angelhaken unter meiner Zunge? – Trotzdem sind wir froh, wenn der Sonntag endlich zu Ende ist.
Ich zweifle, daß es eine Sprache geben wird, in der wir überleben könnten. Die Wörter sterben und zerfallen mit unseren Leibern. Statt schwarzer Stoppeln sprießen grüne Halme aus meiner porösen Haut. Und madenblasse Wurzelspitzen bahnen sich ihren Weg in meine durchlässige Stirn. In Java pflockt man die Delinquenten am Boden fest und wartet einfach ab, bis die Bambussprossen aus der Erde schießen, eine Handbreit am Tag; sie sind es gewohnt, sich ihren Weg zwischen Steinen hindurch zu bahnen, Rippen und Schädelknochen sind da kein Hindernis.