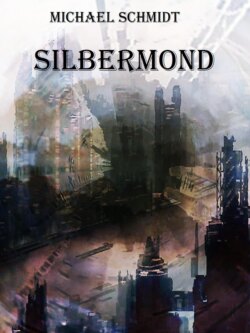Читать книгу Silbermond - Michael Schmidt - Страница 4
Weststadt
ОглавлениеProlog
Es ist ein berauschendes Gefühl, auf diese Stadt hinunter zu blicken. Berauschend ja, aber wie ein guter Wein führt übermäßiger Genuss zu einem schweren Kater. Dabei ist der erste Blick furios.
Ich stehe hier oben, auf dem höchsten Berg, und blicke hinunter zu dem Moloch namens Silbermond. Weit breitet sich die Ebene aus, bei guter Sicht kann man fast die komplette Stadt überblicken, hügelig und lieblich stelle ich sie mir vor, zu Zeiten, als sie noch unberührt war.
Aber das muss lange her sein. Jetzt gibt es hier selten eine klare Sicht. Große Schlote speien schwarze Wolken in die Luft, eine schier unüberschaubare Anzahl von Schornsteinen sticht gen Himmel. Silbermond ist ein riesiger Moloch. Ein Moloch, der lebt, atmet, seine widerlichen Ausscheidungen in die Luft stößt und ein wohl ehemals wunderschönes Tal verschandelt, eine schwärende Wunde in der ansonsten unberührten Natur. Hier und da blitzen grüne Flecken inmitten der Wüste aus Beton, als wollen sie aufbegehren und verlorenes Terrain zurückerobern, doch trügt der Schein. Auch sie sind vom Absterben bedroht.
Drei Flüsse vereinigen sich in Silbermond. Drei Flüsse namens Rhyn, Mohyn und Lehyn, die dem Moloch ihr unverwechselbares Gesicht geben, für gemäßigte Temperaturen sorgen und ihm gleichzeitig die Grenzen aufzeigen. Der Mohyn entspringt dem Gebirge, auf dem ich stehe und teilt die Stadt in West und Ost. Der Westen wird von einem unwegsamen Sumpfgebiet beherrscht, in dem der Abschaum der Stadt, die Beutelleute wohnen. Dieser Sumpf verhindert auch eine Ausbreitung Silbermonds, denn kaum jemand traut sich überhaupt in diese Gegend: Eine Rückkehr ist mehr als ungewiss.
Im Osten sorgt der breite und stolze Rhyn für eine natürliche Grenze, seine Bewohner blicken auf die Enklave Badenau, die jeglichen Kontakt unterbindet und fast schon Krieg mit der Stadt führt.
Der Lehyn dagegen mündet in den Rhyn und ist selbst Mündung für den Mohyn. War der Lehyn lange Zeit ebenfalls Grenze Silbermonds, wuchert seit geraumer Zeit Neustadt jenseits des Flusses, ein besonders hässlicher Fleck voller hoher Betontürme und großer Felder industrieller Anlagen. Aber Neustadt bietet auch Wohnstatt für unzählige Menschen, und so streiten sich die heimlichen Herrscher von West und Ost um diesen stetig wachsenden Teil des Molochs.
Ja, Silbermond pulsiert, man spürt förmlich, wie der Organismus verdaut und ausscheidet.
Doch, lieber: sieh dich vor: Du wärst nicht der erste, der eine Stippvisite mit dem Leben bezahlt. Das Leben in Silbermond ist gefährlich und für viele ist es nicht nur Geburtsstätte sondern auch das Grab.
Aus den Reiseberichten des Hermann Mommens.
1. Jasper
Der Mohyn, auf dessen Oberfläche sich das Mondlicht reflektierte, sorgte für einen Schwall frischer Luft, die zusammen mit dem Regen vom Ostwind herüber geweht wurde. Das rissige Pflaster glänzte schmierig und warf das bunte Licht der Neonreklame zurück, flackernd und seltsam unwirklich. Die Farben verblassten und nahmen an Intensität zu, ganz im Rhythmus der synchronen Schlagzeuge.
Unmengen hatten sich auf dem Wandaplatz versammelt und Jasper mittendrin. Aus tausenden Kehlen trieb Ekstase, angefeuert von der elfköpfigen Kombo, deren intensives Spiel nicht vom Regen abgekühlt wurde, eher fachte es die Leidenschaft der Musiker noch an. Drei Gitarren wetteiferten miteinander in schrillen Töne, deren Melodien sich voneinander entfernten, um sich in verspieltem Werben wieder zusammen zu finden, im seltsamen Widerspruch von Gemeinsamkeit und Egoismus, während im Hintergrund Bass und Rhythmusgitarre den Klangteppich der beiden Schlagzeuger untermauerten. Die letzten Barrieren der Vernunft wurden niedergerissen und verwandelten den Mob in eine kreischende Menge. Drei Stimmen im Chor, monoton und hypnotisch, nur unterbrochen vom kehligen Gesang des Frontmannes, der sich schreiend, fast spastisch gebärdete.
Silbermond. Du Quell meiner Leidenschaft.
Silbermond. Ich begehre dich.
Silbermond. Du bist meine Schaffenskraft.
Silbermond. Ich liebe und hasse dich.
Ach, Silbermond, du einzigartige Stadt. Mein Grab, für immer, gefangen in Ekstase. Du bist ein Moloch, der Sündenpfuhl, der mich aushöhlt.
Ach, Silbermond, was hast du mir angetan?
Silbermond. Du Quell meiner Leidenschaft.
Silbermond. Ich begehre dich.
Silbermond. Du bist meine Schaffenskraft.
Silbermond. Ich liebe und hasse dich.
Jasper tanzte mit, schrie die Zeilen heraus, während er, die Arme gereckt, im Einklang mit der Menge hin und her wogte. Doch plötzlich schwindelte ihm. Sein Gesichtsfeld verschob sich, verzerrte die Wahrnehmung, als würde die Welt in die Länge gezogen, an den Rändern nach innen gestülpt.
Oh Scheiße!
Irgendwas in dem Stoff musste übel gewesen sein. Eine solche Wirkung hatte er niemals zuvor gespürt. Die Musik trat in den Hintergrund, seltsam dumpf, als wäre ein Filter vorgeschaltet. Er schwankte, hielt mühsam die Balance und wischte sich mit dem rechten Arm den Schweiß von der Stirn.
Mann, geht's mir dreckig!
Er blickte sich um, auf Normalität hoffend. Doch der seltsame Modus, der von ihm Besitz ergriffen hatte, blieb und trieb ihn fast an den Rand des Wahnsinns. Als er es nicht mehr aushielt, drehte er sich um und suchte Abstand von der Menge. Er wankte nach rechts, vorbei an den schattenhaften Gestalten, während die Musik mal klarer, mal dumpfer wurde. Hier und da rempelte er versehentlich Menschen an. Flüche und Schläge ignorierend eilte er weiter, ganz gefangen in seiner persönlichen Agonie, während um ihn herum die Stimmung neue Höhen erreichte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte er das Ufer des Mohyn erreicht. Er fiel auf die Knie und tauchte die Hände in die brackige Brühe. Er empfand keine Erleichterung, also spritzte er einen Schwall Wasser in sein Gesicht, tauchte schließlich den ganzen Kopf unter Wasser, um sich wenig später schüttelnd zu erheben. Das kalte Wasser wischte die glückselige Dumpfheit des Maronpulvers hinweg. Doch auch dies vertrieb den Wahnsinnmodus nicht. Die Welt zog, streckte, bog, dehnte, stülpte und normalisierte sich in einem wiederkehrenden, doch alles andere als periodischen Rhythmus. Die Farben flackerten, verliefen ineinander, bis plötzlich das Bild gefror.
Nur noch schwarz und weiß, die Musik verstummte und machte einer bedrohlichen Stille Platz. Er schaute sich um und erstarrte. Ihm wurde heiß und kalt zugleich. Er schwankte wie ein Baum im Sturm unter dem Eindruck des Bildes, das sich ihm bot.
Die Menge war verschwunden, stattdessen wurde der Platz von Karikaturen der Beutelleute bevölkert. Wirkten jene schon anormal, mit abstoßenden Gesichtern und verwachsenen Gliedern, schreckten diese Wesen durch ihre noch schrecklichere Gestalt ab.
Auf dem Rücken thronte ein riesiger Buckel, der ein unheimliches Eigenleben führte, pulsierte, als wäre in ihm etwas Lebendiges, das jederzeit ausbrechen könnte. Im Gesicht prangten riesige Nasen, aus denen weißlicher Schleim lief, der nach einer Mischung aus Eiter und Metall roch und ihm einen Brechreiz verursachte.
Eines der Wesen kam näher, öffnete den Mund und entblößte bläuliche Zähne, klein und messerscharf wirkend. Ein Schwall abgestandener Luft traf ihn, eine Kloake menschlicher Exkremente ähnelnd. Als lange, knochige Finger nach ihm griffen, war es zu viel für ihn.
Das Licht flackerte erneut, wich diesmal aber absoluter Dunkelheit. Er spürte noch einen Schmerz, als er auf den Boden fiel, dann ging das Licht aus. Das wohlige Schwarz des Vergessens hatte von ihm Besitz ergriffen.
Hart klatschte eine Hand an seine Wange und brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Zuerst orientierte er sich mühsam, den nebligen Fetzen des Albtraumes abstreifend, doch eine weitere Ohrfeige brachte ihn zur Besinnung. Abwehrend hob er die Hände. Aufstöhnend folgte er den Worten der Frau, die auf ihn einsprach. Es sprudelte aus ihr heraus, erst unverständlich, es dauerte, bis er ihrem hastig dahin gestammelten Gebrabbel folgen konnte.
„…los mit dir. Hey, ich mach dir nichts. Ich seh' dich nur hier liegen, denk, ich helf' dir. Denke, vielleicht hat der Typ Stoff für dich. Ich hab dir das Leben gerettet, quasi. Der Nächste hätte' dich ausgenommen. Abgestochen. Echt! Komm! Gib mir ein wenig Maron! Du hast doch was?“
Das Gesicht sah verlebt aus, tiefe Falten hatten sich um Mund und Augen gegraben. Falten, die von intensivem Leben zeugten. Maron, Alkohol und mehr, vielleicht Schlimmeres. In diesem Teil der Stadt lebten die Leute schnell und nahmen alles an Vergnügen mit, was das Leben zu bieten hatte. Wer wusste schon, wann der Tod kam? Er lauerte an jeder Straßenecke…
Man konnte die vergangene Schönheit der Frau noch erkennen. Strähniges blondes Haar umrahmte das schmale Gesicht, in dem der volle Mund hervorstach. Blaue Augen spiegelten unerfüllte Wünsche wider und sahen sehnsüchtig, süchtig und auch ein wenig trüb auf ihn herab: „Maron!“
Als er sie mit langem Blick unverständlich musterte, erschien ein ärgerlicher Ausdruck in ihren blauen Augen: „Mann, was ist jetzt? Hast du was für mich?“
Er schüttelte seine Starre ab, spürte die steif gelegenen Glieder und rang immer noch mit den seltsamen Eindrücken, die ihm das verschnittene Maronpulver beschert hatte: Entartete Beutelleute, die eine unheimliche Parodie Silbermonds bevölkerten. In seiner Erinnerung wirbelten Fetzen von Türmen, Erkern und seltsamen blau leuchtenden Lampen…
Er lachte auf, sah ihren bösen Blick und packte ihr Handgelenk, als sie sich abwenden wollte. Sich in die Höhe stemmend, ignorierte er ihr Gejammer und blickte sich um. Immer noch dröhnte die angesagteste Mucke Weststadts aus überdimensionierten Lautsprechern und verwandelte den Wandaplatz in einen sprudelnden Quell von Lebensenergie. Die Menge tanzte selbstvergessen, gefangen in der Magie der rockigen Musik. Von Beutelleutekarikaturen war natürlich weit und breit nichts zu sehen. Er schalt sich einen Narren und überlegte, wie er die nächsten Stunden verbringen wollte. Die Stimmung zum Abrocken war auf jeden Fall verflogen.
Er schaute in ihre blauen Augen, kramte in seinen Taschen und brachte einen Rest Maron zutage.
„Wir teilen“, erwiderte er bestimmt. „Irgendwas ist hier voll krass. Können wir nicht woandershin? Wo wohnst du?“
In ihren Augen blitzte es, dann sah sie zu Boden.
„Ey, ich bin nicht so eine. Ich mache nicht für ein bisschen Pulver die Beine breit, das kannste dir abschminken. Such dir ´ne andere für deine perversen Spielchen.“
Unwillkürlich musste er grinsen, rappelte sich vollends auf und zog sie hinter sich her. Als sie sich sträubte, ließ er sie los.
„Du brauchst keinen Schiss zu haben. Ich will nur quatschen. Quatschen und ein wenig vergessen. Ich hatte gerade einen ziemlich üblen Trip. Du kannst es aber auch lassen. “
Sprach es und schritt von dannen, weg von der Musik, weg von der kreischenden Menge. Und es dauerte nicht lange, da hörte er ihre Schritte.
Sie hatten sich ein gutes Stück vom Mohyn entfernt. Die Frau wohnte in einer kleinen, vollgestopften Bude mehrere Blocks weit vom Wandaplatz entfernt. Er stand auf dem winzigen Balkon, während sie in der Küche Kaffee kochte. Der Beutel mit Maron lag auf dem Tisch, zusammen mit zwei Halbliterflaschen Bier. Er musterte die verschachtelten Gässchen und die unzähligen kleinen Häuser, die sich unter ihm ausbreiteten. Häuser mit Türmchen und Erkern, auf vielen thronten kürzere bis längere Kaminschlote, aus denen dunkler Rauch emporstieg. Die Fassaden waren zumeist grau oder braun oder ganz dunkel, die Wandfarbe blätterte an vielen Stellen ab und zeigte den schon lang anhaltenden Verfall des Viertels. Umtriebig wuselten die Menschen durch die Straßen, manche nach Hause zur Liebsten, andere auf der Jagd nach Vergnügen oder auf dem Weg zu ihren dunklen Geschäften.
Hier, im fünften Stock, hatte man einen recht guten Überblick. Nur ganz verteilt lagen weitere, mehr als dreistöckige Häuser, trotzdem sah er kein Ende der Betonwüste, egal, in welche Richtung er blickte. Er glaubte, den Mohyn zu erkennen oder besser ein Glitzern auf der Oberfläche, aber genauso gut konnte es pure Einbildung sein. Die Musik wehte bis hier hinauf. Doch das war nur ein schwacher Abklatsch dessen, was sie vorher gehört hatten. „Wie heißt Du eigentlich?“
Unbemerkt war sie an ihn herangetreten, sah hinab in die regennassen Straßen, ihr Blick zeigte eine Mischung aus Faszination und Abscheu. Silbermond wurde selten vorbehaltlos geliebt und Weststadt war alles andere als die Schokoladenseite des Betonstarrenden Molochs.
„Ich bin Jasper, der Wandelbare. Aber frag bitte nicht, wie ich zu diesem Namen gekommen bin. Es ist eine bittere Geschichte, die ich an diesem Abend nicht erzählen möchte. Sie handelt vom Schmerz und vom Tod, und ich habe Lust auf Zerstreuung, nicht auf unangenehme Erinnerungen. Wie nennt man dich?“
Ihre Augen waren undurchdringlich, wirkten immer noch verschleiert durch eine Mischung aus Sehnsucht, Trübsinn und etwas anderem, dass er nicht deuten konnte. Vielleicht steckte doch mehr hinter der verlebten Fassade, als der erste Eindruck vermittelte.
„Ich bin Renata. Das Schicksal der Suchenden. Auch meine Geschichte braucht einen anderen Abend, um erzählt zu werden. Sie wird deiner an Bitterkeit in nichts nachstehen. Lass uns das Maron versuchen.“
Sie schien jetzt weniger apathisch, weniger hilflos zu sein. Eigentlich hatte der Wandel schon stattgefunden, als sie sich zusammen auf den Weg zu ihrer Wohnung gemacht hatten.
Der Kaffeeduft stieg ihm in die Nase und er folgte ihr zurück in die kleine Wohnung, den Blick auf die sich wiegenden Hüften fixiert. Sie hatte einen strammen Hintern und auch die Beine schienen knackig. Sie setzte sich, erkannte wohl diesen speziellen Blick und lächelte tiefgründig. Als sie einschenkte, fiel sein Blick unwillkürlich auf ihren Ausschnitt.
Ey, ich bin nicht so eine. Ich mache nicht für ein bisschen Pulver die Beine breit, das kannste dir abschminken.
Ihre Worte klangen in seinen Gedanken nach und er begann, nach einer verborgenen Botschaft zu suchen. Zum wiederholten Male blickte er in ihre blauen Augen und sah überrascht, dass alle Naivität verschwunden war. Immer noch sah sie sehnsuchtsvoll und verloren aus, aber noch etwas Anderes lauerte in den Abgründen ihres Seins.
Er bekam einen Steifen, malte sich aus, wie er ihr das Shirt auszog, dachte an den prallen Hintern...
Jasper nahm einen Schluck Kaffee, auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob sie ihn nicht bewusst manipulierte. Man hörte viel von abgeschleppten Typen, die mit aufgeschnittener Kehle aufgefunden wurden. Er war sich sicher, mit ihr fertig zu werden, aber man sollte die Gefahren Weststadts niemals unterschätzen.
Neben auf dem Schrank lag ein armlanges Messer, ein Fleischklopfer und mehrere Gabeln. Gerade das armlange Messer war eine nicht zu unterschätzende Waffe.
Sein Blick fiel auf Renata und er revidierte seine Einschätzung erneut. Er glaubte, Rätsel in ihr zu erkennen. Ein Mysterium, aber keine Boshaftigkeit. Sie war harmlos, da war er sich sicher. Trotzdem würde er auf der Hut bleiben.
Er öffnete den Beutel und hielt ihn ihr hin. Sie nahm eine Prise des braunen Pulvers, schüttete es auf ihren Handrücken und leckte es in einem Zug auf.
Ihre Grazie bewundernd, gab er sich eine Dosis in die Handfläche und schüttete sie gierig in seinen Schlund. Es war an der Zeit zu vergessen. Und vielleicht erfüllten sich seine Träume.
Die Wirkung setzte ein, seine Begierde wuchs und mit ihr sein Ständer. Er schaute sie an, suchte nach einem Anzeichen von Lust in ihren Augen. Langsam trübten sich die Farben, die Welt zog sich zusammen und wieder zu, so auch ihr Gesicht, ein skurriles Schifferklavier. Es war wieder wie vorhin und er verfluchte sich dafür, die Droge erneut benutzt zu haben.
Er blickte sich um. Die Wände schienen zu leben. Gesichter bildeten sich. Männer, Frauen, die Münder vor Qual verzerrt. Der Boden warf Wellen, auf denen die Köpfe Verstorbener ritten. Ein unheimliches Kichern erklang.
Plötzlich eine Bewegung in den Augenwinkeln. Renata – besser gesagt eine Karikatur Renatas – sah ihm höhnisch entgegen. Sie riss sich das Shirt vom Leib, doch statt wohlgeformter Brüste wanden sich Rattenköpfe und fauchten ihn an. Ihr Gesicht hatte tiefe Furchen, in denen es von Maden wimmelte, die scheinbar aus ihrem Innern hervor krochen. Auf ihrem Rücken thronte ein Buckel, der hin und her wogte, als sei etwas Lebendiges in ihm.
Ihre Nase war lang und krumm. Schleim tropfte heraus und verätzte den Boden. Blasen bildeten sich und verzerrten sich zu weiteren Gesichtern, die ihn stumm anschrien. Seine Angst wuchs ins Irrationale als sie sich ihm näherte, die Brustratten streichelnd und das Becken kreisend, während sie vulgäre Worte herausschrie. Panisch tastete er seine Umgebung ab und packte nach dem nächstbesten Gegenstand, den er fand: ein armlanges Messer.
Er stach nach den Rattenköpfen, schnitt sie vom Torso. Die Ratten verhöhnten ihn mit hoher Stimme, während sie zu Boden klatschten und sich dort weiter gebärdeten und ihn zum hemmungslosen Sex aufforderten. In Raserei gefangen stach er in Renatas Augen, in ihre Arme, ihr Bein und in den Unterleib. Er stach wieder und wieder auf sie ein.
Urplötzlich verschwanden die Gesichter in den Wänden, der Boden blieb ruhig und vor ihm lag Renatas grausam zugerichteter Leib in einer riesigen Blutlache. Nirgendwo waren Rattenköpfe zu sehen, und auch Boden und Wände boten keine Gesichter oder Fußspuren. Ihr Gesicht wirkte normal, sah man von der Schweinerei ab, die er mit dem Messer angerichtet hatte. Die Brüste hingen zerfetzt an ihrem Körper, Eingeweide hingen aus dem geöffneten Unterleib.
Ihre Augen zeigten selbst gebrochen noch das Entsetzen, welches sein Handeln in ihr hervorgerufen hatte. Würgend erbrach er sich auf den Parkettboden, immer wieder, bis sein Magen nur noch bittere Galle hervorbrachte. Als die Kehle vom Brechen schmerzte, hielt er inne.
Erst jetzt kam ihm zu Bewusstsein, was er getan hatte. Er floh so schnell er konnte, fiel fast die Treppe hinunter und verschwand schreiend in der Dunkelheit.
Die Häuser flogen nur so an ihm vorbei. Hier das schreiend blaue Haus des Amelika, dort die bunten Hütten der Karifen,
Monoton platschten seine Füße auf dem nassen Betonboden. Sein Atem ging keuchend, die Lunge schmerzte, die Beine brannten und er lief weiter und weiter. Doch die beginnende Erschöpfung lenkte ihn ein wenig von den Ereignissen der letzten Stunde ab. Er wurde langsamer und begann, seine Aufmerksamkeit auf die Umgebung zu lenken. Die Gegend wurde belebter und ihm fiel auf, dass er trotz seiner Panik den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Den Weg nach Hause.
Plötzlich sah er sie und seine Schritte verlangsamten sich bis er stehenblieb, den Blick nach hinten gerichtet. Er registrierte die fünf Ghessinen, die gerade auf potentielle Kunden einredeten. Er gaffte sie an, doch das war ihm ziemlich schnuppe. Diese Nacht war anders. Sie war magisch, aber nicht in einem positiven Sinne. Ein Albtraum in Reinkultur, unmenschlich, ja böse. Da galten menschliche Konventionen, auf die er eigentlich so viel gab, einen Scheißdreck.
Eine Frau geriet in sein Blickfeld und ging auf ihn zu. Ihr Haar war lang und golden, wallte in einer unglaublichen Fülle fast bis zum Boden. Der Ausschnitt versprach mehr: Ein voller Busen, dessen Anziehungskraft fast unüberwindbar schien. Seine Augen folgten dem wallenden Kleid, dem wohlgeformten Bein in schwarzen Strümpfen, das sie ein wenig angewinkelt hatte. Ihre blassen blauen Augen sahen ihn belustigt an, duldeten stumm seine Musterung. Ihre roten Lippen verzogen sich zu einem spöttischen Lächeln. Sie beugte sich vor und hauchte einen Kuss in seine Richtung.
„Liebster, ich verspreche dir eine Nacht, die du niemals vergisst. Und glaub mir, der Preis lohnt sich …“, warb sie mit kokettem Augenaufschlag, der Jasper schlagartig zur Besinnung brachte. Eine Bordsteinschwalbe, das hatte ihm gerade noch gefehlt.
Kurz hatte er an ein Wunder gedacht: Die perfekte Frau zum richtigen Zeitpunkt, das Licht in der schwärzesten Nacht, die er je erlebt hatte, doch die Illusion zerbarst wie ein billiger Maronrausch und hinterließ nur Enttäuschung in ihm.
Ein erneuter, genauerer Blick zeigte ihm wabbliges Fleisch, das die beste Zeit schon lange hinter sich hatte. Die Strumpfhose war löchrig und versifft. Ihre wirklich interessanten Augen wurden umrahmt von tiefen Furchen, die andeuteten, wie anstrengend das Gewerbe auf Dauer war und wie wichtig es gewesen wäre, rechtzeitig umzusatteln. Selbst die zentimeterdicke Schminke konnte nicht darüber hinwegtäuschen und gab ihrem Gesicht etwas Maskenhaftes, fast schon Abstoßendes.
„Na, Schätzchen, hast wohl schon bessere Zeiten hinter dir. Wie lang stehst du hier schon und wartest vergeblich?“, lästerte er im Fortgehen und quittierte die Schimpfkanonade, die ihm hinterher brandete, mit einem Lächeln. Sein Blick wanderte die Häuserwände entlang, musterte das verwitterte und geschwärzte Mauerwerk, die blinden Fenster. Den Kopf schüttelnd sinnierte er über vergangene, bessere Zeiten. In Weststadt verkam die Gegend immer mehr. Der Einfluss der Banden – vor allem der falschen – stieg beängstigend und sorgte für eine unheilvolle Konzentration aus Gewalt und Gegengewalt. Er war froh, zu fünf der großen Banden gute Beziehungen zu haben. Aber das Aufkommen der Easy Rider machte ihm ernsthaft Sorgen. Dort hatte er keinen Fuß in der Tür. Bei den wenigen Bandenmitglieder, die er kannte, mochte er sich nicht blicken lassen, waren sie doch wenig freundschaftlich auseinandergegangen. Wenn die Entwicklung anhielt, musste er diese Gegend Weststadts über kurz oder lang verlassen und sich ein neues Betätigungsfeld suchen.
Allerdings machten ihm im Moment andere Dinge Sorgen. Um die Ecke biegend lief er mit vollem Schwung in eine Faust. Sein Kopf stieß in den Nacken, doch mit Mühe hielt er die Balance. Der nächste Schlag traf ihn am Kinn und schleuderte ihn zu Boden. Der metallische Geschmack des Blutes war nur die Ouvertüre. Die ersten Tritte erduldete er noch stumm, dann begann er zu schreien, verstummte erneut, als die Heftigkeit der Schläge zunahm. Der Schmerz brannte an unzähligen Stellen und er versuchte instinktiv, den Hieben auszuweichen, doch sie malträtierten ihn von allen Seiten. Wimmernd ertrug er Tritte, Schläge und nahm die Beschimpfungen nur am Rande wahr.
Irgendwann ließen sie endlich von ihm ab und durchsuchten seine Kleidung. Ein triumphaler Schrei als sie den Maronvorrat fanden, dann entfernten sich Schritte.
Er blieb mehr oder minder regungslos liegen. Ein ums andere Mal wurde ihm schwarz vor Augen, während Schmerzwellen durch seinen Körper brandeten.
Später, er wusste nicht, ob es Minuten oder Stunden waren, raffte er sich auf, ging erst schwankend, dann immer sicherer, die leere Straße entlang. Erneut packten ihn Krämpfe, hatte er Erscheinungen, seltsam unwirklich, wie aus einem Traum. Schwebende Frauen, halb durchsichtig, und flüsternde Stimmen, die in einer fremden Sprache vor sich hin fabulierten auf eine Weise, die ihm aus unerfindlichen Gründen obszön vorkam. Nach Ewigkeiten hatte er seine Bude erreicht, im dritten Stock einer der Mietskasernen. Seine bescheidene Bleibe, die aus zwei Zimmern bestand: Dem Schlafwaschraum und einem Wohnzimmer, das gleichzeitig sein persönlicher Poseidontempel war.
Er spürte erneut den reißenden Schmerz des Maronentzuges und war zu schwach, dagegen anzukämpfen und ließ sich fallen. Mit zitternden Händen suchte er nach seiner eisernen Reserve, schmiss Flaschen und Tuben um, bevor er endlich sein Päckchen fand und ungeduldig aufriss. Eine schnelle Prise und schon beruhigte sich sein Puls, die seltsamen Stimmen verstummten.
Jetzt, im Moment der Ruhe, durchfuhr es ihn allerdings siedend heiß. Die letzten beiden Marontrips waren die Hölle gewesen: entartete Beutelleute und eine geisterhafte Stadt. Wenig später eine blutüberströmte Frau, er mit dem Messer direkt über ihr. Die Erinnerung packte ihn, er stürzte ins Schlafbad und kotzte das Waschbecken voll. Als der Magen leer und die größte Panik damit fortgeschwemmt war, fiel sein entsetzter Blick in den Spiegel: blutunterlaufene Augen, das Gesicht zerschunden.
Mann, sehe ich Scheiße aus! Jasper, so kriegst du heute keine Frau mehr rum. So nimmt dich höchstens das Kuriosenkabinett.
Das war sein letzter Gedanke, bevor er das Bewusstsein verlor und zu Boden fiel.
2. Gabriel
Harte Musik drang aus den großen Boxen, und im Luftzug der Bässe wehte der allgegenwärtige Staub auf. Missmutig sah Gabriel auf den Schmutz hinunter. Er hatte sich in seine neue Bude noch nicht eingelebt. Ja, er glaubte sogar, dass ihm das nie gelingen würde.
Emilie!
Der Stich im Herz brachte ihn fast zum Wanken. Er stellte die Musik lauter, dann betrat er den kleinen Balkon und lehnte sich an das rostige Gitter.
Hatten wir einen Spaß. Jeden Tag Party, jeden Tag Abwechslung, ein aufregendes Leben, genau so, wie ich mir das jahrelang erträumt hatte. Musste sie so abstürzen? Maron! Jeden Tag Maron, dieses Teufelszeug. Wie ich dieses beschissene Pulver hasse.
Gabriel sah zu den verwinkelten Gassen runter, sah das rissige Pflaster, der allgegenwärtige Unrat, der die Gehsteige säumte. Er beobachtete die zahlreichen Männer und Frauen, die durch die Gegend liefen.
Wie viele von ihnen waren glücklich? Wie vielen von ihnen ging es wie ihm? Die große Liebe, die nach vier Jahren zerbrach, in einer heftigen Explosion angestauten Frusts. Sie hatte einen neuen, aber war das der Grund? Oder doch eher ihr Lebenswandel und seine Kritik daran?
Er konnte es einfach nicht ertragen. Dieser Sumpf aus Maron und Kriminalität, dieser teuflische Strudel, an den er seine große Liebe verloren hatte.
Emilie!
Der Gedanke schmerzte selbst heute noch.
Er schaute gen Himmel, der trüb vom Smog war. Gerade schickte sich die Sonne an, die letzten Reste der Nacht zu vertreiben. Ein neuer Tag begann, und er steckte immer noch fest, gefangen im Liebeskummer.
Das musste aufhören.
Gabriel straffte die Schultern und sah in die Ferne. Dort hinten, ein gutes Stück weit weg, war das Loreather. Dort würde heute das Festival stattfinden. Hingehen und abfeiern, so würde sein Tag ablaufen. Blut und Begierde, Rosenrot oder Sehnsucht, die ehrliche und harte Musik Weststadts war genau das richtige, um die trüben Gedanken wegzublasen.
Ja, er würde abfeiern gehen und wer weiß: Vielleicht lernte er heute seine neue Liebe kennen. Er spürte es förmlich. Heute war ein besonderer Tag. Ein ganz besonderer Tag. Heute würde etwas passieren. Und er beschloss, alles daran zu setzen, dass sich die Dinge in seinem Sinne entwickelten.
Scheiß auf Emilie! Schicksal, ich komme und pack dich am Schopfe!
3. Maria
Die Kneipe hatte ihre besten Tage schon hinter sich. Groß und verwinkelt wurde der vordere Teil von einer L-förmigen Theke beherrscht. Der Raum selbst besaß eine ähnliche Form, der lange Schenkel bot Platz für zahlreiche Sitzgelegenheiten, die im hinteren Teil aus plüschigen Sofas bestand.
Zum Essen war es etwas unbequem, trotzdem saß Maria hier am liebsten. Marek, der Wirt der Neuen Heimat, war ebenso in die Jahre gekommen wie seine Kneipe, doch sie kannte ihn schon lange und nutze die Räumlichkeit für Treffen, die einen heimlichen Charakter besaßen. Marek war verschwiegen, und zur Not konnte sie auch bei ihm anschreiben lassen. Ihre heutige Verabredung war kein Geheimnis, aber sie genoss die Atmosphäre und den leckeren Nachtisch.
Maria lugte durch den Schleier ihres schwarzen Haares und funkelte ihr Gegenüber belustigt an. „Agneta, du weißt, ich muss auf meine Figur achten. Und du weißt auch, dass ich bei diesen gefüllten Teigröllchen niemals nein sagen kann. Du bist gemein. Willst du mich mästen?“
Agneta strich eine Strähne ihres strohblonden Haares zurück, lehnte sich vor und stellte ein selbstgefälliges Lächeln zur Schau. „Du lebst jetzt. Also lass es dir schmecken. Außerdem brauchst du nach dem herzhaften Essen etwas Süßes, Kleine. Noch einen Dunklen zur Verdauung?“
Der Augenaufschlag Agnetas war verschwörerisch, verbarg aber die sanfte Ironie ihrer Worte nicht. Es war ihr übliches Ritual. Wenn Maria sich von Zeit zu Zeit mit ihrer Freundin zum Frühstück traf, uferte ihr Mahl immer wieder zur reinen Völlerei aus. „Jetzt nicht! Vielleicht nach dem Röllchen. Ich will noch auf das Festival und ein klarer Kopf schadet nicht. Die Musik spielt mindestens bis zum nächsten Morgen und die besten Sachen kommen spät. Da muss ich meine Kräfte einteilen.“
„Ach, das Konzert Weststadts. Als ob die Rosenbergs sich davon beeindrucken lassen. Nein, nicht wirklich. Sollte es eine der Gruppen Weststadts schaffen, werden sie in Oststadt unter Vertrag genommen. Wie immer. Die natürliche Auslese, dieses Pack wird immer reicher. Scheiß Bonzen da drüben! Es wird Zeit, dass die jemand auf die Hörner nimmt. Lynchen sollte man die. Ja, lynchen, dann wäre vielleicht Ruhe. Denen geht es einfach zu gut.
Oststadt wird von den Familien regiert und in Weststadt herrscht Anarchie. Einzig Neustadt bleibt Experimentierfeld und ist in seiner Zerrissenheit zwischen Ordnung und Chaos phasenweise noch gefährlicher als unser Teil der Stadt. Eine stabile Anarchie hat halt auch ihre Vorteile.
Ich sag dir was. Egal wie wir uns ereifern, es ändert sich eh nichts. Lass die Bonzen und Bosse machen, was sie wollen. Hauptsache mir geht es gut. Ich hab´ zu Essen, ich hab´ dich und kann mir auch sonst einiges an Annehmlichkeiten leisten. Also was soll´s? Scheiß drauf!“
Agneta wandte sich wieder dem Essen zu, für sie schien das Thema damit beendet zu sein. Ihr lag weder etwas an Musik noch an revolutionären Gedanken.
Maria fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und beobachte ihre Freundin beim Essen. Zu hastig, zu wenig Würde, so lautete ihr wenig gnädiges Urteil. Sie selbst zerschnitt das Teigröllchen mit langsamen Bewegungen und schob sich die kleinen Stücke anmutig in den Mund, kaute diese genüsslich und ohne die Geräusche, die ihr Gegenüber von sich gab.
Sie dachte über Agnetas Worte nach.
Es herrschte ein Status Quo in Silbermond. Oststadt, begrenzt von Rhyn im Osten und Mohyn im Westen, der die natürliche Grenze zu Weststadt bildete, hatte eine starre Ordnung. Verwaltung, Polizei, gewählte Volksvertreter, alles ging scheinbar seinen normalen Gang. Doch hinter dieser bürgerlichen Fassaden kontrollierten die Familien die Stadt und hatten sie unter sich aufgeteilt: Unterhaltung, Handwerk und Industrie, Prostitution, der Drogenmarkt und die offizielle Staatsmacht. Drüben konnte man nachts bedenkenlos vor die Tür gehen, ganz im Gegensatz zu dem Teil der Stadt, in dem sie wohnte. Früher, als ihre Mutter noch gelebt hatte, waren sie des Öfteren nach Oststadt rüber gegangen und hatten vornehm gespeist. Zeiten, in denen sie wohlhabend waren und Mutters Gewerbe wie geschmiert lief. Natürlich hatte niemand von diesen Ausflügen in den verhassten Teil der Stadt wissen dürfen. Viele wünschten sich insgeheim zwar deren Sicherheit und Glanz, doch nur die wenigsten würden dies auch offen zugeben. Wer etwas auf seinen Ruf gab, der redete schlecht über die Bonzen und blieb auf dieser Seite des Mohyn.
„Wann willst du denn zum Festival? Ist noch etwas Zeit für eine kleine Prise Maron?“ Agnetas Augen funkelten vor Gier. Sie war eindeutig über den Punkt hinaus, an dem das Maron positiven Einfluss ausübte. Schon länger wollte sie mit ihrer Freundin ein ernsthaftes Gespräch über ihren Konsum führen, aber heute war Maria nicht in der Stimmung für ein solches Thema. Der bevorstehende Festivalbesuch stimmte sie gnädig und sie reichte der Freundin den Beutel mit ihrem Vorrat, selbst Lust auf ein wenig Rausch und mehr verspürend. Zwei kleine Dunkle kamen, die sie zuprostend die Kehle hinunterstürzten, bevor sie gemeinsam eine kleine Dosis Maron zu sich nahmen. Und es dauerte nicht lange bis die Wirkung einsetzte.
Das Gesichtsfeld verengte sich, die Geräuschkulisse aus Musik, Stimmengewirr und Gläserklirren trat in den Hintergrund, seltsam dumpf, als hätte sie jemand in Watte gepackt. Ein befreiendes Gefühl kam auf, sie stöhnte vor Glück und Lust, während Wellen der Glückseligkeit sich in ihrer Brust ausbreiteten und den Magen bis hinab in die Gedärme wanderten. Ein Kribbeln erfasste Besitz von ihren Schenkeln, wanderte weiter in die Mitte und erregte das Zentrum ihrer Weiblichkeit.
Zwischen zusammengekniffenen Lidern sah sie Agneta an, der es genau so erging, wie sie an dem lüsternen Funkeln ihrer blauen Augen sah. Sie rückten zueinander und streichelten sich sanft Arme und Beine. Die Berührungen schmerzten, brannten auf der Haut und lösten gleichzeitig Schauer der Hitze aus. Wellen der Erregung jagten durch Marias Körper. Sie war erregt bis in die Fingerspitzen. Ihre Brustnippel wurden hart, fast schmerzhaft, und als Agnetas Hände über ihre Brust wanderten, explodierte die Lust förmlich in ihr. Sie nahm Agnetas Kopf in die Hände und küsste ihre Freundin lang und intensiv. Ihre Zungen zerschmolzen zu einem Feuer der Begierde. Agneta drängte sich näher an Maria ran, lag schwer auf ihrer rechten Seite. Ihre Hände wanderten tiefer, in den Schritt, die Hitze erreichte ihren Höhepunkt. Als Maria die Schenkel weiter öffnete und nach Agnetas Hand gierte, löste sich die Freundin auf wie ein Dunstschleier in einem plötzlichen Windstoß.
Schlagartig fühlte sich Maria ernüchtert, die Erregung fiel von ihr ab wie eine alte Haut und wich einem unangenehmen kalten Schauer. An Stelle Agnetas sah sie einen weißen Vogel, kaum eine Handspanne lang mit schnell schlagenden Flügeln. Der Vogel sah sie aus hellblauen Augen an und sie wusste, er würde ihr den Weg zeigen. Ein Sog ging von ihm aus, der sie fortzog und sie wusste, wohin sie musste.
Dann zerfaserte die Vision und sie kehrte in die Wirklichkeit zurück. Agnetas Zunge zog sich zurück, die Lippen lösten sich und zurückschwankend sah die Freundin sie fragend an, immer noch benebelt von der Droge.
„Was ist los? Was ist mit dir? Magst du mich nicht mehr? Was habe ich getan?“
Maria fiel auf die Bank zurück, eine bleierne Leere in sich spürend. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn, mit einer fahrigen Bewegung wischte sie ihn weg. Der Rausch des Maron fiel von ihr ab wie trockener Sand. Ein schaler Geschmack blieb in ihrem Mund und schmeckte bitter. Hastig spülte sie ihn mit ein wenig Wein hinunter, doch es half wenig.
Verwundert stellte sie fest, dass sie am ganzen Körper zitterte. Agnetas Blicke wurden immer besorgter, je länger das Schweigen zwischen ihnen andauerte.
Mit einem Seufzen riss sich Maria zusammen und unterdrückte das Zittern. Sie sah die Freundin verzeihend an. „Ach Agneta! Es tut mir so leid. Wir hätten so schöne Stunden haben können. Aber es ist etwas passiert.
Ich hatte eine Vision. Eine düstere und bedrückende Vision. Es wird etwas Schlimmes passieren. Aber da ist jemand, der mir den Weg weisen wird.
Sei mir nicht böse. Ich wäre noch gerne mit zu dir gegangen. Aber meine Stimmung ist hin, weggeflossen wie Regen, der in den Boden sickert.
Ach Mensch, ich hatte mich so auf die gemeinsamen Stunden gefreut. Ein wenig kuscheln und mehr. Jetzt ist der Zauber des Moments zerstört. Nein, ich kann nicht mehr warten. Ich muss weg. Es ruft mich, ganz tief in mir drinnen. Verzeih mir! Es geht nicht anders. Wir sehen uns später, ich verspreche es dir.“
Sie stand auf, drückte der verdutzen Agneta eine Abschiedskuss auf die Wange und verließ die Neue Heimat.
Heute stand ihr ein ganz besonderer Tag bevor. Das spürte sie deutlich. Und sie musste sich beeilen. Das Treffen stand kurz bevor.
4. Gabriel
Hörst du mich rufen? Den Schlag meines Herzens? Spürst du die Anziehungskraft? Meine Magie, die dich gefangen hält? Die dich anzieht und abstößt? Es gibt kein Entkommen. Du bist für immer mein. Silbermond ist mein Name und ich bin der Ort deiner Geburt und werde dein Grab. Gib dich mir hin und lege alle Menschlichkeit ab.
Die Gitarren spielten einen einfachen Rhythmus, begleitet vom Takt des Trommlers. Eine rauchige Stimme sang in sanfter Melodie und stand dazu im krassen Gegensatz zum dunklen Inhalt der Lyriks.
Liebling! Komm zurück. Zurück zu mir, dem dunklen Teil deiner Begierde. Der Puls meines Lebens ist in dir und ruft dich. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wohin du gehörst? Weißt du, wohin du gehen willst? Komm bald zurück in meinen Schoß. Komm zu mir.
Die Musik war ergreifend. Ergreifend wie die Show der Vier. Bunt gekleidet, hohe Schuhe tragend und die Gesichter geschminkt, war Blut und Begierde der letzte Schrei Weststadts. Die zugedröhnte Menge tanzte ausgelassen, und das schon seit Stunden. Die ersten Maronleichen lagen herum und weilten in fernen Sphären, während ihr Körper im Matsch des Platzes rund um das Loreather vor sich hin vegetierte.
Seine Beine bewegten sich fast selbstständig und folgten der eingängigen Musik, die langsam an Fahrt gewann, intensiver wurde, das Publikum antrieb.
Komm! Komm! Komm!
Die Schonzeit ist vorbei. Drück dich an meine Brust. Drück dich tief und fest. Erleb den Blues meines Seins. Erleb die dunkle Begierde. Die Lust, das Leben, die Faszination, das Feuer.
Komm! Komm! Komm!
Sprich mit mir! Komm zu mir! Lieb mich! Nimm mich! Halt mich! Fessle mich! Verlier dich in mich!
Die akustischen Gitarren lagen irgendwo auf den Stufen des Loreather. Zwei elektrische Gitarren übernahmen und lieferten sich ein hypnotisches Duell, die rauchige Stimme schwoll an zum Orkan.
Blut! Blut! Blut!
Du kommst aus meinem Schoß. Du endest in meinem Schoß.
Lauf weg, egal, ich bekomme dich.
Sinnlos!
Du endest, ob du willst oder nicht.
Hier!
Blut! Blut! Blut!
Du kommst aus meinem Schoß. Du endest in meinem Schoß.
Lauf weg, egal, ich bekomme dich.
Sinnlos!
Du endest, ob du willst oder nicht.
Hier!
Aus tausend Händen erklang das Klatschen, wild, heftig, immer schneller werdend. Selbst die Maronleichen erhoben sich, erst unwillig, dann gefangen von der Magie der Blut und Begierde.
Das zarte Wesen näherte sich ihm offen, ohne Hemmungen. Ihre kleinen Brüste wippten im Takt der Musik, ihre Augen strahlten voller Glück und Maron. Die Augen groß und rund auf ihn geheftet, verschlangen ihn förmlich. Sie drehte sich und presste sich an ihn.
Die beiden tanzten, hüpften im Gleichklang. Sie vor ihm, rieb ihren süßen Hintern an ihm. Sein Blut kochte nicht allein wegen der Musik. Er schlang die Arme um ihre Hüften, reckte sie empor. Sie schrie vor Begeisterung und wedelte mit den Armen in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit der Band auf sich zu lenken. Gleichzeitig schielte sie zu ihm, sehnsüchtig, von Erregung gepackt.
Er setzte sie ab, sie tanzten umschlungen, ihre Körper verdrehten sich ineinander, knisternd entlud sich die Energie zwischen ihnen. Sie rückten eng aneinander, küssten sich, die Hände wanderten über den Körper des anderen, jegliche Hemmung verlierend, erforschten verbotene und weniger verbotene Zonen, während die Musik an Intensität zunahm, die Fesseln der Vernunft sprengend, weiter ansteigend bis zu einem orgiastischen Höhepunkt. Mit einem Kreischen endete die Musik und es blieb für einen kurzen Moment Stille, bevor der Mob seine Begeisterung zum Ausdruck brachte.
Sie sanken beide zu Boden, klammerten sich aneinander, als hätten sie panische Angst, sich zu verlieren, den Zauber des Augenblicks zu zerstören, diese vollkommene zweisame Einigkeit.
Die Musik setzte erneut ein, ein kurzes Intermezzo, dann ein letzter, disharmonischer Ton. Blut und Begierde winkten ein letztes Mal ins Publikum, bevor sie die Bühne des Loreather verließen. Der Mob tobte noch minutenlang, während sich die beiden weinend festhielten, immer wieder küssten, umarmten, streichelten.
Nur wenig später kehrte die graue Wirklichkeit zurück. Sie sah ihn an. Die braunen Augen blickten traurig und ihre Arme sanken herunter. Sie löste sich von ihm, stand auf und verschwand in der Menge ohne ein Wort des Abschieds. Erschlagen blieb er zurück, erregt, eine qualvoll unerfüllte Lust in sich tragend.
Ich fühle mich einsam. Mein Herz zerbricht. Wieso hat sie mir das angetan? Womit habe ich das verdient?
Eine einsame Träne rann seine Wange hinunter. Genau in dem Moment, als die salzige Flüssigkeit seinen Mundwinkel erreichte, begann die nächste Band mit ihrer Show. Kreischende Gitarren, donnernde Trommeln und ein dunkler Gesang kennzeichneten Gib mir ´ne Chance, die zweite Band des Festivals. Diesmal blieb die Menge ruhiger, Gib mir ´ne Chance bot einen ruhigeren Sound und war nicht so angesagt wie Blut und Begierde. Gabriels Blicke wanderten über das Festivalgelände.
Das Loreather war eine graue Betonschüssel, die zu 240 Grad geschlossen war, der Rest bot offen der riesigen Menge Platz. Eine zwei Meter hohe Mauer grenzte den Publikumsbereich ab. Darüber befand sich der Absatz mit der fünfköpfigen Band und ihrem Equipment, weiter oben setzte sich die Schüssel in Stufen fort. In die Flanken zum Publikumsbereich waren riesige Boxen eingelassen, die für eine unglaublich laute, aber nichtsdestotrotz gute Akustik sorgten.
Der Platz selbst wurde von unzähligen Menschen gesäumt, die allesamt gut drauf waren und das kostenlose Event genossen. Natürlich lag es in erster Linie an der Musik, aber ein Großteil der Menge schwebte auch aus anderen Gründen in fernen Sphären, weit weg vom Loreather.
Vor ihm entwickelte sich ein Tumult. Ein Mann, etwa Eins Achtzig, mit lockigem, blondem Haar, schien der Grund zu sein. Sein geschundenes Gesicht sprach ebenso Bände wie die Gestik, mit der er das Pärchen vor sich anmachte. Der Typ stand vor ihnen, schrie sie mit hochrotem Kopf an, die Hände drohend erhoben.
Einem Impuls folgend beschloss Gabriel einzugreifen, bevor der Konflikt eskalierte. Er packte den Mann bei der Schulter, griff seinen Arm und zog ihn vom Ort des Geschehens weg. Dieser riss sich mit einer wütenden Geste los.
„Lass mich“, brüllte der Fremde, das Gesicht wutverzerrt. „Siehst du nicht…“
„Ich sehe, dass du unschuldige Leute anmachst“, unterbrach ihn Gabriel unwirsch. „Das Pärchen ist im Gegensatz zu dir friedlich. Und ein Blick in dein Gesicht zeigt mir, dass dies nicht der erste Stress des Tages ist. Keine Ahnung, auf welchem Trip du dich befindest, aber es wird Zeit, dass du runter kommst. Bleib mal locker und hol tief Luft. Einfach bis drei Zählen.“
Der Mann, die ganze Zeit gestikulierend, verharrte plötzlich bewegungslos, einen undeutbaren Ausdruck im Gesicht. Dann klärten sich seine Züge und er sah eindeutig verzweifelt drein.
„Scheiße Mann, schon wieder. Die waren ganz normal? Keine entarteten Beutelleute?“
Ein fragender Blick aus blauen Augen ließ Gabriel stutzen. Es war etwas in dem Blick, das nicht zu einem Krawallmacher passte. Und da war noch mehr. Etwas wie beginnender Wahnsinn? Gabriel fragte sich, auf was er sich da eingelassen hatte als er sich einmischte.
„Hier sind keine Beutelleute. Das einzige, was du hier findest, sind durch geknallte Typen, die randvoll mit Alkohol oder Maron sind.“
„Ja…ähm…Ja, jetzt ist alles wieder normal. Sorry, ich glaub, ich muss mich entschuldigen, aber irgendwas geht hier vor. Ist echt krass. Das glaubst du mir nie.“
„Vielleicht solltest du mal nüchtern werden. Der Stoff scheint übel gewesen zu sein.“
„Ja, das hat was. Nüchtern. Ja, das müsste ich werden. “
Der Fremde bog sich vor Krämpfen, das Gesicht verzerrt, bevor er sich wieder entspannte. Gabriel trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Das konnte ja heiter werden.
Plötzlich mischte sich ein bunt gekleideter Mann ein. Schwarze Rastalocken, gelbes Hemd, die Hose grün, eine rote Kopfbedeckung,
„Ey, Ihr da. Ihr komischen Vögel. Schlechtes Zeug geraucht? Ihr steht im Weg. Wir können nichts sehen und das ist echt krass. Mensch, Alter, Gib mir ´ne Chance ist unsere absolute Lieblingsband. Mir schwillt der Kamm, glaub mir. Also, verpisst euch oder wollt ihr eine auf die Fresse? Was ziehst du für ein Gesicht?“
Der Typ rückte näher, baute sich vor dem Fremden auf, wackelte mit seinen Gliedmaßen. Das sollte wohl cool aussehen. Gabriel stöhnte unwillkürlich auf. Er sah an dem Typen vorbei und erkannte den wahren Umfang des Dilemmas. Sie waren zu fünft, und dass diese Typen unverrichteter Dinge wieder abziehen würden, konnte man getrost vergessen. Ein Blick in die Augen des Fremden zeigte ihm, dass dieser die Situation ebenso einschätzte.
Hunderte, ach was, tausende Menschen lungerten hier rum und es musste ausgerechnet ihn treffen. Was um alles in der Welt hatte er verbrochen? Hatte er die letzte Zeit nicht schon genug Scheiße an den Schuhen kleben?
Er war selbst schuld.
Als der Sprecher mit seiner braunen Pranke nach dem Fremden griff, wich dieser zur Seite und schlug ihm ohne Vorwarnung brutal ins Gesicht. Es knackte und aus der gebrochenen Nase floss Blut. Der Fremde trat nach, versenkte seinen Fuß in dessen Unterleib, packte Gabriel und zog ihn hinter sich her.
„Renn! Los! Wir müssen hier weg. Den Menschenschlag kenne ich. Die lassen nicht mit sich diskutieren. Und ich will mir nicht ausmalen, was die mit uns machen, wenn die uns zwischen ihre schmierigen Finger bekommen.“
Gabriel ließ sich nicht zweimal bitten. Sie liefen durch die Menge weg von der Bühne, den direktesten Weg nehmend. Nach wenigen hundert Metern drehte er sich rum und fluchte lauthals, da ihnen die fünf auf den Fersen blieben.
„Vergiss es!“, sprach der Fremde aus, was Gabriel auch schon eingesehen hatte. „Die geben so schnell nicht auf. Dieses Pack hat Blut geleckt. Haben nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Muss natürlich ausgerechnet uns erwischen. Nehmen wir die Beine in die Hand und sehen zu, dass wir Land gewinnen. Ich heiße übrigens Jasper.“
„Na, klasse. Ich heiße Gabriel und freue mich über den Stress, den ich dir verdanke“, presste er mühsam während des Rennens vor.
Hinter ihnen hörte er wütende Schreie. Ihre Verfolger preschten weniger rücksichtsvoll durch die Menge und holten so langsam auf.
„Sie kommen näher.“
„Ich weiß.“
Endlich hatten sie das Gelände überquert und rannten in die nächstbeste Straße. Der Asphalt war rissig und voller Löcher, die Flucht verkam zu einem Hindernislauf. Ein falscher Schritt und das Pack wäre über ihnen.
Sie wechselten die Straßen, bogen links ab, rechts, kreuz und quer, in der Hoffnung, ihre Verfolger zu verwirren, die Schritte noch beschleunigend, wenn dies überhaupt ging. Gabriel brannten die Lungen, sein Brustkorb pumpte wie ein Blasebalg, während er keuchend versuchte mit Jasper Schritt zu halten. Es ging mal steil eine Gasse rauf, dann hetzten sie wieder den harten Beton hinunter. Eine Verschnaufpause wurde ihnen nicht gegönnt, die Verfolger blieben ihnen dicht auf den Fersen. Sie rannten weiter, wechselten die Straßen und Richtungen immer wieder, so dass er vollkommen die Orientierung verlor. Die Gegend wurde düsterer, die Fassaden verwahrloster. Wo waren sie hier nur gelandet?
Vier, fünf Straßen weiter verlangsamte Jasper seine Schritte, dankbar folgte Gabriel seinem Beispiel. Ein Blick zurück, doch von den Verfolgern war nichts zu sehen.
„Ich glaube, wir haben sie abgehängt.“
5. Jasper
Jasper lauschte der heiseren Stimme, während sein Atem versuchte, sich zu beruhigen. Im Moment sah es so aus, aber er war sich da alles andere als sicher. Diese Typen waren zäh und gaben so schnell nicht auf. Ganz im Gegenteil, sie hatten wohl eher Spaß an der Hetzjagd, die sie veranstalteten.
Er musterte sein Gegenüber. Gabriel war fast eins neunzig groß, ein Hüne mit breiten Schultern und kräftiger Muskulatur. Sein Gesicht wirkte etwas streng, ein kantiges Kinn und kräftige Wangenknochen. Seine braunen Augen hatten einen harten Ausdruck, aber Jasper glaubte, dass das täuschte. Warum sonst sollte er sich am Loreather eingemischt haben?
Gabriel trug das dunkelblonde Haar kurz und war schätzungsweise etwas jünger als er selbst.
Jasper fühlte immer noch das Grauen in sich. Die Nacht war kurz gewesen. Vor dem Waschbecken zusammengebrochen hatte er rund drei Stunden auf dem Boden geschlafen, bevor ihn der Lärm einer vorbei streunenden Gang geweckt hatte, deren wildes Geschrei selbst durch das geschlossene Fenster zu hören war. Der Versuch, sich ins Bett zu legen und noch ein wenig Ruhe zu finden, scheiterte kläglich. Eine unendlich lang erscheinende Stunde wälzte er sich hin und her, während seine Gedanken rasten. Dann stand er auf, versorgte die Wunden in seinem Gesicht und zog durch die Gegend in dem Versuch, sich abzulenken. Sich an das Festival erinnernd war sein Ziel klar. Bei Blut und Begierde erwachten seine Lebensgeister. Leider auch seine Sehnsucht nach Maron, und mit dem Trip kam eine erneute, wenn auch abgemilderte Version der vergangenen Erscheinungen.
Wie immer! Kaum bin ich einigermaßen nüchtern, kommt das schlechte Gewissen. Oder bin ich noch gar nicht klar und dauerbreit? Maron ist ein Teufelszeug, die Wirkung kommt und geht, keine Ahnung, welche Regel dahintersteckt. Im Moment soll es mir egal sein. Ich bin froh, wieder bei Verstand zu sein.
Das arme Pärchen. Für die bin ich ein Irrer. Na, vielleicht nicht nur für die. Es ist mein maronzerfressener Verstand, nicht der Äther, der sich öffnet. Ja, Jasper, es gibt keine Welt, die sich öffnet, wenn du auf einem Trip bist. Du bist einfach nur irre. Ein runtergekommener Junkie, dessen beste Zeiten vorbei sind. Grüß dein Grab, Jasper, es winkt schon. Grüß es!
Er blickte sich um: Rosenstraße prangte an dem zweistöckigen Haus in blauen geschwungenen Lettern. Geschriebene Straßennamen fand man nur selten in Weststadt, und so hatten viele Gassen im Volksmund mehrere Namen. Die Rosenstraße gehörte wohl nicht dazu.
„Lass uns weitergehen“, brachte er noch hervor, bevor die Krämpfe erneut begannen und er sich vor Schmerzen krümmte. Sein Gesichtsfeld verzog sich, die Farben veränderten ihre äußere Erscheinung, reduzierten sich auf rot und blau, während flüssiges Magma durch seine Eingeweide floss. Wie durch Watte hörte er Gabriel reden, ohne den Sinn der Worte zu verstehen. Geisterhafte Stimmen vollführten ein unheimliches Konzert, peinigten seine Sinne. Er presste die Hände auf die Ohren, doch das brachte keine Erleichterung. Wimmernd sank er in die Knie, den Wunsch nach Maron ganz tief in sich drin, und brabbelte sinnlose Worte vor sich hin.
Plötzlich erschien ein weiches, angenehmes Licht. Es kam von oben, immer schneller nach unten sinkend. Seinen Blick dem Licht zugewandt, kämpfte er mit weiteren Krämpfen, während im Hintergrund Gabriels Stimme unverständliche Worte murmelte.
Dann sah er Renata, seltsam unwirklich, einen halben Meter über dem Boden schwebend. Sie stand vor ihm und der Schmerz ließ nach. Überrascht stellte er fest, dass ihre Verletzungen verschwunden waren. Sie sah genauso aus, wie er sie auf dem Wandaplatz kennen gelernt hatte. Das blonde, strähnige Haar hing ungepflegt um ihren kleinen Kopf. Sie schaute selbstbewusst, gleichzeitig verloren und abwesend. Ein Blick, wie er ihn niemals zuvor gesehen hatte.
„Wer ist das?“, hörte er Gabriel fragen.
„Renata“, hauchte er zurück, einen schweren Kloß in der Kehle.
Ihm liefen Tränen über die Wangen. Tränen geboren aus Verzweiflung, aber auch aus Freude, einer wirklich tiefen Freude über ihrer Rückkehr. Sie war lebendig, die Last der Schuld, die er seit Stunden mit sich trug, fiel von ihm ab. Er schluchzte wie ein kleines Kind und stammelte:
„Danke, danke, danke! Du lebst. Ich bin so froh, so erleichtert. Aber…ich verstehe nicht…du warst…“
„Ich bin, Jasper, ich bin. Nichts ist ungeschehen, aber vergeben. Alles folgt einem höheren Plan. Das Schicksal hat es so bestimmt.“
„Aber was bedeutet das? Wer oder was um alles in der Welt bist du, Renata? Was machst du hier?“
In ihre Augen trat ein trauriger Ausdruck, ihre Mundwinkel zuckten und man sah den inneren Kampf, die Gefühle, die sie bewegten. Nach wenigen Momenten entspannten sich ihre Gesichtszüge und ein sanftes Lächeln umspielte ihre Lippen, während sie ihn immer noch mit diesem entrückten Blick ansah.
„Ich will euch helfen, denn ihr müsst eine Aufgabe erfüllen. Etwas von größter Wichtigkeit. Geht die Straße weiter entlang, dort findet ihr ein allein stehendes Haus mit blauem Anstrich. Dort wohnt Maria, sie wird euer Schicksal bestimmen.“
Mit diesen Worten verblasste Renata und hinterließ zwei Männer, die sich ungläubig ansahen.
„Was war das?“, fragte Gabriel, doch Jasper schüttelte nur ratlos den Kopf.
„Ich weiß es nicht.“
Minutenlang waren sie unfähig, sich zu regen, immer noch gebannt von der Erscheinung Renatas. Dann traf Jasper eine Entscheidung.
„Lass uns gehen! Wir haben etwas zu erledigen.“