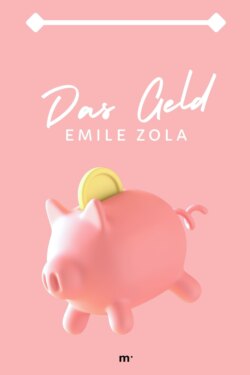Читать книгу Das Geld - Émile Zola - Страница 5
Zweites Kapitel
ОглавлениеAls Saccard nach seinem letzten, unseligen Grundstücksgeschäft sein Palais am Parc Monceau aufgeben und seinen Gläubigem überlassen mußte, um eine größere Katastrophe abzuwenden, hatte er zunächst den Gedanken, sich zu seinem Sohn Maxime zu flüchten. Dieser bewohnte seit dem Tode seiner Frau, die auf einem kleinen Friedhof in der Lombardei ruhte, ganz allein ein Haus in der Avenue de lʼImpératrice, wo er sich sein Leben mit einem klugen und unbändigen Egoismus eingerichtet hatte; als ein Bursche von schwächlicher Gesundheit, durch das Laster frühzeitig gereift, verzehrte er dort in untadeliger Haltung das Vermögen der Toten. Er schlug es seinem Vater rundweg ab, ihn bei sich aufzunehmen, damit alle beide weiter in gutem Einvernehmen leben könnten, wie er mit verschmitzter Miene lächelnd erklärte.
Seitdem dachte Saccard an eine andere Zuflucht. Er wollte schon ein kleines Haus in Passy mieten, das bürgerliche Heim eines Händlers, der sich zurückgezogen hatte, da fiel ihm ein, daß das Erdgeschoß und das erste Stockwerk des Palais dʼOrviedo in der Rue Saint-Lazare noch immer nicht vermietet waren, denn Türen und Fenster waren verschlossen. Die Fürstin dʼOrviedo bewohnte seit dem Tode ihres Mannes drei Zimmer im zweiten Stock und hatte nicht einmal an der grasüberwucherten Toreinfahrt ein Schild anbringen lassen. Am anderen Ende der Vorderfront führte eine niedrige Tür über einen Dienstbotenaufgang in das zweite Stockwerk. Und oft hatte er sich bei den geschäftlichen Besuchen, die er der Fürstin abstattete, über die Nachlässigkeit gewundert, die sie an den Tag legte, wenn es darum ging, einen angemessenen Nutzen aus ihrem Grundstück zu ziehen. Aber sie schüttelte den Kopf, sie hatte in Geldfragen ihre eigenen Vorstellungen. Dennoch willigte sie sofort ein, als er bei ihr vorsprach, um auf seinen Namen zu mieten, und überließ ihm für eine lächerliche Miete von zehntausend Francs die fürstlich eingerichteten prachtvollen Räume im Erdgeschoß und ersten Stockwerk, die sicherlich das Doppelte wert waren.
Alle Welt sprach noch von dem Prunk, den der Fürst dʼOrviedo zur Schau gestellt hatte. Als er aus Spanien gekommen und in Paris inmitten eines Millionenregens gelandet war, hatte er in der fiebrigen Hast seines ungeheuren finanziellen Glücks zunächst einmal dieses Palais gekauft und restaurieren lassen, bis er nach seiner Erwartung die Welt mit einem Palast aus Gold und Marmor in Erstaunen setzen könnte. Das Bauwerk stammte aus dem vorigen Jahrhundert, eines jener Lusthäuser, wie sie galante Herren inmitten weitläufiger Gärten errichten ließen; aber es war teilweise abgerissen und in strengeren Proportionen wiederaufgebaut worden und hatte so von seinem einstigen Park nur einen breiten Hof bewahrt, den Ställe und Remisen säumten und der durch die geplante Rue du Cardinal-Fesch bestimmt bald ganz verschwinden würde. Der Fürst hatte dieses Haus aus der Erbschaft eines Fräulein Saint-Germain erworben, deren Grundbesitz sich einst bis zur Rue des Trois- Frères erstreckte, der früheren Verlängerung der Rue Taitbout. Übrigens hatte das Palais seinen Eingang in der Rue Saint-Lazare behalten, neben einem großen Gebäude aus der gleichen Zeit, der einstigen Folie- Beauvilliers, das die Beauvilliers infolge eines langsamen Ruins noch bewohnten; und diesen gehörte ein Rest des herrlichen Gartens mit prächtigen Bäumen, die bei der nahe bevorstehenden baulichen Veränderung des Viertels ebenfalls zum Verschwinden verurteilt waren.
Trotz eines völligen Bankrotts schleppte Saccard einen Troß von Dienstboten hinter sich her, die Trümmer seines allzu zahlreichen Personals, einen Kammerdiener, einen Küchenchef und dessen Frau, die für die Wäsche zu sorgen hatte, eine weitere Frau, die Gott weiß warum geblieben war, einen Kutscher und zwei Stallburschen; er belegte die Pferdeställe und Remisen mit Beschlag, brachte dort zwei Pferde und drei Wagen unter und richtete im Erdgeschoß einen Speiseraum für seine Leute ein. Er war der Mann, der, obwohl er keine fünfhundert Francs bares Geld in seiner Kasse hatte, auf großem Fuße lebte, als hätte er zwei- oder dreihunderttausend Francs im Jahr. So nahm es nicht wunder, daß er mit seiner Person die weitläufigen Zimmerfluchten im ersten Stockwerk ausfüllte, die drei Salons, die fünf Schlafzimmer, ganz zu schweigen von dem riesigen Speisesaal, wo man eine Tafel für fünfzig Gedecke aufstellen konnte. Dort öffnete sich früher eine Tür auf eine Innentreppe, die in das zweite Stockwerk führte, in einen anderen, kleineren Speisesaal; als die Fürstin vor kurzem diesen Teil des zweiten Stocks an einen Ingenieur, Herrn Hamelin, vermietete, einen Junggesellen, der mit seiner Schwester zusammen wohnte, hatte sie die Tür einfach durch zwei starke Schrauben verschließen lassen. Sie teilte sich so mit diesem Mieter in den ehemaligen Dienstbotenaufgang, während Saccard allein die große Freitreppe benutzte. Er möblierte einige Zimmer teilweise mit den Resten seiner Einrichtung vom Parc Monceau, ließ die anderen leer, und trotzdem gelang es ihm, diesen Zimmerfluchten mit ihrem traurigen, kahlen Mauerwerk, von dem eine eigensinnige Hand nach dem Tode des Fürsten sogar die letzten Tapetenfetzen abgerissen zu haben schien, Leben zurückzugeben. Und er konnte von neuem seinen Traum von einem großen Vermögen beginnen.
Die Fürstin dʼOrviedo war damals eine der seltsamsten Erscheinungen von Paris. Vor fünfzehn Jahren hatte sie sich darein geschickt, den Fürsten, den sie überhaupt nicht liebte, zu heiraten, um einem ausdrücklichen Befehl ihrer Mutter, der Herzogin de Combeville, zu gehorchen. Zu jener Zeit stand dieses junge Mädchen von zwanzig Jahren im Rufe großer Schönheit und Klugheit, sie war sehr fromm und ein wenig zu ernst, obwohl sie die Gesellschaft leidenschaftlich liebte. Sie wußte nichts von den sonderbaren Geschichten, die über den Fürsten im Umlauf waren, von den Ursprüngen seines königlichen Vermögens, das auf dreihundert Millionen geschätzt wurde, von einem ganzen Leben fürchterlicher Räubereien, die er nicht mehr im Dunkel des Waldes ausgeführt hatte, mit bewaffneter Hand wie die adligen Abenteurer von einst, sondern als untadeliger moderner Bandit im hellen Sonnenlicht der Börse, in den Taschen der leichtgläubigen armen Leute, inmitten von Zusammenbruch und Tod. In Spanien und hier in Frankreich hatte sich der Fürst zwanzig Jahre lang seinen Löwenanteil an allen großen Schurkereien geholt, die zur Legende geworden sind. Obwohl die Fürstin nichts von dem Schmutz und dem Blut ahnte, aus dem er so viele Millionen zusammengerafft, hatte sie bei ihrer ersten Begegnung einen Widerwillen empfunden, den nicht einmal ihre Frömmigkeit überwinden konnte; und bald gesellte sich zu dieser Abneigung ein dumpfer, wachsender Groll, kein Kind aus dieser Ehe zu haben, die sie aus Gehorsam auf sich genommen hatte. Die Mutterschaft hätte ihr genügt, sie liebte Kinder über alles, und es kam so weit, daß sie diesen Mann haßte, weil er nicht einmal die Mutter in ihr befriedigen konnte, nachdem er die Liebende zur Verzweiflung gebracht hatte. Zu diesem Zeitpunkt stürzte sich die Fürstin in einen unerhörten Luxus, sie blendete Paris mit dem Glanz ihrer Feste und führte ein verschwenderisches großes Haus, das die Tuilerien39, wie es hieß, mit Eifersucht erfüllte. Dann plötzlich, am Tag nach dem Tode des Fürsten, den ein Schlaganfall niedergestreckt hatte, versank das Palais in der Rue Saint-Lazare in vollkommene Stille und völlige Finsternis. Kein Licht mehr, kein Lärm mehr, die Türen und die Fenster blieben geschlossen; es verbreitete sich das Gerücht, die Fürstin habe das Erdgeschoß und das erste Stockwerk kurzerhand ausgeräumt und sich wie eine Einsiedlerin in drei kleine Zimmer des zweiten Stockes zurückgezogen, mit einem ehemaligen Stubenmädchen ihrer Mutter, der alten Sophie, die sie aufgezogen hatte. Als sie wieder auftauchte, trug sie ein einfaches schwarzes Wollkleid; das Haar unter einem Spitzentuch verborgen, war sie noch genauso klein und rundlich mit ihrer schmalen Stirn, ihrem hübschen runden Gesicht und den Perlenzähnen zwischen den zusammengepreßten Lippen; aber sie hatte schon den gelben Teint, das stumme, einem einzigen Willen ergebene Gesicht einer seit langem im Kloster eingesperrten Nonne. Sie war erst dreißig Jahre alt und lebte seitdem nur noch für die großen Werke der Barmherzigkeit.
In Paris war die Überraschung groß, und es gingen allerlei merkwürdige Geschichten um. Die Fürstin hatte das gesamte Vermögen geerbt, die berühmten dreihundert Millionen, mit denen sich sogar der Lokalteil der Zeitungen befaßte. Und es bildete sich schließlich eine romantische Legende heraus. Ein Mann, ein schwarz gekleideter Unbekannter, so hieß es, war eines Abends, als die Fürstin zu Bett gehen wollte, plötzlich in ihrem Zimmer erschienen, ohne daß sie je erfuhr, durch welche Geheimtür er hatte eintreten können. Was dieser Mann ihr gesagt hat, weiß niemand auf der Welt, aber er muß ihr wohl den abscheulichen Ursprung der dreihundert Millionen enthüllt und ihr vielleicht den Schwur abverlangt haben, so viele Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, wenn sie schreckliche Katastrophen vermeiden wolle. Dann war der Mann verschwunden. Seit fünf Jahren war sie nun Witwe, aber gehorchte sie tatsächlich einem Befehl aus dem Jenseits, oder hatte sich einfach ihr Anstandsgefühl empört, als sie die Akte ihres Vermögens in die Hand bekam? Die Wahrheit war, daß sie nur noch in einem brennenden Fieber des Verzichts und der Wiedergutmachung lebte. Bei dieser Frau, die keine Liebende gewesen war und die nicht hatte Mutter sein können, entfalteten sich alle verdrängten Zärtlichkeiten, vor allem die verkümmerte Liebe zum Kind, zu einer echten Leidenschaft für die Armen, Schwachen, Enterbten, Leidenden, für all jene, deren gestohlene Millionen sie zu besitzen glaubte und denen sie in einem Almosenregen alles königlich zurückerstatten wollte. Seitdem bemächtigte sich ihrer eine fixe Idee, der Nagel der Besessenheit drang ihr in den Schädel: sie betrachtete sich nur noch als einen Bankier, bei dem die Armen dreihundert Millionen hinterlegt hatten, damit sie zu ihrem Besten verwendet würden; sie war nur noch ein Buchhalter, ein Geschäftsführer, der in Zahlen lebte inmitten eines Völkchens von Notaren, Arbeitern und Architekten. Außerhalb hatte sie ein richtiges großes Büro mit etwa zwanzig Angestellten eingerichtet. Zu Hause, in ihren drei engen Zimmern, empfing sie nur vier oder fünf Vermittler, ihre Leutnants; hier verbrachte sie die Tage an einem Schreibtisch wie der Direktor eines Großunternehmens, in klösterlicher Abgeschiedenheit, fern von aufdringlichen Besuchern, in einem Wust von Papieren, der sie überschwemmte. Ihr Traum war, alle Nöte zu erleichtern, die des Kindes, welches leidet, weil es geboren wurde, wie auch die des Greises, der nicht sterben kann, ohne zu leiden. Während dieser fünf Jahre, da sie das Gold mit vollen Händen hinauswarf, hatte sie in La Villette die Kinderkrippe Sainte-Marie gegründet, ein großes, helles Gebäude mit weißen Wiegen für die ganz Kleinen und blauen Betten für die Größeren, in dem schon dreihundert Kinder untergebracht waren; das Waisenhaus Saint-Joseph in Saint-Mandé, wo hundert Knaben und hundert Mädchen so erzogen und ausgebildet wurden wie in den bürgerlichen Familien; schließlich für fünfzig Männer und fünfzig Frauen ein Altersheim in Châtillon und in einem Vorort das Krankenhaus Saint-Marceau mit zweihundert Betten, dessen Säle gerade erst eingeweiht worden waren. Aber ihr Lieblingswerk, das in diesem Augenblick ihr ganzes Herz in Anspruch nahm, war das »Werk der Arbeit«, ihre ureigenste Schöpfung, ein Haus, das die Erziehungsanstalt ersetzen sollte: dreihundert Kinder, hundertfünfzig Mädchen und hundertfünfzig Knaben, die auf dem Pariser Pflaster in der Ausschweifung und im Verbrechen gelebt hatten, wurden hier durch gute Behandlung und die Erlernung eines Berufes auf den rechten Weg gebracht. Diese verschiedenen Gründungen, beträchtliche Schenkungen und eine verrückte Verschwendungssucht der Barmherzigkeit hatten in fünf Jahren nahezu hundert Millionen verschlungen. Noch ein paar Jahre so weiter, und die Fürstin war ruiniert, ohne sich selbst die kleine Rente für Brot und Milch, ihre tägliche Nahrung, gesichert zu haben. Wenn ihre alte Amme Sophie einmal ihr ständiges Schweigen unterbrach, sie mit harten Worten schalt und ihr voraussagte, sie würde noch einmal am Bettelstab enden, hatte sie dafür nur ein schwaches Lächeln, das einzige, das hinfort auf ihren farblosen Lippen erschien, ein göttliches Lächeln der Hoffnung.
Durch ebenjenes »Werk der Arbeit« machte Saccard die Bekanntschaft der Fürstin dʼOrviedo. Er war einer der Eigentümer des Geländes, das sie dafür aufkaufte, eines alten, mit schönen Bäumen bestandenen Gartens, der an den Park von Neuilly angrenzte und sich längs des Boulevard Bineau hinzog. Er hatte sie durch die lebhafte Art, mit der er bei den Geschäften verhandelte, für sich eingenommen, und sie wollte ihn wegen einiger Schwierigkeiten mit den Bauunternehmern wiedersehen. Er selbst hatte sich für die Arbeiten interessiert, seine Phantasie war gefesselt und bezaubert von dem großartigen Plan, den sie dem Architekten aufzwang: zwei monumentale Flügel – der eine für die Knaben, der andere für die Mädchen –, die untereinander durch ein Hauptgebäude verbunden waren, das die Kapelle, die Gemeinschaftsräume, die Verwaltung und alle Diensträume enthielt; jeder Flügel hatte seinen riesigen Hof, seine Werkstätten, seine Nebengebäude aller Art. Doch bei seiner eigenen Vorliebe für das Große und Pomphafte begeisterte ihn vor allem der Luxus, der hier entfaltet wurde: die Größe des Bauwerks, aus einem Material errichtet, das die Jahrhunderte überdauern würde; der verschwendete Marmor, die mit Fayencefliesen ausgekleidete Küche, in der man einen Ochsen hätte braten können, die riesigen, mit Eichenholz getäfelten Speisesäle, die lichtüberfluteten, hell gestrichenen Schlafräume, die Wäscherei, der Baderaum, die mit allen nur erdenklichen Raffinements ausgestattete Krankenstation; und überall breite Nebenausgänge, Treppen, Flure, die im Sommer belüftet und im Winter beheizt wurden; das ganze Haus war in Sonnenschein getaucht und kündete von jugendlicher Fröhlichkeit und dem Wohlbehagen eines großen Vermögens. Als der Architekt, der diese ganze Herrlichkeit unnütz fand, unruhig wurde und von den Ausgaben sprach, schnitt ihm die Fürstin das Wort ab: sie habe den Luxus gehabt und wolle ihn nun den Armen geben, damit sie, die den Luxus der Reichen schaffen, ihn ihrerseits genießen sollten. Ihre fixe Idee bestand in dem Traum, die Elenden mit Wohltaten zu überhäufen, sie in die Betten der Glücklichen dieser Welt zu legen, sie an ihre Tafel zu setzen; nicht mehr das Almosen einer Brotkruste, eines elenden Nachtlagers sollte es sein, sondern das großzügige Leben in Palästen, in denen sie sich zu Hause fühlen, in denen sie sich rächen und die Genüsse von Siegern auskosten konnten. Nur wurde sie bei dieser Verschwendung und den extrem hohen Kostenanschlägen abscheulich bestohlen. Ein Schwarm von Unternehmern lebte von ihr, ganz zu schweigen von den Verlusten, die durch mangelhafte Aufsicht verursacht wurden. Man vergeudete das Gut der Armen. Und Saccard öffnete ihr die Augen, als er sie bat, ihn die Abrechnungen überprüfen zu lassen, was er übrigens völlig uneigennützig tat, einzig um des Vergnügens willen, diesen tollen Tanz der Millionen zu regeln, der ihn begeisterte. Nie hatte er sich so peinlich korrekt gezeigt. Er war in diesem komplizierten Riesengeschäft der wendigste und rechtschaffenste Mitarbeiter, der seine Zeit und sogar sein Geld hingab und einfach nur durch die Freude belohnt wurde, daß diese beträchtlichen Summen durch seine Finger gingen. Im »Werk der Arbeit« kannte man fast nur ihn; die Fürstin ließ sich dort nie sehen, wie sie auch ihre anderen Gründungen nicht besuchte; gleich der unsichtbaren guten Fee blieb sie in der Tiefe ihrer drei kleinen Zimmer verborgen. Er aber, der Angebetete, wurde dort gesegnet und mit der ganzen Dankbarkeit überhäuft, die sie abzulehnen schien.
Zweifellos trug sich Saccard seit jener Zeit mit einem vagen Plan, der jetzt, da er als Mieter im Palais dʼOrviedo wohnte, eine klare und deutliche Wunschvorstellung geworden war. Warum sollte er sich nicht ganz der Verwaltung der guten Werke der Fürstin widmen? In der Stunde des Zweifels, die er durchlebte, als er von der Spekulation besiegt war und nicht wußte, wie er wieder reich werden könnte, erschien ihm das als eine neue Inkarnation, als ein plötzlicher Aufstieg zur Gottheit: der Verteiler dieser königlichen Barmherzigkeit werden, diesen Goldstrom lenken, der sich über Paris ergoß. Die Fürstin hatte noch zweihundert Millionen – wieviel Werke konnte man da noch schaffen, was für eine Stadt des Wunders aus dem Boden stampfen! Ganz davon zu schweigen, daß er diese Millionen Früchte tragen lassen, sie verdoppeln, verdreifachen würde, sie so gut zu verwenden wüßte, daß er eine Welt daraus gewinnen konnte. In seiner leidenschaftlichen Vorstellung wurde alles noch größer, er lebte nur noch in dem berauschenden Gedanken, die Millionen als Almosen ohne Ende auszuteilen, das glückliche Frankreich mit ihnen zu überschwemmen, und er wurde gerührt bei dem Gedanken an seine vollkommene Rechtschaffenheit, denn nicht ein Sou sollte in seinen Fingern bleiben. Und dieser Gedanke wuchs sich in seinem Kopf zur Vision von einem riesigen Idyll aus, dem Idyll eines Mannes, den kein schlechtes Gewissen drückte, nicht der leiseste Wunsch, sich von seinen alten Geldräubereien loszukaufen. Um so mehr, als am Ende der Traum seines ganzen Lebens winkte, die Eroberung von Paris. Der König der Barmherzigkeit, der von der Menge der Armen angebetete Gott sein, einzigartig und volkstümlich werden, daß sich die Welt mit ihm beschäftigte – das überstieg noch seinen Ehrgeiz. Was für Wunder würde er vollbringen, wenn er seine Fähigkeiten als Geschäftsmann, seine Hinterlist, seinen Eigensinn, seinen völligen Mangel an Vorurteilen darauf verwandte, gut zu sein! Und er besäße die unwiderstehliche Kraft, die die Schlachten gewinnt, das Geld, Truhen voll Geld – Geld, das oft soviel Böses schafft und das soviel Gutes schaffen könnte an dem Tage, da man seinen Stolz und sein Vergnügen dafür einsetzte!
Dann erweiterte Saccard seinen Plan noch und fragte sich schließlich, warum er die Fürstin dʼOrviedo nicht heiraten sollte. Das würde die Verhältnisse klären und die bösen Auslegungen verhindern. Einen Monat lang ging er geschickt und listig zu Werke, legte prächtige Pläne dar, glaubte sich unentbehrlich zu machen; und eines Tages brachte er mit ruhiger, unbefangener Stimme seinen Vorschlag vor und entwickelte sein großes Vorhaben. Er bot eine richtige Partnerschaft an, er würde den Liquidator der vom Fürsten gestohlenen Summen abgeben und sich verpflichten, sie verzehnfacht den Armen zurückzuerstatten. Die Fürstin, in ihrem ewigen schwarzen Kleid, ihr Spitzentuch auf dem Kopf, hörte ihm aufmerksam zu, ohne daß auch nur eine Gemütsregung ihr gelbes Gesicht belebte. Sie war sehr betroffen von den Vorteilen, die eine solche Partnerschaft haben könnte, im übrigen aber waren ihr die anderen Erwägungen gleichgültig. Nachdem sie ihre Antwort auf den nächsten Tag verschoben hatte, lehnte sie schließlich ab. Zweifellos hatte sie bedacht, daß sie dann nicht mehr allein Herrin über ihre Almosen wäre, und sie legte Wert darauf, als unumschränkte Herrscherin darüber zu verfügen, selbst auf verrückte Weise. Aber sie erklärte, sie würde sich glücklich schätzen, ihn als Ratgeber zu behalten, und gab zu erkennen, für wie wertvoll sie seine Mitarbeit erachtete, indem sie ihn bat, sich weiterhin mit dem »Werk der Arbeit« zu beschäftigen, dessen eigentlicher Direktor er war.
Eine ganze Woche lang empfand Saccard heftigen Kummer, wie beim Verlust eines liebgewordenen Gedankens. Nicht, daß er sich in den Schlund der Räubereien zurückfallen sah; aber so, wie eine gefühlvolle Romanze den verworfensten Trunkenbolden Tränen in die Augen treibt, hatte dieses riesige Idyll von den Millionen, die soviel Gutes schufen, seine alte Freibeuterseele weich gestimmt. Er stürzte wieder einmal, und aus sehr großer Höhe: es schien ihm, als wäre er entthront worden. Mit Hilfe des Geldes hatte er neben der Befriedigung seiner Begierden immer zugleich die Herrlichkeit eines fürstlichen Lebens angestrebt, das er nie in dem gewünschten Maße hatte führen können. Seine Raserei nahm mit jedem Sturz, der wieder eine Hoffnung zunichte machte, zu. Daher wurde er in eine wütende Kampflust zurückgeworfen, als sein Vorhaben angesichts der ruhigen und deutlichen Weigerung der Fürstin zusammenbrach. Sich schlagen, in dem harten Krieg der Spekulation der Stärkste sein, die anderen fressen, um nicht selbst gefressen zu werden, das war neben seiner Gier nach Glanz und Genuß die wesentliche, die einzige Ursache seiner Leidenschaft für die Geschäfte. Wenn er auch keine Schätze anhäufte, so hatte er doch die andere Freude: den Kampf der hohen Zahlen, die Vermögen, die wie Armeekorps in die Schlacht geführt wurden, den Zusammenprall der streitenden Millionen mit den Niederlagen und mit den Siegen, die ihn berauschten. Und sogleich kam wieder der Haß auf Gundermann, sein zügelloses Bedürfnis nach Revanche zum Vorschein: Gundermann zu Boden werfen, dieses wahnwitzige Begehren quälte ihn, sooft er besiegt am Boden lag. Wenn er auch spürte, wie kindisch ein solcher Versuch war – konnte er Gundermann nicht wenigstens anschlagen, sich einen Platz neben ihm erobern, ihn zur Teilung zwingen, wie es die einander ebenbürtigen Monarchen aus benachbarten Ländern tun, die sich mit »Vetter« anreden? Damals zog ihn erneut die Börse an, und er hatte den Kopf voller Geschäfte, die er starten wollte; er wurde von den widersprüchlichsten Plänen hin und her gerissen mit einer solchen fiebrigen Hast, daß er sich einfach nicht entscheiden konnte bis zu dem Tage, da sich eine alle Maße übersteigende, ungewöhnliche Idee aus allen anderen herauslöste und sich seiner nach und nach ganz bemächtigte.
Seitdem Saccard im Palais dʼOrviedo wohnte, sah er bisweilen die Schwester des Ingenieurs Hamelin, der die kleine Wohnung im zweiten Stock innehatte, eine Frau von bewundernswertem Wuchs, Frau Caroline, wie man sie vertraulich nannte. Was ihn bei der ersten Begegnung vor allem betroffen gemacht hatte, war das prachtvolle weiße Haar, eine Königskrone aus weißen Haaren, die über der Stirn dieser noch jungen, kaum sechsunddreißigjährigen Frau so eigentümlich wirkten. Schon mit fünfundzwanzig Jahren war sie ganz weiß geworden. Die schwarz gebliebenen, sehr dichten Brauen bewahrten dem hermelinumrahmten Gesicht einen seltsamen Reiz von lebhafter Jugendlichkeit. Mit ihrem zu starken Kinn, der etwas zu großen Nase und dem breiten Mund, dessen volle Lippen sehr viel Güte verrieten, war sie nie eigentlich hübsch gewesen. Wohl aber milderte dieses weiße Vlies, dieser wehende Schnee aus feinen, seidigen Haaren ihren ein wenig harten Gesichtsausdruck und verlieh ihr den lächelnden Zauber einer Großmutter in der Frische und der Kraft einer schönen Geliebten. Sie war groß und kräftig und hatte einen freimütigen, sehr edlen Gang.
Sooft Saccard, der kleiner war als sie, ihr begegnete, folgte er ihr interessiert mit den Augen und war insgeheim neidisch auf diese hohe, vor Gesundheit strotzende Gestalt. Und nach und nach erfuhr er von den Leuten aus der Gegend die ganze Geschichte der Hamelins. Caroline und Georges waren die Kinder eines Arztes aus Montpellier, eines bedeutenden Gelehrten und überspannten Katholiken, der ohne Vermögen gestorben war. Als der Vater aus dem Leben schied, waren das Mädchen achtzehn und der Junge neunzehn Jahre alt; und da Georges gerade in die Ecole polytechnique40 aufgenommen worden war, folgte ihm Caroline nach Paris, wo sie als Erzieherin in Dienst trat Sie steckte ihm Hundertsousstücke zu, sie versorgte ihn während der zwei Studienjahre mit Taschengeld; als er später wegen seines schlechten Zeugnisses ohne Arbeit war, unterstützte sie ihn wiederum, bis er eine Anstellung fand. Die beiden Geschwister beteten einander an und träumten davon, einander nie zu verlassen. Als sich jedoch eine unverhoffte Heirat bot – das feine Benehmen und der lebhafte Verstand des jungen Mädchens hatten in dem Haus, wo sie in Stellung war, einen millionenschweren Brauer erobert –, wollte Georges, daß sie einwilligte; er mußte es aber bitter bereuen, denn nach wenigen Ehejahren war Caroline gezwungen, eine Trennung zu verlangen, wenn sie nicht von ihrem Gatten, der ein Trinker war und sie in unsinnigen Eifersuchtsanfällen mit einem Messer bedrohte, umgebracht werden wollte. Sie war damals sechsundzwanzig Jahre alt und wieder arm geworden, da sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, keinen Unterhalt von dem Mann zu fordern, den sie verließ. Aber ihr Bruder hatte endlich nach sehr vielen Versuchen eine Aufgabe gefunden, die ihm gefiel: er sollte mit der Kommission, die mit den ersten Vorarbeiten für den Suezkanal beauftragt war, nach Ägypten gehen, und er nahm seine Schwester mit; sie richtete sich tapfer in Alexandria ein und begann wieder Stunden zu geben, während er durch das Land zog. So blieben sie bis 1859 in Ägypten und waren bei den ersten Spatenstichen am Strand von Port Said dabei: ein kümmerlicher Trupp von knapp hundertfünfzig Erdarbeitern, der sich im Sand verlor und von einer Handvoll Ingenieure angeleitet wurde. Dann schickte man Hamelin nach Syrien, wo er Lebensmittel beschaffen sollte, und nach einem Streit mit seinen Vorgesetzten blieb er dort. Er ließ Caroline nach Beirut kommen, wo neue Schüler sie erwarteten, und stürzte sich in ein großes Unternehmen, das von einer französischen Gesellschaft gefördert wurde; es ging um die Trasse einer befahrbaren Straße von Beirut nach Damaskus, den ersten und einzigen Weg, der durch die Schluchten des Libanon führte. Sie blieben dort noch drei Jahre bis zur Fertigstellung der Straße; er besichtigte die Berge, unternahm eine zweimonatige Reise über den Taurus nach Konstantinopel, sie folgte ihm, sobald sie loskommen konnte, und machte sich seine Projekte zu eigen, dieses alte Land wiederzuerwecken, das unter der Asche der toten Kulturen schlummerte. Er hatte eine ganze Mappe gefüllt, die von Ideen und Plänen überquoll, und er verspürte die gebieterische Notwendigkeit, nach Frankreich zurückzukehren, wenn er diesen umfangreichen Unternehmungen Gestalt verleihen, Gesellschaften gründen und Kapital finden wollte. So kehrten sie nach neun Jahren Aufenthalt im Orient zurück. Aus Neugier reisten sie über Ägypten, wo die Arbeiten am Suezkanal sie begeisterten: in vier Jahren war aus dem Sand des Strandes von Port Said eine Stadt gewachsen, ein ganzes Volk war da am Werke, die menschlichen Ameisen hatten sich vervielfacht und veränderten das Antlitz der Erde. Aber in Paris erwartete Hamelin ein dauerndes Pech. Seit fünfzehn Monaten schlug er sich dort mit seinen Projekten herum, ohne mit seinem Glauben daran jemanden überzeugen zu können, denn er war zu bescheiden und nicht sehr redegewandt; und so war er in diesem zweiten Stockwerk des Palais dʼOrviedo gestrandet, in einer kleinen Fünfzimmerwohnung, die er für zwölfhundert Francs mietete, weiter vom Erfolg entfernt als einst, da er die Gebirge und die Ebenen Asiens durchstreift hatte. Ihre Ersparnisse waren rasch erschöpft, und die beiden Geschwister gerieten in große Geldverlegenheit.
Und genau das erweckte Saccards Interesse, diese zunehmende Traurigkeit von Frau Caroline, deren schöne Heiterkeit sich verdüsterte, weil sie ihren Bruder mutlos werden sah. In ihrem Haushalt war sie ein wenig der Mann. Georges, der ihr äußerlich sehr ähnlich, nur schmächtiger war, konnte in der Arbeit ungewöhnlich ausdauernd sein; aber er vertiefte sich in seine Studien, bei denen man ihn keinesfalls stören durfte. Er hatte sich nie verheiraten wollen, weil er nicht das Bedürfnis dazu verspürte und seine Schwester anbetete – das genügte ihm. Vielleicht hatte er dann und wann eine Geliebte, die man nicht kannte. Und dieser alte Streber von der Ecole polytechnique, der großzügige Ideen hatte und einen so glühenden Eifer für alle seine Unternehmungen, war manchmal von so kindlicher Einfalt, daß man ihn für ein bißchen beschränkt halten konnte. Im engstirnigsten Katholizismus erzogen, hatte er sich seine Kinderreligion bewahrt und befolgte aus voller Überzeugung alle kirchlichen Vorschriften; seine Schwester dagegen hatte durch ihr vieles Lesen, durch die umfassende Bildung, die sie sich an seiner Seite in den langen Stunden erwarb, da er sich in seine technischen Arbeiten vertiefte, ihre geistige Unabhängigkeit zurückgewonnen. Sie beherrschte vier Sprachen, sie hatte die Nationalökonomen und die Philosophen gelesen und sich zeitweilig für die sozialistischen und evolutionistischen Theorien begeistert; dann aber war sie ruhiger geworden. Ihren Reisen, ihrem langen Aufenthalt in fernen Ländern vor allem verdankte sie eine große Toleranz und eine schöne Ausgeglichenheit und Weisheit. Wenn sie auch nicht mehr gläubig war, so hatte sie doch Achtung vor dem Glauben ihres Bruders. Beide hatten sich einmal darüber ausgesprochen und nie wieder davon angefangen. Bei all ihrer Schlichtheit und Gutmütigkeit war sie eine kluge Frau, begabt mit einem außergewöhnlichen Lebensmut und einer fröhlichen Tapferkeit, die den Grausamkeiten des Schicksals widerstand; nur ein einziger Kummer nagte an ihr, so sagte sie: kein Kind zu haben.
Einmal ergab es sich, daß Saccard Hamelin eine Gefälligkeit erweisen konnte, indem er ihm eine kleine Arbeit für eine Kommanditgesellschaft vermittelte, die für die Begutachtung einer neuen Maschine einen Ingenieur brauchte. Und so gelang es ihm, zu den Geschwistern ein vertrauliches Verhältnis zu gewinnen; fortan ging er häufig auf eine Stunde zu ihnen in den Salon hinauf, ihr einziges großes Zimmer, das sie in einen Arbeitsraum umgewandelt hatten. Dieser Raum wirkte völlig kahl, er war nur mit einem langen Zeichentisch, einem zweiten, mit Papieren beladenen kleineren Tisch und einem halben Dutzend Stühle möbliert. Auf dem Kamin stapelten sich die Bücher. Aber ein improvisierter Wandschmuck heiterte diese Leere auf: eine Reihe von Plänen und eine Folge heller Aquarelle, jedes Blatt mit vier Nägeln an der Wand befestigt. Das waren die Projekte aus Hamelins Mappe, die er so zur Schau stellte, seine in Syrien gemachten Aufzeichnungen, sein ganzes künftiges Vermögen; die Aquarelle stammten von Frau Caroline, Ansichten von dort unten, charakteristische Gestalten, Trachten – alles, was ihr auffiel, wenn sie ihren Bruder begleitete, hatte sie mit einem sehr persönlichen Sinn für Farben, doch ohne jeden künstlerischen Anspruch skizziert. Zwei breite Fenster, die auf den Garten des Palais Beauvilliers hinausgingen, ließen helles Licht auf diese kunterbunt durcheinander aufgehängten Zeichnungen fallen, die ein anderes Leben heraufbeschworen, den Traum einer in Staub zerfallenen antiken Gesellschaft, und die Entwürfe erweckten den Anschein, als wollten sie diese Gesellschaft mit festen, mathematischen Linien wiederaufrichten, sie gleichsam stützen mit dem soliden Gerüst der modernen Wissenschaft. Und wenn sich Saccard mit jenem Aufwand an Betriebsamkeit, der seinen Charme ausmachte, nützlich erwiesen hatte, versenkte er sich hingerissen in die Pläne und Aquarelle und bat unaufhörlich um neue Erklärungen. In seinem Kopf keimte schon ein ganzer großer Plan.
Eines Morgens traf er Frau Caroline allein an, sie saß vor dem kleinen Tisch, den sie zu ihrem Schreibtisch gemacht hatte. Sie war todunglücklich, ihre Hände ruhten müßig zwischen den Papieren.
»Was wollen Sie? Das nimmt bestimmt noch ein böses Ende ... Trotzdem verliere ich nicht den Mut. Aber es fehlt uns bald an allem zugleich, und was mir das Herz zerreißt, ist die Kraftlosigkeit, in die das Unglück meinen armen Bruder versetzt, denn er ist nur tapfer, hat nur Kraft bei der Arbeit ... Ich hatte daran gedacht, wieder irgendwo eine Stellung als Erzieherin anzunehmen, um ihm wenigstens zu helfen. Ich habe gesucht und nichts gefunden ... Aber ich kann doch nicht als Aufwartefrau gehen.«
Nie hatte Saccard sie so fassungslos und niedergeschlagen gesehen.
»Zum Teufel! Soweit sind Sie doch noch nicht!« rief er.
Sie schüttelte den Kopf, war voller Bitternis über das Leben, das sie für gewöhnlich so mutig annahm, selbst wenn es sich als böse erwies. Und da Hamelin in diesem Augenblick nach Hause kam und die Nachricht von einem letzten Mißerfolg brachte, flossen ihr langsam dicke Tränen über die Wangen. Sie sprach nicht mehr, die Hände hatte sie, zu Fäusten geballt, auf den Tisch gelegt, und ihre Augen blickten verloren vor sich hin.
»Wenn man bedenkt«, entfuhr es Hamelin, »daß es da unten Millionen gibt, die auf uns warten, und niemand hilft mir, sie zu gewinnen!«
Saccard hatte sich vor einem Entwurf aufgepflanzt, der den Aufriß für einen inmitten großer Lagerhäuser gebauten Pavillon darstellte.
»Was ist denn das?« fragte er.
»Oh, das habe ich nur zum Spaß gemacht«, erklärte der Ingenieur. »Das ist der Entwurf für ein Wohnhaus da unten in Beirut, für den Direktor der Gesellschaft, von der ich immer träumte, Sie wissen ja, die Allgemeine Gesellschaft der vereinigten Dampfschiffahrtslinien.«
Er wurde lebhaft, führte weitere Einzelheiten an. Während seines Aufenthalts im Orient hatte er festgestellt, wie mangelhaft das Transportwesen war. Die wenigen Reedereien mit Sitz in Marseille machten sich durch die Konkurrenz tot, kamen nicht auf die ausreichende Zahl von Schiffseinheiten, die mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet sind; daher war es eine seiner ersten Ideen, bevor er überhaupt an seine vielen anderen Unternehmungen dachte, diese Reedereien in einem Kartell zusammenzufassen, sie in einer großen, mit einem Millionenkapital versehenen Gesellschaft zu vereinigen, die das ganze Mittelmeer ausbeuten und beherrschen könnte, indem sie einen Linienverkehr nach allen Häfen Afrikas, Spaniens, Italiens, Griechenlands, Ägyptens, Asiens und bis ins Schwarze Meer hinein einrichtete. Dieser Plan zeugte von einem großen organisatorischen Spürsinn und zugleich von einem hohen staatsbürgerlichen Bewußtsein: damit war der Orient erobert und Frankreich zum Geschenk gemacht, ganz davon zu schweigen, daß auf diese Weise Syrien näher rückte, wo seinem Wirken noch ein weites Feld offenstand.
»Die Kartelle«, murmelte Saccard, »da scheint heute die Zukunft zu liegen ... Das ist eine so mächtige Form des Zusammenschlusses! Drei oder vier kleine Einzelunternehmen, die sich nur knapp über Wasser halten, gelangen unausweichlich zu neuem Leben und zu neuer Blüte, sobald sie sich zusammentun ... Ja, das Morgen gehört den großen Kapitalien, den vereinten Anstrengungen der großen Massen. Die ganze Industrie, der ganze Handel werden schließlich nur noch ein einziger, ungeheuer großer Basar sein, auf dem man sich mit allem versorgt.«
Er war wieder stehengeblieben, diesmal vor einem Aquarell, das eine wild zerklüftete Landschaft darstellte, eine ausgetrocknete Schlucht, die ein riesiger, mit Gestrüpp bewachsener Felssturz versperrte.
»Oh, oh«, versetzte er, »das ist ja das Ende der Welt. In diesem gottverlassenen Winkel wird man bestimmt nicht von Fußgängern angerempelt.«
»Eine Schlucht im Karmel«, antwortete Hamelin. »Meine Schwester hat das während der Untersuchungen gemalt, die ich dort angestellt habe.« Und er fügte noch hinzu: »Sehen Sie, zwischen den Kreidekalkfelsen und dem Porphyrgestein, das den Kalkstein auf der ganzen Gebirgsflanke gehoben hat, gibt es ein beachtliches Schwefelsilberlager. Ja, ein Silbererzvorkommen, dessen Abbau nach meinen Berechnungen ungeheure Gewinne bringen würde.«
»Ein Silbererzvorkommen«, wiederholte Saccard lebhaft.
Frau Caroline, die in ihrer Traurigkeit immer noch in die Ferne blickte, hatte zugehört, und als wäre eine Vision heraufbeschworen worden, sagte sie:
»Der Karmel! Ach, was für eine Einöde, was für Tage der Einsamkeit! Alles steht voller Myrten und Ginster, das duftet, die laue Luft ist wie von Balsam erfüllt. Und hoch oben schweben immerfort Adler ... Nein, und das viele Silber, das neben soviel Elend in diesem Grab schlummert! Man möchte glückliche Menschen sehen, Bauplätze, aufblühende Städte, ein durch Arbeit erneuertes Volk ...«
»Eine Straße wäre leicht vom Karmel nach Akka erschlossen«, fuhr Hamelin fort. »Und ich glaube bestimmt, man würde auch Eisen entdecken, denn es ist in Hülle und Fülle in den Gebirgen des Landes vorhanden ... Ich habe auch eine neue Art der Förderung entwickelt, die bedeutende Einsparungen bringen würde. Alles ist bereit, es handelt sich nur noch darum, Kapitalien zu finden.«
»Die Silberbergwerksgesellschaft des Karmel!« murmelte Saccard.
Aber jetzt sprang der Ingenieur erhobenen Blickes von einem Plan zum anderen über, diese Arbeit seines ganzen Lebens hatte ihn wieder gepackt, und er fieberte bei dem Gedanken an die strahlende Zukunft, die dort schlummerte, während ihm die Hände gebunden waren, weil er kein Geld hatte.
»Und das ist erst der Anfang«, fuhr er fort. »Schauen Sie diese Reihe von Plänen an, das hier ist der große Coup, ein ganzes Eisenbahnnetz quer durch Kleinasien ... Der Mangel an bequemen und schnellen Verkehrsverbindungen ist nämlich der Hauptgrund für die Stagnation, in der dieses so reiche Land verkommt. Sie finden dort keinen befahrbaren Weg, für jede Reise und jeden Transport sind Sie dort noch immer auf Maultiere oder Kamele angewiesen ... Stellen Sie sich vor, was für eine Umwälzung es wäre, wenn Eisenbahnstrecken bis an die Grenzen der Wüste vordringen! Industrie und Handel würden sich verzehnfachen, das wäre der Sieg der Zivilisation, und Europa stieße endlich die Tore zum Orient auf ... Wenn Sie das nur ein wenig interessiert, so können wir darüber noch im einzelnen sprechen. Und Sie sollen mal sehen, Sie sollen mal sehen!«
Übrigens konnte er es nicht lassen, sogleich Erläuterungen zu geben. Vor allem während seiner Reise nach Konstantinopel hatte er die Absteckung für sein Eisenbahnnetz studiert. Die einzige große Schwierigkeit bestand in der Überquerung des Taurus, aber er war über die verschiedenen Passe gezogen und versicherte, daß es möglich sei, eine direkte und verhältnismäßig wenig kostspielige Linie anzulegen. Er dachte ohnehin nicht daran, das gesamte Netz auf einmal bauen zu lassen. Hatte man vom Sultan die Konzession für das ganze Projekt erlangt, so wäre es klug, zunächst nur die Hauptstrecke, die Linie von Brussa nach Beirut über Angora und Aleppo, in Angriff zu nehmen. Später könnte man an die Nebenstrecken von Smyrna nach Angora und von Trapezunt nach Angora über Erzerum und Siwas denken.
»Später, noch später ...«, fuhr er fort.
Doch er vollendete nicht, er begnügte sich zu lächeln, weil er nicht zu sagen wagte, wie weit er in der Kühnheit seiner Pläne gegangen war. Das war der Gipfel seiner Träume.
»Ach, die Ebenen am Fuße des Taurus«, versetzte Frau Caroline mit der schleppenden Stimme einer Traumwandlerin, »was für ein köstliches Paradies! Man braucht die Erde nur anzukratzen, und die Ernten reifen üppig heran. Die Obstbäume brechen unter der Last der Pfirsiche, Kirschen, Feigen und Mandeln. Und die Felder mit Öl- und Maulbeerbäumen, wie große Wälder kommen sie einem vor! Und was für ein natürliches und leichtes Leben in dieser linden, ewig blauen Luft!«
Saccard brach in jenes schrille, gierige Gelächter aus, das ihn immer ankam, sobald er Geld witterte. Und als Hamelin noch von weiteren Vorhaben, besonders von der Gründung einer Bank in Konstantinopel, sprach und ein Wort über die allmächtigen Verbindungen fallenließ, die er vor allem zur Umgebung des Großwesirs angeknüpft hatte, unterbrach ihn Saccard vergnügt.
»Aber das ist ja ein Schlaraffenland, das ließe sich verkaufen!«
Dann stützte er sehr vertraulich beide Hände auf Frau Carolines Schultern, die immer noch an ihrem Tisch saß.
»Verzweifeln Sie doch nicht, Frau Caroline! Ich mag Sie sehr, Sie werden sehen, ich mache mit Ihrem Bruder etwas sehr Gutes für uns alle ... Haben Sie Geduld und warten Sie ab!«
Im darauffolgenden Monat verschaffte Saccard dem Ingenieur erneut einige kleine Arbeiten, und obwohl er nicht mehr von den großen Geschäften sprach, mußte er doch fortwährend daran denken, wälzte er sie in seinen Gedanken, auch wenn er vor der erdrückenden Größe der Unternehmungen zögerte. Aber was die entstehenden Bande ihrer vertrauten persönlichen Beziehungen enger knüpfte, war die ganz natürliche Art, in der sich Frau Caroline mit seinem Haushalt befaßte. Als alleinstehender Mann wurde er von überflüssigen Kosten aufgefressen und um so schlechter bedient, je mehr Diener er hatte. Er, der nach außen so wendig war und mit starker, geschickter Hand in den trüben Wassern der großen Räubereien fischte, ließ bei sich zu Hause alles drunter und drüber gehen, unbekümmert um die erschreckenden Verluste, die seine Ausgaben verdreifachten; obendrein machte sich das Fehlen einer Frau bis in die kleinsten Dinge hinein empfindlich bemerkbar. Als Frau Caroline die Plünderung bemerkte, gab sie ihm zunächst Ratschläge, mischte sich dann schließlich ein und verhalf ihm zu zwei oder drei Einsparungen, so daß er ihr eines Tages lachend anbot, seine Hausdame zu werden. Warum auch nicht? Da sie eine Stelle als Erzieherin gesucht hatte, konnte sie sehr wohl eine für sie ehrenhafte Stellung annehmen, die ihr erlaubte abzuwarten. Das im Scherz gemachte Angebot wurde ernst. War das nicht eine geeignete Form, sich zu beschäftigen, ihren Bruder mit den dreihundert Francs zu unterstützen, die ihr Saccard monatlich geben wollte? Und sie willigte ein; binnen acht Tagen ordnete sie den Haushalt neu, entließ den Küchenchef und seine Frau und stellte dafür nur eine Köchin ein, die mit dem Kammerdiener und dem Kutscher zur Bedienung ausreichen mußte. Ebenso behielt sie nur ein Pferd und einen Wagen, nahm völlig das Heft in die Hand und prüfte die Rechnungen mit so peinlicher Sorgfalt, daß sie nach den ersten zwei Wochen die Ausgaben um die Hälfte verringert hatte. Saccard war entzückt, scherzte und sagte, daß jetzt er sie um ihr Geld brächte und daß sie einen gewissen Prozentsatz von all den Gewinnen hätte fordern müssen, zu denen sie ihm verhalf.
Von nun an lebten sie sehr eng zusammen. Saccard hatte den Einfall gehabt, die Schrauben herausdrehen zu lassen, die die Verbindungstür zwischen den beiden Wohnungen versperrten, und man stieg wieder ungehindert über die Innentreppe von einem Speisesaal in den anderen; Frau Caroline überließ ihren eigenen Haushalt der Sorge ihres einzigen Dienstmädchens und ging zu jeder Tageszeit hinunter, um wie bei sich zu Hause ihre Anordnungen zu erteilen, während ihr Bruder oben von früh bis spät bei verschlossenen Türen arbeitete, um seine Akten aus dem Orient in Ordnung zu bringen. Saccard freute sich über das ständige Erscheinen dieser schönen großen Frau, die die Räume durchquerte mit ihrem festen und stolzen Schritt, mit der immer wieder neuen, überraschenden Heiterkeit ihres weißen Haars, das ihr um das junge Gesicht flatterte. Sie war wieder sehr fröhlich, sie hatte ihren Lebensmut zurückgewonnen, seitdem sie sich nützlich fühlte, ihre Stunden ausfüllte und fortwährend auf den Beinen war. Ohne Schlichtheit vortäuschen zu wollen, trug sie immer nur ein schwarzes Kleid, aus dessen Tasche das helle Geklingel des Schlüsselbundes zu vernehmen war; und fraglos machte sie, die Gelehrte und Philosophin, sich ein Vergnügen daraus, nichts weiter als eine gute Hausfrau zu sein, die Haushälterin eines Verschwenders, den sie zu lieben begann, so wie man die mißratenen Kinder liebt. Saccard, der einen Augenblick ganz hingerissen war und sich ausrechnete, daß der Altersunterschied zwischen ihnen nur vierzehn Jahre betrug, hatte sich gefragt, was wohl geschehen würde, wenn er sie eines schönen Abends in die Arme nähme. Durfte er annehmen, daß sie seit zehn Jahren, seit ihrer erzwungenen Flucht aus dem Hause ihres Gatten, von dem sie mit ebensoviel Schlägen wie Zärtlichkeiten bedacht worden war, wie eine reisende Amazone gelebt hatte, ohne einen Mann anzusehen? Vielleicht hatten die Reisen sie geschützt. Indes wußte er, daß ein Kaufmann und Freund ihres Bruders, der in Beirut geblieben war und dessen Rückkehr nahe bevorstand, sie sehr geliebt hatte; um sie heiraten zu können, hatte er den Tod ihres Gatten herbeigesehnt, der wegen Säuferwahnsinn in ein Irrenhaus eingeliefert worden war. Offenbar hätte diese Heirat nur ein sehr entschuldbares, beinahe legitimes Verhältnis geregelt. Warum sollte er, Saccard, nun nicht der zweite sein, wo es ja schon einen gegeben haben mußte? Aber Saccard ließ es beim bloßen Gedanken bewenden, denn er fand sie so kameradschaftlich, daß das Weib oft gänzlich in den Hintergrund trat. Sooft er sie mit ihrer bewundernswerten Gestalt vorbeigehen sah, fragte er sich von neuem, was wohl geschehen würde, wenn er sie umarmte. Und er gab sich selbst die Antwort, daß sehr gewöhnliche, vielleicht ärgerliche Sachen passieren würden, und er verschob den Versuch auf später, drückte ihr nur, beglückt über ihre Herzlichkeit, kräftig die Hand.
Dann war Frau Caroline plötzlich wieder sehr bekümmert. Eines Morgens kam sie niedergeschlagen, sehr blaß und mit verschwollenen Augen herunter. Er konnte nichts aus ihr herausbringen und fragte sie nicht weiter aus angesichts der Hartnäckigkeit, mit der sie behauptete, sie habe nichts, sie sei wie alle Tage. Erst am nächsten Tag begriff er, als er oben einen Brief fand, in dem die Heirat von Herrn Beaudoin mit der sehr jungen und unermeßlich reichen Tochter eines englischen Konsuls angezeigt wurde. Der Schlag mußte um so härter gewesen sein, als die Nachricht ohne jegliche Vorbereitung, sogar ohne ein Lebewohl, nur mit diesem banalen Brief eintraf. Das war ein richtiger Zusammenbruch im Dasein der unglücklichen Frau, der Verlust der fernen Hoffnung, an die sie sich in den Stunden des Unglücks klammerte. Und wie es der Zufall wollte, der abscheuliche Grausamkeiten bereithält, hatte sie gerade zwei Tage zuvor erfahren, daß ihr Gatte gestorben war, und achtundvierzig Stunden lang an die nahe bevorstehende Verwirklichung ihres Traums geglaubt. Ihr Leben stürzte zusammen, sie war vernichtet. Am gleichen Abend wartete noch eine weitere unangenehme Überraschung auf sie: als sie, ehe sie zum Schlafen hinaufging, wie gewöhnlich bei Saccard eintrat, um sich mit ihm über die Anordnungen für den folgenden Tag zu unterhalten, sprach er so teilnahmsvoll von ihrem Unglück, daß sie in Schluchzen ausbrach. Rührung überkam sie, ihre Willenskraft war wie gelähmt, und sie fand sich plötzlich in seinen Armen, sie gab sich ihm hin, freudlos für beide. Als sie wieder zu sich kam, begehrte sie nicht auf, aber sie war unendlich traurig. Warum hatte sie das geschehen lassen? Sie liebte diesen Mann nicht, und er liebte sie wohl auch nicht. Keineswegs schien er ihr in einem Alter und von einem Aussehen, die intimer Zärtlichkeit unwürdig wären. Gewiß war er keine Schönheit und auch nicht mehr jung, doch sein lebhaftes Mienenspiel, der Tatendrang seiner ganzen kleinen dunkelhäutigen Person nahmen sie für ihn ein; ohne ihn genau zu kennen, wollte sie ihn für gefällig, überdurchschnittlich intelligent und für fähig halten, die großen Unternehmungen ihres Bruders mit der üblichen Allerweltsehrlichkeit zu verwirklichen. Nur, was für ein blödsinniger Fehltritt! Sie, die so vernünftig, durch die harte Erfahrung so klug geworden, so voll Selbstbeherrschung war, mußte wie eine sentimentale Grisette in einem Tränenausbruch erliegen, ohne zu wissen, wie und warum! Das schlimmste war, daß sie spürte, wie er gleich ihr über das Abenteuer erstaunt und beinahe verärgert war. Als er sie zu trösten suchte, als er mit ihr über Herrn Beaudoin wie über einen einstigen Geliebten sprach, dessen gemeiner Verrat nur vergessen zu werden verdiente, und sie sich dagegen verwahrte und schwor, daß zwischen ihnen nie etwas gewesen sei, glaubte er zunächst, sie hätte aus weiblichem Stolz gelogen; aber sie wiederholte diesen Schwur mit soviel Nachdruck, und ihre Augen blickten dabei so schön, so klar und ehrlich, daß er schließlich von der Wahrheit ihrer Geschichte überzeugt war: wie sie sich aus Redlichkeit und Würde für ihren Hochzeitstag aufheben wollte und der Mann sich zwei Jahre lang geduldete, dann müde wurde und bei Gelegenheit eine andere heiratete, deren Jugend und Reichtum sich ihm allzu verführerisch darbot. Und das Merkwürdige daran war, daß diese Entdeckung, diese Überzeugung, die Saccard hätte in Leidenschaft versetzen müssen, ihn im Gegenteil beinahe verwirrte, so sehr begriff er die lächerliche Zufälligkeit seines unverhofften Glücks. Übrigens taten sie es nie wieder, da offenbar keiner von beiden Lust dazu verspürte.
Vierzehn Tage lang war Frau Caroline schrecklich traurig. Die Lebenskraft, dieser Antrieb, der aus dem Leben eine Notwendigkeit und eine Freude macht, hatte sie verlassen. Sie ging zwar ihren vielfältigen Beschäftigungen nach, war aber irgendwie geistesabwesend, ohne sich über Sinn und Zweck der Dinge noch Täuschungen hinzugeben. Die menschliche Maschine arbeitete aus Verzweiflung über die Nichtigkeit allen Tuns. Ihre einzige Zerstreuung in diesem Schiffbruch ihrer Tapferkeit und Heiterkeit war es, alle ihre freien Stunden an einem Fenster des großen Arbeitszimmers zu verbringen, die Stirn an die Scheiben gepreßt und den Blick starr auf den Garten des Nachbarhauses geheftet, jenes Palais de Beauvilliers, dessen bittere Not und verborgenes Elend sie seit den ersten Tagen nach ihrem Einzug erraten hatte, obwohl man sich so verzweifelt bemühte, den Schein zu wahren. Dort gab es auch Wesen, die litten; ihr eigener Kummer war wie durchtränkt von diesen Tränen, und sie verfiel in tödliche Schwermut, so daß sie sich bisweilen gefühllos und tot im Schmerz der anderen vorkam.
Diese Beauvilliers, denen früher in der Rue de Grenelle ein herrliches Palais gehörte, ganz zu schweigen von ihren riesigen Gütern in der Touraine41 und im Anjou42, besaßen in Paris nur noch dieses ehemalige Lusthaus, das zu Beginn des vorigen Jahrhunderts außerhalb der Stadt errichtet worden war; heute war es von den dunklen Häusern der Rue Saint-Lazare eingeschlossen. Die letzten schönen Bäume des Gartens standen dort wie in der Tiefe eines Brunnens, das Moos zerfraß die Stufen der zerbröckelnden, geborstenen Freitreppe. Man hätte meinen können, das Ganze sei ein Stück Natur im Gefängnis, ein ruhiger, trauriger Winkel von stummer Verzweiflung, in den die Sonne nur noch als grünliches Tageslicht hinabdrang, dessen Kälte die Schultern erstarren ließ. Und der erste Mensch, den Frau Caroline in diesem feuchten Kellerfrieden oben auf jener zerfallenen Freitreppe entdeckte, war die Gräfin Beauvilliers, eine große, magere Frau von sechzig Jahren, mit schlohweißem Haar, eine sehr vornehme, ein wenig altmodische Erscheinung. Mit der großen geraden Nase, den dünnen Lippen und dem ungemein langen Hals sah sie wie ein uralter Schwan von trauriger Sanftmut aus. Hinter ihr war fast gleichzeitig ihre Tochter erschienen, Alice de Beauvilliers, fünfundzwanzig Jahre alt, aber so kümmerlich, daß man sie ohne ihren schlechten Teint und ihr eingefallenes Gesicht für ein kleines Mädchen gehalten hätte. Der Mutter war sie wie aus dem Gesicht geschnitten, nur schmächtiger, ohne die aristokratische Vornehmheit, der Hals lang bis zur Häßlichkeit; sie besaß nichts weiter als den kläglichen Reiz eines aussterbenden großen Geschlechts. Die beiden Frauen lebten allein, seitdem der Sohn, Ferdinand de Beauvilliers, nach der von Lamoricière verlorenen Schlacht bei Castelfidardo43 bei den päpstlichen Zuaven44 diente. Wenn es nicht regnete, kamen sie täglich, eine hinter der anderen, aus dem Haus, stiegen die Freitreppe hinab und machten einen Gang um den schmalen Rasen in der Mitte, ohne ein Wort zu wechseln. Es gab nur Efeueinfassungen, Blumen wären nicht gewachsen oder vielleicht zu teuer gewesen. Und dieser langsame Verdauungsspaziergang der beiden blassen Frauen unter den hundertjährigen Bäumen, die so viele Feste gesehen hatten und denen nun die Bürgerhäuser aus der Nachbarschaft die Luft nahmen, war von so schmerzlicher Schwermut, als führten beide die Trauer um die alten toten Dinge spazieren.
Frau Caroline, deren Teilnahme erwacht war, beobachtete ihre Nachbarinnen mit zärtlicher Sympathie, ohne böse Neugier; und da sie von ihrem Platz aus den Garten überblicken konnte, drang sie allmählich in das Leben der beiden Frauen ein, das diese mit eifersüchtiger Sorge nach der Straße zu verbergen wollten. Immer noch stand ein Pferd im Stall und ein Wagen in der Remise, ein alter Diener, der Kammerdiener, Kutscher und Concierge in einer Person war, versorgte beides; dann war noch eine Köchin da, die auch als Stubenmädchen diente. Doch wenn auch der Wagen, korrekt angespannt, aus dem Hauptportal fuhr und die Damen mit ihm ihre Besorgungen erledigten, wenn auch die Tafel bei den im Winter alle vierzehn Tage stattfindenden Diners, zu denen einige Freunde kamen, einen gewissen Luxus wahrte – mit welch langem Fasten, mit welch knausrigen Einsparungen zu jeder Stunde war dieser trügerische Schein des Reichtums erkauft! In einem kleinen Schuppen, den Blicken verborgen, wurden ständig die armseligen, von der Seife zerfressenen, Faden für Faden geflickten Sachen gewaschen, um die Rechnung für die Wäscherei niedrig zu halten; ein bißchen verlesenes Gemüse bildete die Abendmahlzeit, das Brot ließ man auf einem Brett altbacken werden, um weniger davon zu essen; da gab es alle möglichen Kniffe der Sparsamkeit, unscheinbar und rührend: der alte Kutscher nähte wieder und wieder die durchlöcherten Stiefelchen des Fräuleins, die Köchin schwärzte die Fingerspitzen der allzu abgetragenen Handschuhe der gnädigen Frau mit Tinte, die Kleider der Mutter gingen nach geschickt ersonnenen Umarbeitungen auf die Tochter über, und die Hüte überdauerten dank den ausgetauschten Blumen und Bändern Jahre. Wenn niemand erwartet wurde, waren die Empfangssalons im Erdgeschoß sowie die großen Räume im ersten Stockwerk sorgfältig verschlossen, denn von der ganzen weitläufigen Wohnung bewohnten die beiden Frauen nur noch ein schmales Zimmer, das sie zu ihrem Eßzimmer und Boudoir gemacht hatten. Wenn das Fenster etwas offenstand, konnte man die Gräfin wie eine arme kleine Bürgersfrau beim Wäscheausbessern sehen, während das junge Mädchen zwischen seinem Klavier und seinem Wasserfarbenkasten Strümpfe und Fäustlinge für die Mutter strickte. Eines Tages, als ein starkes Gewitter tobte, sah man die beiden im Garten, wie sie den Sand zusammenschaufelten, den der heftige Regen weggespült hatte.
Jetzt kannte Frau Caroline ihre Geschichte. Die Gräfin Beauvilliers hatte unter ihrem Gatten, der ein Wüstling war, viel gelitten, sich aber nie beklagt. In Vendôme hatte man ihn ihr eines Abends röchelnd, mit einer Kugel im Leib, ins Haus gebracht. Man sprach von einem Jagdunfall: irgendein Schuß von einem eifersüchtigen Forstaufseher, dessen Frau oder Tochter er genommen hatte. Und das schlimmste war, daß mit ihm das einst riesige Vermögen der Beauvilliers dahingeschwunden war, unermeßliche Ländereien, wahrhaft königliche Güter, die schon vor der Revolution zusammengeschrumpft waren und die sein Vater und er vollends durchgebracht hatten. Von dem gesamten großen Grundbesitz blieb ein einziger Pachthof, Les Aublets, einige Meilen von Vendôme entfernt, der an die fünfzehntausend Francs Jahreszinsen einbrachte, die einzige Hilfsquelle der Witwe und ihrer beiden Kinder. Das Palais in der Rue de Grenelle war längst verkauft worden, das Haus in der Rue Saint-Lazare verschlang den größten Teil der fünfzehntausend Francs aus dem Pachthof, denn es war mit Hypotheken überlastet und von der Versteigerung bedroht, wenn die Zinsen nicht bezahlt wurden; es blieben kaum noch sechs- oder siebentausend Francs für den Unterhalt von vier Personen, für die Lebenshaltung einer adligen Familie, die nicht abdanken wollte. Schon vor acht Jahren, als die Gräfin Witwe geworden war und mit einem zwanzigjährigen Sohn und einer siebzehnjährigen Tochter den Zusammenbruch ihres Hauses erlebte, hatte sie in ihrem Adelsstolz dem Schicksal Trotz geboten und sich geschworen, lieber von Wasser und Brot zu leben, als von ihrem Rang herabzusteigen. Seitdem hatte sie nur noch den einen Gedanken, ihre gesellschaftliche Stellung zu behaupten, ihre Tochter mit einem Mann von gleichem Adel zu verheiraten, aus ihrem Sohn einen Soldaten zu machen. Ferdinand hatte ihr zunächst durch ein paar Jugendtorheiten, Schulden, die bezahlt werden mußten, übermäßige Sorgen bereitet; aber nachdem er in einer feierlichen Unterredung über ihre Lage unterrichtet worden war, hatte er nicht wieder angefangen. Denn im Grunde besaß er ein zärtliches Gemüt, war einfach nur müßig und unbedeutend, wurde aus jedem Amt abgeschoben und fand keinen annehmbaren Platz in der heutigen Gesellschaft. Jetzt, als Soldat des Papstes, gab er ihr immer noch Anlaß zu heimlicher Angst, denn er war von schwächlicher Gesundheit und trotz seines stolzen Äußeren empfindlich; bei seiner Blutarmut war das römische Klima gefährlich für ihn. Was Alices Heirat betraf, so wollte und wollte sie sich nicht anbahnen, und der traurigen Mutter standen die Augen voller Tränen, wenn sie ihre schon gealterte Tochter anschaute, die im Warten dahinwelkte. Trotz ihres schwermütigen und unscheinbaren Aussehens war sie keineswegs einfältig, sie sehnte sich glühend nach dem Leben, nach einem Mann, der sie lieben würde, nach Glück; doch weil sie die Familie nicht noch mehr betrüben wollte, tat sie so, als hätte sie auf alles verzichtet, machte sich über die Ehe lustig und sagte, daß sie berufen sei, eine alte Jungfer zu werden. Nachts aber schluchzte sie in ihr Kopfkissen und glaubte vor Schmerz über ihr Alleinsein sterben zu müssen. Die Gräfin hatte es durch die Wunder ihres Geizes immerhin geschafft, zwanzigtausend Francs beiseite zu legen, Alices ganze Mitgift; desgleichen hatte sie aus dem Schiffbruch einige Schmuckstücke gerettet, ein Armband, Fingerringe und Ohrringe, die etwa zehntausend Francs wert waren – eine sehr magere Mitgift, ein Brautgeschenk, von dem sie nicht einmal zu sprechen wagte, da es kaum für die ersten Ausgaben langen würde, wenn der erwartete Ehemann vorstellig werden sollte. Und doch wollte sie nicht verzweifeln, sondern kämpfte weiter, gab keines der Vorrechte ihrer Geburt auf, war noch immer vornehm und angemessen reich und hielt es für unter ihrer Würde, zu Fuß auszugehen oder am Empfangsabend ein Zwischengericht weniger zu reichen. Dafür knauserte sie in ihrem verborgenen Leben, verurteilte sich wochenlang dazu, Kartoffeln ohne Butter zu essen, um der doch nie ausreichenden Mitgift der Tochter fünfzig Francs hinzuzufügen. Tagtäglich erlegte sie sich diesen schmerzlichen und kindischen Heldenmut auf, während über ihren Köpfen das Haus von Tag zu Tag immer mehr verfiel.
Indessen hatte Frau Caroline bis dahin noch keine Gelegenheit gefunden, mit der Gräfin und ihrer Tochter zu sprechen. Mittlerweile kannte sie die intimsten Einzelheiten aus ihrem Leben, Einzelheiten, die die Beauvilliers vor der ganzen Welt verborgen glaubten, doch sie hatten bislang nur Blicke getauscht, Blicke, die sich unbewußt in ein plötzliches Gefühl der Zuneigung verwandeln können. Die Fürstin dʼOrviedo sollte sie einander näherbringen. Sie war auf den Gedanken gekommen, für ihr »Werk der Arbeit« eine Art Aufsichtskommission aus zehn Damen zu bilden, die wöchentlich zweimal zusammenkamen, das »Werk« eingehend in Augenschein nahmen und alle Abteilungen kontrollierten. Da sie sich vorbehielt, diese Damen selbst auszuwählen, hatte sie als eine der ersten Madame de Beauvilliers benannt, die früher eine ihrer besten Freundinnen gewesen und heute, da sie zurückgezogen lebte, einfach ihre Nachbarin geworden war. Und als die Aufsichtskommission plötzlich ohne Sekretärin war, hatte Saccard, der bei der Verwaltung des Hauses das große Wort führte, den Einfall, Frau Caroline als eine Mustersekretärin zu empfehlen, wie man sie nirgendwo anders finden könne. In der Tat war die Arbeit ziemlich mühselig, es gab viel Schreibereien, und man mußte manchmal sogar mit Hand anlegen, was diesen Damen ein wenig zuwider war; aber von Anfang an offenbarte sich Frau Caroline als eine bewundernswerte Hausmutter; ihre unbefriedigte Mutterschaft, ihre übermäßige Kinderliebe entfachten in ihr eine lebhafte Zärtlichkeit für alle diese armen Wesen, die man aus der Pariser Gosse zu retten versuchte. So war sie bei der letzten Kommissionssitzung der Gräfin Beauvilliers begegnet; die Gräfin hatte aber nur einen ziemlich kühlen Gruß an sie gerichtet, um ihre heimliche Verlegenheit zu verbergen, denn zweifellos spürte sie, daß sie in ihr eine Zeugin ihres Elends vor sich hatte. Jetzt grüßten sich beide, sooft ihre Augen sich trafen und es eine zu große Unhöflichkeit gewesen wäre, so zu tun, als kennte man sich nicht.
Eines Tages beobachtete Frau Caroline wie gewöhnlich vom Fenster des großen Arbeitszimmers aus die Gräfin und deren Tochter bei ihrem Gang durch den Garten, während Hamelin einen Plan nach neuen Berechnungen berichtigte und Saccard daneben stand und ihm bei der Arbeit zusah. An jenem Morgen entdeckte sie an den Füßen der beiden Frauen Schuhe, die so abgetragen waren, daß nicht einmal eine Lumpensammlerin sie von der Straße aufgelesen hätte.
»Ach, die armen Frauen!« murmelte sie. »Wie schrecklich muß diese Komödie des Luxus sein, die sie meinen spielen zu müssen!«
Und sie trat zurück, verbarg sich hinter dem Vorhang, aus Furcht, die Mutter könnte sie bemerken und noch mehr darunter leiden, so belauert zu werden. Sie selbst hatte sich in den drei Wochen, die sie allmorgendlich an diesem Fenster verbrachte, beruhigt. Der große Kummer über ihre Verlassenheit schwand; es war, als ließe sie der Anblick des Unglücks anderer ihr eigenes Mißgeschick, diesen Zusammenbruch, von dem sie glaubte, er erfasse ihr ganzes Leben, mutiger ertragen. Erneut ertappte sie sich beim Lachen.
Einen Augenblick noch folgte sie mit träumerischem Blick den beiden Frauen in dem von grünem Moos überwucherten Garten. Dann drehte sie sich lebhaft zu Saccard um.
»Sagen Sie mir doch bloß, warum kann ich nicht traurig sein ... Nein, dies Gefühl hält bei mir nicht an, hat nie angehalten, ich kann nicht traurig sein, was mir auch zustößt ... Ob das wohl Egoismus ist? Aber nein, das glaube ich nicht. Das wäre zu häßlich, und wenn ich auch noch so fröhlich bin, so zerreißt es mir trotz allem das Herz beim Anblick des geringsten Schmerzes. Bringen Sie das unter einen Hut, ich bin fröhlich, und ich könnte über alle Unglücklichen weinen, die vorbeigehen, wenn ich mich nicht zurückhielte, weil ich begreife, daß das kleinste Stückchen Brot ihrer Sache viel besser dienen würde als meine unnützen Tränen.«
Während sie das sagte, lachte sie ihr schönes, mutiges Lachen einer tapferen Frau, die geschwätzigem Mitleid die Tat vorzieht.
»Gott weiß«, fuhr sie fort, »ob ich Grund hatte, an allem zu verzweifeln. Ach, das Glück hat mich bisher nicht verwöhnt ... Nach meiner Heirat bin ich in die Hölle geraten, wurde beschimpft und geschlagen, und ich habe manchmal gedacht, daß mir nur noch übrigbliebe, ins Wasser zu gehen. Ich bin nicht ins Wasser gegangen, und als ich vierzehn Tage später mit meinem Bruder in den Orient fuhr, zitterte ich vor Jubel, und eine unermeßliche Hoffnung erfüllte mich ... Und bei unserer Rückkehr nach Paris, als uns beinahe alles fehlte, durchwachte ich scheußliche Nächte, in denen ich uns über unseren schönen Plänen verhungern sah. Wir sind nicht gestorben, ich fing wieder an, von erstaunlichen, glückverheißenden Dingen zu träumen, über die ich manchmal im stillen selber lachen mußte ... Und neulich, als mir dieser furchtbare Schlag versetzt wurde, von dem ich noch nicht einmal zu sprechen wage, war mir, als ob mir das Herz herausgerissen würde; ja, ich habe wirklich gespürt, wie es nicht mehr schlug, ich habe geglaubt, es ist zu Ende, ich habe geglaubt, ich wäre tot. Und dann nichts von allem! Das Leben hat mich wieder gepackt, heute kann ich schon wieder lachen, morgen werde ich wieder hoffen und von neuem leben wollen, immer leben ... Es ist doch komisch, daß ich nicht lange traurig sein kann!«
Saccard, der auch lachte, zuckte mit den Achseln.
»Ach was! Sie sind wie jedermann. Das Leben ist eben so.«
»Glauben Sie?« rief sie verwundert aus. »Mir scheint aber, als gäbe es so traurige Leute, die nie fröhlich sind, die sich das Leben unmöglich machen, so schwarz malen sie es sich aus ... Oh, nicht, daß ich noch Illusionen über die Annehmlichkeit und die Schönheit hätte, die es bietet. Es ist zu hart gewesen, ich habe es zu sehr aus der Nähe gesehen, überall und ungehindert. Es ist abscheulich, wenn nicht gar schändlich. Aber was wollen Sie? Ich liebe es. Warum? Ich weiß es nicht. Rings um mich kann alles in Gefahr sein und zusammenbrechen, ich stehe trotzdem schon am nächsten Tag fröhlich und voll Vertrauen auf den Trümmern ... Ich habe schon oft gedacht, daß mein Fall im kleinen der der Menschheit sei, die in einem gräßlichen Elend lebt, gewiß, die aber von der Jugend einer jeden Generation wieder aufgemuntert wird. Nach jeder Krise, die mich zu Boden wirft, kommt so etwas wie eine neue Jugend, ein Frühling, der neuen Lebenssaft verheißt, mich wieder erwärmt und mein Herz höher schlagen läßt. Das ist wirklich wahr. Wenn ich nach einem großen Kummer auf die Straße hinausgehe und in die Sonne trete, fange ich gleich wieder an zu lieben, zu hoffen, glücklich zu sein. Und das Alter hat mir nichts anhaben können, ich bin so einfältig, daß ich altere, ohne es gewahr zu werden ... Sehen Sie, ich habe für eine Frau viel zuviel gelesen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin ich gehe, wie es übrigens auch diese ganze weite Welt nicht mal mehr weiß. Aber unwillkürlich scheint mir, daß ich, daß wir alle auf etwas sehr Gutes, sehr Fröhliches zugehen.«
Sie bog am Ende alles ins Scherzhafte ab, und doch war sie bewegt, wollte nur verbergen, daß ihre Hoffnung sie hatte weich werden lassen; ihr Bruder hatte den Kopf gehoben und sah sie mit dankbarer Verehrung an.
»Oh, du«, sagte er, »du bist für Katastrophen wie geschaffen, du bist die Liebe zum Leben!«
Bei diesen täglichen Plaudereien am Morgen stellte sich nach und nach eine fieberhafte Erregung ein, und wenn Frau Caroline zu dieser natürlichen Freude zurückfand, die ihrer Gesundheit innewohnte, so rührte das von dem Mut her, den ihr Saccard mit seiner flammenden Begeisterung für die großen Geschäfte einflößte. Es war fast beschlossene Sache, die berühmte Mappe auszubeuten. Unter seiner schallenden hellen Stimme bekam alles Leben, wurde alles noch aufgebläht. Zuerst legte man die Hand aufs Mittelmeer, eroberte es durch die Allgemeine Gesellschaft der vereinigten Dampfschiffahrtslinien; und er zählte die Häfen aller Länder des Küstenstreifens auf, in denen die Schiffe künftig anlegen sollten, und er mischte verblaßte Erinnerungen an die Antike unter seine Begeisterung als Spekulant, pries dieses Meer, das einzige, das die alte Welt gekannt hatte, dieses blaue Meer, an dessen Gestaden einst die Kultur blühte, dessen Wellen die antiken Städte bespülten, Athen, Rom, Tyrus, Alexandria, Karthago, Marseille, all jene Städte, die Europa zu dem gemacht haben, was es ist. Wenn man sich dann dieses langen Weges in den Orient versichert hätte, wollte man unten in Syrien durch das kleine Geschäft mit der Silberbergwerksgesellschaft des Karmel beginnen, einfach ein paar Millionen so nebenbei zu gewinnen; ein hervorragender Auftakt wäre das, denn der Gedanke an ein Silberbergwerk, an scheffelweise in der Erde gefundenes Geld hatte immer etwas Begeisterndes für das Publikum, vor allem wenn man ihm noch einen so ungewöhnlichen und hochtönenden Namen wie Karmel als Aushängeschild hinzufügen konnte. Es gab dort unten auch Kohlevorkommen, Kohle direkt an der Oberfläche des Gesteins, die Gold aufwog, sobald erst Fabriken das Land überzogen; ganz zu schweigen von den anderen kleinen Unternehmungen, die als Zwischenakte dienen würden, die Gründung von Banken, Kartelle für die aufblühenden Industrien, die Ausbeutung der weiten Wälder des Libanon, dessen riesige Bäume an Ort und Stelle verfaulen, weil es an Straßen fehlt. Schließlich kam Saccard auf den großen Bissen zu sprechen, die Gesellschaft der Orient-Eisenbahnen, und da begann er irre zu reden, denn dieses Eisenbahngeflecht, gleich einem Fischernetz über ganz Kleinasien geworfen, bedeutete für ihn die Spekulation, das Leben des Geldes, das sich auf einen Streich dieser alten Welt bemächtigte wie einer neuen, noch unberührten Beute von unschätzbarem Reichtum, die unter der Unwissenheit und dem Schmutz der Jahrhunderte verborgen lag. Er witterte den Schatz, er wieherte wie ein Streitroß beim Geruch des Schlachtfeldes.
Frau Caroline, die einen so rechtschaffenen gesunden Menschenverstand besaß und sich für gewöhnlich allzu hitzigen Einbildungen gegenüber ablehnend verhielt, ließ sich dennoch von dieser Begeisterung hinreißen, sah nicht mehr klar, wie übertrieben alles war. In Wahrheit schmeichelte das ihrer Leidenschaft für den Orient, ihrer Sehnsucht nach diesem wunderbaren Land, in dem sie sich glücklich gewähnt hatte; und unbeabsichtigt peitschte Frau Caroline als logisches Ergebnis mit ihren farbigen Schilderungen, ihren überströmenden Auskünften Saccards Erregung höher und höher. Wenn sie von Beirut sprach, wo sie drei Jahre gelebt hatte, fand sie kein Ende mehr: Beirut am Fuße des Libanon, auf seiner Landzunge zwischen Strand aus rotem Sand und Felsmassen gelegen, Beirut mit seinen Häusern inmitten ausgedehnter Gärten in einem terrassenförmig ansteigenden weiten Rund – welch köstliches, mit Palmen, Orangen- und Zitronenbäumen bepflanztes Paradies. Dann die Küstenstädte, im Norden Antiochia mit seiner versunkenen Pracht, im Süden Saida, das alte Sidon, Akka, Jaffa und Tyrus, das heutige Sur, in dem man von allen anderen Städten etwas wiederfindet, Tyrus, dessen Kaufleute Könige gewesen waren, dessen Seefahrer Afrika umschifft hatten und das heute mit seinem versandeten Hafen nur noch ein Ruinenfeld ist, Staub der Paläste, aus dem sich hier und da ein paar elende Fischerhütten erheben. Sie hatte ihren Bruder überallhin begleitet, sie kannte Aleppo, Angora, Brussa, Smyrna und auch Trapezunt; einen Monat lang hatte sie in Jerusalem gelebt, das im Schacher um die heiligen Stätten entschlummert war, dann zwei weitere Monate in Damaskus, der Königin des Orients, der Industrie- und Handelsstadt, die die Karawanen aus Mekka und Bagdad zu einem Zentrum pulsierenden Lebens machen. Sie kannte auch die Täler und die Gebirge, die Dörfer der Maroniten45 und Drusen46 auf den Hochebenen und in der Tiefe der Schluchten, die bebauten Äcker und die ausgedörrten Felder. Und aus den entlegensten Winkeln, den stummen Einöden wie aus den Großstädten hatte sie die gleiche Bewunderung für die unerschöpfliche, die üppig wuchernde Natur und den gleichen Zorn auf die stumpfsinnigen, bösen Menschen mitgebracht. Wie viele Reichtümer der Natur wurden hier verschmäht oder verschleudert! Sie sprach von den Lasten, die Handel und Industrie zum Erliegen bringen, von diesem schwachsinnigen Gesetz, welches verbietet, in der Landwirtschaft Kapital über eine bestimmte Höhe hinaus zu investieren, und vom althergebrachten Schlendrian, der in den Händen des Bauern den Pflug beläßt, dessen man sich schon vor Christi Geburt bediente, und von der Unwissenheit, in der diese Millionen Menschen noch heute verkommen, gleich idiotischen, in ihrem Wachstum zurückgebliebenen Kindern. Früher war die Küste zu klein, die Städte berührten einander; jetzt hat sich das Leben ins Abendland verzogen, es scheint, als ginge man über einen ungeheuren verlassenen Friedhof. Keine Schulen, keine Straßen, die übelsten Regierungen, eine bestechliche Justiz, ein abscheuliches Verwaltungspersonal, allzu drückende Steuern, absurde Gesetze, Faulheit, Fanatismus, ganz zu schweigen von den ständigen Erschütterungen durch Bürgerkriege und Blutbäder, die ganze Dörfer ausrotten. Da wurde sie böse und fragte, ob es erlaubt sei, das Werk der Natur so zu verderben, ein gesegnetes Land von bestrickendem Reiz so zugrunde zu richten, ein Land, in dem alle Klimazonen anzutreffen waren, die glühenden Ebenen, die gemäßigten Hänge der Gebirge, der ewige Schnee auf den hohen Gipfeln. Und ihre Liebe zum Leben, ihre lebhafte Hoffnung versetzten sie in Glut bei dem Gedanken an den allmächtigen Zauberstab, mit dem die Wissenschaft und die Spekulation an diese alte, schlummernde Erde rühren konnten, um sie aufzuwecken.
»Warten Sie ab!« rief Saccard. »Diese Schlucht im Karmel, die Sie da gezeichnet haben, wo es nur Steine und Mastixsträucher gibt – sobald das Silbererzvorkommen abgebaut wird, wächst dort zunächst ein Dorf, dann eine Stadt empor ... Wir werden die versandeten Häfen freilegen und durch starke Molen schützen. Schiffe mit großem Tiefgang werden da anlegen, wo heute nicht mal Boote vor Anker zu gehen wagen ... Und in den entvölkerten Ebenen, auf den öden Pässen, die unsere Eisenbahnlinien überqueren sollen, werden Sie eine richtige Auferstehung erleben. Ja, Sie sollen sehen, wie die Felder urbar gemacht werden, wie Straßen und Kanäle entstehen, neue Städte aus dem Boden wachsen, wie das Leben endlich zurückkehrt wie in einen kranken Körper, dem man neues Blut zuführt. Ja, das Geld wird diese Wunder vollbringen!«
Und beim beschwörenden Klang dieser durchdringenden Stimme sah Frau Caroline die vorausgesagte Zivilisation wirklich anbrechen. Die nüchternen Zeichnungen, die geometrischen Umrisse nahmen Leben an, bevölkerten sich; das war ihr Wunschtraum von einem Orient, der von seinem Schmutz befreit, aus seiner Unwissenheit gerissen war, der mittels aller Erleichterungen der Wissenschaft den fruchtbaren Boden und das herrliche Klima nutzen konnte. Schon einmal hatte sie dem Wunder beigewohnt, diesem Port Said, das in so wenigen Jahren auf einem kahlen Strand emporgewachsen war – zuerst nur Hütten, die den wenigen Arbeitern der ersten Stunde Obdach gewährten, dann eine Stadt mit zweitausend Seelen, eine Stadt mit zehntausend Seelen, Häuser, riesige Kaufhäuser, ein gigantischer Hafendamm, lebhaftes Treiben und Wohlstand, von menschlichen Ameisen in ihrem Starrsinn geschaffen. Und das war es, was sie erneut vor Augen sah, den unaufhaltsamen Vormarsch, das Drängen des Volkes nach dem größtmöglichen Glück, das Bedürfnis zu handeln, vorwärtszugehen, ohne genau zu wissen wohin, doch unbeschwerter, unter besseren Bedingungen vorwärtszugehen; sie sah den Erdball umgewühlt von dem Ameisenhaufen, der seine Behausung erneuert, und sie sah die fortwährende Arbeit, die Eroberung neuer Genüsse, die verzehnfachte Macht des Menschen, die Erde, die ihm von Tag zu Tag mehr gehört. Das Geld bewirkte diesen Fortschritt, indem es der Wissenschaft half.
Hamelin, der lächelnd zuhörte, ließ nun ein weises Wort fallen.
»All das ist die Poesie der Ergebnisse, aber wir sind noch nicht einmal bei der Prosa des Anfangs.«
Doch Saccard geriet erst in Hitze, wenn er seine Vorstellungen ins Maßlose trieb, und das wurde schlimmer mit dem Tage, als er sich daranmachte, Bücher über den Orient zu lesen, und eine Geschichte über den Feldzug nach Ägypten47 aufschlug. Schon erfüllte ihn die Erinnerung an die Kreuzzüge, diese Rückkehr des Abendlandes an seine Wiege, das Morgenland, jene große Bewegung, die das ferne Europa in die Ursprungsländer zurückgeführt hatte, die noch in voller Blüte standen und wo es soviel zu lernen gab. Allein die große Gestalt Napoleons, der dorthin auszog, um für ein großartiges und geheimnisvolles Ziel Krieg zu führen, berührte ihn noch mehr. Wenn Napoleon davon sprach, Ägypten zu erobern, dort eine französische Niederlassung zu gründen und auf diese Weise Frankreich das Monopol im Levantehandel zu verschaffen, so sagte er gewiß nicht alles; und Saccard wollte in dieser Seite der Expedition, die unklar und rätselhaft geblieben ist, ein für ihn selbst nicht recht durchschaubares Vorhaben von gewaltigem Ehrgeiz sehen, die Wiedererrichtung eines unermeßlichen Reiches: Napoleon, in Konstantinopel zum Kaiser des Orients und Indiens gekrönt, verwirklichte, größer als Caesar48 und Karl der Große49, den Traum Alexanders50. Sagte er nicht auf Sankt Helena, als er von Sidney sprach, dem englischen General, der ihn vor Akka aufgehalten hatte: »Dieser Mann hat mich um mein Glück gebracht.« Und was die Kreuzzüge versucht hatten, was Napoleon51 nicht hatte vollenden können, dieser gigantische Gedanke an die Eroberung des Orients, eine wohldurchdachte, mit Hilfe der zwiefachen Kraft von Wissenschaft und Geld ins Werk gesetzte Eroberung, entflammte Saccard. Da ja die Kultur von Osten nach Westen gewandert war, warum sollte sie eigentlich nicht in den Osten zurückfinden, heimkehren in den ersten Garten der Menschheit, in dieses Eden der hindostanischen Halbinsel, die in der Ermattung der Jahrhunderte dahinschlummerte? Das wäre eine neue Jugend, er erweckte das irdische Paradies zu neuem Leben, machte es durch die Dampfkraft und die Elektrizität erneut bewohnbar, erhob Kleinasien wieder zum Zentrum der Alten Welt als Knotenpunkt der großen natürlichen Verbindungswege zwischen den Kontinenten. Nicht mehr Millionen waren zu verdienen, sondern Milliarden und aber Milliarden.
Seitdem hatten Hamelin und er allmorgendlich lange Besprechungen. Wenn auch die Hoffnung groß war, so zeigten sich doch zahlreiche Schwierigkeiten von riesigem Ausmaß. Der Ingenieur, der 1862 in Beirut gewesen war, während des entsetzlichen Blutbades, das die Drusen unter den maronitischen Christen anrichteten52 und das Frankreichs Eingreifen erforderlich machte, verhehlte nicht die Hindernisse, auf die man bei diesen Bevölkerungsgruppen stoßen würde, die sich ständig zum Vorteil der türkischen Behörden bekämpften. Allein er besaß in Konstantinopel mächtige Verbindungen, er hatte sich der Unterstützung des Großwesirs Fuad Pascha53 versichert, eines Mannes von echtem Verdienst und erklärten Parteigängers der Reformen; von ihm, so schmeichelte er sich, würde er alle notwendigen Konzessionen bekommen. Obwohl er den unvermeidlichen Bankrott des Osmanischen Reiches prophezeite, sah er andererseits in diesem zügellosen Geldbedürfnis, den Anleihen, die Jahr für Jahr aufgenommen wurden, eher einen günstigen Umstand: eine Regierung in Geldnöten ist, wenn sie keine persönliche Bürgschaft leisten kann, stets bereit, sich mit Privatunternehmen zu verständigen, sobald sie den geringsten Nutzen dabei findet. Und war es nicht eine praktische Art, die ewige und leidige Orientfrage zu lösen, indem man das Reich an großen zivilisatorischen Arbeiten interessierte, indem man es zum Fortschritt führte, damit es nicht mehr diesen ungeheuerlichen Grenzstein zwischen Europa und Asien bildete? Was für eine schöne patriotische Rolle könnten französische Gesellschaften dabei spielen!
Dann kam Hamelin eines Morgens in aller Ruhe auf das geheime Programm zu sprechen, auf das er manchmal anspielte und das er lächelnd die Krönung des Gebäudes nannte.
»Wenn wir dann die Herren sind, stellen wir das Königreich Palästina wieder her und setzen dort den Papst ein ... Zunächst wird man sich mit Jerusalem und Jaffa als Seehafen begnügen können. Dann wird Syrien für unabhängig erklärt und angegliedert ... Sie wissen, daß die Zeiten nahe sind, wo das Papsttum wegen der empörenden Demütigungen, denen man es unterwirft, nicht mehr in Rom bleiben kann54. Für jenen Tag müssen wir bereit sein.«
Saccard hörte ihm offenen Mundes zu, wie er diese Dinge arglos mit dem tiefen Glauben eines Katholiken vorbrachte. Er selbst scheute sich nicht vor überspannten Einfällen, aber nie wäre er so weit gegangen. Dieser Mann der Wissenschaft, der nach außen hin so kühl wirkte, verblüffte ihn. Er rief:
»Das ist ja verrückt! Die Pforte55 wird Jerusalem nicht hergeben.«
»Oh, warum nicht?« versetzte Hamelin friedlich. »Sie braucht soviel Geld! Mit Jerusalem hat sie Ärger, so wird sie es billig los. Oft weiß sie nicht, wie sie sich zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich den Besitz der heiligen Stätten streitig machen, verhalten soll ... Übrigens fände der Papst in Syrien echte Unterstützung bei den Maroniten, denn wie Sie wissen, hat er in Rom ein Kollegium für ihre Priester eingerichtet ... Mit einem Wort, ich habe mir alles gut überlegt, alles vorausgesehen, und eine neue Ära, die triumphale Ära des Katholizismus, wird anbrechen. Vielleicht wird man einwenden, das hieße zu weit gehen, der Papst sei dann gleichsam abgeschnitten von Europa und an seinen Angelegenheiten nicht mehr interessiert. Aber in welchem Glanz wird er erstrahlen, welche Autorität wird er genießen, wenn er an den heiligen Stätten thront und im Namen Christi vom Heiligen Land aus spricht, wo Christus gepredigt hat! Dort ist sein Erbe, dort muß sein Königreich sein. Und seien Sie beruhigt, wir werden dieses Königreich mächtig und fest begründen, wir werden es vor politischen Wirren schützen, indem wir sein Budget aus den Einnahmen des Landes und mit Hilfe einer großen Bank finanzieren, um deren Aktien sich die Katholiken in der ganzen Welt reißen werden.«
Saccard, der zu lächeln angefangen hatte, war von den Ausmaßen des Vorhabens schon verführt, wenn auch noch nicht ganz überzeugt, aber er konnte sich nicht versagen, dieser Bank mit einem Freudenruf über seinen glücklichen Einfall schon einen Namen zu geben.
»Die Bank zum Heiligen Grab, was? Prächtig! Das wird ein Geschäft!«
Er begegnete dem vernünftigen Blick Frau Carolines, die ebenfalls lächelte, aber skeptisch, sogar ein wenig verärgert, und er schämte sich seiner Begeisterung.
»Trotzdem werden wir, mein lieber Hamelin, gut daran tun, diese Krönung des Gebäudes, wie Sie sagen, geheimzuhalten. Man würde sich über uns lustig machen. Und dann ist unser Programm schon mächtig überlastet, es ist angebracht, seine letzten Konsequenzen, das ruhmreiche Ende, allein den Eingeweihten vorzubehalten.«
»Zweifellos, das ist immer meine Absicht gewesen«, erklärte der Ingenieur. »Dies wird das Mysterium sein.«
Und auf dieses Wort hin wurde an jenem Tag endgültig beschlossen, die Mappe auszubeuten, die ganze lange Reihe von Vorhaben in Angriff zu nehmen. Man wollte damit beginnen, ein bescheidenes Kreditinstitut zu schaffen, um die ersten Geschäfte zu tätigen; wenn dann der Erfolg half, konnte man sich allmählich zum Herrn des Marktes aufschwingen und die Welt erobern.
Als Saccard am nächsten Tag zur Fürstin dʼOrviedo hinaufging, um eine Weisung für das »Werk der Arbeit« entgegenzunehmen, kam ihm die Erinnerung an den Traum wieder, mit der er einen Augenblick lang geliebäugelt hatte, nämlich der Prinzgemahl dieser Königin des Almosens, der schlichte Verteiler und Verwalter des Vermögens der Armen zu werden. Und er lächelte, denn er fand das jetzt ein wenig läppisch. Er war dazu geschaffen, Leben zu zeugen, und nicht, die Wunden zu verbinden, die das Leben geschlagen hat. Endlich sollte er wieder an seinem Platz stehen, mitten in der Schlacht der Interessen, und am Wettlauf um das Glück teilnehmen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert der Marsch der Menschheit zu größerer Freude und zu mehr Licht gewesen ist.
Am selben Tag traf er Frau Caroline allein im Zeichenraum an. Sie stand an einem der Fenster, wo das Erscheinen der Gräfin Beauvilliers und ihrer Tochter im Nachbargarten zu ungewohnter Stunde sie festhielt Die beiden Frauen lasen mit dem Ausdruck großer Traurigkeit einen Brief, zweifellos ein Brief des Sohnes Ferdinand, dessen Lage in Rom nicht gerade glänzend sein mochte.
»Schauen Sie«, sagte Frau Caroline, als sie Saccard gewahrte. »Noch ein neuer Schmerz für diese Unglücklichen. Die Bettlerinnen auf der Straße tun mir weniger leid.«
»Ach was!« rief er fröhlich aus. »Sie müssen sie bitten, mich zu besuchen. Wir werden auch sie reich machen, da wir ja jedermann zum Glück verhelfen.«
Und in seiner glücklichen, fieberhaften Erregung suchte er ihre Lippen, um sie zu küssen. Aber mit einer schroffen Bewegung hatte sie den Kopf weggezogen und war, von plötzlichem Unbehagen befallen, ernst und blaß geworden.
»Nein, bitte nicht.«
Seitdem sie sich ihm in einem Augenblick mangelnder Selbstkontrolle hingegeben hatte, versuchte er zum erstenmal wieder, sie zu nehmen. Da die ernsten Geschäfte eingeleitet waren, dachte er an sein Glück in der Liebe und wollte auch von dieser Seite her die Lage klären. Ihre lebhaft abweisende Bewegung verwunderte ihn.
»Ganz ehrlich, würde Ihnen das weh tun?«
»Ja, sehr.«
Sie beruhigte sich und lächelte.
»Und gestehen Sie es nur, Ihnen liegt selbst nicht viel daran.«
»Mir? Oh, ich bete Sie an.«
»Nein, sagen Sie das nicht. Sie werden bald so beschäftigt sein! Und dann ... ich versichere Ihnen, ich bin bereit, wahre Freundschaft für Sie zu empfinden, wenn Sie der Mann der Tat sind, für den ich Sie halte, und wenn Sie alle die großen Dinge vollbringen, von denen Sie reden ... Sehen Sie, Freundschaft ist viel besser!«
Immer noch lächelnd, hörte er ihr zu und war doch verlegen und betroffen. Sie verweigerte sich ihm. Zu dumm, daß er sie nur einmal besessen hatte, damals, als er sie überrumpelt hatte. Doch darunter litt nur seine Eitelkeit.
»Also bloß Freunde?«
»Ja, ich will Ihr Kamerad sein, ich werde Ihnen helfen ... Lassen Sie uns Freunde, wahre Freunde sein!«
Sie hielt ihm die Wangen hin, und besiegt, weil er fand, daß sie recht hatte, drückte er zwei herzhafte Küsse darauf.