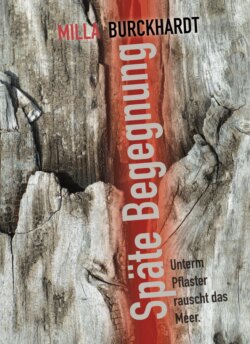Читать книгу Späte Begegnung - Milla Burckhardt - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Kind sein
ОглавлениеBjörn
Seine Eltern trafen sich während des Studiums an der University of Southern California in Los Angeles. Finn war aus Skandinavien gekommen1 und wollte eigentlich schreiben, aber er brauchte Geld, und mit Literatur konnte er nichts verdienen. Es blieb die Wissenschaft und für das Fach Volkswirtschaft waren Stipendien ausgeschrieben. Er musste sich nicht sehr anstrengen, um eines zu gewinnen und war zunächst seiner finanziellen Sorgen ledig. Bei einem studentischen Fest lernte er Louise kennen und war fasziniert von ihrem Auftreten. Da er in den USA zunächst sehr alleine war, war er glücklich, dass sie sich zunächst auf ein Gespräch, dann auf mehrere Tänze einließ. Ihre großen Augen, ihr Lächeln und nicht zuletzt ihr Temperament beim Tanz verwirrten ihn, der bislang nur mit Männern näheren Kontakt hatte. Louise wiederum war unter Frauen aufgewachsen und hatte keinerlei Erfahrung mit Männern. Aber dass sie ein attraktives Mädchen war, das hatte sie schon als Jugendliche an den Reaktionen von Verwandten, Mitschülern und Freundinnen erfahren. Finn, den norwegischen Studenten, erlebte sie als höflich und liebenswürdig, ohne aufdringlichen Charme. Sein Flair aus der Welt Europas zog sie an, wie auch seine Klugheit. Sie verstanden sich auf Anhieb. Schnell wurden sie ein Paar. Sie wechselte ihr Studienfach und begann, ebenfalls VWL zu studieren. Beide fühlten sich einer intellektuellen Schicht in den USA zugehörig, die sozialistischen Ideen anhing und nicht nur in Amerika mehr Chancengleichheit realisieren wollte.
Finn wie Louise trugen an schwerem Kindheitsgepäck. Louises Eltern waren kurz nacheinander an der Spanischen Grippe2 gestorben, als sie fünf Jahre alt war. Sie wuchs bei der Großmutter auf, getrennt von ihren Geschwistern, die bei Schwestern ihrer Mutter untergebracht wurden. Finns Vater in Norwegen zog seinen Sohn alleine auf. Er konnte nicht verwinden, dass ihn seine Frau kurz nach der Geburt des Sohnes verlassen hatte. Sein Enkel erlebte ihn als einen Mann, der an der Welt und seinem eigenen Leben krankte. Finn wie auch Louise hatten frühe Bindung nur als eigene Sehnsucht erlebt. In die Ehe stolperten sie ohne sexuelle Erfahrungen.
Finn hatte Freude an wissenschaftlicher Arbeit und sie fiel ihm leicht. Sofort nach dem Abschluss des Studiums erhielt er eine Stelle als Assistenzprofessor in Charlottesville im Staat Virginia. Damit war der Lebensunterhalt für ihn und eine künftige Familie gesichert. Er mietete eine Wohnung und kaufte einen gebrauchten Model T Ford, ein Auto, das noch mit einer Kurbel in Gang gebracht werden musste. Das Baby, das er und Louise sich wünschten, kam 1936 zur Welt und wurde nach Finns Vater Björn genannt.
Louises Beziehung zu ihrem Kind war überschattet von beginnender Unzufriedenheit mit ihrer Hausfrauenrolle und ihrer Ehe. Sie fühlte sich weder sexuell noch intellektuell ausgelastet. Was der Ehemann ihr an Bestätigung nicht geben konnte und was ihr im Beruf fehlte, sollte nun ihr kleiner Junge bringen. Ein Kind zu haben, Mutter zu sein, bedeutete Erfolg im Leben einer Frau und einen Meilenstein auf dem Wege zu gesellschaftlichem Ansehen. Stolz fuhr sie mit dem Baby zu den Verwandten in Ohio, wo sie ihre Kindheit verbracht hatte. Und die Anerkennung für das kleine blonde Wesen blieb nicht aus: Alle waren angetan von dem aufgeweckten Baby. Louise freute sich, dass ihr in dieser Woche auch viel abgenommen wurde: Großmutter und Schwester wollten immer wieder das Baby füttern, wickeln und mit ihm spielen. Es gab auch ein Fest im Haus der Verwandten, an dem die junge Frau gerne teilnahm. Ihr Baby legte sie in einem Dachzimmer ins große Doppelbett, damit es schlafen konnte. Als sie nach dem Fest das Zimmer betrat, war sie entsetzt: das Baby hatte sich wider Erwarten bis zum Ende des Bettes gerollt und war hinunter gefallen. Louise dachte, ihr Sohn sei tot, bis sie merkte, dass er nach dem Sturz ruhig weiter geschlafen hatte. Sie war unendlich erleichtert. Ansonsten befand sich das Kind nicht im Zentrum ihres Denkens und Fühlens.
Bei ihrer Abfahrt hatten sich alle am Bahnhof eingefunden, um ihr Adieu zu sagen. Louise stieg in den Zug, der Zug fuhr los. Louise stand am Fenster und winkte. Erschrocken hörte sie ihre Großmutter schreien. „Louise, Louise!“ Sie sah ihr Kind in den Armen der Tante und nun fiel ihr auf, dass sie es vergessen hatte. Der Schaffner zog die Notbremse und so kamen Mutter und Kind wieder zusammen. Louise war der Vorfall peinlich – dass eine Frau ihr Kind vergaß stand nicht im Guide zur erfolgreichen Mutterschaft. Finn konnte sie die Geschichte schon amüsiert erzählen und er, der immer noch begeistert war von ihr, fand sie ebenfalls lustig.
Wenn Louise Björn ansah, ihn wickelte, sein Lächeln wahrnahm, wenn sie ihn, etwas später, beim Spielen beobachtete, fühlte sie nicht nur Stolz, sondern auch Zärtlichkeit. Wie war es möglich, dass sie ein solches Wesen auf die Welt gebracht hatte! Er war nicht nur ein sehr hübsches Kind, das anzusehen ihr Freude bereitete. Er reagierte sensibel auf alle Reize seiner Umgebung, auch auf jede ihrer Stimmungen. So war er oft ein Gefährte für sie, der ihr die eigene Befindlichkeit widerspiegelte.
Sobald er sprechen konnte, stellte er Fragen zum Zustand der Welt und allem, was er um sich herum wahrnahm. Er lernte schnell und ließ sich in seinem Tun nicht leicht beirren – Misserfolge bei der Lösung einer Aufgabe, sei es beim Spielen, sei es im Haushalt, entmutigten ihn nicht. Er bemerkte die stolzen Blicke seiner Eltern. Sie konnten beide nicht mit ihm spielen, über diese Gabe verfügten sie nicht, aber sie erklärten ihm sehr früh den unbefriedigenden Zustand der Welt und die täglichen Herausforderungen, ohne Druck auszuüben.
Mit dem kleinen Elefanten, den Louise ihm zum zweiten Geburtstag schenkte, hatte Björn zum ersten Mal in seinem Leben einen Freund. Das Stofftier war fast so groß wie der kleine Junge und wurde zu seinem ständigen Begleiter. Louise fragte nicht lange, wie er das Tier nennen wolle, sondern gab ihm den Namen Aloysius. Mit diesem Namen verband Björn mit der Zeit die Nähe und Wärme, die er manchmal bei beiden Eltern vermisste. Beide waren zeitlich sehr eingebunden. Finn musste sich anstrengen, im Wettbewerb der akademischen Welt zu bestehen. Louise strebte ebenfalls eine akademische Karriere an, so war die Zeit für das Kind knapp. Dafür war der Elefant immer da, er war der Gefährte, der aufmerksam Björns Vorträgen lauschte. Und darauf verstand sich der Dreijährige. Er nahm Inhalte schnell auf und konnte sie auch wiedergeben. Seine Eltern hatten ihm erklärt, dass sie mit Volkswirtschaft ihr Geld verdienten, und Volkswirtschaft, so lernte er, befasste sich mit der Verteilung knapper Güter. Björn zitierte seine Eltern, obwohl er nicht alles verstand und hielt Aloysius Vorträge auch zu diesem Thema. Er war beglückt über den interessierten Zuhörer.
Aber er verlor seinen Freund. Bei einem Ausflug ins Gebirge kurvte der Bus hin und her und Björn wurde so schlecht, dass er sowohl auf seinen Elefanten wie auch auf den Sitz erbrach. Der Busfahrer, wütend über die nun verdreckten Sitzkissen und den ihm drohenden Ärger, riss Aloysius aus Björns Armen und warf ihn den Abhang hinunter. Björn war verzweifelt, schrie und wollte seinem Freund hinterher springen, um ihn zu retten. Das konnten die Eltern verhindern. Nicht aber den Schmerz über den verlorenen Freund.
Als Ersatz für Aloysius kauften sie einen lebendigen Hund für ihren Sohn. Der Hund kam seiner Aufgabe nach, den Schmerz Björns zu lindern. Björn war glücklich, wenn Bobby schwanzwedelnd auf ihn zukam, sich zu seinen Füßen legte, seine Hände oder auch das Gesicht leckte. Mit diesem Freund konnte er reden und bekam auch eine Antwort, was nicht hieß, dass der Hund immer folgte. Aber er achtete auf das, was Björn zu ihm sagte. Immer wenn Björn ihn liebevoll, auffordernd oder strafend ansah oder ansprach, reagierte er unterschiedlich. Er war lebendig. Björn hatte nun wieder einen Gefährten, der ihn überallhin begleitete, wo ein Hund erlaubt war. Bobby war ein richtiges Familientier und freute sich auch, mit den Eltern oder einem von ihnen zusammen zu sein.
Eines Tages, als Björn noch im Kindergarten war, fuhr der Vater in die Garage. Bobby kannte den Wagen und freute sich dermaßen, dass er ihm ins Auto lief. Finn hatte den kleinen Hund nicht bemerkt und überfuhr ihn. Der Hund war nur noch ein blutiges Etwas und starb vor seinen Augen. Entsetzt berichtete er seiner Frau, was passiert war. Als Björn nach Hause kam, fragte er als Erstes: „Wo ist Bobby?“ Denn er war es gewohnt, dass der Hund ihm entgegen sprang. Finn war gerade nicht im Raum, Louise senkte kurz die Augen und sagte ihm dann, sie hätten den Hund in eine Klinik bringen müssen, er sei schwer krank. Björn brach in Tränen aus, wollte in die Klinik, aber seine Mutter sagte, der Hund müsse sich erholen. Und Bobby kam nicht wieder. Damit der Schmerz um den Hund, der nicht wiederkommen würde, abgemildert würde, kaufte Finn einen Bruder von Bobby. Der solle nun so lange bleiben, bis Bobby wieder käme, sagten er seinem kleinen Jungen. Aber Björn konnte sich an den neuen Hund nicht gewöhnen – er war doch ganz anders als Bobby. Bobby kam nicht wieder, und Björns Schmerz war noch schlimmer als die Trauer um Aloysius. Wieder war der nun Vierjährige alleine.
Die Eltern spürten, dass es bei Björn ein großes Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit gab. Sie hatten selbst in ihrer Kindheit nicht genug davon bekommen und waren von daher nicht ausreichend in der Lage, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Weitere Kinder, die ein Gegengewicht gebildet hätten, vermieden sie. Louise hatte schon mit einem Kind genug zu kämpfen, um in der Arbeitswelt Fuß zu fasen. Manchmal nahm sie Björn in den Arm und küsste ihn. Aber das war nicht oft, und immer, wenn er anfing, die körperliche Nähe zu genießen, setzte sie ihn ab und wandte sich ihren anderen Interessen zu. Seine Sehnsucht wurde nie ganz erfüllt.
Mit vier Jahren verliebte sich Björn in Vera, ein gleichaltriges Mädchen aus der Nachbarschaft. Er wollte ihr nahe sein, ihren Körper berühren und sich an sie schmiegen. Später würde er sie heiraten. Er zog das Mädchen liebevoll und voller Neugier auf den Mädchenkörper aus. Sie sagte: „Was machst du da?“, unterbrach ihn aber nicht. Sie genoss, dass er sie streichelte und beide Kinder dachten sich nichts Böses. Nachdem Vera zu Hause erzählt hatte, was Björn mit ihr spielte, verboten ihre Eltern den Umgang mit ihm – für Björn ein Schlag in das Gestrüpp seiner Sehnsüchte. Hatte er etwas Schlechtes getan? Er verstand Veras Eltern nicht. Louise verurteilte ihn zwar nicht, sie ließ den Vorfall auf sich beruhen. Aber sie versäumte, mit ihm darüber zu sprechen, so dass sich bei dem kleinen Jungen eine gewisse Unsicherheit festsetzte. Wenn er nun Vera sah, vermied er ein Näherkommen, um nicht noch einmal enttäuscht zu werden.
Andere Jungen erlebte er als aggressiv und gewalttätig. Ein Junge, kleiner als er, war langsamer als die anderen Kinder und einige der Jungen verspotteten ihn. Wenn es Streit gab, waren zwei Jungen, Ronald und Herbert, auch gleich zu Schlägen bereit – man musste sich vorsehen. Björn hatte Angst, selbst die Rolle des gedemütigten Jungen übernehmen zu müssen. Und er gab den aggressiven Kindern Anlässe. Er war gesichtsblind3, ohne es zu wissen. Wenn er ein Gesicht sah, das ihm eigentlich bekannt war, konnte er sein Gegenüber nicht erkennen. So hielt sein Gegenüber – Kind oder Erwachsener – ihn häufig für unhöflich oder dumm. Freunde fand er nicht.
Seine Position in der Hierarchie der Kindergruppe wurde durch eine weitere körperliche Schwäche beeinträchtigt. Die Kinder im Kindergarten und später in der Grundschule nutzten die Gelegenheit, ihn auszulachen, denn seine Beine konnten auf Druck nicht standhalten. Björn konnte nicht mehr aufrecht stehen, wenn ein Kind ihn von hinten schubste, er fiel sofort auf die Knie, und die waren immer lädiert. Diese Unfähigkeit wurde als Schwäche betrachtet. Die Kinder machten sich über ihn lustig, auch die Erwachsenen hielten ihn für einen Schwächling. Sie kümmerten sich nur dann um ihn, wenn die Knie bluteten und ein Pflaster nötig war. Seine Schwäche gab ihm immer wieder das Gefühl, nicht so stark und leistungsfähig wie die anderen zu sein. Jahre später, als die stärkeren Beschwerden schon fast der Vergangenheit angehörten, wurde die Auffälligkeit als Morbus Ollier diagnostiziert. Als er das erfuhr, dachte er: Vielleicht war es ein Glück, dass im Kindesalter keine Diagnostik stattfand – man hätte ihn möglicherweise operiert, was nicht erforderlich war, weil das Leiden sich meistens auswächst.
Verhielten sich manche Kinder im Kindergarten Björn gegenüber unduldsam und unfreundlich, so waren sie gegenüber jenen, die den Kindergarten gar nicht besuchen konnten, voller Verachtung. Schwarze galten nicht als vollwertige Menschen. Man sah sie nicht im Kindergarten, außer vielleicht in Kinderbüchern. Sie traten nur als minderwertige Objekte in Erzählungen oder Berichten in Erscheinung. Björn nahm diese Überheblichkeit mit Erstaunen zur Kenntnis, denn Finn und Louise hatten ihm vermittelt, dass alle Menschen ohne Ansehen der Hautfarbe oder Religion ein Recht auf Glück hatten. Praktiziert wurde ihre Einstellung täglich, wenn sie respektvoll mit ihrem schwarzen Dienstmädchen die Alltagsprobleme und -aufgaben besprachen. Björn merkte, dass die Prinzipien, an die seine Eltern glaubten, nicht überall galten. Insofern erweiterte die Enge des Kindergartens seinen Gesichtskreis.
Björn hatte Vera geliebt. Die Fragen, die er in der Begegnung mit ihr hatte, waren durch den Abbruch der Beziehung nicht beantwortet worden. In der Begegnung mit Mädchen im Kindergarten stellten sie sich neu. Wie sah ein Mädchen aus im Vergleich zu ihm? Welches waren die Unterschiede? Wie reagierte es auf eine Berührung hier oder dort? Manchmal versuchte er, Mädchen auszuziehen, um ihren Körper zu bewundern. Drei der kleinen Mädchen ließen das gerne geschehen. Hier war es eher sein Forscherdrang, der ihn antrieb, nicht die Sehnsucht nach Nähe. Aber die Mädchen erzählten, was geschehen war, den Erzieherinnen, die empört reagierten. Rosina sah ihn böse an und sagte: „Wie kannst du solche Schweinereien machen?“ Gretel, die zweite Erzieherin, sah ihn ebenfalls vorwurfsvoll an und sagte: „Was du da tust ist unkeusch.“ Der kleine Björn war niedergeschmettert. Schweinereien? Unkeusch? Was ist das? Er begriff die Worte für sein Tun nicht und konnte nichts zu seiner Verteidigung vorbringen. Für die professionellen Erzieherinnen war er ein perverser Junge, sie kündigten den Vertrag mit seinen Eltern. Finn und Louise, denen Freud nicht unbekannt war, konnten an Björns Verhalten nichts Schlimmes finden und nahmen sein Verhalten als Ausdruck von Entdeckungslust, vielleicht auch früher sexueller Neugierde wahr. Das war nichts Schlimmes, wie sie wussten. Es war nicht das einzige Mal, dass ihnen Amerika rückständig vorkam. Aber sie sprachen nicht mit ihm, um ihm die unterschiedlichen Normen im Kindergarten und zu Hause verständlich zu machen. Björn behielt im Ohr, wie empört die Erzieherinnen mit ihm und über ihn sprachen. Er durfte nicht mehr in den Kindergarten gehen und fühlte sich ausgestoßen. Seine Unsicherheit im Umgang mit Mädchen wurde verstärkt. Was war richtig, was falsch? Musste man sich generell fern von diesen Geschöpfen halten, die er doch so gerne mochte? Er wusste es nicht und erhielt auch keine Antwort.
Zu Hause machte Björn ein störendes Leiden zu schaffen. Wie in den USA üblich, war er als Neugeborener beschnitten worden. Die Operation wurde fehlerhaft durchgeführt und der Junge erlitt bleibende Schäden. Er hatte Schwierigkeiten, die Kontrolle über die Blase zu behalten, und nässte immer wieder nachts ein. Der Vater weckte ihn nachts, um das Bett trocken zu halten und Björn entwickelte große Ängste. Er wollte doch alles richtig machen! Die nächtlichen Überfälle durch warmen Urin jagten ihm immer wieder Schrecken ein – Schrecken vor sich selbst, der nicht in der Lage war, sein Pipi zu halten. Der Vater verzog sein Gesicht in leichtem Ekel, wenn er das Bettzeug wechseln musste. Die Mutter sprang in diesen Situationen nur ein, wenn Finn nicht anwesend war. Auch ihr war diese Entwicklungsverzögerung ihres Sohnes peinlich. Tagsüber wurde nicht darüber gesprochen, und das Schweigen verstärkte die Angst Björns vor der nächsten Nacht, wenn „es“ denn wieder einmal passiert war. Beide Eltern wussten nicht, dass die Blasenschwäche eine besondere körperliche Ursache hatte und behandelten ihn in diesem Punkt als Versager. Erst als Schulkind hatte er die Kontrolle über die Blase, aber auch dann versagte sie manchmal in Stresssituationen.
Bei all diesen Unsicherheiten waren seine Eltern doch ein sicherer Boden, von dem aus er neue Erfahrungen machen konnte. Aber dieser Boden begann zu schwanken. Finn war weichherzig und seine Familie bedeutete für ihn sein ganzes Glück. Kam es zu Konflikten im Alltag, gab er Louise eher recht, als sich zu streiten. Diese Nachgiebigkeit wertete sie als Schwäche. Je weniger er Louise entgegentrat, umso mehr fühlte sie sich zu „starken“ Männern hingezogen. Sie hätte jetzt lieber einen anderen Mann gehabt. Nicht nur war ihr die Beziehung zu ihrem Mann lästig, auch mit ihrem Hausfrauendasein war sie unzufrieden. Finn hatte eine Professur in Lawrence/Kansas bekommen, Louises Karriere machte keine Fortschritte. Der Krieg kam ihren Trennungsabsichten in gewisser Weise zu Hilfe, weil er das Auseinanderbrechen der Familie beschleunigte.
Nach dem Überfall Japans auf Pearl Harbour traten die USA in den Krieg ein4, der nachträglich der Zweite Weltkrieg genannt wurde. Das Erste, was die Familie davon merkte, war die Zuteilung von Lebensmittelkarten. Sein Leben lang erinnerte sich Björn daran, dass er während des Krieges nicht mehr so viel Fleisch bekam, wie er es gewohnt war. Seinem Vater gab der Krieg eine Chance, seine Solidarität mit der neuen Heimat und seinen Abscheu gegenüber dem Hitler-Regime zum Ausdruck zu bringen. Unmittelbar nach der Kriegserklärung meldete er sich zum Militär. Aufgrund seiner norwegischen Herkunft erhielt er das Angebot, eine Ausbildung als Spion in Europa zu absolvieren. Er nahm das Angebot gerne an. Diese Ausbildung fand an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Ländern statt, so dass er nur selten bei seiner Familie lebte.
Seine Abwesenheit nutzte Louise, sich um die eigene Karriere zu kümmern. Sie nahm einen Lehrauftrag an einem College in Winfield/Kansas an; so kam es zum nächsten Umzug. Björn vermisste den Vater, aber der Wechsel der Umgebung machte ihm keine Probleme.
Um ihm Kontakte zu anderen Kindern zu ermöglichen, aber vor allem, um einige Stunden für sich zu haben, schickte ihn Louise in eine Sonntagsschule. Björn hörte erstaunliche Geschichten von Gott und Jesus – seine Eltern hatten nie mit ihm über die Religion gesprochen und er hatte Gott nie vermisst. In der Sonntagsschule litt er nicht darunter, dass die anderen Kinder ihn für dumm hielten, weil er von ihrer Religion nichts wusste. Er wunderte sich nur über die so anderen Gewissheiten seiner peers.
Die Lehrerin erwartete fraglosen Gehorsam und der war nicht seine Art. Sie erzählte, wie Gott die Welt geschaffen hatte und die Kinder erhielten die Aufgabe, auf einem Blatt Papier den Schöpfungsprozess darzustellen. Den Anfang machte die Lehrerin mit der Erschaffung von Tag und Nacht. Die Kinder sollten dieses große Ereignis auf ein Papier malen, indem sie auf der einen Seite den Tag weiß und auf der anderen die Nacht schwarz ausmalten. Björn sagte: „Aber das Papier ist doch schon weiß, dann muss man es doch nicht weiter bemalen“. „Nun tu, was ich dir gesagt habe“, antwortete die Lehrerin und ihr Tonfall verriet eine aufsteigende Wut. Die Kinder lachten ihn aus, weil ihnen schien, er hätte die simple Anweisung nicht verstanden. Björn gehorchte schließlich, um seine Ruhe zu haben. Beim Abschied von der Lehrerin zeigte diese auf ein Jesusbild an der Wand und mahnte ihn mit erhobenem Zeigefinger, er müsse Jesus immer bei sich tragen. Björn gehorchte diesmal ohne zu zögern und überzeugt, das Richtige zu tun: Er hängte das Bild ab, um es mit nach Hause zu nehmen. Die Lehrerin wertete das Missverständnis als Frechheit und schimpfte. Björn hatte die Regeln der Schule, die in Anpassung bestanden, nicht begriffen, eine Auswirkung seines Asperger-Syndroms. Auch später geschah ihm dies immer wieder. Von zu Hause war er in diesem Punkt mehr Verständnis und keine Schimpfereien gewöhnt. Als er Louise erzählte, wie es ihm ergangen war, verzichtete sie darauf, ihn wieder in die Sonntagsschule zu schicken.
Louises Lehrauftrag wurde nicht verlängert, die akademische Karriere blieb aus. Sie war enttäuscht und zog mit ihrem Sohn nach Washington. Dort, so glaubte sie, würde es leichter sein, eine Stelle zu finden. Außerdem bot diese Stadt auch Finn die Möglichkeit, seinen Sohn zu sehen, da seine Ausbildung teilweise dort stattfand. Finn war es wichtig, Frau und Kind so häufig wie möglich zu besuchen.
Louise fand eine Anstellung als Volkswirtin in einem Ministerium. Sie war glücklich, endlich ihr eigenes Geld verdienen zu können und unabhängiger von Finn zu sein. Auch als Frau blühte sie in Washington auf. Finn war häufig abwesend und sie hatte die Gelegenheit, auszugehen. Sie lernte zunächst bei ihrer Arbeit, dann auch in der Freizeit Männer kennen, die sich für sie interessierten. Manchmal, wenn Finn nicht anwesend war, brachte sie tagsüber auch einen Mann nach Hause. Björn nahm die Veränderungen zur Kenntnis und genoss es, wenn sie über Nacht fort blieb und ihn alleine ließ. Dann fand er Geld auf dem Tisch, von dem er sich zu essen kaufen konnte, was er wollte. Das häufige Alleinsein tat ihm gut, er konnte sich gut allein beschäftigen.
Als Finn wieder einmal kam, war Louise im Haus beschäftigt. Er rief nach ihr, wer kam, war der kleine Björn, der sich über alle Maßen freute, den Vater wiederzusehen. Finn nahm den Jungen in den Arm, warf ihn hoch, Björn jauchzte. Dann betrat Louise das Wohnzimmer. Finn wollte sie in den Arm nehmen, aber ihr Körper versteifte sich. Er konnte nicht anders, als eine Entfremdung zwischen sich und Louise wahrzunehmen, die er nicht ganz verstand. Der Grund, dass sich seine Frau ihm verweigerte und nicht gut gelaunt war, musste seine häufige Abwesenheit sein. Da er Louise liebte, hatte er kein Bedürfnis nach einer anderen Frau und konnte sich auch nicht vorstellen, dass sie andere Bedürfnisse hatte als mit ihm zu leben. Björn registrierte die Zurückhaltung seiner Mutter und war traurig, dass die Eltern nicht mehr so liebevoll und freundlich miteinander waren wie in den ersten Jahren seiner Kindheit. Eine Scheidung gab es in seinem Kinderkosmos nicht.
Clara
Claras Vater Leon wuchs als Sohn eines preußischen Offiziers in Schlesien auf. Seine Mutter hielt sich nicht an die militärischen und auch sonst gültigen Normen – sie betrog ihn, verließ Mann und Sohn und reichte die Scheidung ein. Daraufhin war die Karriere des Vaters beendet, er wurde als Leiter eines Gefängnisses eingesetzt. Im ersten Weltkrieg musste er als Soldat „dienen“ und fiel in Frankreich. Leon hatte nun mit acht Jahren Mutter und Vater verloren. Seine Verwandten wollten ihm eine militärische Karriere ermöglichen und steckten ihn in eine Kadettenanstalt. Die dort praktizierte Erziehung für das Militär bedeutete Zwang zur Männlichkeit mit der Betonung von Zucht und Disziplin auf der einen, der Verdrängung von Emotionalität und Sensibilität auf der anderen Seite.5 Leon war unglücklich in der Anstalt, seine Eltern hatten ihm mehr Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt.
Auch in den Ferien bei seinen Verwandten ging es ihm nicht gut. Diese Menschen waren ihm fremd und vertraten Ansichten, die er nicht teilte: Anerkennung autoritärer Systeme, Verteufelung von Sexualität außerhalb der Ehe, Antisemitismus. Von Vater und Mutter hatte er in den ersten Jahren seines Lebens eine gewisse Freizügigkeit im Denken erlernt. Die Schule, die er verachtete, verließ er ohne Abschluss. Er machte eine Ausbildung als Buchhändler und fand eine Anstellung in einem Verlag.
Sein eigentliches Leben fand außerhalb des Broterwerbs statt. Lesen, denken, diskutieren, eine eigene Meinung zum Sinn des Lebens, zur Gesellschaft, zur Politik zu entwickeln – das machte ihm Freude. Das Berlin der 20erJahre war abenteuerlich und er war politisch überaus interessiert. Er schloss sich den Kommunisten an und verfolgte die politische Entwicklung ab 1930 mit großer Sorge. In Annita, die er auf einem Ball kennen lernte, fand er eine Gesinnungsgenossin. Sie kam aus einem kleinbürgerlichen Elternhaus, in dem sie neben ihrer angeblich schöneren Schwester immer die Zweite war. Mit ihrer Neugier auf geistige Anregungen war sie dort recht alleine gewesen. Wie Leon hatte sie Freude am Lesen und Diskutieren über den Zustand der Welt. Sie erlebte Leon als Befreiung von den Fesseln des Kleinbürgertums. Beide fanden sich im Interesse für neue Strömungen wie der Psychoanalyse und in der Wut auf die beginnende Naziherrschaft. Nie konnten sie begreifen, dass die Deutschen von Hitlers Absichten angeblich nichts gewusst hatten.6 Beide wussten, dass sie ihre Ansichten nun nicht mehr öffentlich äußern durften.
Leon brauchte die Bestätigung durch immer neue Geliebte, das führte zu Spannungen. Sie heirateten trotzdem. Beide planten keine Kinder. Leon lehnte Kondome ab und „sah sich vor“. So aufgeklärt er sich fühlte, so weit war er in diesem Punkt hinter seiner Zeit zurück. Aber Sex mit Kondom widersprach ihm, und die Folgen zeigten sich. Eines Abends, Annita hatte wie meistens etwas zu essen vorbereitet, saßen sie sich gegenüber. „Ich bin schwanger“, sagte sie und sah ihm ernst in die Augen. Leon blickte zurück und war zunächst einmal sprachlos. Dann fragte er: „Bist du sicher?“ Annita, die schon beim Frauenarzt gewesen war, nickte. „Willst du das Kind denn bekommen?“ fragte er, in der Hoffnung, sie würde abtreiben. Aber Annita bejahte und so fand er sich mit seinem Schicksal ab, Vater zu werden. Es war ja noch lange hin bis zur Geburt.
Die Freude der werdenden Eltern hielt sich in engen Grenzen. Ihre Beziehung war nicht stabil, immer wieder fühlte sich Annita von Leons Eskapaden verletzt, der grössten Wert auf seine Freiheit legte. Annita hingegen liebte ihn und konnte ihn nicht verlassen. Schon gar nicht nun, da sie schwanger war. Hinzu kamen die Vorboten und der Ausbruch des Krieges.7 Sie hatten Grund zur Angst vor dem Kommenden, denn dass dieser Krieg auf Dauer nicht mit einem Sieg für Deutschland enden würde, war ihnen klar. Es galt, Überlebensstrategien zu entwickeln.
Zunächst sah alles gut aus. Es gab noch keine großen Dokumentationszentren, wo verzeichnet war, dass Leon einmal Kommunist gewesen war. Er war in der Lage, seine Lebensgeschichte zu „frisieren“ und bekam unter den Nazis eine Anstellung bei einem großen Verlag, den er in besetzten Ländern vertreten sollte. In Dänemark, dann in Brüssel hatte er die Aufgabe, deutsche Literatur zu vertreiben und Propaganda für die Besetzer zu machen. Nebenbei konnte er in seltenen Fällen auch Juden und anderen Gefährdeten helfen, unterzutauchen oder das Land zu verlassen. Aber die Möglichkeiten, seiner Überzeugung gemäß zu leben, waren begrenzt.
Obwohl Annita schwanger war, wollte er sie nicht in seiner Nähe haben, er ließ sie in Berlin alleine. Kurz vor der Geburt des Kindes setzte sie sich in ein Flugzeug und flog zu ihrem Mann nach Kopenhagen. Leon kümmerte sich um ein Krankenhaus, wo Clara zur Welt kam. Er besuchte sie im Krankenhaus und schaute erstaunt auf den Säugling, den er mit ihr gemeinsam in die Welt gesetzt hatte. Einen Bezug dazu hatte er nicht. Clara war Annitas Anhängsel und hatte mit seinem Leben nichts zu tun, außer dass er für die Zeugung verantwortlich war. Annita war enttäuscht und deprimiert: Bedeutete es gar nichts für ihn, dass sie ein Kind geboren hatte, ein Kind, das nun die Fürsorge beider Eltern brauchte? Offensichtlich nicht. Immerhin übernahm Leon finanzielle Verantwortung.
Nach der Entbindung buchte er ein gutes Hotel, in dem sie mit dem Baby ein paar Tage bleiben würde. Annita bat Leon um ein Gespräch. Bei einem abendlichen Treffen im Hotel sprachen sie über die Zukunft. Sie sagte bittend: „Wir haben jetzt ein Kind, wir sind eine Familie. Wir müssten doch zusammenleben.“ Leon senkte den Kopf. Er wusste um ihre Erwartungen. Aber Familie – das war kein Wert, der in seinem Leben eine große Rolle spielte. Der Säugling, den er gezeugt hatte, gehörte zu Annita. „Es tut mir leid, aber ich habe eine Freundin. Du passt nicht mehr in mein Leben.“ Annita hatte es geahnt, aber Freundinnen hatte Leon schon viele gehabt. Sie war schließlich mit ihm verheiratet und nun auch Mutter seines Kindes. Dieses Pfund hatte sie in die Waagschale geworfen, aber umsonst. „Ich möchte nicht mit dir zusammenleben“, sagte er leise, aber bestimmt. „Ich werde für dich und das Kind sorgen, aber leben möchte ich nicht mit dir.“ Annita sah, dass er seinen Standpunkt nicht verändern würde. Sie versuchte gar nicht erst, ihn umzustimmen – es wäre verlorene Liebesmüh (!) gewesen. Sie war zu stolz, um zu weinen oder gar zu betteln und fügte sich seinen Wünschen. Sie trat die Rückreise nach Deutschland an. Von dort zog es sie nach Österreich, wo sie eine Freundin hatte. Leon zahlte ihr genug Unterhalt für ein finanziell sorgenfreies Leben mit ihrem gemeinsamen Kind.
Die junge Mutter konnte allerdings mit einem Kleinkind nicht viel anfangen. Sie selbst war aufgrund einer tiefen Unsicherheit über ihren Wert von dem Bemühen durchdrungen, über Schönheit und Leistung die Anerkennung ihrer Umwelt, besonders von Männern, zu erringen. Sie hatte keine Lust, mit ihrem Kind zu spielen, zu basteln, zu malen – sie wollte selbst mehr Aufmerksamkeit haben. Sie wäre froh gewesen, wenn Clara sich als Überfliegerin entpuppt, wenn sie alles von alleine gekonnt hätte. Aber Clara war wie die meisten Kinder darauf angewiesen, dass eine Person ihr zeigte und mit ihr erprobte, wie die Welt auseinander- und wieder zusammenzusetzen war. Sie brauchte ein wenig Hilfestellung um zu erfahren, was sie selbst mit Bewegung und Fingerfertigkeit erreichen konnte. Dazu war Annita nicht in der Lage: Sie hatte selbst keine solche Person in ihrer Kindheit gehabt. Immerhin hatte Clara einen wachen Verstand, nahm schnell auf und richtete sich nach den Erwartungen der Mutter. Annita liebte ihre Tochter, weil das Kind sie liebte und ihre Hilfsbereitschaft anfeuerte. Aber die erwartungsvollen Augen, mit denen Clara sie anschaute, ihre unausgesprochenen Bitten, immer wieder Aufmerksamkeit von der Mutter zu erhalten, das Bewusstsein, dass Clara mit ihr spielen wollte, das alles stresste ihre Mutter. Und dennoch versuchte das kleine Mädchen so zu sein, wie die Mutter es wünschte: liebevoll, aufmerksam, hilfsbereit, soweit es ihrem Alter möglich war. Aber die Anerkennung der Tochter zählte nicht für Annita, solange sie nicht die Anerkennung ihres Mannes erhielt. Und die blieb aus.
Die kleine Clara spürte die Ambivalenz der Mutter und tat alles, um ihre Liebe zu gewinnen. Da die Mutter ihre Bedürfnisse nach Zärtlichkeit auch mit Clara teilweise befriedigen konnte, gab es Momente der Übereinstimmung und Verbundenheit. Das Wickeln und Waschen des Säuglings, dann die Körperpflege des Kleinkindes waren solche Momente. Die Berührungen durch die mütterliche Hand, die liebevollen Augen und die schöne Stimme der Mutter entzückten sie. Annita ihrerseits freute sich, wenn ihr Kind sie anlächelte, nach ihrer Hand griff, wenn sie die Berührungen und das Streicheln offensichtlich genoss. Wollte die Kleine aber mit der Mutter spielen, verweigerte sich Annita und beendete die glücklichen Momente – sie konnte nicht spielen. In Claras Liebe fand sie für kurze Zeit die Bestätigung, die sie brauchte. Immer wieder war sie in Gefahr, in depressive Stimmungen abzugleiten. Clara erlebte die seelische Abwesenheit der Mutter als Distanzierung und fühlte sich dann allein. Sie war sich bald bewusst, dass sie nicht im Zentrum der Interessen ihrer Mutter stand.
Zum Glück für Annita fand sie bei einem ihrer Ausflüge nach Wien einen Mann, mit dem sich eine Liebesgeschichte entwickelte. Sie ließ Leon wissen, dass sie nun auch einen Liebhaber hatte. Er war nicht eifersüchtig, sondern beruhigt, dass er nun ohne Rücksicht auf Annitas Empfindungen sein Liebesleben gestalten konnte. Erneut war Annita gekränkt und die einzige Gegenmaßnahme, die ihr blieb, war die Ausgestaltung der Beziehung zu Robert, der sie bat, sich scheiden zu lassen, um ihn zu heiraten. Eine Scheidung im Krieg von Österreich aus in die Wege zu leiten, war Annita in der gegebenen Situation nicht möglich, aber sie fand den Gedanken einer Alternative zur Ehe mit Leon durchaus tröstlich. Und Wien, wo sie sich mit Robert traf, war ein Ort, an dem sie alle ihre Sehnsüchte nach kulturellen Events, schönen Restaurants und schicken Geschäften befriedigen konnte. Dies alles mit einem Mann an ihrer Seite, der bemüht war, jeden ihrer Wünsche zu erfüllen. Ein Kind störte da eher.
Eine Kinderfrau nahm sich Claras an, wenn die Mutter fortfuhr. Clara mochte die Frau nicht. Sie war grob, unfreundlich, wenn die Mutter nicht da war, und überfreundlich, wenn sie sich im Haus befand. Clara verstand die Mutter nicht, die zu dieser Frau Vertrauen hatte. Der leise Protest der Dreijährigen gegen das Wegfahren der Mutter blieb ungehört.
Ihren Vater erlebte Clara nur bei seltenen Besuchen. Leon kam nach einem Jahr das erste Mal, um seine Familie, die er großzügig unterstützte, zu sehen und ein paar Tage in den Bergen auszuspannen. Annita kündigte Clara den Besuch an, aber Clara konnte noch nicht begreifen, dass nun der Erzeuger im Anflug war. „Vater“ war ein Fremdwort ohne Bedeutung für sie. Das änderte sich, als Vater und Tochter sich begegneten. Für Leon war die Begegnung mit seinem Kind eine Offenbarung. Er merkte, wie das kleine Mädchen sich freute, wenn er es in den Arm nahm und mit ihm sprach. Er nahm wahr, wie aufmerksam sie lauschte und die Arme nach ihm ausstreckte, sein Streicheln genoss. Annita sah die beginnende Liebesbeziehung zwischen Vater und Tochter mit gespaltener Seele. Auf der einen Seite war die Zuneigung Leons zu Clara eine Bestätigung für sie als Mutter, auf der anderen aber spürte sie Eifersucht auf die vorbehaltlose Liebe, die das Kind von ihrem Mann erhielt und die er ihr vorenthielt.
Leon reiste nach wenigen Tagen ab, kam aber nun jedes halbe Jahr, um seine Tochter zu besuchen. Jedes Mal blühte Clara auf, wenn er sie in den Arm nahm, wenn er mit seiner wunderbaren Stimme mit ihr sprach oder sie streichelte. Oft hörte sie, wie die Eltern stritten. Einmal, Clara lag schon in ihrem Bett, hörte sie Annita im Nebenzimmer weinen: „Wo bleibt deine Verantwortung für deine Familie? Dass du zahlst reicht mir nicht. Du bist doch mein Mann.“ Das sah Leon anders. Er hatte Annita einen Gefallen getan, sie zu heiraten, so dachte er. Und sie konnte wirklich froh sein über die finanzielle Sorglosigkeit, in der sie während des Krieges mit ihrem Kind leben konnte. Clara musste hinnehmen, dass der Vater nie blieb. Die Eltern erklärten ihr, er müsse arbeiten und könne Geld nur an einem anderen Ort verdienen.
Eines Tages kam der Vater und blieb länger. Er musste nicht arbeiten gehen, und die Eltern stritten sich nicht mehr. Es war kurz vor Ende des Krieges und die Wehrmacht zog alle Männer ein, die noch verfügbar waren. Das traf auch Leon, den man ebenfalls zum Dienst an der Waffe verpflichtete. Aber Leon hatte sich geschworen, nie im Krieg eine Waffe auf ihm völlig unbekannte Menschen zu richten. Für die Deutschen und ihren Führer zu kämpfen kam von daher nicht in Frage für ihn, erst recht nicht, sein Leben für das kriminelle Unternehmen „Weltkrieg“ zu riskieren. Er desertierte und setzte sich nach Österreich ab. Dort konnte er sich an Annita wenden: Er brauchte ihre Hilfe, um unterzutauchen.
Es war eine Genugtuung für Annita, dass Leon zu ihr flüchtete. Sie versteckte ihn und richtete sich ihren Alltag so ein, dass die Familie nicht durch Denunzianten gefährdet war. Ein Raum in der Wohnung wurde für Leon eingerichtet und Annita organisierte den Alltag zu dritt, ohne dass Leon nach außen in Erscheinung trat. Robert musste warten, Leon war wichtiger. Zu dritt konnten sie von dem Geld leben, dass Leon Annita immer geschickt und auch noch mitgebracht hatte. Aber es blieb nicht viel Zeit, denn die Deutschen kämpften weiter, obwohl das Ende in Sicht war. Die Gefahr, dass ein Deserteur von deutschfreundlichen Nachbarn verraten wurde, bestand nach wie vor. Sie mussten schnellstmöglich nach Wien, wo die Russen schon Einzug gehalten hatten. Annita packte die Koffer. Zentral für sie waren neben ein paar Kleidungsstücken und Hygieneartikeln die Bettdecken – wer weiß, wie lange sie auf der Flucht sein würden. Die Einigkeit der Eltern in der Vorbereitung der Flucht gab Clara das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit.
Mit ihrer fünfjährigen Tochter, zwei Koffern und zwei Taschen verließen die Eltern die kleine Wohnung am späten Abend. Es war dunkel und nach mehreren Stunden erreichten sie den Wald. Dort schienen sie sicher zu sein. Die Bettdecken wurden auf dem Boden ausgebreitet; Clara durfte zwischen den Eltern liegen. Sie schaute zum Nachthimmel auf, den Flugzeuge erhellten. Endlich war sie mit ihren Eltern zusammen. Leon wie Annita gaben ihr einen Gutenacht-Kuss und sagten „Gute Nacht“. Das war der Himmel auf Erden.
Morgens packten die Eltern die Sachen wieder zusammen. Annita hatte ein wenig zu trinken und zu essen mitgenommen, so dass sie nicht ganz ohne Frühstück den zweiten Teil ihrer Wanderung antraten. Nach zwei Stunden erreichten sie das besetzte Wien.8 Leon gelang es, zur sowjetischen Kommandantur vorzudringen und sich als Antifaschisten und Deserteur auszuweisen. Die Familie erhielt Quartier und wurde mit Mahlzeiten versorgt. Wenig später ging es in einem Lastwagen ab nach Berlin in den russischen Sektor, wo Leon eine neue Karriere als Verleger begann. Die frühere Nähe zu den Kommunisten half ihm dabei. Die russische Sektorenverwaltung gab ihm den Auftrag, einen Verlag für die russische Zone aufzubauen, und er nahm das Angebot freudig an. Dankesbriefe von Verfolgten des Nazi-Regimes waren eine Hilfe, um das Vertrauen der Russen zu gewinnen.
Im Gegensatz zur Mehrheit der Berliner Bevölkerung ging es der kleinen Familie gut. Sie erhielten eine große Wohnung, aus der Nazis vertrieben worden waren, und mussten nicht Hunger leiden. Clara kam schnell in Kontakt mit einem Mädchen aus dem Nebenhaus. Die beiden Kinder spielten auf der Straße miteinander - es wurde Sommer. Eines Tages zeigte Gisela Clara einen offen stehenden Keller und Clara ging mit hinein. Gisela sagte: „Ich kenne ein schönes Spiel, aber du musst die Hose dafür ausziehen.“ Clara war ein wenig unsicher, und erwiderte: „Und du?“ „Ich ziehe auch die Hose aus,“ antwortete Gisela, und beide Mädchen taten wie besprochen. Gisela gab Clara die Anweisung, sich zu bücken und hantierte dann mit einem kleinen Stock an Claras Po. Clara mochte das Gefühl. Natürlich wollte auch Gisela, dass Clara ihr dieses Gefühl verschaffte und Clara erfüllte den Wunsch. Gisela wusste, dass sie etwas Verbotenes taten. Clara war sich nicht sicher, aber sie sprach zu Hause nicht darüber.
Zum ersten Mal bestand Claras Alltag im Zusammenleben mit beiden Eltern. Sie war fünf Jahre alt und betete ihren Vater an. Er genoss ihre Bewunderung, manchmal spielte er mit ihr. Zu ihrem Entzücken auch einmal im Bett, wo sie auf seinen Händen als Flugkörper balancierte. Sie blickte von oben in sein Gesicht und sah, wie auch er sich freute. Dann brach er das Spiel unversehens ab, senkte die Arme und liess sie aufs Bett fallen. Sie dachte, sie habe etwas falsch gemacht. Aber er beruhigte sie und sprach davon, dass er jetzt arbeiten müsse. Erst viel später konnte sie sein Verhalten verstehen: Er wollte sich gegen eigene Übergriffe auf das jauchzende Kind schützen. In diesem Moment jedoch war er ihr ein Rätsel, und sie konnte ihn nicht verstehen.
Das Verhältnis der Eltern verschlechterte sich – es gab wieder Streitereien. Leon hatte wieder eine Geliebte neben seiner Frau gefunden, und Annita litt erneut Qualen der Eifersucht. Im Gegensatz zu Leon, der in seinem Job viel Anerkennung erhielt, hatte sie nur den häuslichen Bereich zu bestimmen und sie war nur sehr ungerne Hausfrau. Dass Clara und Leon ein sehr inniges Verhältnis hatten, Leon offenbar auch Clara näher war als ihrer Mutter, verstärkte die Unzufriedenheit. Ihre Kränkung durch die Bindung von Vater und Tochter ging so weit, dass sie Clara einmal wegen einer Kleinigkeit bei ihrem Vater verpetzte und es genoss, dass Leon Clara übers Knie legte. In Clara regte sich keine Empörung gegenüber ihrer Mutter, nur Unverständnis. Allerdings überkam sie auch ein Gefühl von Kälte, und der Zweifel, ob die Mutter sie wirklich liebte.
Als Leon Clara den Hintern versohlte, konnte sie einfach nicht glauben, was passierte. Dass der Vater, der geliebte Vater, zum Schlagen bereit war, entsprach so gar nicht dem Bild, das sie von ihm hatte. Nach der Prügelei ging sie in ihr Zimmer. Weinen konnte sie nicht. Sie war wie erstarrt.
Leon hatte sich zu diesem Exzess hinreißen lassen, weil er sich Annita gegenüber schuldig fühlte. Die eigene Schwäche wurde ihm aber mit ein wenig Nachdenken klar und er ging zu Clara, um sich zu entschuldigen. Als er Claras Zimmer betrat, versuchte sie gerade, das Bild des Vaters zu vervollständigen. Er verurteilte Lügen aufs Schärfste und sie hatte gelogen, das war ja so. Dass er schlug bekam sie jedoch nicht damit zusammen. Er sagte: „Das hätte ich nicht tun dürfen.“ Mit diesem Bekenntnis war Clara überfordert. Ein wunderbarer Vater, der Fehler macht und sein Verhalten bereut – das stand nicht auf der Agenda. Sie verstand seinen Sinneswandel ebenso wenig wie die Prügel. Das Erlebnis blieb, wie auch die Erfahrung beim Balancieren im Bett, in ihrem Gedächtnis haften als ein Wissen darüber, dass Männer fehlerhaft, aber nicht böse sind.
Die Eltern wollten, dass das Einzelkind Clara mit anderen Kindern in Berührung kam. So wurde sie einem Kindergarten anvertraut, wo sie sich allerdings im Gegensatz zu den Erwartungen der Eltern überhaupt nicht wohlfühlte. Während ihr das Zusammensein mit Gisela Freude gemacht hatte, verspürte sie im Kindergarten Angst. Einige Kinder kannten sich, Clara kannte niemanden. Sie sprachen berlinerisch und wunderten sich über Claras hochdeutsche Aussprache. Kein Kind wollte mit ihr spielen und sie wusste nicht, wie sie hier eine Freundin gewinnen konnte. Einige der Kinder, die das Sagen hatten, verhöhnten Clara, die unsportlich war und keines der Spiele kannte. Sie gehörte nicht dazu. Da waren die Erwachsenen noch besser: Man konnte mit ihnen reden. Allerdings nicht mit den Erzieherinnen im Kindergarten – die waren damit beschäftigt, dass alles seinen Gang ging. Ein Glück, dass sie mittags nach Hause gehen durfte.