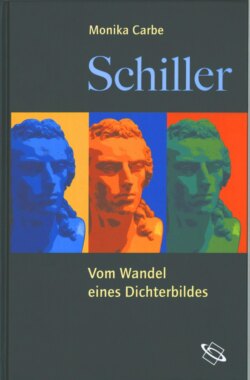Читать книгу Schiller - Monika Carbe - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Tod und kein Vergessen
ОглавлениеDie Erinnerungskultur macht es möglich. Durch Briefwechsel und Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen ist kaum ein Tag, kaum eine Stunde in Schillers Leben unbekannt geblieben. Solange die Dichter und Denker des Weimarer Kreises und alle, die ihm nahe standen, Pläne miteinander schmiedeten und nicht verfeindet waren, wechselten sie fast Tag für Tag Briefe oder Billetts miteinander, Zettel mit Kurznachrichten, die Boten von Haus zu Haus trugen. Nahezu alles wurde gesammelt und aufgehoben. Von Freunden und Verehrern, von Gleichgestellten und vom Hauspersonal.
Neben der literarischen Hochkultur, neben Gedichten und Essays, Rezensionen und Glossen, die im „Merkur“ oder im „Journal des Luxus und der Moden“ erschienen, neben der Philologie, die fast noch den Status einer Liebhaberei hatte, blühte eine Alltagskultur, bei der Schreiben, Zeichnen und Musizieren zum Zeitvertreib gehörte. Diesem Vergnügen widmeten sich allerdings fast nur Adlige und aufstrebende Bürger mit ihren Familien, die an einem der deutschen Fürstenhöfe in Lohn und Brot standen. In Briefen teilte man einander vieles mit; das reichte von Stimmungen und Stimmungsschwankungen bis hin zu Klatsch und Banalitäten.
An den Briefen, die innerhalb des Weimarer Kreises und weit darüber hinaus gewechselt wurden, und an Gesprächsaufzeichnungen, unter anderem aus dem Haus Goethes am Frauenplan, lässt sich erkennen, was für Reaktionen der Tod Schillers am 9. Mai 1805 auslöste. Einschließlich dieser Dokumente, die wieder und wieder von allen herangezogen werden, die der Wirkungsgeschichte Schillers nachgehen, ist die Zahl der Bände, die Schiller gewidmet sind, heute – nach zweihundert Jahren – ungleich größer als das eigentliche Werk. Das Bild Schillers gleicht einem Puzzlespiel mit unendlich vielen Teilen, die seit 1805 ständig neu zusammengesetzt werden, da sich in Nachlässen von Freunden und Familienangehörigen seiner und der nächsten Generationen immer wieder Ergänzungen finden, die Aufschluss über neue Facetten seiner Person und seines Lebens geben, abgesehen davon, dass seine Dramen, Balladen und Gedichte, seine historischen Abhandlungen und philosophischen Schriften bislang in jeder Epoche neu interpretiert wurden.
Verehrt wurde Schiller als Verkünder des „Wahren, Guten, Schönen“ auf dem Parnass, aber mit Kritik am Pathos, an den überschäumenden Freuden und dem unermesslichen Leiden seiner Helden wurde schon zu Lebzeiten nicht gespart. Der Dichter der „Räuber“, der einst seine Generation mit der Rebellion gegen das „tintenklecksende Saeculum“ mitgerissen hatte, erntete Hohn und Spott von Seiten der Romantiker, allen voran von Friedrich Schlegel, als das „Lied von der Glocke“ veröffentlicht wurde. Caroline Schlegel soll sich vor Lachen gekugelt haben, als sie dieses Lehrgedicht hörte. War das junge Genie, kaum im Hafen der Ehe, als Hausvater zum moralisierenden Philister erstarrt?
Blinde Verehrung auf der einen und kritische Stimmen auf der anderen Seite hielten sich von Anfang an die Waage. Bei offenen Angriffen oder versteckten Seitenhieben in Zeitschriften oder Briefen mag auch Neid und Häme mitgespielt haben. Das geistige Bündnis zwischen Goethe und Schiller, von der Mit- und Nachwelt mal zur Freundschaft der Heroen stilisiert, mal als reines Zweckbündnis heruntergespielt, muss auf manche der jüngeren Autoren, die auf der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert ihre ersten Lorbeeren ernteten, wie ein rotes Tuch gewirkt haben. Zwischen ihnen und dem Weimarer Kreis hatten sich Gräben aufgetan, die für manche kaum zu überwinden waren, wenn sie kein Entreebillett, sei es durch ihre Dramen oder Gedichte, sei es durch Beziehungen, zu der erlauchten Runde hatten.
Kräftiges Geraschel im Blätterwald der Zeitschriften und Kalendarien trug schon zu Schillers Lebzeiten zur Legendenbildung bei. Goethe, bei Schillers Tod in seinem sechsundfünfzigsten Lebensjahr, war Diplomat genug, um die Schranke zwischen seinen Kreisen und der neugierigen Außenwelt zu wahren. Aber auch Schiller schien, zwar nicht in seiner Jugend, doch in späteren Jahren, sorgsam darauf bedacht gewesen zu sein, sich gegenüber Besuchern abzuschirmen.
Jean Paul zum Beispiel, der Goethe und Schiller zeitweise den Rang in der Gunst des Publikums ablief, stimmte zwar nicht in das Hohngelächter der Schlegels ein, wahrte immer den – wenn auch manches Mal ironischen – Respekt und beschreibt Schiller nach einer Begegnung in Jena dennoch in einem Brief an einen Freund als kalt und abweisend: „Ich trat gestern vor den felsigten Schiller, an dem wie an einer Klippe alle Fremde zurückspringen ... Seine Gestalt ist verworren, hartköpfig, voll Ecksteine, voll scharfer, schneidender Kälte, aber ohne Liebe.“
Auch wenn Jean Paul Schillers Dramen schätzte, schreckte er vor der Kälte der Person des Dichters gegenüber Außenstehenden zurück. In Schillers Briefen jedoch, ob an Freunde oder Familienmitglieder, findet sich Wärme, Herzlichkeit und Humor. Sein Briefstil ist locker, in seinen Kommentaren über Dritte wird er manchmal auch bissig. Spontan lässt er spitze Bemerkungen gegen lebende Ikonen der Weimarer Gesellschaft fallen, etwa gegen das Fräulein von Göchhausen, die Hofdame der Herzoginmutter Anna Amalia, die er „ein verwachsenes und mokantes Geschöpf“ nennt, oder lässt sich über Unbilden des Alltags aus, mit rascher Feder hingeworfen und im Handumdrehen ironisiert. Er spielte leidenschaftlich gern Tarock, Whist oder L’hombre, trank Wein, und dies nicht nur zu den Mahlzeiten, rauchte und schnupfte Tabak.
Im Januar 1791 war ein Katarrh aufgetreten, der ihm immer wieder zu schaffen machte. Der spätere Erfurter Stadtrat und Buchhändler Kaspar Konstantin Beyer erzählt in seinem Tagebuch von Schillers Schwächeanfall: „Den 3ten, Montag. Abends auf dem Redoutensaal ins Concert, das heute Madame Häsler zur Feyer des Geburtstages unseres Churfürsten gab. Es waren verschiedene Musiker und andere Dilettanten aus Weimar hier, die es executieren halfen, unter ihnen befand sich auch der geschickte Violinist Unrein aus der Herzoglichen Capelle. Es hatte sich ein zahlreiches Publikum eingefunden, auch Schiller mit seiner Frau war da. Nach dem Concerte wurde von einer aus mehr als hundert Personen bestehenden Gesellschaft, worunter sich auch der Coadjutor und sämmtliche hier befindliche Fremde befanden, auf dem Speisesaale soupiert. – Schiller wurde mitten im Concert unpass und musste sich in einer Sänfte nach Hause tragen lassen, konnte also dem Souper nicht beiwohnen.“
Bei seiner chronischen Krankheit handelte es sich vermutlich um eine Pneumonie, verbunden mit einer Rippenfellentzündung. Vom Dezember 1804 an plagte ihn, wie oft in den Jahren zuvor, eine anhaltende Entzündung der Schleimhäute, im Februar darauf überfiel ihn wieder heftiges Fieber, und in den letzten Tagen seines Lebens litt er unter einer akuten Lungenentzündung. Liest man das Obduktionsergebnis, das der Arzt, Dr. Huschke, an den Herzog von Weimar, Carl August, sandte, gewinnt man den Eindruck, als habe ein Mensch in seinen letzten Monaten nur noch mit dem Kopf gelebt. Er muss seinen Körper immer wieder überfordert, wenn nicht überlistet haben:
„Gegen Abend um 1⁄2 6 bekam er schnell einen Nervenschlag. 3⁄4 auf 6 repetierte der Schlag heftig, und er blieb plötzlich. Da er lange einen elenden Körper hatte und ungesund war, so machten wir den Tag drauf nachmittags die Sektion und fanden folgendes Merkwürdiges:
1 Die Rippenknorpel waren durchgängig und sehr stark verknöchert.
2 Die rechte Lunge mit der Pleura von hinten nach vorne und selbst mit dem Herzbeutel ligamentartig so verwachsen, dass es kaum mit dem Messer gut zu trennen war. Diese Lunge war faul und brandig, breiartig und ganz desorganisiert.
3 Die linke Lunge besser, marmoriert mit Eiterpunkten.
4 Das Herz stellte einen leeren Beutel vor und hatte sehr viel Runzeln, war häutig, ohne Muskelsubstanz. Diesen häutigen Sack konnte man in kleine Stücke zerhacken.
5 Die Leber natürlich, nur die Ränder brandig.
6 Die Gallenblase noch einmal so groß als im natürlichen Zustande und strotzend von Galle.
7 Die Milz um 2⁄3 größer als sonst.
8 Der vordere konkave Rand der Leber mit allen naheliegenden Teilen bis zum Rückgrat verwachsen.
9 Die rechte und linke Niere in ihrer Substanz aufgelöst und völlig verwachsen.
10 Auf der rechten Seite alle Därme mit dem Peritonäum verwachsen.
11 Urinblase und Magen waren allein natürlich.“
Eine vergeistigte Existenz auf einem maroden körperlichen Fundament? Es hat den Anschein, als habe Schiller, ständig gleichzeitig mit verschiedenen Plänen zu Essays und Dramen beschäftigt, seinen Körper kaum wahrgenommen, wenn nicht gar negiert. In der Todesstunde waren Schillers Frau Charlotte und ihre Schwester Caroline von Wolzogen, besagter Dr. Huschke und zwei Diener im Sterbezimmer des Hauses an der Esplanade in Weimar. Die Beerdigung fand in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai statt, nachts, wie es damals in Weimar üblich war. Im Weimarer Hoftheater hätte an diesem Abend ein Singspiel, „Die Saalnixe“, gegeben werden sollen; aus Pietät wurde es abgesagt, jedoch auch, weil Schillers Tod die Schauspieler so traurig stimmte, dass sie keinen Sinn für Munterkeit auf der Bühne aufbrachten.
Auf eine der ersten Meldungen im Intelligenzblatt der „Neuen Leipziger Zeitung“, in der es hieß: „Tief und allgemein wird sein Verlust gefühlt. Seine Schriften kennt die Welt“, folgten Todesnachrichten und Nachrufe, unter anderem in Halle, Berlin und Wien. Die Nekrologe waren oft weniger von Sachkenntnis als von den Emotionen ihrer Verfasser geprägt und enthielten Ungenauigkeiten. So verbreitete sich zum Beispiel das Gerücht vom „Arme-Leute-Begräbnis“, das jeder Grundlage entbehrt. Nächtliche Bestattungen waren, wie gesagt, in Weimar Brauch, und in der Regel trugen Handwerker den Sarg. Schillers Sarg aber trugen Künstler und Gelehrte, die man rasch benachrichtigt hatte. Das Begräbnis war ebenso angemessen wie der Trauergottesdienst am Tag danach, einem Sonntag, in der St.-Jacobi-Kirche, der von Mozarts „Requiem“ umrahmt wurde.
Unter den Kondolenzbriefen, die Charlotte von Schiller, seine Witwe, erhielt, war auch ein Schreiben von Madame de Staël, die sich von Dezember 1803 bis Februar 1804 in Weimar aufgehalten hatte. Ihr Besuch wurde zum Ereignis, und ihr Auftreten hatte viel Staub in der Weimarer Szene aufgewirbelt. In ihrem Buch „Über Deutschland“, fünf Jahre nach Schillers Tod erschienen, porträtiert sie die Autoren ihrer Zeit und analysiert ihre Werke. Schiller nennt sie einen „Mann von seltenem Genie und vollkommener Gewissenhaftigkeit“ und geht ausführlich auf die Begegnung ein:
„Ich sah Schiller zum ersten Mal im Salon des Herzogs und der Herzogin von Weimar in Gegenwart einer ebenso fein gebildeten wie imposanten Gesellschaft. Er las das Französische sehr gut, hatte es aber nie gesprochen. Ich verfocht mit großer Hitze die Behauptung, dass unser dramatisches System allen andern überlegen sei. Er enthielt sich nicht, mich zu bekämpfen, und ohne sich durch die Schwierigkeiten und Hindernisse, welche die Darlegung seiner Gedanken in französischer Sprache ihm bereitete, anfechten zu lassen, ohne die Ansicht der Zuhörer zu fürchten, die der seinen entgegen war, bewog seine innere Überzeugung ihn zum Reden. Ich bediente mich anfangs, um ihn zu widerlegen, französischer Waffen: der Lebhaftigkeit und des Witzes, bald aber entdeckte ich in dem, was Schiller sagte, bei all den Hindernissen, welche die Worte ihm bereiteten, so viel Ideen, wurde bald so von dieser Charaktereinfachheit, die einen Mann von Genie bewog, sich in einen Kampf einzulassen, bei welchem ihm die Worte für die Gedanken fehlten, eingenommen, fand ihn so bescheiden und unbekümmert bezüglich dessen, was seine eigenen Erfolge anging, so stolz und lebhaft bei der Verteidigung dessen, was er für Wahrheit hielt, dass ich von Stund’ an eine mit tiefer Bewunderung gemischte Freundschaft zu ihm fasste ...“
Wilhelm von Humboldt war Germaine de Staël mehrfach begegnet und teilte ihr am 25. Mai 1805 trauernd mit: „Ich schreibe Ihnen, verehrte Frau, in einer Stunde tiefen Schmerzes: Schiller ist gestorben, ich erfahre es in diesem Augenblick. Er war der einzige Mensch, den ich auf dieser Erde sehr geliebt habe. An ihn knüpften stets alle meine Gedankengänge an; mit ihm habe ich Jahre trauten Verkehrs verlebt, das Höchste und Tiefste mit ihm geteilt und erwogen; dem Einzigen vielleicht, dem ich notwendig zum Leben war. Noch sind es nicht zwei Jahre, dass er mir über unsere Trennung in tiefer Schwermut schrieb, und nun ist diese unheilbar geworden. Er ist nicht mehr. Ihnen konnte er sich nicht geben, wie er wirklich war: er hatte nicht, wie Goethe, eine zugleich alle Künste umfassende Einbildungskraft, welche das Universum in der Vielgestalt von Malerei, Musik und Poesie zusammenschaut; die seine erschöpfte sich im Gedanken und in der Beredsamkeit. Nur eine Gabe hatte ihm die Natur verliehen: das Wort.“
Goethe galt als Universalgenie, Schillers Talent lag allein auf dem Gebiet der Sprache – und der Reflexion, so urteilt Humboldt. Kennen gelernt hatte Schiller den um acht Jahre jüngeren Wilhelm von Humboldt durch die Schwestern von Lengefeld; Charlotte, seine spätere Frau, schreibt am 13. Juli 1789 an Schiller: „Gestern Abend sind wir hier angekommen, la Roche, den Sie kennen, ist hier und ein Herr von Humpolt der auch schon vorigen Winter bei uns war.“ Von Beginn der neunziger Jahre des 18. Jahrhunderts an herrschte ein reger Gedankenaustausch zwischen Schiller und Wilhelm von Humboldt, ein gemeinsames Entwickeln von Ideen, das sich für beide als fruchtbar erwies.
In einem Nachruf, der im Juni im Weimarer „Journal des Luxus und der Moden“ anonym erschien, macht der Verfasser keinen Hehl aus der düsteren Stimmung, in die ihn Schillers Tod versetzt hat, und es ist sogar etwas über das Wetter zu erfahren: „Wie gut, dass der Mai so finster und melancholisch ist ...“ Der Totenkult trieb allerdings auch seltsame Blüten. Überliefert ist unter anderem ein Gedicht von Julie von Bechtolsheim, die einst als Wielands Muse gegolten hatte:
Blume auf Schillers Grab
Sänger unsterblicher Lieder, ein Gott im Berühren der Leier,
Raget der Mächtige stets über die Fluten der Zeit.
Zarten Gemütern ein Liebling und forschenden Geistern ein Lichtstrom,
Reich an Gefühl und an Kraft, war er ein Meister als Mensch ...
Das sind sorgsam gedrechselte Trauerverse, die heute peinlich berühren. Ihre Eloge wirkt wie eine Parodie, ist aber bitterernst gemeint.
Vom 6. Juni an wurden Totenfeiern in Königsberg, Hamburg, Frankfurt am Main und anderen Städten veranstaltet, die Schiller zur Kultfigur stilisierten. Im Theater von Königsberg etwa stand ein Sarkophag auf der Bühne, und die Zuschauer kamen zum Teil in Trauerkleidung. In Frankfurt am Main ließ man die wichtigsten Gestalten aus Schillers Dramen wortlos über die Bühne schreiten, Gedichte wurden rezitiert, und Trauergesang erscholl. Echt war das Trauern der Schauspieler nicht immer; viele Theaterdirektoren und ihre Akteure sollen unter dem Einstudieren der Versdramen Schillers gelitten haben. Zum Beispiel wurde auch in Magdeburg eine Totenfeier veranstaltet, einer der beiden Theaterleiter, Hostowsky, soll jedoch bei der Nachricht von Schillers Tod ausgerufen haben: „... Gott sei Dank, dass iss gestorben verfluchtes Jambenmacher!“
Wenige solcher spontanen Reaktionen sind überliefert, vielleicht auch aus Pietät der Chronisten. Aus Goethes Aufzeichnungen geht hervor, dass der Tod Schillers einen schweren Verlust für ihn bedeutete. Er scheint es so empfunden zu haben, als sei ihm ein Teil seiner selbst gestorben. „Die Paraden im Tode sind nicht das, was ich liebe“, sagt er fast zehn Jahre später in einem Gespräch kurz nach Wielands Tod. „Auch will ich es nicht verhehlen, eben das ist es, was mir an Schillers Hingang so ausnehmend gefällt. Unangemeldet und ohne Aufsehen zu machen, kam er nach Weimar, und ohne Aufsehen zu machen, ist er auch wieder von hinnen gegangen.“
Die Beziehung zwischen Goethe und Schiller hatte sich sehr langsam angebahnt. Bei der allerersten Begegnung, die dem um zehn Jahre jüngeren Schiller viel bedeutete, dürfte Goethe ihn, den jungen Eleven an der Hohen Karlsschule in Stuttgart, kaum wahrgenommen haben. Bei der Rückkehr von seiner zweiten Reise in die Schweiz hatte Goethe mit Herzog Carl August von Weimar Mitte Dezember 1779 in Stuttgart Station gemacht, und beide wurden von Herzog Carl Eugen von Württemberg eingeladen, dessen Akademie zu besichtigen, die aus der von ihm gegründeten militärischen Pflanzschule auf Schloss Solitude hervorgegangen war. Goethe und der Herzog nahmen als Gäste an einer akademischen Feier teil, bei der Schiller zwar drei Preise für seine Leistungen auf medizinischem Gebiet erhielt, in Sachen Sprache jedoch leer ausging. Unter den Studenten, die zur Preisverleihung antraten, dürfte Schiller Goethe nicht aufgefallen sein. Mit Begeisterung hatte Schiller zu diesem Zeitpunkt längst „Götz von Berlichingen“, das Jugenddrama Goethes, gelesen und schrieb damals heimlich an den „Räubern“, da er mit einem Verweis hätte rechnen müssen, wenn ruchbar geworden wäre, dass er rebellische Dramen verfasste, statt sich dem Lehrstoff zu widmen.
Dem Weimarer Herzog war Schiller fünf Jahre später unter einem anderen Vorzeichen wiederbegegnet. Durch Charlotte von Kalb vermittelt, war Schiller, der nach der Uraufführung der „Räuber“ am Mannheimer Theater mittlerweile als vielversprechender junger Dichter galt, im Dezember 1784 am Hof von Darmstadt eingeladen, um aus „Don Carlos“ zu lesen; Carl August war dort zu Gast und zeigte sich sehr angetan von der literarischen Gestaltung der politischen Wirren im Spanien des 16. Jahrhunderts, erkannte Parallelen zur Gegenwart, machte Schiller Komplimente zu seinem Talent und nahm dies zum Anlass, Schiller den Titel eines Weimarischen Rats zu verleihen, allerdings ohne Pflichten, ohne Rechte – und ohne Salär.
Als Schiller im Juli 1787 auf Einladung von Charlotte von Kalb nach Weimar kam, war Goethe in Italien, und durch Wieland wurde er in den Kreis um die Herzoginmutter eingeführt. Früh verwitwet, hatte Anna Amalia einen Erzieher für ihre beiden halbwüchsigen Söhne gesucht, und im Jahr 1772 war Christoph Martin Wieland nach Weimar gekommen, Goethe, der Herder nachzog, drei Jahre später. Als Schiller ankam, hatte sich längst ein enges Beziehungsgeflecht gebildet. In Zirkeln und Kränzchen, in Mittwochs- und Freitagsgesellschaften, beim Tee oder Ausflügen aufs Land, in die freie Natur, wurde diskutiert und geplaudert, über Philosophie und Religion, über Rousseau, Voltaire und die neueste Literatur, die mitten unten ihnen entstand, aber auch über die Kräuter, die für den Küchengarten anzuschaffen seien, oder die Windpocken der Kinder.
Die Frauen, seien es Gattinnen, Geliebte oder Schauspielerinnen des Hoftheaters, spielten eine maßgebliche Rolle; ihnen war zwar ein reguläres Studium verwehrt, aber sie lasen, schrieben, übersetzten Texte aus dem Englischen oder Französischen, veröffentlichten ihre Texte, oft unter Pseudonym, da es als unschicklich galt, wenn Frauen ihrer Schicht sich zu weit in die Öffentlichkeit hinauswagten. Viele von ihnen hatten nichts dagegen, als fördernde Musen angesehen zu werden.
Von verschiedenen Seiten versuchte man, Schiller in Geselligkeiten, Bälle und andere Vergnügungen einzubeziehen. Wieland öffnete ihm die Türen zum Kreis um die Herzogin Anna Amalia und forderte ihn zur Mitarbeit am „Teutschen Merkur“ auf, der literarischen Zeitschrift, die er herausgab. Rasch verbreitete sich das Gerücht, Wieland habe es auf Schiller als künftigen Schwiegersohn, als Gatten einer seiner fünf Töchter abgesehen. Goethes Abwesenheit wurde allgemein bedauert; dieses Bedauern ging so weit, dass Hofrat von Knebel am 28. August 1787 zur Feier von Goethes Geburtstag in dessen Garten einlud. Da trafen sich Charlotte von Stein, die Kammersängerin und Schauspielerin Corona Schröter, der Schiller als alternder, einst bildschöner Frau – zu diesem Zeitpunkt war sie sechsunddreißig – verwitternde Gesichtszüge bescheinigte, und viele, die in Weimar Rang und Namen hatten.
Goethe indes war in Rom und kehrte im Juni 1788 so verändert zurück, dass dies für Furore sorgte. Seine Reise nach Italien und der lange Aufenthalt in Rom hatten Erfahrungen mit sich gebracht, die ihm Weimar eng erscheinen ließen. Sobald er zurückgekehrt war, zog er sich, soweit Carl August ihm dies zubilligte, von den Regierungsgeschäften zurück und hatte von nun an mehr Muße, sich all dem zu widmen, was ihn wirklich interessierte.
Goethe und Schiller trafen einander im September desselben Jahres in Rudolstadt, eher ausgelöst durch die Zufälligkeiten des geselligen Lebens, in diesem Fall einer Landpartie, und auf einem Spaziergang an der Saale entlang unterhielten sie sich miteinander, ohne dass ihr Gespräch über ein unverbindliches Plaudern hinausging. Hin und wieder fanden formale Treffen zwischen beiden statt; überdies setzte Goethe sich im gleichen Jahr beim Herzog von Weimar dafür ein, dass Schiller zum außerordentlichen Professor an der Universität Jena ernannt wurde. Dennoch hielten beide Distanz. Zu einem ersten längeren Gespräch, bei dem beide über Konventionelles hinaus aufeinander eingingen, kam es erst sechs Jahre später in Jena nach einer Sitzung der Naturforschenden Gesellschaft. Von dieser Zeit an begann ein wechselseitiger Austausch, der in der Literaturgeschichte einmalig ist.
Schiller hatte Goethe einen Monat zuvor, im Juni 1794, brieflich darum gebeten, an den „Horen“ mitzuarbeiten, der Zeitschrift, die Epoche machen sollte. Den Plan dazu hatte er zwei Jahre zuvor gefasst und ihn dann während einer Reise in sein „Vaterland“, nach Württemberg, mit dem Verleger Johann Friedrich Cotta in Stuttgart konkretisiert. Wilhelm von Humboldt und Fichte waren bereits für die Mitarbeit gewonnen. Zustimmend hatte Goethe wenig später geantwortet. Von der ersten längeren Unterhaltung in Jena an wurde Schiller ein Gesprächspartner für Goethe, und mehr als das. Der intensive Austausch zwischen beiden trug unter anderem dazu bei, dass Goethe angefangene Projekte, die er hatte ruhen lassen, erneut in Angriff nahm. Beide motivierten einander wechselseitig, verführten einander zu neuer poetischer Gestaltung, zur Weiterentwicklung von Theorien im Bereich der Kunst im weitesten Sinne, der Philosophie und der Naturwissenschaften.
War Schiller anfangs noch der Werbende gewesen, der sich von Goethes kühler Zurückhaltung nicht hatte abschrecken lassen, so war von dieser Zeit an eine Form des Gleichgewichts hergestellt, in der gedankliches Geben und Nehmen zwischen beiden austariert war. In den „Tag- und Jahresheften“ verzeichnet Goethe für das Jahr 1794: „In diesem Drange des Widerstreits übertraf alle meine Wünsche und Hoffnungen das auf einmal sich entwickelnde Verhältnis zu Schiller; von der ersten Annäherung an war es ein unaufhaltsames Fortschreiten philosophischer Ausbildung und ästhetischer Tätigkeit.“ Dramen wurden weiter strukturiert und ausgearbeitet, neue Balladen entstanden. Wie zwei Lausbuben schmiedeten sie gemeinsam Pläne zu den „Xenien“, Epigrammen, die sich manchmal in kryptischer, von den Angesprochenen jedoch leicht zu entschlüsselnder Form gegen Verleger, Herausgeber von Zeitschriften und Autoren richteten, und die, wie von beiden erwartet, enormes Aufsehen erregten.
Nach Schillers Tod schrieb Goethe am 1. Juni an den Komponisten Zelter: „Ich dachte mich selbst zu verlieren und verliere nun einen Freund und in demselben die Hälfte meines Lebens.“ Das ist eine klare Aussage, mit der Goethe den Verlust und die Leere zur Sprache bringt. Ihm wird bewusst, dass er altert. Schmerzhaft fühlt er die Lücke, da dieses Wechselspiel von Gedanken und Phantasien, das beide zu neuen Texten angeregt hatte, etwas Einmaliges war, das sich in dieser Form nicht wiederholen würde.
Goethe trug sich eine kurze Zeit lang mit Überlegungen, Schillers Entwurf des Dramas „Demetrius“ fortzuschreiben und fertig zu stellen, gab diesen Plan aber auf. Vielleicht hatte er eine Scheu davor, sich trotz aller Fähigkeit zur Empathie zu intensiv auf die Gedankenwelt des Verstorbenen einzulassen. Auch die Idee zu einem dramatischen Gedicht, einer Totenfeier für Schiller, gab er auf, ließ aber am 10. August 1805 im Theater von Lauchstädt die letzten drei Akte von „Maria Stuart“ spielen und das „Lied von der Glocke“ szenisch aufführen. Eine Schauspielerin trug seinen „Epilog zu Schillers Glocke“ vor. Die Erinnerung an Schiller hat Goethe auch in späteren Jahren bewahrt und sich kontinuierlich dafür eingesetzt, dass sein Andenken lebendig blieb.
Nur wenige kritische Stimmen wie jene des Theaterleiters von Magdeburg waren nach Schillers Tod zu vernehmen. Drastisch drückt es Leopold Graf von Stolberg in einem Brief vom 20. Mai 1805 aus: „Schiller ist also tot! Gott habe ihn selig. Für die Philosophie, Religion und den Geschmack des Wahren und Schönen ist sein Tod Gewinn. Er hatte Talent zum glänzend Falschen, nicht genug fürs Wahre.“ Ein harsches Urteil, das sich bei der Nachwelt nicht durchgesetzt hat.
Die Brüder Christian und Leopold von Stolberg, als Studenten Mitglieder des Göttinger Hainbundes und in ihren Jugendjahren schwärmerische Verehrer Klopstocks, waren 1775 in der Schweiz mit Goethe zusammengetroffen; Leopold von Stolberg, der später – als Protestant – zur katholischen Kirche übertrat, hatte Schillers philosophisches Gedicht „Die Götter Griechenlands“, von Wieland 1788 im „Merkur“ veröffentlicht, in einer umfangreichen Rezension verrissen und dem Autor Gotteslästerung vorgeworfen. Fast noch im Stil des Rokoko lässt Schiller hier die Antike lebendig werden:
Da ihr noch die schöne Welt regiertet,
an der Freude leichtem Gängelband
glücklichere Menschenalter führtet,
schöne Wesen aus dem Fabelland!
Ach! Da euer Wonnedienst noch glänzte,
wie ganz anders, anders war es da!
Da man deine Tempel noch bekränzte,
Venus Amathusia!
So die erste Strophe. Am Beispiel der Kritik des Grafen von Stolberg an diesem Gedicht zeigt sich eine Tendenz der Wahrnehmung Schillers, die sich von dieser Rezension an durch die Zeiten schleppt: Stolberg wirft Schiller Atheismus vor. Der Graf war offensichtlich nicht in der Lage, die lyrische Fiktion zu erkennen. Wenn er in seinem Kommentar zu Schillers Tod vom „glänzend Falschen“ spricht, könnte er den verführerischen Ton Schillers meinen, der von der Realität ablenkt.
Für viele von Schillers Freunden, die ihn in verschiedenen Lebensphasen begleitet hatten, war sein Tod ein Schock. Der Bildhauer Johann Heinrich von Dannecker etwa, ein Jahr älter als Schiller und sein Mitschüler an der Stuttgarter Karlsschule, schrieb unmittelbar, nachdem er die Todesnachricht erhalten hatte: „Den anderen Morgen beim Erwachen war der göttliche Mann vor meinen Augen, da kam mirs in den Sinn, ich will Schiller lebig machen, aber der kann nicht anders lebig sein als kolossal. Schiller muss kolossal in der Bildhauerei leben, ich will eine Apotheose.“
Der Enthusiasmus Danneckers, der Schillers Kopf bereits zu Lebzeiten, bei Schillers längerem Aufenthalt in Stuttgart im Jahr 1794, modelliert hatte, geht noch weiter. Ende Mai 1805 hatte er die Absicht, einen Tempel zu entwerfen, der Schiller gewidmet sein sollte, und sandte Skizzen seines Plans an Wilhelm und Caroline von Wolzogen. Wie schon in den Totenfeiern sind hier die Anfänge einer Heroisierung zu finden, die sich das ganze 19. Jahrhundert hindurch fortsetzte und zeitweise dazu führte, dass Schiller überlebensgroß dargestellt und zu einem Dichtergott stilisiert wurde, dem das Publikum sich hochgestimmt und weihevoll näherte. Die Marmorbüste wurde ausgeführt, und ihre Abgüsse im Kleinformat waren jahrzehntelang Bestandteil des Schreibtischnippes gutbürgerlicher Familien. Der Gedanke an einen Tempel wurde zum Glück nie realisiert.
Die ersten Biografen meldeten sich schon 1805 zu Wort, waren aber – trotz aller Unrichtigkeiten, die sich in ihren flüchtig hingeschriebenen Texten fanden – so bescheiden, ihre Ansätze zu Lebensbeschreibungen „Skizzen“ oder „Szenen aus Schillers Leben“ zu nennen. Sie nahmen ihre Phantasie zu Hilfe, wenn es ihnen an authentischen Zeugen und Zeugnissen mangelte. Einer der ersten, die sich für kompetent genug hielten, Schillers Leben zu beschreiben, war Johann Gottfried Gruber. In seiner „Skizze einer Biographie“ wimmelt es von Fehlern, und allenthalben werden Widersprüche deutlich. Er behauptet, er habe Schiller gekannt, ihn besucht, berichtet auch von einem seiner Besuche bei ihm; es bleibt jedoch unklar, ob hier nur der Wunsch der Vater des Gedankens war und er Schiller in Wirklichkeit nie persönlich begegnet ist.
Grubers Beschreibung von Schillers Äußerem wurde in Varianten oft und gern jahrzehntelang wiederholt: „Er war lang von Statur. Sein Körper schien den Anstrengungen des Geistes damals schon zu unterliegen, sein Gesicht war bleich und verfallen, aber eine stille Schwärmerei schimmerte aus seinem schönen, belebten Auge, und die hohe, freie Stirn verkündete den tiefen Denker.“
Bei so viel Erhöhung, so viel Verklärung durften auch die Parodien nicht fehlen, die früh im Umlauf waren. Unzählige Parodien gibt es zum Beispiel auf das „Lied von der Glocke“; aus den Jahren um 1810 stammt ein Gesang auf den Kaffee von Gottfried Günther Röller:
In der Walze Form gebrochen,
Liegt die Trommel da von Blech.
Jetzo will ich Kaffee kochen;
Mägde, lauf mir keine weg,
Tummeln müsst ihr euch,
Faules Wetterzeug,
Soll der Trank für zarte Gäste;
Doch die Köchin thut das Beste.
Ein wenig wird hier nach dem Prinzip „Reim dich / oder ich fress dich“ verfahren – „Blech“ auf „weg“, „euch“ auf „-zeug“, das Metrum ist jedoch identisch. Für alle Leser, denen die erste Strophe des „Lieds von der Glocke“ nicht mehr aus dem Stegreif präsent ist – wohl die Mehrheit –, sei hier der Originaltext zitiert:
Fest gemauert in der Erden
Steht die Form, aus Lehm gebrannt.
Heute muss die Glocke werden!
Frisch, Gesellen, seid zur Hand!
Von der Stirne heiß
Rinnen muss der Schweiß!
Soll das Werk den Meister loben;
Doch der Segen kommt von oben.
Von dem eigentümlichen Glück Schillers, auch beim Volke, das heißt in den sogenannten niederen Ständen, beliebt zu sein, sprach Goethe einmal, und hier sei daran erinnert, dass die Kluft zwischen Adel und Bürgertum knapp zwei Jahrzehnte nach der Französischen Revolution noch recht groß war. Abstand herrschte zwischen den Ständen, und man hielt – von beiden Seiten – bewusst Distanz. Wer als Bürgerlicher Hauspersonal hatte – und wer hatte das nicht? –, blickte auf das „Gesinde“ herab. Wie auf die „Mägde“, die zum Kaffeekochen beordert wurden.
Erst sieben Jahre nach Schillers Tod erschien die erste Ausgabe seines Gesamtwerks; mit Umsicht und Genauigkeit machte sich Christian Gottfried Körner die Mühe, Schillers Dramen, Prosa und Lyrik herauszugeben, und brachte sein Unternehmen in den Jahren 1812 bis 1815 zum Abschluss. Körner war habilitierter Jurist, drei Jahre älter als Schiller und während seiner steilen Karriere unter anderem Staatsrat im preußischen Ministerium des Innern. Die Geschichte der Beziehung Schillers zu Körner hat ihre Anfänge in einer Jugendschwärmerei Körners und seiner späteren Frau Minna. Beide waren in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts gemeinsam mit Minnas Schwester Dora und deren damaligem Verlobten Ludwig Ferdinand Huber so begeistert von Schillers frühen Dramen, dass sie ihm ein Paket nach Mannheim sandten, mit Liebesgaben und Verehrerbriefen. Schiller hatte anfangs belustigt reagiert, sich dann aber auf das Werben der beiden Paare eingelassen und war im April 1785 von Mannheim nach Sachsen gereist. Von da an lebte er zwei Jahre lang in Leipzig und Umgebung, danach in Loschwitz bei Dresden und in Dresden selbst, in ständigem Kontakt mit Körner, Huber, den beiden jungen Frauen und ihrem Kreis.
Aus dem Überschwang der Begeisterung für das sinnliche Erleben der Freundschaft hatte er in diesen Jahren eine rauschhafte Lyrik verfasst; die „Ode an die Freude“ ist ein Produkt dieser Zeit. In einem seiner Briefe beschreibt Schiller später einmal seinen Freund Christian Körner: „Es ist kein imposanter Charakter, aber desto zuverlässiger auf der Probe. Ich habe sein Herz noch nie auf einem falschen Klang überrascht; sein Verstand ist richtig, uneingenommen und kühn; in seinem ganzen Wesen ist eine schöne Mischung von Feuer und Kälte.“
„Schiller: Sämmtliche Werke“ ist in zwölf Bänden bei Cotta erschienen, und Körner trug ein Vorwort, „Nachrichten von Schillers Leben“, dazu bei. Seine Nachrichten sind sachlich, mit der Genauigkeit eines Juristen abgefasst, wenn auch ein wenig trocken, und beruhen auf authentischem Material. Im Sommer 1809 überließ Charlotte von Schiller Körner Briefe aus dem Nachlass; weitere Briefe und genaue Informationen erhielt er von Schillers Schwester Christophine, die mit dem Bibliothekar Reinwald in Meiningen verheiratet war, einem Sprachwissenschaftler, der im Poetischen dilettierte, aber verlässlich war, was biografische Daten betraf; auch er leistete einen Beitrag. Eine weitere wichtige Quelle für Körner war Wilhelm von Humboldt. Das Echo auf Körners Einleitung zu seiner Ausgabe der Sämtlichen Werke soll verhalten gewesen sein und erst ein größeres Publikum erreicht haben, als Caroline von Wolzogen Passagen aus Körners „Nachrichten“ im Jahr 1830 in ihre Biografie „Schillers Leben“ übernahm.
In den Jahren, als Körner seine Informationen zusammentrug und sorgfältig darauf achtete, dass alles Anekdotische und jede Effekthascherei unterblieb, mit der die frühen Biografen geliebäugelt hatten, um sich selbst einen Namen zu machen, führten Schillers Gedichte, wie schon zu seinen Lebzeiten, zu einem Enthusiasmus bei der Jugend, der während der kriegerischen Auseinandersetzungen der Jahre 1806 bis 1813 in nationalistische Schwärmerei umschlug.
Eines der meistgespielten Dramen dieser Jahre war „Die Jungfrau von Orleans“, die romantische Tragödie, in der Jeanne d’Arc sich aus Liebe zu ihrem Vaterland opfert. Schillers Gedichte verführten zum Atheismus – so der Vorwurf Stolbergs. Schillers Dramen verführten offensichtlich auch zum Patriotismus. Die Lust, sich vom Boden der Wirklichkeit zu entfernen, hatte in der Tat für alle Schillerverehrer etwas Verlockendes, und die nationalistische Schwärmerei, mit der Soldaten sich dann wieder 1870 / 71 und im Ersten Weltkrieg auf Schiller beriefen, könnte ebenfalls darauf zurückzuführen sein, dass Fiktion und Realität schamlos miteinander vermischt wurden. Fasziniert von dem Streben nach persönlicher und allgemeiner Freiheit, das in Schillers liedhaften Gedichten zum Ausdruck kommt, wurden diese Gedanken zum Schlachtruf gegen den jeweiligen Feind.
Der Sohn Christian Körners, Theodor Körner, Verfasser schwärmerischer Freiheitslieder, noch bis zum Ersten Weltkrieg als patriotischer Dichter verehrt, ist ein solches Opfer der falschen Wahrnehmung der Poesie. Von Schiller zutiefst beeindruckt, orientierte er sich in allem, was er schrieb, an dessen Diktion. Auch Dramen schrieb er und wurde Hoftheaterdichter am Wiener Theater. Die unselige Verwechslung von Literatur und Leben verblendete ihn dermaßen, dass er sich im März 1813 der deutschen Befreiungsbewegung gegen Frankreich anschloss und als Soldat des von Lützowschen Freicorps, genauer gesagt, als Adjutant des Majors von Lützow, im August desselben Jahres in Mecklenburg fiel, knapp 22 Jahre alt. Sein früher Tod trug zu seinem unverdienten Nachruhm als Dichter bei. Seine Texte waren epigonal.
Unter den vielen Texten des Liederbuchs des Lützowschen Freicorps, dessen „Kriegsgesänge für freie Deutsche“ den Soldaten Todesmut einimpfen sollten, befanden sich nur vier von Schiller, darunter „Des Reiters Lied“, das in der Tat ein Schlachtgesang ist und aus „Wallensteins Lager“ stammt: „Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd, / ins Feld, in die Freiheit gezogen! ...“ Wo auch immer „Wallenstein“ in diesen Jahren aufgeführt wurde, sang das Publikum mit, sobald dieses Lied von der Bühne ertönte.
Über hunderttausend Tote und Verletzte forderte die Schlacht von Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813. In den „Tag- und Jahresheften“ streift Goethe kurz die Auswirkungen des Krieges auf Weimar in jenem Herbst: „... der französische Gesandte wird in Gotha überrumpelt und entkommt. Ein geringes Korps Preußen besetzt Weimar und will uns glauben machen, wir seien unter seinem Schutz sicher. Die Freiwilligen betragen sich unartig und nehmen nicht für sich ein. Ich reise ab. Begegnisse unterwegs. In Dresden russische Einquartierung, nachts mit Fackeln. ... Vorläufige Andeutungen einer allgemeinen Verbindung gegen Napoleon. Schlacht von Lützen. Franzosen in Dresden. Waffenstillstand. ... Rückkehr nach Weimar. Die jüngste französische Garde zieht ein. General Travers, den ich als jenen Begleiter des Königs von Holland kennen gelernt, wird bei mir zu seiner höchsten Verwunderung einquartiert. Die Franzosen ziehen alle vorwärts. Schlacht von Leipzig. Die Kosaken schleichen heran, der französische Gesandte wird hier genommen, die Franzosen von Apolda und Umpferstedt hier andrängend. Die Stadt wird vom Ettersberg her überfallen. Die Österreicher rücken ein.“
Viele Weimarer Familien kamen in dieser Zeit bei Freunden und Verwandten auf dem Land unter, so auch Charlotte von Schiller mit ihren Kindern. Wieder in ihrem Haus an der Esplanade, schreibt sie im November 1813 an Caroline Luise, die Tochter des Herzogs von Weimar und mittlerweile Prinzessin von Mecklenburg: „Ich hatte eine heimliche Angst, wieder herzukommen; Sie wissen, dass ich mein Haus als Schillers heiliges Andenken liebe. Ich habe es doch vor Gewalttätigkeiten bewahrt und unter Schillers Bild wie an einen Altar mich geflüchtet.“
Und sie schreibt weiter, dass Offiziere aus vielen Ländern zu ihr gekommen seien, um sie voller Ehrfurcht nach Schiller zu fragen und mit ihr zu trauern. Wie schon in den Totenfeiern zeigt sich in diesen Worten der Witwe eine starke Tendenz zur Verklärung, die Schiller in die Nähe einer Ikone rückt. Es ist nicht zu verkennen, dass die Glorifizierung, die sich in den kommenden Jahrzehnten noch steigerte und seltsame Züge annahm, von der Familie des Dichters zwar nicht gesteuert, aber mitgetragen wurde.
Charlotte und ihre Schwester nahmen Anteil an den intellektuellen Vergnügungen der Männer, lasen viel und debattierten mit, auch wenn ihnen die Hörsäle der Universitäten verschlossen blieben. Aus dem Briefwechsel zwischen Schiller mit den beiden Schwestern geht hervor, dass Caroline und Charlotte die Neuerscheinungen ihrer Zeit lasen und Schillers Arbeiten aufmerksam verfolgten, bis hin zu seinen historischen und philosophischen Essays.
Als Beispiel für Charlottes Interesse nicht nur an der Philosophie und Literatur ihrer Zeit, sondern auch an den Entdeckungen der Weltreisenden, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts in ihren Kreisen Gesprächsstoff waren, möge hier ein Zitat aus einem ihrer Briefe aus Rudolstadt an Schiller vom 2. Dezember 1788 stehen:
„Ich habe einige Tage ganz in anderen Weltteilen zugebracht, und nahm die Landkarten zu Hilfe, und vergaß ganz, dass ich so auf einem kleinen Fleck Erde war. Aber ich habe mich doch auch bei all meiner Freude über die Menschen geärgert, dass sie so in fremde Gegenden reisten, und alle die Länder als ihr Eigentum ansahen, wozu sie kein Recht hatten, und nur das Gefühl, dass sie gesitteter, und vielleicht einige Kenntnisse mehr hätten, ihnen das Recht gab, sich zu Herren aufzuwerfen. Es würde uns doch nicht angenehm sein, wenn wir so auf einmal von unserm Fleck Erde vertrieben würden. –“ Ein klares Wort gegen die Anmaßung der Kolonialherren ihrer Zeit von Charlotte von Lengefeld, einer Frau, der von der Nachwelt kaum mehr zugetraut worden war, als dass sie ihrem Mann den Rücken freigehalten habe.
Und am 15. Mai 1790 schrieb Schiller an seine Schwägerin Caroline: „Lolo hat gestern zwei Stunden im Kabinett neben meinem Auditorium zugebracht und mich lesen hören und mir Tee gemacht.“ Demnach fand sie sogar einen Weg, eine seiner Vorlesungen zu hören. Sie unterstützte ihn in allem, erledigte mit Hilfe des Hauspersonals alles, was den Alltag, was das Praktische betraf, war jedoch gewiss nicht hausbacken, wie sie zum Beispiel von den Schlegels dargestellt wurde. Sie war achtunddreißig Jahre alt, als Schiller starb, und ihr Dasein als Schillers Witwe begriff sie als Verpflichtung, sich mit allen Fasern ihres Wesens für sein Andenken einzusetzen. Auf der anderen Seite spricht aus allen ihren Briefen ein Sinn für das Machbare, der nichts von Schwärmerei an sich hat, selbst nicht in ihrer Jugend.
Während die Hinterbliebenen, sei es die Familie, seien es Freunde, Verehrer und Epigonen, Wert darauf legten, alles, was an Schiller erinnerte, zu bewahren, stand die Literaturkritik nicht still. War das „Lied von der Glocke“ Anlass für die Schlegels, die Nase zu rümpfen, hat ihre Reaktion auf dieses Lehrgedicht, das zu bravem Verhalten mahnt, eher anekdotischen Charakter, so haben Friedrich und August Wilhelm Schlegel sich doch auch philologisch genau mit Goethes und Schillers Werk befasst. Als zu kopflastig bezeichnet Friedrich Schlegel Schillers Dramen und tadelt die Tendenz zur Idealisierung; zu sentenzenreich nannte August Wilhelm Schlegel die Theaterstücke in seinen Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. An den „Räubern“ kritisierte er, dass Schiller sich allzu deutlich an Shakespeare anlehne, „Kabale und Liebe“ nannte er zu sehr der Empfindsamkeit verpflichtet und an manchen Stellen geradezu peinlich.
Clemens Brentano, der nur einen losen Kontakt zu dem Kreis um die Schlegels hatte, äußerte sich widersprüchlich. Kurz nach der Uraufführung der „Braut von Messina“ in Weimar im März 1803 nannte er Schillers Trauerspiel in einem Brief an Achim von Arnim „... ein erbärmliches Machwerk, langweilig, bizarr und lächerlich“. Als er sich zehn Jahre später eine Zeitlang in Wien aufhielt, bestritt er seinen Lebensunterhalt unter anderem mit Theaterkritiken für den dort erscheinenden „Dramaturgischen Beobachter“.
In seiner Besprechung der Wiener Darbietung der „Braut von Messina“ vom 12. Januar 1814 bemühte er sich redlich, sein früheres, eher privates Urteil für das Zeitungspublikum zu revidieren. Er gestaltet seine Kritik poetisch und wird fast hymnisch: „Schiller hat nirgends seine Güte, seine Dichterunschuld, seine Liebe zu der Welt so gezeigt, als da er ihrer Schaubühne dieses Werk anvertraute.“ Besonders beeindruckt hat ihn die Hauptdarstellerin Antonie Adamberger, die trauernd hinterbliebene Braut Theodor Körners: „Ich habe nie eine Schauspielerin gesehen von solchen herrlichen Gaben.“
Wenige Tage später wurde „Kabale und Liebe“ am Wiener Hoftheater gegeben, und Brentano sagt in seiner Rezension dieses Trauerspiels offen, dass er das Schauspielhaus mitten im dritten Akt verlassen habe, da er sich seelisch und geistig malträtiert fühlte. Danach rechnet er in Bausch und Bogen mit Schiller ab: „In den ‚Räubern‘ riss er sich vom gemeinen Leben los, im ‚Fiesco‘ ergab er sich mit Studentenwut der Geschichte, in ‚Kabale und Liebe‘ fing ihn seine Zeit und sein Vaterland mit Kabale und Liebe ein. Im ‚Don Carlos‘ war er schön und wendete sich auf dem einzig möglichen Weg von der Wahrheit des wirklich schönen Lebens zu einer sogenannten Wahrheit eines schönen Kunstlebens; nachher tritt er in das strenge, reine, höhere, historische Leben im ‚Wallenstein‘, in der ‚Johanna d’Arc‘ zur zweiten schönen Jugend, und hat in der ‚Braut von Messina‘ seinen Gipfel erreicht.“
In chronologischer Reihenfolge handelt Brentano hier das Dramenwerk Schillers ziemlich unbekümmert ab; „Maria Stuart“ und „Wilhelm Tell“ hat er ausgelassen. Der burschikose Stil von Brentanos Rundumschlag gegen Schillers Dramen sagt auch etwas über das Urteil eines belesenen Dichters der nächsten Generation aus, denn damit wendet er sich deutlich gegen den Kult, der zum einen auf der populären Ebene, zum anderen auf dem Theater mit Schillers Dramen inszeniert wird.
In den Jahren 1815 bis 1825 war Schiller zwar nach wie vor präsent und an den Bühnen etabliert, stand jedoch nicht mehr im Zentrum der literarischen Aufmerksamkeit. Diese galt nun Werken der nächsten Generation wie der Sammlung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Adelbert von Chamissos Novelle „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“, E. T. A. Hoffmanns „Elixieren des Teufels“ und seinen „Lebensansichten des Katers Murr“; Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel, Achim von Arnim und Clemens Brentano machten von sich reden. In Weimar hatten sich neue Kreise gebildet, und von Goethe hieß es nach einem Epigramm Heinrich von Kleists, er zerlege jetzt den Strahl, den seine Jugend einst warf. Kleists bissiger Spruch bezog sich auf „Dichtung und Wahrheit“, Goethes Autobiografie, deren erster Teil in Kleists Todesjahr – 1811 – publiziert wurde, ein Werk, an dem deutlich wird, in welchem Maß Goethe darauf bedacht war, der Nachwelt ein Bild seiner selbst zu hinterlassen, das er selbst bestimmte. Vergleichbares gilt für seine Beziehung zu Schiller. Sie sollte der Nachwelt als makellos überliefert werden.
Goethe gehörte zu den kritisch Bewahrenden. Unter anderem waren es „Die Räuber“ gewesen, die ihn dazu veranlasst hatten, sich Schiller gegenüber distanziert zu verhalten, da Goethe seine Sturm-und-Drang-Zeit hinter sich gelassen hatte, als das Stück in Mannheim uraufgeführt wurde. Auch nach Schillers Tod machte er keinen Hehl aus seinen gemischten Gefühlen: „Denn eigentlich wird jene rohe Großheit, die uns in dem Schillerschen Stücke in Erstaunen setzt, nur dadurch erträglich, dass die Charaktere im Gleichgewicht stehen.“ Auch im Alter hat Goethe sich kontinuierlich mit Schiller auseinander gesetzt, kritisch, jedoch auch mit verschiedenen Akten der Pietät; so wiederholte er die Schillergedenkfeier vom August 1805 im Mai 1806, dann wieder zur fünften wie zur zehnten Wiederkehr des Todestages, wiederum mit dem „Lied von der Glocke“ und seinem Epilog.
Ablehnend standen nicht nur einige der Romantiker, sondern auch Ludwig Börne Schiller gegenüber. Seine Rezension der Aufführung des „Don Carlos“ in Frankfurt am Main vom September 1818 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Die Wa(a)ge“ hat einen hohen Unterhaltungswert, den er Schillers Drama abspricht: „Doch an diesem bejahrten Denkmal der Kunst, seit langem allen sichtbar und zugänglich, hat das Urteil sich wohl schon längst erschöpft, und nur erinnerte, keine neuen Bemerkungen lassen sich erwarten. Darum mag nur so viel berührt werden, als nötig ist, um vor der Ungerechtigkeit zu schützen, dass wir die Schwächen der Dichtung nicht der Darstellung anrechnen.“
Börne verwahrt sich gegen diesen „vierstündigen Unterricht in Dingen der Weltweisheit“. Für ihn scheint Schiller zum alten Eisen zu gehören, dessen Dramen nur noch aus Pietät gespielt werden. Wie Clemens Brentano in Wien bei „Kabale und Liebe“ muss Börne sich unsäglich gelangweilt haben, denn „nichts geschieht, wenig wird empfunden, am meisten wird gedacht. Es ist ein schönes vergoldetes Lehrbuch über Seelenkunde und Staatskunst, vom Schulstaube gereinigt, uns in die Hände gegeben.“ Mit dieser Kritik Börnes wird ein Ton angeschlagen, der in späteren Jahrzehnten oft zu hören ist.
Hier würden Ideen in Szene gesetzt, die Figuren seien im Grunde genommen nur schwache Verkörperungen der Gedankenwelt Schillers, bewegten sich wie Marionetten und hätten keinen Bezug zur Realität, weder in der fiktiven Vergangenheit, noch in der Gegenwart.
Liest man diese Rezension, könnte man fast den Eindruck gewinnen, als sei Schillers Zeit vorbei, als seien seine Dramen verstaubt, seine Balladen und Lieder schon dabei, in Vergessenheit zu geraten. Nichts dergleichen. Zwar bestand, wie Börne andeutet, jetzt bereits die Gefahr, dass Schiller zum Klassiker erstarrte, aber die intensive Beschäftigung mit seinem Leben und Werk fing erst an. Man denke nur an die Vertonungen. Von 1822 an, wenn nicht bereits früher, soll Beethoven sich mit dem Gedanken an die Komposition der „Ode an die Freude“ befasst haben. Früh war bereits Musik zu einzelnen Werken geschrieben worden.
Die ersten Vertonungen stammen von Johann Rudolf Zumsteeg, wie Dannecker ein Mitschüler Schillers an der Karlsschule. Er schrieb 1781 die Musik zu den „Räubern“ und vertonte später viele seiner Gedichte und Balladen. Als Schiller im Juni 1784 das Überraschungspaket seiner ihm bis dahin unbekannten Verehrer aus Dresden erhielt, von Christian Gottfried Körner und seinen Freunden, befand sich darin auch Körners Komposition des Lieds der Amalia, der weiblichen Hauptfigur in den „Räubern“.
Als Schiller dann in Gohlis bei Leipzig wohnte, dank Körner finanziell unabhängig, schrieb er das Lied „An die Freude“ wie im Rausch, als eine Hymne auf die Freundschaft, die er in Sachsen erlebte. Die Ode erschien in der ersten Fassung 1786 in der „Thalia“. Auch heute fällt es sogar distanzierten Lesern – oder Zuhörern – schwer, sich von Rhythmus, Reim und Rausch nicht mitreißen zu lassen.
Jean Paul jedoch analysiert die Version von „Freude, schöner Götterfunke“ von 1795 schonungslos witzig in der „Vorschule der Ästhetik“. Nach einer Kritik an dem Lehrgedicht „Die Ideale“ fährt er fort: „Ebenso lückenhaft ist das berühmte Gedicht ‚an die Freude‘ gebauet, in welchem sich an den Trinktisch nicht bloß, wie bei den Ägyptern an den Esstisch, ‚Tote‘ setzen, sondern auch ‚Kannibalen‘, ‚Verzweiflung‘, das ‚Leichentuch‘, der ‚Bösewicht‘, das ‚Hochgericht‘, und worin aller mögliche Jammer zum Wegsingen und Wegtrinken eingeladen ist. Übrigens würd’ ich aus einer Gesellschaft, die den herzwidrigen Spruch bei Gläsern absänge: ‚Wers nie gekonnt, der stehle weinend sich aus unserm Bund‘, mit dem Ungeliebten ohne Singen abgehen und einem solchen harten elenden Bunde den Rücken zeigen, zumal da derselbe kurz vor diesen Versen Umarmung und Kuss der ganzen Welt zusingt und kurz nach ihnen Verzeihung dem Todfeind, Großmut dem Bösewichte nachsingt.“
In einer Fußnote fügt er hinzu: „Wie poetischer und menschlicher würde der Vers durch drei Buchstaben: ‚der stehle weinend sich in unsern Bund!‘ Denn die liebewarme Brust will im Freudenfeuer eine arme erkaltete an sich drücken.“ Bevor Jean Paul in seiner „Kurzen Nachschrift oder Nachlese der Vorlesung über Schiller“ dazu übergeht, die „Frauenwürde“ zu zerpflücken, gibt er seiner Verwunderung darüber Ausdruck, dass die „Ode an die Freude“ auch noch mehrfach vertont worden sei.
Zu diesem Zeitpunkt, 1812, lagen bereits Kompositionen unter anderem von Johann Friedrich Reichardt und Karl Friedrich Zelter vor. Zelter, Dirigent der Berliner Singakademie, ist als Freund und Briefpartner Goethes, als Komponist vieler Lieder Goethes bekannt; er löste Reichardt als Komponist in der Gunst Goethes ab. Vermutlich lernte Beethoven die „Ode an die Freude“ 1792 kennen, richtete sich nach einer revidierten Fassung, als er sie als Finalsatz in seine 9. Symphonie einfügte, und nahm selbst ein paar Änderungen am Text vor.
Im Jahr 1826 war die Zeit für Bestattungen in der Gruft, in der man Schillers Leichnam beigesetzt hatte, abgelaufen, und der Weimarer Bürgermeister verfügte, das sogenannte Kassengewölbe auf dem Jakobsfriedhof zu schließen. Unter den Skeletten und Totenköpfen, die man darin fand, ließ sich – so heißt es – der Schädel Schillers durch einen Vergleich mit den Maßen der Totenmaske zweifelsfrei identifizieren. Beschlossen wurde, den Schädel feierlich im Sockel der Schillerbüste Danneckers beizusetzen, die in der Tat, wie von dem Bildhauer geplant, etwas Kolossales hatte. Dies geschah in einer Feierstunde in der Herzoglichen Bibliothek am 17. September 1826; Ernst von Schiller, der zweitälteste Sohn des Dichters, sprach, und statt Goethe dessen Sohn August, der die Rede des Vaters vortrug.
Eingehend betrachtete Goethe am folgenden Tag Schillers Schädel und nahm ihn eine Woche später mit in sein Haus. Es war die Zeit, in der für Goethe der Begriff der Weltliteratur Form und Gestalt annahm, die Zeit, in der er Dantes „Göttliche Komödie“ las, und als er in der Nacht vom 24. auf den 25. September mit seinem Todesgedicht aus Anlass der Betrachtung von Schillers Schädel begann, näherte er sich Dantes Form, indem er Terzinen wählte, Dantes Versmaß:
Im ernsten Beinhaus wars, wo ich beschaute,
wie Schädel Schädeln angeordnet passten;
die alte Zeit gedacht ich, die ergraute.
Sie stehn in Reih geklemmt, die sonst sich hassten,
und derbe Knochen, die sich tödlich schlugen,
sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten ...
Durch den Rhythmus der Terzinen entsteht eine Form, die teils wiederholend, teils neu ansetzend ins Unendliche weist. Auffällig ist, dass Schillers Name nur im Titel genannt wird, der dem Gedicht postum gegeben wurde. In keiner Zeile taucht er auf. Dem lyrischen Ich, dem „Adepten“, der in die Geheimnisse von Leben und Tod eingeweiht ist, erschließt sich nach und nach der Sinn, der sich hinter der Aneinanderreihung der Totenköpfe und dem Durcheinander von Skeletten verbirgt. Die Entdeckung des einzigen – und einzigartigen – Schädels, auf den es ihm ankommt, lässt ihn das Wesen der Schöpfung erkennen, die er Gott-Natur nennt. Der Schluss, den der Eingeweihte daraus zieht, gibt ihm, dem Greis, Hoffnung: Aus Materie wird Geist, und Geist kann nicht verloren gehen, mehr als das, er wird durch die Natur, die Goethe mit dem Gottesbegriff seiner universalen Religion gleichsetzt, konserviert. Dieses Altersgedicht Goethes ist als ein Schlüssel seiner Beziehung zu Schiller, wenn nicht gar zu den Menschen schlechthin, zu sehen.
Der Schädel kehrte erst spät wieder an den dafür vorgesehenen Platz im Postament der Marmorbüste zurück, denn Wilhelm von Humboldt hat ihn bei einem Besuch am Frauenplan im Dezember desselben Jahres gesehen und beschreibt ihn in einem Brief an seine Frau in gewohnt altväterlichem Stil: „Jetzt liegt er auf einem blausamtenen Kissen, und es ist ein gläsernes Gefäß darüber, das man abnehmen kann. Man kann sich wirklich an der Form dieses Kopfes nicht satt sehen. Wir hatten einen Gipsabguss von Raffaels Schädel daneben. Der letztere ist regelmäßiger, gehaltener, in ganz gleich verteilter Wölbung. Aber der Schillersche Kopf hat etwas Größeres, Umfassenderes, mehr auf einzelnen Punkten sich ausdehnend und entfaltend, neben anderen, wo Flächen oder Einsenkungen sind. Es ist ein unendlich ergreifender Anblick, aber doch ein sehr merkwürdiger.“ Ein Jahr später, im Dezember 1827, wurden die sterblichen Überreste Schillers in die neuerbaute Weimarer Fürstengruft auf dem Neuen Friedhof überführt.
Bewusstes Erinnern und der Gedanke an den eigenen Tod, der Wunsch, der Nachwelt ein lupenreines Bild seiner selbst und seiner Beziehung zu Schiller weiterzugeben, waren Anlass für Goethe, seinen Briefwechsel mit Schiller aus den Jahren 1794 bis 1805 herauszugeben, als er auf sein achtzigstes Lebensjahr zuging; 1828 / 29 erschienen sechs Bände bei Cotta in Stuttgart. Wer dem Verhältnis zwischen Goethe und Schiller auf den Grund gehen will, findet hier reichhaltigen Stoff, um zu analysieren, wie ernst beide ihre Freundschaft nahmen. Schiller war, wie oben erwähnt, der Werbende, hatte er Goethe doch nicht nur für die Mitarbeit an den „Horen“ gewinnen wollen. Auf den in der Schillerforschung oft zitierten Brief vom 23. August 1794, mit dem Schiller Goethes Weg der Erkenntnis definiert, der so ganz anders sei als sein eigener, antwortet ihm Goethe mit freundlichem Erstaunen, Schiller habe damit die Summe seiner, Goethes, Existenz gezogen.
Gemeinsam entwickeln beide eine Theorie der Kunst, nicht in dem Plauderstil, den man so häufig in den Briefsammlungen dieser Jahrzehnte findet, sondern hier wird deutlich, dass Goethe und Schiller einander Fragen stellen und Antworten darauf finden, die sie stetig weiterverfolgen. Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang eine Rezension des Briefwechsels in der „Evangelischen Kirchenzeitung“, die von dem unerbittlich dogmatischen Theologen Ernst Wilhelm Hengstenberg herausgegeben wurde. Statt den gedanklichen Höhenflug zu würdigen, erhob er den Vorwurf der Unchristlichkeit.
Beide Dichter hätten – für die Moral des Publikums Besorgnis erregend – den Segnungen der christlichen Religion den Rücken gekehrt und würden nur sich selbst verehren. Immerhin überwogen die positiven Stimmen, die das ästhetische Konzept, das Goethe und Schiller miteinander entwickelten, zu würdigen wussten.
Kurz darauf, 1830, kam ein weiteres Sammelwerk von Briefen heraus. Humboldts „Vorerinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung“, die er der Korrespondenz zwischen Schiller und ihm von 1792 bis 1805 voranstellt, gilt als eine der klarsten und tiefsten Würdigungen des Dichters, die je erschienen. Er schreibt: „Was jedem Beobachter an Schiller am meisten, als charakteristisch bezeichnend, auffallen musste, war, dass in einem höheren und prägnanteren Sinn, als vielleicht je bei einem andern, der Gedanke das Element seines Lebens war."
Humboldt betont, dass geistige Beschäftigung für Schiller keine Anstrengung, sondern Erholung, mehr als das, Lebenselixier, war, spricht von Schillers „sehr vielseitiger Weltansicht“, obwohl er keine Reisen in ferne Länder unternommen hatte, und seiner „rastlos angestrengten Phantasie“. Humboldts Analysen ausgewählter Texte Schillers in dieser ausführlichen Einleitung wurden und werden von Generationen von Germanisten bis auf den heutigen Tag herangezogen, wenn es um die Interpretation Schillerscher Geistesprodukte geht. Humboldts Stil jedoch ist so ernst und getragen, dass sich bei der Lektüre gepflegte Langeweile einstellt.
Bereits 1825 war „The Life of Friedrich Schiller“ von Thomas Carlyle in London erschienen; Goethe korrespondierte mit dem Verfasser, seit dieser ihm seine Übersetzungen aus „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ ins Englische zugesandt hatte. Der Philosoph und Historiker Carlyle, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einer Biografie Friedrichs II. von Preußen bekannt werden sollte, hatte unter anderem auch Texte von Musäus, Ludwig Tieck, E. T. A. Hoffmann und Jean Paul übersetzt, unter dem Titel „German Romance“ veröffentlicht und mit einführenden Worten zur deutschen Literatur seiner Zeit versehen.
Als der Frankfurter Verleger der deutschen Übersetzung von Carlyles Schiller-Biografie Goethe darum bat, eine Einleitung zu verfassen, sagte Goethe zu. Darin heißt es, dass die Lebensgeschichte, die „ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Meere“, der „Schottländer“ Carlyle, verfasst habe, den Landsleuten Schillers zwar kaum Neues biete, aber Goethe gibt Lesern und Leserinnen zu verstehen, wie sehr er es schätzt, dass Schiller weit über nationale Grenzen hinaus gewürdigt wird. „Mir wenigstens war es rührend zu sehen, wie dieser rein und ruhig denkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Produktionen unseres Freundes immer den edlen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward und sich ein Ideal des vortrefflichen Sterblichen an ihm auferbauen konnte.“
Das Buch erschien 1830 auf Deutsch. Erstaunlich, dass Goethe hier wiederum seine Ablehnung von Schillers Jugendwerk zur Sprache bringt; es hat fast den Anschein, als gelte Schiller ihm erst von den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts an als Dichter.
Goethe hatte in diesen Jahren seine Überlegungen zur Weltliteratur weiterentwickelt und betont mehrfach, wie wertvoll es sei, wenn die Literaturen der Länder der Welt wechselseitig übersetzt würden, möglichst bei Beibehaltung der Essenz, die den Charakter der jeweiligen Landschaft auszeichnet. Deutlich gibt er sein Wohlwollen an dem Interesse einer Würdigung Schillers jenseits der Grenzen zu erkennen und lobt den Autor dafür, dass er seinen Dichterkollegen als mustergültig darstellt. Ganz im Gegensatz zu Goethes anerkennender Betrachtung von Carlyles Werk ließen sich andere Rezensenten gar nicht erst ernsthaft auf die Lebensbeschreibung Carlyles ein; von Wolfgang Menzel zum Beispiel, dem Starkritiker seiner Zeit, der Heinrich Heine das Leben schwer machte, waren scharfe nationalistische Töne zu vernehmen.
In einem Brief vom 10. November 1830, dem Gedenktag zu Schillers Geburtstag, an Wilhelm von Humboldt urteilt Caroline von Wolzogen sehr hart und mit bemerkenswerter Schnoddrigkeit, die man sonst kaum bei ihr findet, indem sie von dem „ganz nullen Werck aus dem Englischen“ spricht. Ihr Buch, „Schillers Leben, verfasst aus Erinnerungen der Familie, seinen eigenen Briefen und Nachrichten seines Freundes Körner“, wurde im selben Jahr wie die deutsche Übersetzung von Thomas Carlyles Lebensbeschreibung und Humboldts Briefwechsel mit Schiller publiziert.
Spätestens 1826, nach dem Tod ihrer Schwester Charlotte, vielleicht auch schon früher, entschloss sie sich, das Lebensbild Schillers zurechtzurücken und in ihrem Sinne Klarheit zu schaffen. Beide Schwestern lebten für das Andenken des Verstorbenen und ärgerten sich über Unrichtigkeiten und Verdrehungen der frühen Biografen. Erwähnt wurden bereits die „Skizzen einer Biografie“ von Johann Friedrich Gruber aus dem Todesjahr Schillers, im gleichen Jahr war „Schiller oder Scenen und Charakterzüge aus seinem spätern Leben, nebst Bruchstücken einer künftigen Biographie desselben“ von Christian Wilhelm Oemler publiziert worden, das er ein Jahr später um „Schiller, der Jüngling, oder Scenen und Charakterzüge aus seinem frühern Leben“ ergänzte. Bei Oemlers „Scenen“ handelt es sich um ein Machwerk, dessen Fehlinformationen noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein von späteren Biografen Schillers übernommen wurden.
Endgültig muss Caroline der Kragen geplatzt sein, als im Jahr 1822 wieder einmal eine Lebensgeschichte auf den Markt gekommen war: „Friedrich von Schillers Leben. Aus theils gedruckten, theils ungedruckten Nachrichten, nebst gedrängter Übersicht seiner poetischen Werke“. Der Autor, Heinrich Döring, war ein populärer Vielschreiber, der mit rasch verfassten Biografien und Nekrologen berühmter Schriftsteller Erfolg hatte. Charlotte nannte Dörings Buch in einem Brief an ihren Sohn Ernst „klein und armselig“, und Caroline mokierte sich über „das abgeschmackte Produkt über Schillers Leben“. Denkbar ist, dass sie bereits zu diesem Zeitpunkt den Plan hatte, mit einem eigenen Buch Klarheit in den Nebel um Schillers Lebensgeschichte zu bringen.
Caroline von Wolzogen war Schriftstellerin. Als Schiller ihren ersten Roman „Agnes von Lilien“ 1796 / 97 anonym in den „Horen“ in Fortsetzungen veröffentlichte, hielten die Brüder Schlegel Goethe für den Autor. Ein größeres Kompliment hätte man ihr kaum machen können, hatte sie ihren Stil doch, empfindsam und anempfindend, jenem Goethes angeglichen. Als der Roman dann als Buch erschien, verkaufte er sich ausgezeichnet. Unschwer ist in der Romanfigur Agnes Caroline selbst zu erkennen, in Amalie ihre Schwester Lotte, und die männliche Hauptfiur, der Graf Nordheim, trägt Züge Schillers und Wilhelm von Wolzogens. Ihre enge Verbindung, genauer gesagt, ihre Zugehörigkeit zum Weimarer Kreis und ihre innige Beziehung zu Schiller, dem sie mehr als Schwägerin war, bietet an sich schon Stoff zu Romanen, die bis in die jüngste Zeit hinein erschienen sind.
Aus Kalkül ihrer verwitweten Mutter, Luise von Lengefeld, war Caroline im Alter von sechzehn Jahren mit Friedrich Wilhelm von Beulwitz verlobt worden und heiratete ihn, den um elf Jahre älteren Geheimen Schwarzburg-Rudolstädtischen Legationsrat, pflichtbewusst, als sie einundzwanzig war. Es war eine Vernunftehe, in die sie sich fügte, da das Auskommen der engeren Familie Lengefeld, die aus der Mutter und den beiden Schwestern bestand, dadurch halbwegs gesichert war. Als entfernte Verwandte der Henriette von Wolzogen hatten die Lengefelds Schiller auf der Durchreise in Mannheim im Juni 1784 bei einer Stippvisite kennen gelernt. Henriette von Wolzogen hatte Schiller als Schulkameraden ihrer Söhne von Dezember 1782 bis zum Sommer 1783 Zuflucht auf ihrem Landgut in Thüringen, in Bauerbach bei Meiningen, geboten, als er, der junge Dichter der „Räuber“, Württemberg hatte verlassen müssen.
Eine intensive Beziehung zwischen den beiden Schwestern und Schiller bahnte sich drei Jahre später an, als Wilhelm von Wolzogen im Dezember 1787 mit Schiller durch Rudolstadt ritt, um ihm seine „superklugen Cousinen“ vorzustellen. Schiller verbrachte dann die Sommermonate 1788 und 1789 in der Gegend von Rudolstadt, um in Ruhe unter anderem an der „Geschichte des Abfalls der Niederlande“ zu arbeiten und den Schwestern nahe zu sein. Er liebte beide, hielt zu dieser Zeit – nach dem Vorbild der „Neuen Heloise“ von Rousseau – wenig von der Ehe als institutionalisierter Zweierbeziehung und erwartete auch bei der Heirat mit Charlotte im Februar 1790 noch, dass ihr Dreiecksverhältnis beibehalten würde.
Auch wenn Caroline nach Schillers und Charlottes Hochzeit auf konventionelle Schranken Rücksicht nahm und nicht mit dem jungen Ehepaar zusammenzog, ist zu vermuten, dass sie nach ihrer Scheidung von dem Geheimen Legationsrat von Beulwitz im August 1794 mit der Heirat von Wilhelm von Wolzogen bald darauf wiederum eine Vernunftehe einging und Schiller nach wie vor innig liebte. Charlotte blieb „Lottchen“ oder „Lolo“, ihre kleine, um drei Jahre jüngere Schwester, für die sie mitdachte, mithandelte und der sie sich intellektuell überlegen fühlte.
In ihrer Lebensbeschreibung Schillers hat Caroline von Wolzogen „an jenen Briefen Schillers das unschuldigste und liebenswürdigste Falsum begangen, das wohl je in der Literatur begangen worden ist. Man wird in den Briefen an die beiden Schwestern das psychologische Problem finden, im Reiche der Geister das durchzuführen, was die Volkssage vom Ehebett des Grafen Gleichen erzählt“, schreibt Karl von Hase, Professor der Theologie in Jena, als Herausgeber ihres „Literarischen Nachlasses“. Ihre Schiller-Biografie beruht zwar auf authentischen Materialien, Caroline hat sich jedoch das Recht vorbehalten, die Dokumente in ihrem Sinne zu bearbeiten. Als Charlottes Schwester hatte sie nach deren Tod einen direkten Zugang zu Schillers Nachlass. Darüber hinaus hatte sie Freunde und Familienangehörige gebeten, ihr Materialien für ihr Buch zu überlassen. Die meisten waren ihrem Wunsch bereitwillig nachgekommen.
Geduldig trug sie die Lebenszeugnisse zusammen, ordnete Briefe, Notizen und längere Ausführungen den einzelnen Phasen von Schillers Leben zu und teilte ihr Buch in entsprechende Kapitel ein. Etwa die Hälfte machen Schillers Briefe an unterschiedliche Empfänger in verschiedenen Lebensabschnitten aus. Die Briefe allerdings, die vor und während der Verlobungszeit zwischen Schiller und den Schwestern gewechselt wurden, redigierte sie, indem sie kurzerhand aus „Meine Liebsten“ oder „Liebste Caroline“ – „Theure Lotte“ machte. Aus der Anrede „Ihr“ und Eure“ wurde konsequent „Du“, „Deine“ etc. Briefe, die ursprünglich für Caroline gedacht waren und kompromittierende Stellen enthielten, da manches zu intim wirkte, widmete sie um und gab Charlotte als Adressatin an. Wenn sie dennoch einmal Briefe in ihren Band aufnahm, die sich an beide Schwestern wandten, führte sie als Begründung an: „Da er wusste, dass meine Schwester mir alles mitteilte, so sind die folgenden Briefe an uns Beide gerichtet.“
Die Aufmerksamkeit ihrer Leser lenkt Caroline von Wolzogen von Anfang an sehr bewusst darauf, dass nur ihre kleine Schwester Ziel von Schillers erotischem Begehren war. Sie biegt die Vergangenheit so zurecht, wie es in das prüde Weltbild ihrer Gegenwart als Frau von über sechzig Jahren – und ihres Lesepublikums – passt. So möchte sie gesehen werden, als empfindsame, hochgebildete Freundin, die als rührend besorgte große Schwester selbstlos alles für das Eheglück der Jüngeren tat. Aus einigen ihrer überleitenden Kommentare spricht eine peinlich anmutende Selbstgerechtigkeit. Zum Beispiel interpretiert sie Schillers Zusammentreffen mit ihrer Familie in dem Sinne, dass der Dichter dadurch erst geformt, mit anderen Worten, veredelt worden sei: „Ein glückliches Geschick führte unseren Freund bald zur Wahrheit, zu besseren Naturen in der Frauenwelt“ – ein deutlicher Hieb gegen Charlotte von Kalb, die Carolines Schwester eine Eifersuchtsszene machte, als sie von der geplanten Heirat hörte. Als Caroline von Wolzogen an ihrem Buch arbeitete, waren Moral und Prüderie an die Stelle der nun als frivol empfundenen Leichtigkeit ihrer Jugend getreten. Hinzu kam, dass sie pietistisch angehaucht war, seit sie ihren Mann durch den Tod und – härter noch – ihren einzigen Sohn bei einem vermeintlichen Jagdunfall verloren hatte.
Für die Kindheit und Jugendzeit waren es Aufzeichnungen ihrer Schwester und Tagebuchnotizen von Christophine, Schillers Schwester, mit der sie, wie sie schreibt, eine enge Freundschaft verband. Hier wird eine idyllische Kindheit rekonstruiert, die so sorglos und heiter nicht gewesen sein kann: Die Mutter wird als fürsorglich und anspruchslos geschildert und Schiller als Kind schon genial und erpicht darauf, alles, was der Vater abends im Familienkreis vorlas, rasch zu memorieren. Man gewinnt den Eindruck, als habe sie Schillers Kindheit mit einem Zuckerguss der Harmonie überzogen. Sehr sachlich wirken die Berichte Friedrich von Hovens, Altersgenosse Schillers und Medizinalrat, der von der abenteuerlichen Leidenszeit an der Karlsschule – mit Augenmaß und ohne Übertreibungen – erzählt. Passagen aus Körners Einleitung zu seiner Ausgabe von Schillers Sämtlichen Werken bilden, wie oben erwähnt, einen weiteren Teil des Buches, außerdem sind unter anderem Briefe Wielands und Kants an Schiller eingeflochten.
Caroline war eine Meisterin im Harmonisieren und im Schönreden der härtesten Tatsachen. Sie wollte Klarheit bringen und trug dennoch zur weiteren Legendenbildung bei. Ihre Kommentare zeigen, dass sie im Grunde genommen ähnlich wie Dannecker auf eine Apotheose Schillers zusteuerte. Indem sie Schiller – wie der Bildhauer – auf ein Podest des Erhabenen, Verehrungswürdigen stellt, fern von den Niederungen des Alltäglichen, leistet auch sie dem Kult um ihren Schwager Vorschub.
Gegenüber dem Schwulst, den man bei ihren Zeitgenossen, vor allem aber auch bei späteren Biografen findet, wirkt ihr Stil jedoch zum größten Teil sogar sachlich, auch wenn sie manchmal allzu großzügig mit schmückenden Adjektiven umgeht. Erschreckend blumig drückt sie sich aus, wenn sie Schillers Äußeres beschreibt: „Der Blick unter den hervorstechenden Stirnknochen und den blonden, ziemlich starken Augenbrauen warf, nur selten und im Gespräch belebt, Lichtfunken ...“ Stellt man sich dieses Bild plastisch vor, fragt man sich unwillkürlich, wessen Blicke, ganz allgemein gesehen, „Lichtfunken“ werfen könnten; doch nur jene eines Heiligen!
Alles, was es an Schiller zu preisen gibt, wird in wohlgesetzten, sorgsam abgewogenen Worten gepriesen. Beispielsweise sagt sie: „Das Kantische Moralgesetz, jeden Menschen als Zweck, nie als Mittel zu betrachten, war der Anspruch seiner eigenen Natur“, oder: „Er stand unter der Herrschaft seines Geistes, der nur das Gesetz der Wahrheit und Schönheit anerkannte.“ Hat Caroline von Wolzogen Schiller wirklich nicht verstanden? Hat sie nicht erkannt, dass dem Edlen und Erhabenen grausame Schattenseiten gegenüberstehen, die Schiller durchaus zur Sprache brachte? Auch persönliche Schwachstellen werden nicht genannt, und wenn, dann höchstens als zu vernachlässigende Kleinigkeiten. Karl von Hase kommentiert das wiederum treffend: „Denn Frau von Wolzogen in der milden, alle Spitzen umbiegenden Weise ihres Charakters oder ihres Alters hat diejenigen Stellen ausgelassen, in denen die scharfen, steilen Kanten von Schillers Charakter oder Urteil hervortreten.“
Trotz der charmanten kleinen Inkorrektheiten und ihrer redigierenden oder moralisierenden Eingriffe, auch trotz ihrer starken Tendenz zum Harmonisieren bleibt sie im Vergleich zu allen anderen Biografen vor ihr in der Beschreibung der Lebenslinien Schillers genau. Ihr Buch stieß anfangs auf ein wohlwollendes Echo beim Publikum und bei der Kritik und wurde dann, mit dem wachsenden Nachruhm Schillers, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt populärer, schließlich in vielen Familien zum Hausbuch und erlebte seine letzten regulären Auflagen 1903 und 1905. Einen Nachdruck gab es noch einmal 1940, bis „Schillers Leben“ – nun eher zu Forschungszwecken – mit einem außerordentlich informativen Nachwort von Peter Boerner 1990 als Faksimile herausgegeben wurde.