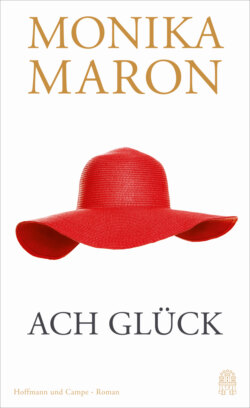Читать книгу Ach Glück - Monika Maron - Страница 5
ОглавлениеEr fuhr vom Flughafen stadteinwärts, nicht über die Autobahn, er misstraute der Autobahn, vor allem im Berufsverkehr, und es war zwischen acht und neun Uhr am Morgen. In der Güntzelstraße, kurz bevor er in die Nassauische hätte einbiegen müssen, sah er auf die Uhr, es war fünf Minuten vor neun, um neun Uhr, glaubte er sich zu erinnern, öffnete das »Einstein«, und er fuhr weiter. Das Café war noch leer und von morgendlicher Neutralität. Noch kämpften keine schneidenden, klirrenden, sägenden, dröhnenden, polternden Stimmen um die durchdringenden Frequenzen, kein Zigarettenrauch trübte den Blick in den Garten, wo ein paar Spatzen durch die noch kahlen Äste der Bäume tobten. Er bestellte einen großen Milchkaffee und ein Stück Mohnkuchen, wählte unter den Zeitungen, die in sperrigen Holzklammern an einem Ständer hingen, eine überregionale und eine Berliner Zeitung, legte sie neben sich und schloss für einen Moment die Augen. Er kam sich seltsam vor in diesem großen leeren Raum, ein bisschen deplatziert, er fühlte sich wie jemand, der spielte, dass er allein frühstücken ging, aber es gefiel ihm. Johanna saß in einem Flugzeug nach Mexiko und er in einem Café bei Mohnkuchen und Milchkaffee. Für einen Monat, hat sie gesagt, vielleicht auch ein oder zwei Wochen länger. Bis gestern Abend hatte er sich nicht vorstellen können, dass sie wirklich abfliegen würde, verschwinden auf unbestimmte Zeit. Er hat gesehen, wie sie die große Reisetasche aus der Kammer gezerrt und ihre Kleider gepackt hat, darunter auch warme Kleidungsstücke, obwohl in Mexiko im April sommerliche Temperaturen herrschten. Aber an den Abenden sei es kalt, hat sie gesagt und ihn dabei mit einem jener merkwürdigen Blicke bedacht, die er seit einiger Zeit schon an ihr bemerkt hatte und die er, obwohl sie ein diffuses Unbehagen in ihm hinterließen, nicht versucht hatte zu ergründen, jedenfalls nicht ernsthaft genug, wie sich nun herausstellte; ein ruhiger, abwartender, zugleich herausfordernder Blick. Nachträglich glaubte er, ihn zum ersten Mal wahrgenommen zu haben, als sie den Hund anbrachte und mitteilte, dass er nun bleiben werde. Was mit dem Hund denn werden solle, hatte er gefragt. Ich glaube, er bleibt, hatte sie gesagt und dabei mit diesem Blick die Unentschlossenheit ihrer Formulierung eindringlich dementiert. Auch als sie ihm eröffnete, sie würde demnächst in der Galerie dieses Russen arbeiten, hatte sie ihn angesehen, als wartete sie auf seinen Widerspruch, nur um zu erklären, warum er ihr gleichgültig war und an ihren Plänen nichts, gar nichts ändern würde. Sogar zuletzt, als sie sich noch einmal umdrehte, ehe sie im schmalen Durchgang zur Sicherheitskontrolle verschwand, hat sie ihn noch einmal so angesehen: Was sagst du nun, hieß dieser Blick; triumphierend, ein bisschen traurig vielleicht auch.
Aber eigentlich, dachte er, eigentlich hat alles mit dem Hund angefangen.
Ich glaube, er bleibt; das war eine Kampfansage, das wusste er jetzt. Inzwischen hatte der Kampf stattgefunden. Aber woher hätte er damals wissen sollen, dass Johanna ihm den Krieg erklärte, einen stillen Krieg, Johannas Krieg eben, aber Krieg, den er verloren hatte, ohne an ihm teilzunehmen. Er wollte den Hund nicht, aber er hat nichts gegen ihn unternommen. Er hat ihn nicht vergiftet, nicht geschlagen oder getreten. Er hat ihn geduldet, sogar gefüttert und durch die Straßen geführt, wenn Johanna darum bat. Und wenn er ihm eins seiner zerfetzten und eingespeichelten Spielzeuge aufs Knie legte, hat er es ihm in eine Zimmerecke geworfen. Dem Hund war es gleichgültig, ob er es gern tat oder angewidert war. Nein, nicht der Hund, Johanna war gekränkt, wenn er seinen Ekel vor den vollgesabberten Gummibällen und Plüschbären nicht ausreichend verbarg und nicht voller Entzücken zusah, wie der Hund seine Jagdgelüste dem Parkett einschrammte. Er hatte sich darüber keine Gedanken gemacht, damals; sie hat ihren Hund, dachte er, und ich habe das Recht, ihn nicht zu mögen. Dabei mochte er ihn sogar, jedenfalls später. Als Hund mochte er ihn, wogegen Johanna ein höheres Wesen in ihm sah, nicht einen Menschen, dafür war sie zu intelligent und hatte zu viel Geschmack, aber ein Wesen, das von Natur aus recht hatte, mit göttlicher Kompetenz ausgestattet. Sie bewunderte ihn, sie betete ihn an; das war vielleicht übertrieben, aber nicht maßlos. Er hatte gehofft, Johannas Verzückung würde sich allmählich legen, wenn der Hund erst einmal alltäglich geworden sein würde, so alltäglich wie alles andere in ihrem Leben, die Arbeit, ihre Tochter, er selbst. Damals, als Laura geboren wurde, war Johanna auch für ein Jahr in ihrer Mutterschaft versunken. Ein Jahr lang hatten sie über nichts anderes gesprochen als Lauras Trink- und Essgewohnheiten, Lauras Lallen, Lächeln, über ihre Zähne, die zu früh oder zu spät kamen, nichts auf der Welt konnte wichtiger sein als Lauras Verdauung. Damals hat er befürchtet, die Frau, die er geheiratet hatte, würde nie wieder auftauchen aus den Wonnen ihrer natürlichen Bestimmung und er würde für immer ein Fremder bleiben für dieses symbiotische Wesen aus Mutter und Kind. Aber nachdem Johanna sich allmählich davon überzeugt hatte, dass Laura auch dann wuchs und atmete, wenn sie ihr nicht ständig dabei zusah, kam sie selbst wieder zum Vorschein, obwohl Achims Mutmaßung, von etwas Bestimmtem, das die beiden verband, ausgeschlossen zu bleiben, sich bestätigte. Vielleicht wäre es mit einem Jungen anders gewesen, aber Laura war nun einmal ein Mädchen.
Jedenfalls glaubte er, dass Johanna aus ihrem Hundewahn erwachen würde wie damals aus ihrem Mutterschaftsrausch, und wartete ab. Aber während Johannas Verhalten nach Lauras Geburt von Hormonen beherrscht wurde, entschied sie über ihren Umgang mit dem Hund selbst, und somit konnte er nicht hoffen, dass die Sache sich allein durch gesetzmäßige Abläufe in Johannas Körper erledigen würde. Es hatte sich auch nicht erledigt, gar nichts hatte sich erledigt. Johanna flog nach Mexiko, derweil er bei Milchkaffee und Mohnkuchen im Café saß.
Während Achim darauf gewartet hatte, dass der Hund sein göttliches Wesen verlieren und sich auch in Johannas Augen wieder in einen Hund verwandeln würde, braute sich hinter seinem Rücken etwas zusammen. Nein, nicht hinter seinem Rücken, eigentlich vor seinen Augen. Und was er nicht sehen konnte, erzählte ihm Johanna, absonderliche Geschichten von den nächtlichen Spaziergängen, die sie mit dem Hund unternahm, oder aus der Galerie, in der sie tagelang mitsamt dem Hund saß und nichts tat, oder von der verrückten alten Russin, die sich eines Tages aufgemacht hatte, um in Mexiko nach einer anderen Verrückten zu suchen. Und immer hängte sie ihren Erzählungen diesen Blick an, dieses: Was sagst du nun? Er wusste nicht mehr, was er damals über diesen Blick gedacht hat, er konnte sich nicht einmal genau erinnern, ab wann er ihm aufgefallen war. Inzwischen kam es ihm vor, als hätte sie ihn das ganze letzte Jahr oder sogar noch länger so angesehen; wenn er sich ihr Gesicht vorstellte, dann nur so, mit diesem Blick, nicht erwartungsvoll, das nicht, eher abwartend oder gespannt und geduldig wie jemand, der einen Countdown zählt: five, four, three, two, one, zero. Und während all dieser Zeit lag der Hund, schwarz und kleinstmöglich zusammengerollt, fast unsichtbar auf dem schwarzen Ledersofa wie ein hundgewordener Flaschengeist oder Alien, was schließlich nichts anderes war als ein moderner Flaschengeist, lag schwarz auf dem schwarzen Ledersofa, öffnete nur ab und zu die Augen, sodass das Weiße darin aufleuchtete, um das Ausmaß der Verwirrung zu kontrollieren, die er angezettelt hatte. Nein, nein, nein, der Hund war ein Hund, kein Gott, kein Flaschengeist, kein Alien, sondern nichts als ein Hund, ein über Jahrtausende domestizierter Wolf, vielleicht sogar der beste Freund des Menschen, aber ein Hund. Trotzdem hat mit diesem Hund alles angefangen. Im Frühjahr hatte Johanna mit ihren Nachtwanderungen begonnen. Wenigstens zweimal in der Woche zog sie kurz vor Mitternacht mit dem Hund los und kam erst nach zwei, manchmal sogar drei Stunden wieder.
Früher, sagte Johanna, sehr viel früher, als sie ihn noch nicht gekannt und Laura noch nicht geboren hatte, als sie noch kein Auto hatte und kein Geld für Taxen, als sie noch bei ihren Eltern wohnte und später in dieser Bruchbude in der Metzer Straße, früher sei sie oft allein durch die Stadt gezogen, wenn sie von einem Fest kam oder mitten in der Nacht jemanden besuchen wollte, der dann aber nicht zu Hause war. Sie erinnere sich genau an das triumphale Gefühl, in das die tiefstille, menschenverlassene Stadt sie hatte versetzen können, wenn sie sich vorgestellt hatte, alle Menschen wären gestorben oder geflohen und alle Häuser und Straßen gehörten nun ihr; sie, Johanna, hätte die Stadt erobert, kampflos, durch bloßes Dasein, weil irgendein Spuk, der alle anderen dahingerafft hatte, sie nicht betraf. Die Stadt gehörte ihr, ihr allein. Sie könne nicht mehr sagen, ob sie sich damals wirklich nicht gefürchtet oder ob die Angst dazugehört hatte, weil sie erobert werden musste wie die Einsamkeit. Wer einsam war und für seine Angst ganz allein zuständig, war erwachsen. Später, als ihr Erwachsensein nicht mehr angezweifelt werden konnte, hätte sie ihre Kampfansage an die Stadt wohl zurückgezogen. Einsame nächtliche Wege hätte sie nur noch auf sich genommen, wenn sie unvermeidlich waren, und erleuchtete Fenster hätten sie eher beruhigt, als dass sie dahinter überlebende Feinde imaginiert hätte.
Er fand ihre Erzählung reichlich pathetisch; eine Zeile von Kleist aus dieser dröhnenden Germania-Ode fiel ihm ein: … nicht der Mond, der, in den Städten, / aus den öden Fenstern blinkt …
Dabei, sagte Johanna, und das merke sie erst jetzt, hätten ihr diese Spaziergänge in all den Jahren gefehlt, ohne dass sie es genau so hätte sagen können: Mir fehlen die nächtlichen Spaziergänge, aber die Empfindungen, die sie in ihr auslösten, habe sie vermisst, einen gewissen hochmütigen Abstand zur Welt, wenn fast alle Menschen sich wie die Tiere in ihre Höhlen zurückgezogen hätten und schliefen oder ihren Geschlechtstrieb auslebten, wenn die Stadt so stumm und farblos sei, dass sie sich einbilden konnte, sie lasse sich neu erfinden, und wenn die Straßen sich wie Skelettknochen vor ihr ausbreiteten würden, ohne Fleisch und Blut, fühle sie einfach anders, unabhängiger, kühler. Und diese wiedergewonnene Freiheit, sagte Johanna, verdanke sie nur dem Hund.
Ihr Blick, den sie dem Satz anfügte wie ein Frage- oder Ausrufungszeichen, verlangte nach einer Antwort und ließ gleichermaßen keine zu. Dem Hund verdankte sie also die Freiheit, zu der er ihr nicht verhalf, weil er nachts nicht mit ihr spazieren gehen wollte, sondern lieber am Schreibtisch saß, der Welt den Rücken zugewandt, wie Johanna meinte. Er hielt ihren unausgesprochenen Vorwurf für unlogisch, denn in seiner Begleitung wäre sie nicht allein gewesen, sodass sie sich ihren erhabenen Einsamkeitsphantasien gar nicht hätte hingeben können.
Allerdings hat er damals, nachdem er sich mit der Anwesenheit des Hundes einmal abgefunden hatte, wenig Gedanken verwendet auf Johannas neue Gewohnheiten. Er nahm nur dankbar zur Kenntnis, wie allmählich die Unzufriedenheit, ja, Misslaunigkeit von ihr abfiel, die in der letzten Zeit zu ihrem auffälligsten Wesensmerkmal geworden war und die Achim ihrem schwierigen Alter zugeschrieben hatte. Plötzlich hörte er sie wieder aus dem Hintergrund der Wohnung lachen, unvermittelt und übermütig, wie früher, wenn sie mit Elli oder einer anderen Freundin, manchmal auch mit Laura, telefonierte und wovon zuletzt nur ein Raunen und Wispern geblieben war, das in ihm immer den Verdacht genährt hatte, es gelte ihm; er solle nicht hören, was da gesprochen wurde, weil er der Gegenstand des Geraunes war, auf jeden Fall als Mitwisser unerwünscht. Sobald er in Johannas Nähe kam, verließ sie, als wollte sie ihn mit ihrem Gerede nicht stören, den Raum und wanderte mit dem Telefon durch die Wohnung.
Mit dem Hund lachte Johanna wieder, sie gurrte und scherzte, rief laut: Bravo, Bredow! und klatschte in die Hände, wenn der Hund irgendeine Intelligenzaufgabe, die Johanna sich ausgedacht hatte, gelöst oder ein neues Wort gelernt hatte. Nichts erheiterte sie mehr als der Hund. Wochenlang las sie nur Bücher über Hunde. Sie warf die Kunstbände aus ihrem Bücherregal und ersetzte sie durch eine Hunde-Bibliothek. Die Kunstbände stellte sie mit der Bitte, sie irgendwie unterzubringen, in sein Zimmer. Abends, wenn Johanna auf dem Sofa lag und las oder einen dieser Serienkrimis sah, was sie seit einiger Zeit häufig tat, rollte sich der Hund in ihre Kniekehlen und legte seine feuchte Schnauze auf ihren Oberschenkel. Als Achim einmal bemerkte, er halte das Verhältnis zwischen dem Hund und ihr für obszön, sagte Johanna, das liege an ihm, weil er glaube, der Hund sei ein Mann. Der Hund sei aber kein Mann, sondern, wenn er ihn überhaupt mit einem Menschen vergleichen wolle, ein Kind; und an einem Kind in ihren Kniekehlen sei absolut nichts obszön.
In Achims Augen blieb der Hund in Johannas Kniekehlen obszön. Er vermied es hinzusehen, wenn er an dem schwarzverknäulten Paar vorbei an das Bücherregal gehen musste oder eine Zeitung suchte. Er konnte sich an diesen Anblick nicht gewöhnen, im Gegenteil, sein Widerwillen steigerte sich zum Ekel, insbesondere wenn der Hund, die Hinterbeine weit gespreizt, sich auf dem Rücken wälzte, seine schwarzbehaarten Geschlechtsteile animalisch ungeniert darbot und Johanna ihm die vorgereckte Brust kraulte, während der Hund gurgelnde, orgiastische Geräusche ausstieß und dabei seinen Rachen krokodilsgleich aufriss, sodass man den gekerbten graphitschwarzen Gaumen sehen konnte.
Er schob die letzten Krümel des Mohnkuchens mit dem Zeigefinger auf den Löffel, überlegte, ob er einen zweiten bestellen sollte oder vielleicht lieber Spiegeleier wie die karamellhäutige Schönheit vom Tisch gegenüber, die so anmutig die kleinen Eiweißläppchen zwischen ihre rosigen Lippen schob, als würde sie dabei für eine Hühnerei-Reklame gefilmt. Er entschied sich für Spiegelei mit Toast und einen zweiten Milchkaffee, griff nach der lokalen Zeitung, setzte aber die Brille nicht auf, sodass er nur die Überschriften lesen konnte, die nicht mehr sagten, als er schon wusste: Die Opposition blockierte die Reform, und die Friedensbemühungen im Nahen Osten versprachen immer noch keinen Erfolg. Die Schönheit vom Tisch gegenüber beschäftigte sich misslaunig mit ihrem Telefon. Vermutlich hatte jemand sie versetzt oder verspätete sich. Er fragte sich, ob sie sich, für den Fall, dass er sich darum bemühen würde, für ihn interessieren könnte. Sie war höchstens fünfunddreißig, wahrscheinlich jünger. Johanna verachtete Männer, deren sexuelle Leidenschaft sich nur noch an der Generation ihrer Töchter entzünden konnte, sie hielt sie für Verräter mit inzestuösen Phantasien. Sobald sie von einem fünfzigjährigen Mann hörte, der seine fünfzigjährige Frau verlassen hatte, um mit einer Dreißigjährigen ein Kind zu zeugen, zählte sie die Namen einiger ihrer Freundinnen auf, die sie samt und sonders für klug und schön erklärte und die alle, seit sie die Fünfzig überschritten hätten, meistens aber schon früher, allein lebten, weil sie in den Augen gleichaltriger Männer auf den erotischen Abfallhaufen gehörten. Eine wortgleiche Suada, seit Jahren, nur der Ton, in dem Johanna sie vortrug, war mit der Zeit schärfer geworden, als hätte Achim sie verlassen oder als erwartete sie, dass er sie verlassen würde. Manchmal gab er ihr recht, manchmal schwieg er, manchmal wiegelte er ab, was insofern gleichgültig war, als Johannas Empörung durch seine Antworten vollkommen unbeeinflusst blieb. Einmal, sie hatten schon den Hund, einmal sagte sie, ohne Achim anzusehen, weil sie gerade Geschirr in den Schrank stellte: Es geht um Liebe. Er wusste nicht mehr, ob er ihr darauf etwas geantwortet hat. Und hätte sie diese vier Worte nicht wiederholt, wohl weil sie glaubte, sie seien im Geklapper des Porzellans untergegangen, wäre ihm die Situation wahrscheinlich gar nicht im Gedächtnis geblieben. Es geht um Liebe; dieser dürftige Satz, durch die Wiederholung mit Pathos aufgeladen, ließ eine Antwort auch nicht zu, so wenig wie eine allgemeine Klage über den Tod oder das Alter eine Antwort zugelassen hätte. Vielleicht hatte er auch etwas geantwortet: Natürlich um Liebe, was sonst, wird er vielleicht gesagt haben; oder etwas Ähnliches. Seit fast dreißig Jahren war er mit Johanna verheiratet. Die Zeit, in der Gedanken an Trennung zwischen ihnen eine Rolle gespielt hatten, lag gewiss fünfzehn oder sogar zwanzig Jahre zurück. Es geht um Liebe. Was war das anderes als Liebe. Er konnte in Johanna immer noch das Mädchen erkennen, als das er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Sie war schon fünfundzwanzig und sah aus wie ein ernstes Kind, was in reizendem Widerspruch zu ihrer Verkleidung stand. Sie trug ein lose gestricktes, sehr enges, bis zum Brustansatz ausgeschnittenes graues Kleid, das gleichermaßen altmodisch und frivol wirkte, dazu einen großen, mit Blumen dekorierten Hut und schwarze Schnürstiefel. Das war beim Fasching in der Kunsthochschule. Johanna lehnte, geschützt vor der sich wild durch Gänge und Treppenhaus wälzenden Menschenmasse, in einer Fensternische, als suchte oder erwartete sie jemanden. Er lebte erst seit ein paar Monaten in Berlin, wo er eine Doktorandenstelle an der Humboldt-Universität erjagt hatte, und kannte außer seinen Kollegen kaum jemanden. Die Karte für den Fasching hatte ihm ein Romanist verkauft, von dem er später erfuhr, dass er schwul war. Johanna studierte Germanistik, und er musste ihr eigentlich schon im Institut begegnet sein, hatte sie aber anscheinend übersehen, anderenfalls hätte er ihr Lächeln nicht als Aufforderung verstanden, sie anzusprechen, und das ganze Leben wäre vielleicht anders verlaufen. Er war damals verlobt mit Sabine, die wie er aus Stralsund stammte, auch in Greifswald studiert hatte und zu der Zeit als Assistenzärztin in Pasewalk arbeitete. Johanna wohnte mit einem Jörg in einer Ladenwohnung im Prenzlauer Berg. Er entlobte sich von Sabine, Johanna fand eine baupolizeilich gesperrte Mansarde mit Außenklo, in die sie gemeinsam einzogen, ein Zimmer, Kammer und Küche. Ein halbes Jahr später machte Johanna das Examen, ein Jahr danach heirateten sie, und noch ein Jahr später wurde Laura geboren.
An Bilder dieser Zeit erinnerte er sich genau, Johanna in ihrem engen, vom Knie abwärts glockig fallenden Strickkleid, das roséfarbene, mit Kirschen gemischte Blumenbüschel an ihrem schwarzen Hut; oder Johanna, die fast körperlos unter einem viel zu weiten Pullover, eine Zigarette zwischen den Fingern, am weißen Kachelofen in der Mansarde lehnt. Die Bilder sah er deutlich; von den Gefühlen wusste er nur. Er hätte sie benennen können, so wie er von einem vergangenen Schmerz sagen konnte, dass er stechend, erträglich oder überwältigend gewesen war. Aber er konnte sie nicht nachfühlen, er wusste nicht einmal zu sagen, ob sie stärker oder schwächer waren als spätere Gefühle. Er wusste aber, dass er, seit er Johanna kannte, sich in Berlin heimisch fühlte und sich nichts anderes vorstellen wollte als ein Leben mit Johanna und dass er, wenn auch nicht ohne Skrupel, zu unvermuteter Grausamkeit gegenüber Sabine imstande war.
Es geht um Liebe. Natürlich, von Anfang an ging es um Liebe. Und plötzlich sprach Johanna von Liebe wie von einer Schwangerschaft, die er, ein Mann, niemals nachempfinden könne. Vielleicht hat es gar nicht mit dem Hund angefangen, sondern mit diesem Russen, von dem er überhaupt nicht wusste, dass sie ihn kannte; bis zu der Silvesterfeier bei Karoline Winter. Er war überrascht, dass Johanna bei Karoline feiern wollte und nicht, wie in jedem Jahr, bei Barbara und Richard. Dieses kollektive Altern deprimiere sie, sagte sie, jedes Jahr die gleichen Gesichter, nur ein bisschen faltiger. Beim letzten Mal sei nur über berufliche Abstiege, Krankheiten, Todesfälle und zu erwartende Todesfälle gesprochen worden. Bestenfalls werde die Geburt einiger Enkelkinder vermeldet. Nicht einmal Scheidungskatastrophen gäben noch interessanten Gesprächsstoff her, weil sogar diese Gefahren schon hinter ihnen lägen.
Karoline wohnte in einem dieser Charlottenburger Wohnpaläste, sechs oder sieben Zimmer, erlesen möbliert, an den Wänden ihre eigenen, aber auch fremde Bilder, geerbt oder mit Kunstverstand gesammelt. An der Tür nahm ihnen ein Mädchen die Mäntel ab. Aus den Zimmern drang wildes Stimmengewirr. Eine Weile standen sie unschlüssig im Flur, Johanna zupfte an ihrem Kleid, das sie eigens für ihren Auftritt bei Karoline gekauft hatte. Am Tag zuvor hatte sie wenigstens eine Stunde damit zugebracht, ihre Robe für diesen Abend auszuwählen, und am Ende entschieden, dass keines ihrer Kleidungsstücke den Ansprüchen einer Silvesterfeier bei Karoline standhielt. Umso weniger verstand er, warum es sie in eine Gesellschaft drängte, für die sie nicht einmal ein passendes Kleid besaß. Endlich stürzte Karoline in den Flur, umarmte Achim, küsste Johanna und sagte: Igor hat schon nach dir gefragt.
Wer ist Igor, flüsterte er Johanna ins Ohr, und Johanna antwortete laut: Der Wiedergänger von Majakowski, habe ich dir doch erzählt. Er wusste genau, dass sie den Namen bis dahin nie erwähnt hatte und er ihn in dieser Minute zum ersten Mal von ihr hörte. Ehe er noch etwas fragen konnte, stand Igor schon zwischen ihnen, küsste Johanna die Hand und drückte Achims; unverkennbar Majakowskis Wiedergänger, kahler Schädel, weißes Hemd, schwarze Weste und sicher ein Meter neunzig groß.
Igor ist Galerist, für moderne russische Kunst, ein Freund von Karoline und der arroganteste Russe, den ich kenne, sagte Johanna.
Vor allem, sagte Igor, bin ich ein Bewunderer Ihrer Frau, die mich mitten in der norddeutschen Wildnis von meinem slawischen Barbarentum kurieren wollte.
Wenn er sich die Szene heute ins Gedächtnis rief, sah er, dass Johanna errötete. Schon wenn Igor ihr die Hand küsste, überzog ein rosiger Schatten ihr Gesicht. Damals hatte er das nicht bemerkt, aber inzwischen hielt er es für unmöglich, dass sie nicht errötet war. Falls er an diesem Abend schon geahnt haben sollte, dass sie nur dieses Russen wegen bei Karoline Silvester feiern mussten und Johanna nur seinetwegen ein neues Kleid brauchte, hatte er es nicht bis in sein Bewusstsein dringen lassen. Er wusste nicht, warum Johanna sie in diese Ansammlung fremder Menschen geschleppt hatte. Er kannte fast niemanden, höchstens fünf oder sechs Gesichter glaubte er auf einem von Karolines ländlichen Sommerfesten schon gesehen zu haben, ohne sie aber einer Person zuordnen zu können. Der Russe und Johanna waren in dem Menschengewühl untergetaucht, er widmete sich den Bildern an den Wänden und kam darüber mit einem Mann ins Gespräch, der sich als Kurator eines Museums in Braunschweig oder Hannover vorstellte. Entweder fühlte er sich ähnlich fremd oder konnte nur schlecht stehen, jedenfalls schlug er Achim vor, in einem abgelegenen Zimmer nach einer Sitzgelegenheit zu suchen, um ungestört über Malerei und andere Belange der Kunst zu plaudern. Er sei kein Mann für große Gesellschaften, sagte er, und er habe den Eindruck, es gehe Achim ähnlich. Sein Name war Müller-Blume, und eigentlich war er seit zwei Jahren schon nicht mehr Kurator, sondern Pensionär und schrieb nun, teils aus Leidenschaft, teils aus Gewohnheit, Aufsätze für Fachzeitschriften und hielt Vorträge, wo immer man ihn darum bat. Sie saßen in einem kleinen, sparsam eingerichteten Raum, der offenbar als Gästezimmer diente, Müller-Blume in einem Lehnstuhl, Achim auf dem Bett. Achim zündete sich eine Pfeife an. Er habe sich das Rauchen schon vor fünf Jahren abgewöhnt; das Herz, sagte Müller-Blume. Er war ein nicht sehr großer, stämmiger, aber nicht dicker Mann mit einem fast femininen Gesicht, die weichen Wangen von bläulichen Äderchen durchzogen, das weiße Haar korrekt gescheitelt.
Ja, so ist das, sagte er, da glaubt man, die Welt könnte Rembrandt oder Picasso vergessen, wenn man nicht tagtäglich als Diener der Kunst dagegen ankämpft, und dann stellt sich heraus, dass es ohne einen genauso gut geht, vielleicht sogar besser. Aber man trabt weiter wie ein alter Gaul. Ein anderes Leben habe ich nicht gelernt. Früher, als Studenten, haben wir nächtelang in Gasthäusern gesessen. Ich wüsste nicht einmal mehr, mit wem ich jetzt noch dahin gehen sollte, die einen sind tot, die anderen krank, den Rest hat man aus den Augen verloren.
Die ganze Zeit lächelte er, resigniert oder verlegen, als müsse er sich entschuldigen für so intime Mitteilungen.
Freundschaft, sagte er, Freundschaft ist wichtig, vielleicht das Wichtigste. Aber das versteht man erst, wenn es zu spät ist. Ich jedenfalls habe es erst verstanden, als es zu spät war. Vermutlich hätte sich auch Ihr Kleist nicht umbringen müssen, wenn er einen Freund gehabt hätte. Haben Sie Freunde?
Ja. Ja, ich habe Freunde, sagte Achim, ohne zu überlegen.
Und jetzt, noch nicht einmal vier Monate später, könnte er diese Frage nicht mehr beantworten. Vielleicht hatte er Freunde, vielleicht war Richard sein Freund. Sie hatten Freunde, Johanna und er. Ob er auch ohne Johanna Freunde hätte, jedenfalls in dem Sinne, der Müller-Blume wohl vorschwebte, erschien ihm zweifelhaft.
Müller-Blume nahm einen kräftigen Schluck von seinem Rotwein, wobei ein Tropfen in der tiefen Falte neben seinem rechten Mundwinkel versickerte und eine dünne, krustige Spur hinterließ. Er gab ein kleines schmatzendes »Tja« von sich, ein Seufzer oder der verzagte Auftakt einer Mitteilung. Es ist schon seltsam, sagte er, wie das Leben uns täuscht, indem es uns in die Gespinste unseres Ehrgeizes verstrickt und uns erst, wenn das Spiel vorbei ist, erkennen lässt, dass es darum gar nicht ging.
Achim war in den letzten Minuten des alten Jahres nicht nach den späten Lebenseinsichten eines enttäuschten Kunstbeamten zumute, er verweigerte die Frage, worum es denn in Wahrheit gehe, und schlug stattdessen vor, sich wieder unter die übrige Gesellschaft zu mischen, zumal seine Frau ihn sicher schon vermissen würde.
Unter den Gästen breitete sich die alljährliche, fünfzehn Minuten vor zwölf einsetzende Nervosität aus. Die Sektgläser wurden abgezählt und bereitgestellt, Flaschen geöffnet, auf dem Balkon steckten einige Männer Raketen in leere Weinflaschen, das Radio wurde angeschaltet, um den entscheidenden Glockenschlag nicht zu verpassen, Paare suchten einander, eine Frau in einer rotseidenen Jacke verteilte Wunderkerzen. Müller-Blume blieb an Achims Seite und räsonierte über die unsinnige Freude an der Vergänglichkeit. Den kahlen Schädel des Russen entdeckte Achim zuerst, Johanna stand dicht neben ihm in der Nähe der Balkontür, vor der sich schon die Pyromanen drängten.
Hatte er damals wirklich gesehen, was er jetzt sah? Hatte er wirklich gesehen, dass Igor seinen Arm um Johannas Schulter legte? Er hatte die Brille nicht auf, vielleicht hatte Igor sich mit dem Arm auch nur gegen den Türrahmen gestützt. Was aber, gesetzt den Fall, Igor hatte seinen Arm wirklich um Johanna gelegt, hatte er bei diesem Anblick gedacht? Nichts, jedenfalls konnte er sich nicht erinnern, etwas gedacht zu haben. Vielleicht hatte er es wirklich gesehen und nichts gedacht, weil es keinen Grund gab, etwas zu denken. Er legte seinen Arm auch manchmal um die Schulter einer Frau, freundschaftlich oder sogar als Zitat eines früheren Begehrens. Vielleicht hätte er vor zwanzig Jahren etwas gedacht. Irgendwann hatte er es nicht mehr für möglich gehalten, dass Johanna ihn verlassen könnte. Wann eigentlich? Vor zwanzig Jahren war Johanna vierunddreißig. Vor zehn Jahren vielleicht oder vor neun. Ungeachtet dessen, dass Johanna in ihrem Temperament eher ein Käthchen von Heilbronn als eine Penthesilea und somit die Gefahr, sie könnte ihm die Ehe um einer neuen Leidenschaft willen eines Tages einfach aufkündigen, eher unwahrscheinlich war, ungeachtet dessen hielt er seit einigen Jahren die Möglichkeit, ein anderer Mann könnte in ihr die Verkörperung seiner Sehnsüchte erkennen, für ziemlich gering. Nicht weil sie besonders faltig oder gar unförmig geworden wäre, im Gegenteil, sie war schlank und wirkte, gemessen an ihrem Alter, fast noch jung. Aber er glaubte nicht, dass Johanna, sähe er sie jetzt zum ersten Mal, ein erotisches Verlangen in ihm erregt hätte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie in einem Mann, der sie nicht vor zwanzig oder dreißig Jahren gekannt hatte, ein Gefühl der Rührung hätte wecken können. Sie wirkte eher sachlich und nüchtern, vielleicht sogar abweisend. Und wer, außer ihm, konnte in ihr noch das Mädchen in der Faschingsverkleidung erkennen, das allein in einer Fensternische lehnt? Offenbar der Russe, der seinen Arm um sie gelegt hatte und dabei ihren Körper jugendlich biegsam erscheinen ließ, so jedenfalls sah er das jetzt: Johanna in ihrem neuen Kleid (das teuerste, das sie je gekauft hat, sagte sie), schmal und schwarz im Arm des Russen. Und er hatte sich nichts gedacht.
Eine Woche später erzählte sie beim Abendessen, dass Igor am Silvesterabend gefragt habe, ob sie ihn für zwei oder drei Wochen in der Galerie vertreten wolle, weil er dringend nach Russland reisen müsse und die Studentin, die ihn für gewöhnlich in solchen Fällen vertrete, mitten im Examen stecke.
Kannst du das denn, fragte Achim.
Dafür muss ich nichts können, sagt Igor. Nur die Galerie bewachen, möglichen Käufern, mit denen aber nicht zu rechnen ist, Tee aus dem Samowar anbieten, die Post annehmen und in unvorhergesehenen Fällen Igor anrufen.
Und der Hund, fragte er.
Den nehme ich mit, sagte Johanna.
Johanna hatte kurz vor Weihnachten ihre letzte Arbeit über Wilhelmine Enke dem Verlag abgeliefert und, soviel er wusste, keinen nennenswerten neuen Auftrag. Warum hätte sie nicht für zwei oder drei Wochen in Igors Galerie aushelfen sollen? Aber war es überhaupt von Belang, ob Johannas seltsame Verwandlung mit dem Hund oder mit dem Russen begonnen hatte? Vermutlich hatten beide, Russe und Hund, in ihr Leben nur einbrechen können, weil Johanna auf sie gewartet hatte, auf sie oder andere, die geeignet gewesen wären, ihr gewohntes Leben auf den Kopf zu stellen.
Die Schönheit gegenüber gab auf. Mit einem gereizten Zug um den Mund verlangte sie nach der Rechnung, als träfe die Kellnerin eine Schuld, dass sie versetzt worden war. Am Tisch neben ihm saß inzwischen ein junges Paar, das augenscheinlich die Nacht miteinander verbracht hatte. Sie verknoteten ihre Finger ineinander und tauschten dazu Blicke, die ihre Hände in Arme und Beine verwandelten und ihre züchtigen Berührungen in heimliches, ganz unzüchtiges Treiben. Er fühlte sich gestört. Diese alltägliche sexuelle Ungeniertheit löste misanthropische Anfälle in ihm aus. Plötzlich störte ihn alles, das gellende Geschepper von massakriertem Porzellan, das aus der Küche drang, besonders wenn die Kellner der Schwingtür einen Fußtritt versetzten, sodass sie sich bis zum Anschlag öffnete; das, wie er fand, geile Gelächter einer Frau irgendwo in seinem Rücken störte ihn, ein kokettes, gieriges Signallachen, das eine bestimmte Sorte Frauen nur für Männer lachte. Es störte ihn überhaupt, dass er völlig absichtslos unter fremden Menschen in diesem Café saß, das sich inzwischen, es war kurz vor elf, zur Hälfte gefüllt hatte. Warum saß er eigentlich hier und nicht zu Hause an seinem Schreibtisch, wo er hingehörte. Was war denn schon passiert? Seine Frau war verreist; das hob die Welt nicht aus den Angeln.