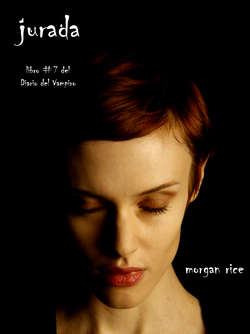Читать книгу Der Eid Der Brüder - Морган Райс, Morgan Rice - Страница 8
KAPITEL VIER
ОглавлениеGodfrey spürte den Schweiß, der seinen Hals herunterlief, als er sich unter der Gruppe der Sklaven versteckte und versuchte nicht gesehen zu werden, als sie durch die Straßen von Volusia gingen. Ein weiterer Peitschenhieb zischte durch die Luft und Godfrey schrie vor Schmerz auf, als die Spitze der Peitsche seinen Rücken traf. Die Sklavin neben ihm schrie noch lauter, denn der Schlag war für sie bestimmt und traf sie quer über den Rücken. Sie wimmerte und stolperte weiter.
Godfrey hielt sie fest und fing sie auf, bevor sie zusammenbrach, und wusste dass er damit sein Leben riskierte. Sie fing such und wandte sich ihm mit Panik und Angst im Blick zu. Als sie ihn sah, riss sie überrascht die Augen auf. Offensichtlich hatte sie nicht mit seinem Anblick gerechnet: Ein hellhäutiger Mensch, der ohne Fesseln frei neben ihr herging. Godfrey schüttelte schnell den Kopf, legte einen Finger auf seine Lippen und betete, dass sie schweigen würde. Zum Glück tat sie es.
Godfrey hörte die Peitsche wieder knallen, sah sich um und sah die Zuchtmeister, die sich die Karawane entlangarbeiteten und gedankenlos auf die Sklaven eindroschen. Sie wollten sich lediglich Respekt verschaffen. Als er sich umsah, bemerkte er direkt hinter sich die panischen Gesichter von Akorth und Fulton, deren Augen nervös hin und her wanderten, und neben ihnen die gefassten Mienen von Merek und Ario. Godfrey staunte, dass die beiden Jungen mehr Fassung und Mut zeigten als Akorth und Fulton, zwei ausgewachsenen, wenn auch betrunkene, Männer.
Sie marschierten immer weiter, und Godfrey ahnte, dass sie sich ihrem Ziel näherten, was immer es auch sein mochte. Natürlich konnte er nicht dorthin gehen: Er musste bald etwas tun. Er hatte sein Ziel erreicht – sie waren in Volusia, doch nun mussten sie sich von dieser Gruppe entfernen, bevor man sie entdeckte.
Godfrey sah sich um und bemerkte etwas, das er freudig wahrnahm: Die Zuchtmeister sammelten sich nun weitestgehend vor der Karawane der Sklaven. Das war natürlich sinnvoll. Nachdem alle Sklaven aneinander gefesselt waren, konnten sie offensichtlich nirgendwo hin fliehen und die Zuchtmeister sahen keine Notwendigkeit, das Ende des Zuges zu bewachen. Abgesehen von einem einsamen Zuchtmeister, der peitschend neben der Karawane herlief, gab es niemanden, der sie davon abhalten würde, sich nach hinten davonzustehlen. Sie konnten fliehen und lautlos in den Straßen Volusias verschwinden.
Godfrey wusste, dass sie schnell handeln sollten, und doch pochte sein Herz jedes Mal, wenn er es in Erwägung zog. Sein Verstand sagte ihm, dass er gehen sollte, doch sein Körper zögerte immer wieder – er konnte nie den Mut zusammenkratzen, es zu tun.
Godfrey konnte immer noch nicht glauben, dass sie hier waren, dass sie es wirklich in die Stadt geschafft hatten. Es war wie ein Traum – doch ein Traum, der immer schlimmer wurde. Der Schwips vom Wein ließ nach, und je mehr er nachließ, desto mehr erkannte er, dass all das eine grundlegend schlechte Idee gewesen war.
„Wir müssen hier raus.“ Merek beugte sich vor und flüsterte drängend. „Wir müssen los.“
Godfrey schüttelte den Kopf und schluckte schwer. Schweiß brannte in seinen Augen. Ein Teil von ihm wusste, dass er Recht hatte, ein anderer Teil von ihm wollte auf den richtigen Moment warten.
„Nein“, antwortete er. „Noch nicht.“
Godfrey sah sich um und sah alle möglichen Sklaven die gefesselt durch die Straßen von Volusia gezerrt wurden, nicht nur jene mit dunkler Haut. Es sah aus, als ob es dem Empire gelungen war, die unterschiedlichsten Rassen aus allen Ecken und Winkeln des Empire zu versklaven – alles und jeden, der nicht der Rasse des Empire angehörte, jeden, der nicht ihre leuchtend gelbe Haut, ihre Größe, die breiten Schultern und die kleinen Hörner hinter den Ohren besaß.
„Worauf warten wir?“, fragte Ario.
„Wenn wir einfach so mitten auf die Straße laufen“, sagte Godfrey, „erwecken wir womöglich Aufmerksamkeit. Vielleicht fangen sie uns sogar. Wir müssen warten.“
„Warten worauf?“, drängte Merek frustriert.
Godfrey schüttelte ratlos den Kopf. Er hatte das Gefühl, dass sich sein Plan in Wohlgefallen auflöste.
„Ich weiß es nicht“, sagte er.
Sie bogen um eine weitere Kurve, hinter der sich die ganze Stadt Volusia vor ihnen ausbreitete. Godfrey nahm ehrfürchtig den Anblick in sich auf.
Es war die unglaublichste Stadt, die er je gesehen hatte. Godfrey, der Sohn eines Königs, war schon zuvor in großen und eindrucksvollen, reichen und gut befestigten Städten gewesen. Er hatte einige der schönsten Städte der Welt gesehen. Nur wenige Städte konnten es mit Savaria, Silesia oder gar mit King’s Court aufnehmen. Er ließ sich nicht so leicht beeindrucken.
Doch er hatte noch nie etwas wie das hier gesehen. Eine Kombination aus Schönheit, Ordnung, Macht und Reichtum. Der Reichtum dominierte offensichtlich. Das erste, was Godfrey auffiel, waren all die Götterbilder. Überall in der Stadt standen Statuen, Bildnisse von Göttern, die Godfrey fremd waren. Einer schien ein Meeresgott zu sein, der andere ein Gott des Himmels, einem dritten schienen die Hügel geweiht zu sein… Und vor allen standen Gruppen von Menschen, die sie anbeteten. In der Ferne, überragte eine riesige goldene Statue, die sich mehr als dreißig Meter erhob, die Stadt – es war die Statue von Volusia. Horden von Menschen verneigten sich vor ihr.
Was Godfrey als nächstes überraschte waren die Straßen, die mit Gold gepflastert waren, glänzend, makellos, alles außergewöhnlich ordentlich und sauber. Alle Gebäude waren aus perfekt behauenen Steinen erbaut, nicht einer war krumm. Die Straßen zogen sich unendlich lange hin, die Stadt selbst schien bis zum Horizont zu reichen. Was ihn noch sprachloser machte waren die Kanäle und Wasserstraßen, die sich mit den Straßen verwoben und das azurblaue Wasser des Meeres als Lebensadern benutzten, um alles in der Stadt fließen zu lassen. Diese Wasserstraßen waren voller reich verzierter goldener Boote, die geräuschlos auf ihnen auf und abfuhren und unter den Straßen hindurch glitten.
Die Stadt strahlte im Licht, das vom Hafen reflektiert wurde, dominiert vom allgegenwärtigen Rauschen der Wellen, da sich die hufeisenförmige Stadt um den Hafen an die Küste schmiegte, und die Wellen sich an ihrem goldenen Meereswall brachen. Das glitzernde Licht des Meeres, die Strahlen der beiden Sonnen und die reichen goldenen Verzierungen blendeten die Augen. Gerahmt wurde alles von den beiden gigantischen Säulen an der Hafeneinfahrt, die hoch in den Himmel ragten, eine Bastion der Stärke.
Godfrey erkannte, dass die Stadt mit dem Ziel einzuschüchtern und Reichtum auszustrahlen erbaut worden war, und sie erfüllte ihren Zweck gut. Es war eine Stadt die Fortschritt und Zivilisation ausstrahlte, und wenn Godfrey nicht über die Grausamkeit ihrer Bewohner Bescheid gewusst hätte, wäre es eine Stadt gewesen, in der er selbst gerne gelebt hätte. Sie war so anders als alles, was der Ring zu bieten hatte. Die Städte des Rings waren erbaut um zu beschützen und zu verteidigen. Sie waren bescheiden und unaufdringlich, wie ihre Bewohner. Die Städte des Empire andererseits waren offen, furchtlos, und erbaut, um Reichtum zur Schau zu stellen. Godfrey erkannte, dass das durchaus einen Sinn ergab: Schließlich mussten sich die Städte des Empire nicht vor Angriffen fürchten.
Godfrey hörte vor sich lauten Aufruhr, und als sie um eine weitere Ecke bogen öffnete sich plötzlich ein riesiger Platz vor ihnen, und dahinter lag der Hafen. Es war ein großer, mit Steinen gepflasterter Platz, eine der großen Kreuzungen der Stadt, vom dem ein Dutzend Straßen in alle Richtungen führten. All das konnte er nur bruchstückhaft durch einen großen steinernen Bogen der zwanzig Meter vor ihnen lag erkennen. Godfrey wusste, dass sie, sobald ihre Karawane hindurch war, auf einer offenen Fläche waren und nicht mehr entkommen konnten. Was noch beunruhigender war, war dass Godfrey sah, wie aus allen Richtungen Sklaven aus allen Winkeln des Empire von Zuchtmeistern hierher geführt wurden. Alle waren gefesselt und wurden auf eine hohe Plattform am Rande des Meers gezerrt. Die Sklaven standen oben, während reiche Bürger des Empire sie betrachteten und ihre Gebote abgaben. Es sah aus wie ein Versteigerungspodest.
Jubel brandete auf, und Godfrey beobachtete, wie ein Adliger des Empire den Kiefer eines Sklaven untersuchte, eines Sklaven mit weißer Haut und strähnigem braunem Haar. Der Adlige nickte zufrieden, und ein Zuchtmeister kam und legte dem Sklaven Fesseln an, als ob damit das Geschäft abgeschlossen war. Der Zuchtmeister ergriff den Sklaven beim Hemd und warf ihn mit dem Gesicht voran von der Plattform auf den Boden. Der Mann schlug hart auf dem Boden auf und die Menge jubelte zufrieden, als mehrere Krieger kamen und ihn davonzerrten.
Eine weitere Sklavenkarawane kam aus einer anderen Ecke der Stadt und Godfrey sah zu, wie der größte Sklave vorgeschoben wurde. Er war mehr als einen Kopf grösser als die anderen, stark und gesund. Ein Empire-Krieger hob seine Axt und der Sklave duckte sich.
Doch der Zuchtmeister schlug seine Fesseln durch und das Klirren der Axt hallte über den Platz.
Der Slave sah den Zuchtmeister verwirrt an.
„Bin ich frei?“, fragte er.
Doch mehrere Krieger kamen herbeigeeilt, ergriffen die Arme des Sklaven und zerrten ihn zum Sockel einer großen Statue im Hafen, eine weitere Statue von Volusia, deren Finger hinaus aufs Meer wies. Wellen brachen sich unter ihren Füssen.
Die Menge versammelte sich dicht um sie herum, als die Krieger den Mann festhielten und seinen Kopf mit dem Gesicht voran auf den Fuß der Statue drückten.
„NEIN!“, schrie der Mann.
Der Empirekrieger mit der Axt trat wieder vor, schwang sie erneut, und diesmal enthauptete er den Mann.
Die Menge jubelte verzückt, und ging auf die Knie, um der Statue zu huldigen während das Blut über ihre Füße floss.
„Ein Opfer für unsere große Göttin!“, rief der Krieger. „Wir widmen dir die besten unserer Früchte.“
Die Menge jubelte erneut.
„Ich weiß nicht, wie es mit dir steht“, flüsterte Merek drängend in Godfreys Ohr, „doch ich habe keine Lust mich irgendeinem Idol opfern zu lassen. Nicht heute.“
Ein weiterer Peitschenhieb, und Godfrey konnte sehen, dass der Eingang zum Platz näher kam. Sein Herz pochte, während er über Mereks Worte nachdachte – er hatte Recht. Er wusste, dass sie etwas tun mussten, und zwar schnell.
Eine plötzliche Bewegung ließ Godfrey herumfahren. Aus dem Augenwinkel sah er fünf Männer in leuchtendroten Umhängen mit Kapuzen, die schnell die Straße hinunter in die andere Richtung gingen. Er bemerkte, dass sie weiße Haut, Hände und Gesichter hatten, sah dass sie zierlicher waren, als die muskelbepackten Rohlinge der Rasse des Empire und wusste sofort, wer sie waren: Finianer. Die einzige Ausnahme. Ihnen war erlaubt, frei zu leben, Generation um Generation, denn sie waren zu reich, um sie zu töten, hatten zu gute Verbindungen, und waren zu fähig, sich unabdingbar zu machen und mit ihrer Macht zu verhandeln. Sie waren leicht zu erkennen, hatte man ihm gesagt – an ihrer schneeweißen Haut, an ihren scharlachroten Umhängen und dem kupferroten Haar.
Godfrey hatte eine Idee. Jetzt oder nie.
„BEWEGT EUCH!“, rief er seinen Freunden zu.
Godfrey drehte sich um und rannte hinten aus der Karawane heraus, vorbei an den überraschten Sklaven, dicht gefolgt von den anderen.
Godfrey rannte keuchend, beladen mit den schweren Goldsäcken an seinem Gürtel, die bei jedem Schritt klirrten. Vor sich sah er die fünf Finianer in eine schmale Gasse einbiegen; Er rannte direkt auf sie zu und betete, dass sie die Gasse erreichten, bevor sie jemand entdeckte.
Godfrey, dessen Ohren rauschten, bog um die Ecke, und als er die Finianer vor sich sah, sprang er ohne weiter nachzudenken hoch und warf sich von hinten auf die Gruppe.
Er warf drei der Männer zu Boden, und seine Rippen schmerzten, als er mit ihnen auf dem Steinboden aufschlug. Er blickte auf und sah Merek, der seinem Beispiel folgte, einen weiteren angreifen, während Akorth sich auf einen weiteren stürzte und Fulton den letzten, den kleinsten der Gruppe angriff. Godfrey sah entnervt, wie Fulton sein Ziel verfehlte und stattdessen stöhnend zu Boden stolperte.
Godfrey schlug einen nieder, und hielt einen weiteren fest, doch er verfiel in Panik, als der kleinste davonlief und im Begriff war, um die Ecke zu biegen. Er beobachtete aus dem Augenwinkel wie Ario ruhig vortrat, einen Stein aufhob, ihn in der Hand wog und dann warf.
Ein perfekter Wurf traf den Finianer an der Schläfe, als er gerade um die Ecke biegen wollte, und ließ ihn zu Boden gehen. Ario rannte zu ihm hinüber, zog ihm seinen Mantel aus und zog ihn an – offensichtlich hatte er Godfreys Plan verstanden.
Godfrey, der immer noch mit dem anderen Finianer kämpfte, konnte ihm schließlich seinen Ellbogen ins Gesicht rammen und ihn KO schlagen. Merek würgte seinen lange genug, sodass er das Bewusstsein verlor und Godfrey beobachtete, wie sich Merek auf den letzten Finianer rollte und ihm einen Dolch an die Kehle drückte.
Godfrey wollte Merek gerade zurufen, aufzuhören, als eine Stimme ihm zuvorkam.
„Nein!“, befahl eine barsche Stimme.
Godfrey blickte auf und sah, dass Ario über Merek stand und ihn missmutig ansah.
„Töte ihn nicht!“, befahl Ario.
Merek sah ihn finster an.
„Tote Männer reden nicht“, sagte Merek. „Wenn ich ihn gehen lasse, sterben wir alle.“
„Egal!“, sagte Ario. „Er hat dir nichts getan. Er wird nicht getötet.“
Trotzig stand Merke auf und sah Ario an.
„Du bist halb so groß wie ich, Junge“, zischte Merek. „Und ich habe einen Dolch. Fordere mich nicht heraus.“
„Vielleicht bin ich halb so groß wie du“, antwortete Ario ruhig. „Doch ich bin doppelt so schnell. Greif mich an und ich werde dir den Dolch abnehmen und dir den Hals aufschlitzen, bevor du fertig ausgeholt hast.“
Godfrey war erstaunt über den verbalen Schlagabtausch besonders, weil Ario so ruhig war. Es war surreal. Er blinzelte nicht, bewegte keinen Muskel und sprach, als hätte er die ruhigste Konversation auf Erden. Und das machte seine Worte noch überzeugender.
Merek musste derselben Meinung gewesen sein, denn er bewegte sich nicht. Godfrey wusste, dass er sie unterbrechen musste, und zwar schnell.
„Das ist nicht der Feind.“, sagte Godfrey, und ergriff Mereks Handgelenk mit dem Dolch. „Der Feind ist da draußen. Wenn wir gegeneinander kämpfen, haben wir keine Chance.“
Glücklicherweise senkte Merek seine Hand und steckte den Dolch weg.
„Beeilt euch jetzt. Entkleidet sie und legt ihre Kleider an. Wir sind jetzt Finianer.“
Sie zogen die Finianer aus und warfen sich ihre leuchtend roten Umhänge mit den Kapuzen um.
„Das ist lächerlich“, sagte Akorth.
Godfrey sah ihn an und sah, dass sein Bauch zu dick und er zu groß war; der Umhang war zu kurz für ihn und reichte ihm gerade mal bis zu den Waden.
Merek kicherte.
„Hättest vielleicht ein Bier weniger trinken sollen“, sagte er.
„Ich zieh das nicht an!“, sagte Akorth.
„Das ist keine Modenschau“, sagte Godfrey. „Willst du dich lieber erwischen lassen?“
Akorth fügte sich mürrisch.
Godfrey stand da und betrachtete seine Gruppe. Alle trugen sie die roten Mäntel, doch sie waren in einer fremden Stadt, umgeben von Feinden. Ihre Chancen waren bestenfalls gering.
„Was jetzt?“, fragte Akorth.
Godfrey drehte sich um und blickte in Richtung der Hauptstraße. Er wusste, dass die Zeit reif war.
„Lasst uns gehen und uns ein wenig in Volusia umsehen.“