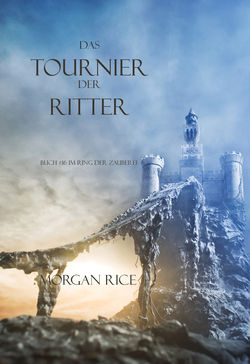Читать книгу Der Traum Der Sterblichen - Морган Райс, Morgan Rice - Страница 11
KAPITEL SIEBEN
ОглавлениеGodfrey, der zusammengerollt schlief, wurde von einem stetigen, andauernden Stöhnen geweckt, das in seine Träume drang. Er wachte langsam auf, unsicher, ob er wirklich wach oder immer noch in seinem endlosen Alptraum gefangen war. Er blinzelte ins blasse Licht und versuchte, seinen Traum abzuschütteln. Er hatte geträumt, dass er eine Marionette war, die über den Mauern von Volusia hing und von den Finianern gehalten wurde, die an den Seilen zogen und Godfreys Arme und Beine bewegten. Godfrey hatte zusehen müssen, wie unter ihm tausende seiner Landsleute niedergemetzelt und die Straßen von Volusia mit ihrem Blut rot gefärbt wurden.
Jedes Mal, wenn er dachte, es wäre vorbei, hatten die Finianer wieder an den Seilen gezerrt, und ihn in alle Richtungen tanzen lassen…
Endlich, glücklicherweise, war Godfrey von diesem Stöhnen aufgewacht, und hatte sich mit dröhnendem Kopf zur Seite gerollt und gesehen, dass es von Akorth und Fulton kam, die nicht weit weg von ihm lagen und selbst voller blauer Flecke waren. Neben ihnen lagen Merek und Ario – regungslos, doch zumindest waren sie hier und Godfrey konnte sehen, dass sie atmeten. Godfrey war zur gleichen Zeit erleichtert und besorgt. Er war erstaunt, am Leben zu sein, nachdem er Zeuge dieses Hinterhalts geworden war, und wunderte sich immer noch darüber, dass die Finianer ihn nicht auch umgebracht hatten. Er fühlte sich hohl, niedergeschlagen unter der Last erdrückender Schuldgefühle, da er sich die Schuld dafür gab, dass Darius und die anderen in die Falle in Volusia gegangen waren. Alles nur wegen seiner Naivität. Wie hatte er nur so dumm sein und den Finianern vertrauen können?
Godfrey schloss die Augen und schüttelte den Kopf. Er wollte die Bilder vergessen, wünschte sich, dass die Nacht anders verlaufen wäre. Er hatte ohne sein Wissen Darius und die anderen wie Lämmer zur Schlachtbank geführt. Immer und immer wieder hörte er die Schreie der Männer, die um ihr Leben kämpften, zu fliehen versuchten. Immer und immer wieder hallten sie in seinem Kopf wieder und ließen ihn nicht in Frieden.
Godfrey hielt sich die Ohren zu und versuchte es zu vergessen, genauso wie Akorth und Fultons Stöhnen. Beide mussten offensichtlich Schmerzen haben von all ihren blauen Flecken und der Nacht, die sie auf dem kalten Steinboden verbracht hatten.
Godfrey setzte sich auf und betrachtete seine Umgebung. Sein Kopf fühlte sich unsagbar schwer, als er die Zelle betrachtete, in der außer ihm und seinen Freunden nur noch ein paar andere Männer gefangen gehalten wurden. Es tröstete ihn, dass sie wahrscheinlich eher früher als später sterben würden, denn diese Zelle unterschied sich deutlich von der letzten – sie fühlte sich mehr wie eine Station auf dem Weg zum Tod an.
Aus der Ferne hörte Godfrey die Schreie eines Gefangenen, der über den Flur gezerrt wurde und erkannte: Diese Zelle war wirklich eine Station auf dem Weg des Todes – es war eine Todeszelle, in der die Gefangenen auf ihre Exekution warteten. Er hatte von anderen Exekutionen in Volusia gehört, und er wusste, dass er und die anderen beim ersten Tageslicht hinaus in die Arena gezerrt werden würden, wo die Razifs sie in Stücke reißen würden, als Belustigung für die Zuschauer bevor die Gladiatorenkämpfe begannen. Nur deshalb waren sie noch am Leben. Zumindest ergab nun alles einen Sinn.
Godfrey rappelte sich auf Hände und Knie auf, dann stieß er seine Freunde an und versuchte sie zu wecken. Alles drehte sich um ihn und jede Bewegung tat ihm weh. Das letzte, an das er sich erinnern konnte war, dass ein Krieger ihn bewusstlos geschlagen hatte, und er erkannte, dass sie weiter auf ihn eingeschlagen haben mussten, als er schon am Boden war.
Die Finianer, diese verräterischen Feiglinge, waren offensichtlich nicht einmal Manns genug, ihn selbst zu töten.
Godfrey hielt sich den Kopf, erstaunt, dass er solche Kopfschmerzen haben konnte, ohne auch nur einen Schluck getrunken zu haben. Mit zittrigen Knien stand er auf und sah sich in der düsteren Zelle um. Eine einzelne Wache stand draußen vor den Gitterstäben. Er hatte ihm den Rücken zugekehrt und schenkte der Zelle keine Beachtung. Diese Zellen mit massiven Gittern und dicken Schlössern gesichert und Godfrey wusste, dass ihnen diesmal nicht so leicht die Flucht gelingen würde. Diesmal würden sie bis zu ihrem Tod hier bleiben.
Langsam begannen Akorth, Fulton, Ario und Merek sich neben ihm aufzurappeln und ihre Umgebung zu betrachten. Er konnte die Verwirrung und die Furcht in ihren Augen sehen – und dann das Bedauern, als sie sich zu erinnern begannen.
„Sind sie alle tot?“, fragte Ario und sah Godfrey verzweifelt an.
Godfrey verspürte physischen Schmerz, als er langsam zustimmend nickte.
„Es ist unsere Schuld“, sagte Merek. „Wir haben sie im Stich gelassen.“
„Ja das ist es“, antwortete Godfrey mit gebrochener Stimme.
„Ich habe dir doch gesagt, dass man den Finianern nicht vertrauen kann“, sagte Akorth.
„Die Frage ist nicht die, wessen Schuld es ist“, sagte Ario, „sondern was wir unternehmen werden. Werden wir zulassen, dass all unsere Brüder und Schwestern umsonst gestorben sind? Order werden wir Rache nehmen?“
Godfrey konnte an seinem Gesicht sehen, wie ernst es der junge Ario meinte und war beeindruckt von seiner kalten Entschlossenheit, selbst angesichts seines eigenen bevorstehenden Todes.
„Rache?“, fragte Akorth. „Bist du verrückt geworden? Wir sind unter der Erde eingeschlossen, hinter eisernen Gittern und bewacht von Empire-Kriegern. Alle unsere Männer sind tot. Wir sind mitten in einer feindlichen Stadt mit einer feindlichen Armee. All unser Gold ist fort, unsere Pläne liegen in Scherben. Wie sollen wir da deiner Meinung nach Rache nehmen?“
„Es gibt immer einen Weg“ sagte Ario entschlossen. Er wandte sich Merek zu.
Alle Augen wanderten zu Merek, der seine Stirn in Falten legte.
„Ich bin kein Experte im Rachenehmen“, sagte Merek. „Ich töte Männer, wenn sie mir im Weg stehen, ich warte nicht ab.“
„Doch du bist ein meisterlicher Dieb“, sagte Ario. Du hast dein ganzes Leben in Kerkern verbracht, wie du selbst gesagt hast. Du kannst uns doch sicher hier heraus bringen, oder nicht?“
Merek drehte sich um und betrachtete die Zelle, die Gitterstäbe, die Fenster, die Schlüssel, die Wachen – alles – mit dem geübten Auge eines Experten. Dann sah er sie grimmig an.
„Das ist keine gewöhnliche Zelle“, sagte er. „Sie muss den Finianern gehören. Sehr teuer und stabil. Ich sehe keine Schwachpunkte und keinen Ausweg, so gerne ich euch auch etwas anderes sagen würde.“
Godfrey, der sich überfordert fühlte, versuchte die Schreie der Gefangenen am Ende des Flurs zu ignorieren. Er ging zur Zellentür, drückte seine Stirn gegen das kalte Eisen und schloss die Augen.
„Bringt ihn her!“, polterte eine Stimme auf dem Flur.
Godfrey öffnete seine Augen, blickte hinaus und sah, wie mehrere Wachen einen Gefangenen über den Flur zerrten. Der Gefangene trug eine rote Schärpe quer über die Brust, und er hing schlaff in ihren Armen – er versuchte nicht einmal, sich zu wehren. Als sie näher kamen, sah Godfrey, dass sie ihn schleiften, weil er bewusstlos war. Etwas stimmte offensichtlich nicht mit ihm.
„Bringst du mir etwa ein weiteres Opfer der großen Plage?“, schrie die Wache wütend. „Was soll ich denn mit dem anfangen?“
„Nicht unser Problem“, maulten die anderen zurück.
Die erste Wache hob furchtsam die Hände.
„Ich fass den nicht an!“, sagte er. „Bringt ihn da rüber in die Grube zu den anderen Opfern der Plage.“
Die Wachen sahen ihn fragend an.
„Aber er ist doch noch nicht tot“, antwortete einer.
Der andere sah sie böse an.
„Denkst du, das interessiert mich?“
Die Wachen tauschten einen Blick und taten, wie ihnen befohlen wurde. Sie schleiften den Mann über den Flur und warfen ihn in eine tiefe Grube. Godfrey konnte jetzt sehen, dass die Grube voller Leichen war, die alle dieselbe rote Schärpe trugen.
„Und was, wenn er versucht zu fliehen?“, fragte einer der Wachen, bevor er sich abwandte.
Die kommandierende Wache sah ihn mit einem grausamen Lächeln an.
„Weißt du nicht, was die Plage mit einem Mann anstellt?“, fragte er. „Morgen früh wird er tot sein.“
Die beiden anderen Wachen wandten sich um und zogen sich zurück, und Godfrey betrachtete das Opfer der großen Plage, das alleine in der unbewachten Grube lag, und plötzlich hatte er eine Idee. Sie war verrückt genug, um funktionieren zu können.
Godfrey wandte sich Akorth und Fulton zu.
„Schlagt mich“, sagte er.
Sie tauschten verwirrte Blicke aus.
„Ich habe gesagt schlagt mich“, sagte Godfrey.
„Bist du verrückt geworden?“, fragte Akorth.
„Ich werde dich doch nicht schlagen“, erklärte Fulton, „so sehr du es auch verdienen magst.“
„Ich sag euch, schlagt mich!“, forderte Godfrey. „Und zwar heftig! Mitten ins Gesicht. Ihr müsst mir die Nase brechen. SOFORT!“
Doch Akorth und Fulton wandten sich ab.
„Du hast den Verstand verloren.“
Godfrey wandte sich Merek und Ario zu, doch auch sie zögerten.
„Was du auch immer damit bezweckst“, sagte Merek, „ich will damit nichts zu tun haben.“
Plötzlich kam einer der anderen Gefangenen herüber zu Godfrey.
„Ich hab mitgehört“, sagte er, grinste breit und entblößte dabei seine abgebrochenen und fehlenden Zähne. Sein stinkender Atem stieg Godfrey in die Nase. „Ich schlag dich gerne, wenn dich das zum Schweigen bringt! Mich musst du nicht zweimal fragen!“
Der Gefangene holte aus und traf Godfrey direkt auf die Nase. Dieser spürte, wie ein scharfer Schmerz durch seinen Schädel schoss, schrie auf und hielt sich die Nase. Blut spritzte über sein Gesicht und sein Hemd. Der Schmerz brannte in seinen Augen und ließ ihn verschwommen sehen.
„Jetzt brauche ich diese Schärpe da“, sagte Godfrey zu Merek gewandt. „Kannst du sie für mich besorgen?“
Irritiert folgte Merek seinem Blick über den Flur zu dem Gefangenen, der bewusstlos in der Grube lag.
„Warum?“, fragte er.
„Tu’s einfach“, sagte Godfrey.
Merek legte die Stirn in Falten.
„Wenn ich irgendwas zusammenbinden könnte, könnte ich es vielleicht erreichen“, sagte er. „Ich brauche etwas Langes und Dünnes.“
Merek betastete seinen Kragen und zog einen Draht hervor, der lang genug war, um diesen Zweck zu erfüllen. Merek lehnte sich gegen die Gitterstäbe, vorsichtig, um nicht die Aufmerksamkeit der Wache zu erwecken, und versuchte, den Draht in die Schärpe einzuhaken. Doch sein Draht war ein paar Zentimeter zu kurz.
Er versuchte es immer wieder, doch sein Ellbogen passte nicht durch die Gitterstäbe. Er war nicht dünn genug.
Die Wache wandte sich in seine Richtung um, doch Merek zog schnell genug seinen Arm zurück.
„Lass es mich versuchen“, sagte Ario, nachdem die Wache sich wieder abgewandt hatte.
Ario ergriff den langen Draht und steckte seinen Arm durch die Gitterstäbe. Da er viel schmaler gebaut war als Merek gelang es ihm, seinen Arm bis zur Schulter hindurchzuschieben.
Das waren die Extra-Zentimeter die sie brauchten. Der Draht verhakte sich am Ende der Schärpe und Ario begann, daran zu ziehen. Er hielt inne als die Wache, die kurz davor stand einzuschlafen, den Kopf hob und sich umsah. Schwitzend und betend hielt er inne und hoffte, dass die Wache nicht in seine Richtung blicken würde. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, bis der Mann endlich wieder einnickte.
Ario zog die Schärpe immer näher heran, bis er sie schließlich durch die Gitterstäbe in die Zelle ziehen konnten.
Godfrey ergriff sie und legte sie an, und die anderen wichen ängstlich von ihm zurück.
„Was zum Henker tust du da?“, fragte Merek. „Der Mann der sie getragen hat, hat die Plage gehabt! Du kannst uns alle damit anstecken.“
Die anderen Gefangenen in der Zelle wichen ebenfalls zurück.
Godfrey wandte sich Merek zu.
„Ich werde jetzt anfangen zu husten, und nicht aufhören“, sagte er, während die Idee in seinem Kopf Form annahm. „Wenn die Wache kommt, wird er mein Blut sehen und die Schärpe, und dann sagst du ihm, dass ich die Plage habe und sie einen Fehler gemacht haben, als sie mich nicht ausgesondert haben.“
Godfrey verschwendete keine Zeit. Er begann wild zu husten und verteilte dabei das Blut von seiner Nase überall auf seinem Hemd, um es schlimmer aussehen zu lassen. Er hustete laut wie nie, bis er schließlich hörte, wie die Zellentür geöffnet wurde, und die Wachen eintraten.
„Bring deinen Freund dazu, das Maul zu halten“, sagte die Wache. „Verstehst du mich?“
„Er ist nicht mein Freund“, antwortete Merek. „Er ist nur ein Mann, dem wir zufällig begegnet sind. Er hat die Plage.“
Irritiert blickte die Wache zu ihm herab, bemerkte die rote Schärpe und riss die Augen auf.
„Wie ist er hier rein gekommen?“, fragte die Wache. „Er hätte ausgesondert werden sollen.“
Godfrey hustete und keuchte immer weiter, gebeutelt von einem Hustenanfall.
Bald spürte er, wie grobe Hände ihn hochzogen und vor sich her schubsten. Er stolperte durch den Flur, und mit einem letzten Stoß beförderten sie ihn in die Grube mit den anderen Opfern der Plage.
Godfrey lag auf einem infizierten Leichnam und versuchte, seinen Kopf abzuwenden, um nicht die Krankheit einzuatmen. Er betete zu Gott, dass er nicht krank werden würde. Es würde eine lange Nacht werden.
Doch jetzt war er unbewacht. Wenn es hell genug war, würde er aufstehen.
Und dann würde er zuschlagen.